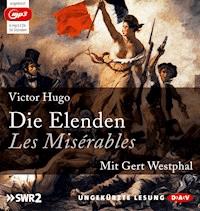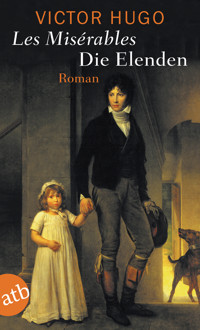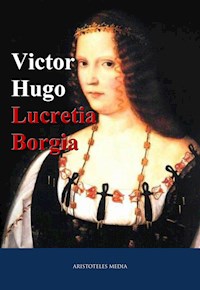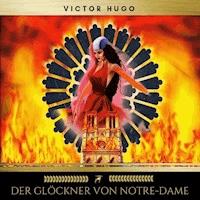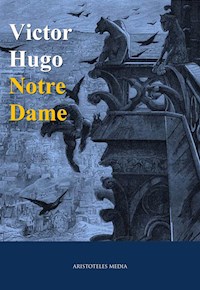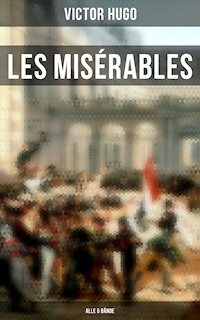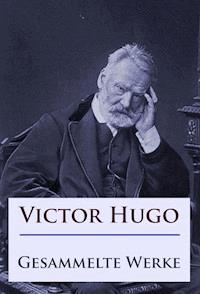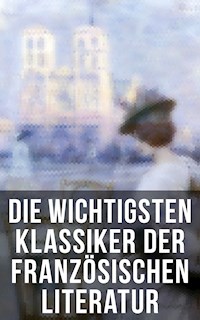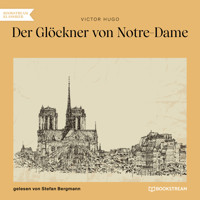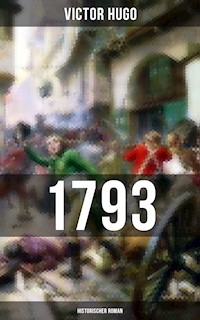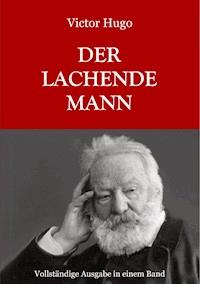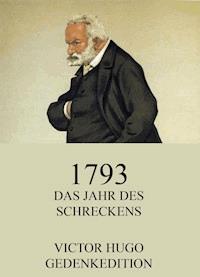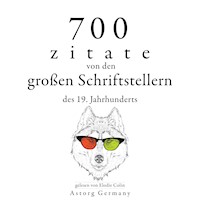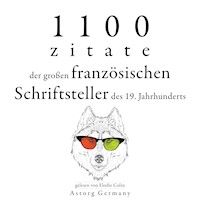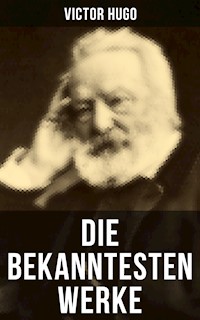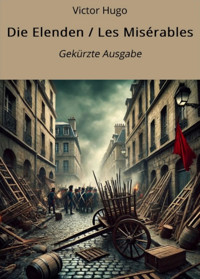
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adlima GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch präsentiert den Klassiker der Weltliteratur in sorgfältig gekürzter Form. Der Text wurde in modernes Deutsch übertragen, wobei Stil, Ton und Ausdruck des Originals weitgehend beibehalten wurden. Für alle, die einen raschen Zugang zu diesem umfangreichen Klassiker erhalten möchten. „Les Misérables“ von Victor Hugo ist ein monumentaler Roman über Gerechtigkeit, Armut und Menschlichkeit im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Jean Valjean, ein armer Mann, der 19 Jahre im Gefängnis verbringt, weil er ein Brot gestohlen hat. Nach seiner Entlassung wird er von der Gesellschaft ausgestoßen. Erst ein barmherziger Bischof schenkt ihm Vertrauen. Valjean beginnt ein neues Leben unter anderem Namen und wird ein ehrbarer Fabrikbesitzer und Bürgermeister. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein: Inspektor Javert, ein unerbittlicher Vertreter des Gesetzes, verfolgt ihn gnadenlos. Parallel dazu erzählt Hugo die Geschichte von Fantine, einer Arbeiterin, die in Armut gerät und ihre Tochter Cosette zurücklässt. Valjean verspricht der sterbenden Fantine, sich um Cosette zu kümmern. Er rettet das Mädchen aus den Fängen grausamer Wirtsleute und zieht sie wie eine Tochter groß. Später verliebt sich Cosette in den idealistischen Studenten Marius, der in den Pariser Barrikadenkämpfen eine zentrale Rolle spielt. Valjean rettet Marius das Leben, obwohl er weiß, dass er dadurch Cosette an ihn verlieren wird. Der Roman thematisiert soziale Ungerechtigkeit, Armut und die Frage nach Moral. Victor Hugo verbindet persönliche Schicksale mit historischen Ereignissen wie dem Aufstand von 1832 und entwirft ein bewegendes Bild menschlicher Hoffnung und Güte. „Les Misérables“ bleibt ein zeitloser Klassiker über Mitgefühl und den Kampf für ein besseres Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Victor Hugo
Die Elenden / Les Misérables - Gekürzt
Gekürzte Ausgabe
Erster Teil, Erstes Buch. Ein Gerechter
Im Jahr 1815 war Charles François Bienvenu Bischof von Digne. Er war 75 Jahre alt und hatte das Amt seit 1806 ausgeübt. Er stammte aus einer angesehenen Beamtenfamilie in Aix. Er war klein, aber gut gebaut, gepflegt, geistreich und beliebt bei Frauen.
Als 1789 die Französische Revolution ausbrach, wurde auch seine Familie verfolgt. Myriel floh nach Italien. Dort starb seine Frau an einer schweren Krankheit. Sie hatten keine Kinder. Warum er nach seiner Rückkehr plötzlich Priester wurde, wusste niemand genau. Jedenfalls kam er als Geistlicher zurück.
1804 lebte Myriel als Pfarrer zurückgezogen in Brignolles. Er reiste einmal nach Paris. Dabei begegnete er zufällig Kaiser Napoleon. Der Kaiser bemerkte, dass Myriel ihn aufmerksam ansah und fragte schroff: „Wer ist dieser Mann?“
Myriel antwortete: „Majestät, Sie sehen einen guten Mann. Und ich sehe einen großen Mann. Beide können davon profitieren.“
Kurz darauf erfuhr Myriel überraschend, dass er zum Bischof von Digne ernannt worden war.
In Digne kannte kaum jemand seine Vergangenheit genau. Es kursierten viele Gerüchte über sein früheres Leben. Myriel ließ die Leute reden. Doch nach neun Jahren waren die Geschichten vergessen und niemand sprach mehr darüber.
Myriel lebte in Digne mit seiner Schwester Baptistine, die zehn Jahre jünger war als er. Mit ihnen wohnte Frau Magloire, eine ältere Magd, die früher nur Myriel gedient hatte. Nun kümmerte sie sich um den gesamten Haushalt und auch um Baptistine.
Fräulein Baptistine war groß und schlank, mit blasser Haut und einem sanften Wesen. Sie hatte ihr ganzes Leben der Nächstenliebe gewidmet. Sie wirkte mehr wie eine Seele als wie ein Körper. Ihre großen Augen hielt sie meist gesenkt, als wolle sie bescheiden auf der Erde verweilen.
Frau Magloire war klein, rundlich und ständig außer Atem, da sie sich im Haus viel bewegte und schlecht Luft bekam.
***
Der bischöfliche Palast in Digne war ein prachtvolles Gebäude. Gleich daneben lag das einfache Spital der Stadt. Drei Tage nach seiner Ankunft besuchte Bischof Myriel das Krankenhaus und stellte viele Mängel fest: überfüllte Zimmer, schlechte Belüftung, zu kleiner Garten und Platzmangel bei Epidemien.
Im Gespräch mit dem Direktor erkannte Myriel, dass der große Speisesaal seines Palastes mehr Platz für Kranke bot als das gesamte Spital. Er sagte: „Es liegt ein Irrtum vor. Ihr habt meine Wohnung, ich die eure. Gebt mir mein Haus zurück.“
Am nächsten Tag zogen die 26 Kranken in den Palast und der Bischof selbst zog ins Spital.
Myriel besaß kein eigenes Vermögen. Seine Schwester lebte von einer kleinen Rente und sein Bischofsgehalt betrug 15‘000 Franken. Er behielt nur 1‘000 Franken für sich und spendete den Rest. Er unterstützte Schulen, religiöse Einrichtungen, arme Mütter, Gefangene, Lehrer, Arme und viele wohltätige Organisationen.
Fräulein Baptistine fügte sich ohne Widerspruch der neuen Wohnsituation. Für sie war Myriel nicht nur Bruder, sondern auch Bischof und geistliche Autorität. Sie verehrte ihn und unterstützte alles, was er tat. Nur Frau Magloire beklagte sich ein wenig.
Trotzdem konnte der Bischof Besucher bewirten – dank der Sparsamkeit von Frau Magloire und der Umsicht von Baptistine. Doch Myriel stellte fest: „Meine Einkünfte reichen kaum aus!“ Frau Magloire riet ihm, auch die Vergütung für Reisekosten zu beantragen, wie seine Vorgänger es getan hatten. Der Bischof reichte das Gesuch ein und der Generalrat bewilligte ihm 3‘000 Franken jährlich.
Frau Magloire freute sich: „Endlich hat der Bischof auch an sich gedacht. Die Armen sind versorgt – jetzt sind wir dran!“
Doch am selben Abend verteilte der Bischof die 3‘000 Franken erneut: für Frauenvereine, Waisen- und Findelkinder. Auch alle Nebeneinnahmen reichte er an die Armen weiter. Spenden kamen reichlich. Doch Myriel änderte nie seinen einfachen Lebensstil. Was über das Notwendige hinausging, behielt er nie für sich.
Weil es mehr Elend als Hilfsbereitschaft gab, war alles, was Myriel erhielt, sofort wieder verteilt. Er besaß nie etwas und gab im Notfall sogar noch mehr von seinem Eigenen.
Die Armen nannten ihn bald nur noch „Bienvenu“, was „Willkommen“ bedeutet. Myriel mochte diesen Namen. Er fand ihn freundlicher als den stolzen Titel „Bischöfliche Gnaden“.
***
Obwohl Bischof Myriel seine Reisemittel für Almosen aufgegeben hatte, besuchte er regelmäßig seine weitläufige Diözese. Wenn möglich, ging er zu Fuß, fuhr mit der Kutsche oder ritt auf einem Maultier. Seine Schwester und Frau Magloire begleiteten ihn meist. Einmal kam er auf einem Esel in Senez an. Einige Bürger lachten ihn aus, doch er erklärte ruhig: „Ich reite den Esel nicht aus Eitelkeit, sondern aus Not – so wie einst Jesus.“
Überall zeigte sich Myriel gütig und verständnisvoll. In seinen Predigten sprach er einfach und bildhaft. Statt großer Theorien gab er Beispiele aus der Region: Er lobte Briançon, wo Bedürftige kostenlos Hilfe beim Hausbau bekommen. In Embrun kümmerte sich das ganze Dorf um die Ernte, wenn jemand verhindert war. In Devolny überließen Brüder ihren Schwestern das Erbe, damit diese heiraten konnten. Und in Queyras gab es keine Richter – der Bürgermeister regelte alles gerecht und ohne Bezahlung. Besonders schätzte er dort das einfache Schulsystem: Wanderlehrer zogen von Dorf zu Dorf und unterrichteten.
Mit solchen anschaulichen Geschichten berührte Myriel die Herzen. Seine Worte waren schlicht, aber kraftvoll – wie die Gleichnisse Jesu, voller Güte und aus tiefem Herzen gesprochen.
***
Bischof Myriel war im Gespräch herzlich und humorvoll. Er passte sich seinen beiden Mitbewohnerinnen an und lachte oft wie ein Schuljunge. Frau Magloire nannte ihn gern „Hoher Herr“. Als er einmal ein Buch nicht erreichen konnte, scherzte er: „Die Hoheit des hohen Herrn reicht nicht bis an das Brett da.“
Er spottete selten, aber mit Bedeutung. Bei einer Todesanzeige voller Adelstitel meinte er: „Was für einen starken Rücken der Tod haben muss, so viele Titel zu tragen!“
Ein junger Vikar hatte in einer Predigt über das Jenseits einen reichen Zuhörer beeindruckt. Dieser spendete eine Kupfermünze an sechs Bettlerinnen. Der Bischof kommentierte trocken: „Schau mal, da kauft sich Herr Geborand für einen Sou ewige Seligkeit.“
Er bat stets um Hilfe für die Armen. Einmal sagte der reiche Marquis von Champtercier: „Ich habe schon meine Armen.“
Der Bischof erwiderte: „Dann geben Sie mir die.“
In einer Predigt prangerte er die Zustände in armen Häusern an, die nur eine Tür und ein Fenster hatten. Er schilderte das harte Leben der Bauern eindringlich. Myriel sprach die Sprache des einfachen Volkes. Er konnte mit einfachen Worten große Wahrheiten ausdrücken. Er behandelte alle Menschen gleich und urteilte nie vorschnell.
Seine Lehre war klar: Der Mensch ist Geist im Fleisch – und dieses Fleisch ist oft Last und Versuchung. Doch Verständnis und Mitgefühl standen für ihn über allem.
Bischof Myriel glaubte, dass der Mensch seinen Schwächen standhalten, sie zügeln und nur im Notfall nachgeben solle. Selbst wenn ein solcher Fall Schuld mit sich bringe, sei Vergebung möglich. Wer falle, könne auf den Knien wieder aufstehen.
„Ein Heiliger zu sein ist selten, ein Gerechter zu sein genügt“, sagte er. Fehler seien menschlich, wichtig sei die Gerechtigkeit. Er war nachsichtig, besonders gegenüber Frauen, Kindern, Armen und Unwissenden. Die Schuld sah er oft bei den Reichen, den Gebildeten und der Gesellschaft, die Bildung verweigere. „Nicht der Sünder ist schuld, sondern der, der die Nacht geschaffen hat.“
Als ein Kriminalfall besprochen wurde, bei dem ein Mann aus Liebe Falschgeld hergestellt hatte, hörte Myriel schweigend zu. Die Frau hatte ihn schließlich verraten, weil der Staatsanwalt sie eifersüchtig gemacht hatte. Die Gesellschaft lobte dessen Taktik. Der Bischof aber fragte nur ruhig: „Vor welches Gericht kommen die beiden?“ „Vor die Assisen.“
„Und der Staatsanwalt?“
In einem anderen Fall wurde ein Mann zum Tode verurteilt. Der zuständige Priester weigerte sich, ihn zu begleiten. Myriel sagte: „Er hat recht, das ist nicht sein Beruf – aber es ist der meine.“
Er ging sofort ins Gefängnis, blieb den ganzen Tag bei dem Verurteilten, redete mit ihm, betete für ihn, tröstete ihn. Der Mann war erschüttert und sah im Tod nur Dunkelheit. Am Tag der Hinrichtung begleitete Bischof Myriel den Verurteilten. Er ging neben ihm in seinem violetten Bischofsmantel, stieg mit ihm auf den Karren und bis aufs Schafott. Der Mann, am Vortag noch verzweifelt, wirkte nun ruhig – er fühlte sich mit Gott versöhnt. Kurz vor dem Fallbeil sagte der Bischof: „Wen Menschen töten, den nimmt Gott auf. Bete, glaube, gehe ein ins ewige Leben.“
Nach der Hinrichtung kehrte der Bischof still zurück. Zu seiner Schwester sagte er: „Ich habe ein feierliches Hochamt gehalten.“
Die Hinrichtung erschütterte Myriel schwer. Der Anblick der Guillotine ließ ihn nicht los. Für ihn war sie kein bloßes Gerät, sondern ein unheimliches, lebendiges Wesen. Er sprach halblaut mit sich selbst: „Nur Gott darf den Tod geben. Warum nehmen Menschen sich dieses Recht?“
Bischof Myriel war stets für Leidende da. Man konnte ihn zu jeder Tageszeit zu Kranken oder Sterbenden rufen. Zu Witwen und Waisen ging er von selbst. Oft saß er schweigend bei Trauernden, spürte aber den Moment, in dem Worte helfen konnten.
Er tröstete nicht durch Vergessen, sondern durch Hoffnung. Er sagte: „Blickt nicht auf das Vergängliche, sondern auf das Licht.“ So lehrte er, den Schmerz zu verwandeln – durch Glauben, Geduld und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
***
Bischof Myriel führte ein einfaches Leben, das mit seinen religiösen Pflichten im Einklang stand. Er schlief wenig, widmete sich morgens dem Gebet und las dann die Messe. Sein Frühstück bestand aus Roggenbrot und Milch. Danach arbeitete er: Er empfing täglich seine Mitarbeiter, prüfte religiöse Schriften, schrieb Erlasse und vermittelte zwischen Geistlichen und Behörden.
Was ihm an Zeit blieb, widmete er den Armen und Kranken. Dann las oder arbeitete er im Garten. Für ihn waren körperliche und geistige Arbeit gleichwertig. Mittags machte er Spaziergänge, meist in armen Gegenden. Die Menschen freuten sich über sein Kommen. Kinder und Alte traten auf die Türschwelle, als käme mit ihm die Sonne. Er segnete die Menschen, sprach mit Kindern, lächelte den Müttern zu. Hatte er Geld, besuchte er die Bedürftigen. Hatte er keins, ging er zu den Reichen.
Zu Hause aß er zu Mittag – schlicht wie das Frühstück. Am Abend speiste er mit seiner Schwester, bedient von Frau Magloire. Das Mahl war einfach: Gemüse, Suppe mit Öl. Nur wenn ein Pfarrer zu Besuch war, setzte sie dem Bischof etwas Besonderes vor.
Nach dem Essen sprach er mit den beiden Frauen und zog sich dann zum Schreiben zurück. Er war sehr belesen und hinterließ mehrere theologische Manuskripte.
Manchmal schweifte Bischof Myriel beim Lesen ab und schrieb seine Gedanken direkt in die Bücher. Diese Notizen hatten oft nichts mit dem Inhalt zu tun. In einem Buch über britische Generäle fand sich zum Beispiel sein Gebet: „O Du, der Du bist! ... Der schönste Deiner Namen ist: der Erbarmer.“
Gegen neun Uhr zogen sich seine Schwester und Frau Magloire zurück, während er allein im Erdgeschoss blieb.
***
Das Haus war schlicht: unten drei Zimmer – Speise-, Schlaf- und Betzimmer – oben drei Schlafzimmer. Hinter dem Haus lag ein kleiner Garten. Die Küche war in der alten Spitalapotheke untergebracht.
Im Garten stand ein Stall mit zwei Kühen. Die Hälfte der Milch schenkte der Bischof täglich den Kranken. Im Winter saß er oft in einem Bretterverschlag im Stall, den er seinen „Wintersalon“ nannte. Seine Möbel waren einfach: Holztische, Strohstühle, ein Buffet.
Wenn viele Gäste kamen, holte er alle verfügbaren Stühle zusammen – elf waren es insgesamt. Kamen mehr, blieb er einfach stehen und unterhielt sich im Stehen, um niemanden bloßzustellen.
Im Alkoven stand zwar noch ein Stuhl, aber er war beschädigt. Auch Fräulein Baptistine besaß einen großen Holzsessel, doch der war zu sperrig, um ihn durchs Treppenhaus zu bewegen und konnte daher nicht als Ersatz dienen.
Das Schlafzimmer des Bischofs war schlicht: ein eisernes Spitalbett mit grünem Himmel, ein Strohsessel am Schreibtisch, einfache Möbel und ein kleiner Altar aus einem alten Buffet. Zwei Priesterporträts hingen über dem Bett.
Ein Vorhang aus grober Wolle bedeckte das Fenster; als er zu alt wurde, nähte Frau Magloire ein Kreuz hinein. „Wie schön das aussieht“, sagte der Bischof oft. Die Zimmer waren weiß getüncht, die Böden aus roten Ziegeln, mit Strohmatten vor den Betten. Im ganzen Haus herrschte große Sauberkeit
„Denn das nimmt den Armen nichts“, meinte der Bischof.
Vom einstigen Reichtum waren ihm nur sechs silberne Bestecke und ein Suppenlöffel geblieben, an denen Frau Magloire hing. Myriel gestand: „Darauf zu verzichten, fiele mir schwer.“
Zudem besaß er zwei silberne Leuchter. Bei Besuch stellte Frau Magloire sie mit brennenden Kerzen auf den Tisch. Ansonsten bewahrte sie das Silbergeschirr in einem Schränkchen über dem Bett auf – unverschlossen.
Der Garten des Bischofs war von einfachen Wegen durchzogen. Vier Beete waren mit Buchsbaum eingefasst: Drei nutzte Frau Magloire für Gemüse, das vierte bepflanzte der Bischof mit Blumen. Als sie ihn neckte, das bringe doch nichts ein, antwortete er: „Das Schöne ist ebenso nützlich wie das Nützliche.“
Täglich arbeitete er dort ein bis zwei Stunden, jätete Unkraut und pflegte die Pflanzen.
Im Haus war keine Tür abgeschlossen. Die Tür zum Domplatz war einst stark gesichert, doch der Bischof ließ alle Schlösser entfernen. Sie blieb nun Tag und Nacht nur eingeklinkt. Anfangs machten sich die Frauen Sorgen, doch Myriel sagte: „Lasst eure Türen verriegeln, wenn Ihr wollt.“
Er notierte in seiner Bibel: „Die Tür des Arztes soll nie verschlossen, die des Geistlichen immer offen sein.“ In einem anderen Buch schrieb er: „Auch ich bin ein Arzt – meine Kranken sind die Unglücklichen.“ Und: „Fragt den, der um Obdach bittet, nicht nach seinem Namen.“
Als ein Pfarrer ihn wegen der offenen Tür warnte, antwortete der Bischof ruhig: „Wenn der Herr das Haus nicht bewacht, wachen die Hüter umsonst.“
***
Eine Begebenheit zeigt besonders deutlich den Charakter von Bischof Myriel: Nach der Zerschlagung einer Räuberbande trieb deren Anführer Cravatte wieder sein Unwesen in den Bergen. Er raubte sogar die Sakristei von Embrun aus und verbreitete Angst in der Region. Als Bischof Myriel auf dem Weg nach Chastelar war, warnte ihn der Maire: „Die Gegend ist gefährlich, nicht einmal eine Eskorte biete Schutz.“
Doch Myriel antwortete ruhig: „Ich werde ohne Begleitung reisen.“ Auf die Einwände des Bürgermeisters entgegnete er: „In den Bergen lebt eine kleine Gemeinde, die ich seit drei Jahren nicht besucht habe. Die Hirten dort sind fromme, einfache Leute. Was würden sie von einem Bischof denken, der sich fürchtet?“
Als der Maire ihn an die Räuber erinnerte, sagte der Bischof: „Vielleicht will mich Gott gerade zu diesen Menschen senden. Auch sie brauchen das Wort Gottes.“
Der Bürgermeister warnte: „Sie werden ausgeraubt oder getötet!“ Doch Myriel blieb gelassen: „Ich habe nichts. Und was sollten sie mit einem alten Priester anfangen, der betet?“
Er reiste schließlich allein mit einem Jungen als Führer. Sein Mut sorgte überall für Aufsehen – und für große Besorgnis.
Er erreichte unbeschadet das Dorf seiner Hirtenfreunde und blieb dort 14 Tage, um seelsorgerisch zu wirken.
Vor der Abreise wollte er ein Tedeum feiern. Doch es fehlte am passenden Ornat. Myriel sagte dennoch: „Wir kündigen es an. Die Sache wird sich schon machen.“
Kurz darauf übergaben zwei unbekannte Reiter dem Pfarrer eine Kiste mit prachtvollen bischöflichen Gewändern – es waren die gestohlenen Kirchenschätze aus Embrun. Auf einem Zettel stand: „Von Cravatte an den Herrn Bischof Bienvenu.“
Der Bischof lächelte: „Wer sich mit einem Pfarrerrock begnügt, dem sendet Gott ein Erzbischofsgewand.“
Der Pfarrer scherzte: „Gott – oder der Teufel?“
Doch Myriel erwiderte ernst: „Gott.“
Auf dem Rückweg wurde der Bischof viel bestaunt. In Le Chastelar traf er seine Schwester und Frau Magloire. Zu Baptistine sagte er: „Ich ging mit leeren Händen und kehre mit einem Domschatz zurück. Mein einziges Gepäck war Gottvertrauen.“
Am Abend sagte er: „Fürchten wir nicht Räuber – fürchten wir unsere eigenen Vorurteile und Laster. Das Böse droht nicht von außen, sondern aus uns selbst.“
Über den Verbleib der Kirchenschätze ist nichts Genaues bekannt. In Myriels Papieren fand sich nur ein Satz: „Die Frage ist, ob es dem Dom oder dem Krankenhaus zukommt.“
***
Der Senator war ein kluger, erfolgreicher Mann. Er war großzügig zu Familie und Freunden, aber nur das Angenehme im Leben interessierte ihn. Er verspottete alles, was ewig oder religiös war, auch die Überzeugungen des Bischofs.
Bei einem offiziellen Essen sprach der Senator während des Desserts zum Bischof: „Lassen Sie uns offen reden. Ein Bischof und ein Senator – wir sind wie zwei alte Füchse. Ich habe meine eigene Philosophie. Ich lese Pyrrho, Hobbes und Naigeon, aber Diderot ist mir zu idealistisch. Voltaire war besser. Wissen Sie, ein Tropfen Essig im Mehl genügt, um Leben zu erzeugen – so braucht man keinen Schöpfergott mehr. Ich glaube nicht an einen himmlischen Vater. Ich halte es mit dem Nichts – das lässt mich in Ruhe.“
Der Bischof entgegnete ruhig: „Sie schlafen auf einem Purpurbett, Herr Senator.“
Doch der Senator fuhr unbeirrt fort: „Jesus redet nur von Entsagung und Aufopferung. Ich sehe nicht ein, warum wir Menschen das tun sollten. Dieses Leben ist alles. Nach dem Tod bleibt nur Asche. Der Glaube an das ewige Leben ist ein fauler Trick. Ich war vor meiner Geburt nichts und ich werde nach dem Tod nichts sein. Also genieße ich lieber das Leben. Die Kirche soll den Armen ruhig vom Himmel erzählen. Wer nichts hat, soll wenigstens den lieben Gott haben. Ich aber halte mich an die Realität. Gott ist etwas fürs Volk.“
„Das nenne ich eine starke Rede!“, sagte der Bischof und klatschte. „Solcher Materialismus ist wirklich großartig. Wer so denkt, muss sich um nichts mehr kümmern: keine Verantwortung, keine Skrupel. Er kann alles nehmen – Ämter, Titel, Macht, ehrlich oder unehrlich – und dann satt und zufrieden sterben. Ich meine das nicht persönlich, Herr Senator, aber ich gratuliere: Ihr Reichen habt eine eigene feine Philosophie. Und Ihr habt nichts dagegen, dass der Glaube an Gott dem Volk bleibt.“
***
Digne, den 16. Dezember
Teuerste Freundin,
wir sprechen täglich von Ihnen. Heute aber habe ich einen besonderen Anlass zu schreiben. Beim Putzen hat Frau Magloire in unseren Schlafzimmern wahre Schätze entdeckt: hinter den alten Tapeten kamen bemalte Decken, vergoldete Balken und Wandbilder zum Vorschein. Mein Zimmer zeigt jetzt Szenen aus der Antike.
Ich bin glücklich, wie immer. Mein Bruder ist gut – fast zu gut. Er gibt alles den Bedürftigen. Deshalb leben wir einfach, vor allem im Winter. Trotzdem haben wir genug Licht und Wärme, wofür ich sehr dankbar bin.
Er hat seine eigenen Gewohnheiten. Die Haustür ist nie verschlossen. Er sagt, ein Bischof müsse mutig sein. Er geht allein hinaus, bei Wind, Regen und Schnee. Letztes Jahr war er 14 Tage unterwegs in einer Räuberregion. Wir dachten schon, er sei tot. Doch er kam gesund zurück – mit gestohlenen Kirchenschätzen, die ihm die Räuber freiwillig gaben.
Früher hatte ich große Angst um ihn. Jetzt bete ich mit Frau Magloire für ihn und schlafe ruhig. Wir wissen: Wenn ihm etwas zustößt, ist das auch unser Ende – dann folgen wir ihm zu Gott. Der Teufel könnte ins Haus kommen – wir hätten keine Angst. Es ist ja ein Stärkerer bei uns.
So lebt man mit einem Mann, dessen Herz groß ist.
Grüßen Sie bitte Ihren Vetter, den Herrn Kardinal. Sylvanie geht es gut – sie tut, was Sie wünschen und hat mich lieb. Mehr brauche ich nicht. Ich werde zwar magerer, aber es geht mir nicht schlecht.
Leben Sie wohl. In treuer Freundschaft
Ihre Baptistine
Die beiden Frauen hatten ein feines Gespür für den Bischof. Sie verstanden ihn oft besser, als er sich selbst. Obwohl sie seine kühnen Handlungen mit Sorge betrachteten, ließen sie ihn still gewähren. Frau Magloire wagte nur manchmal Einwände, aber nie, wenn er sich einmal entschieden hatte. Sie gehorchten ihm, halfen ihm notfalls durch ihre Abwesenheit und wussten, dass zu viel Fürsorge störend sein kann. Auch wenn sie sich sorgten, vertrauten sie ihn Gott an.
***
Einige Zeit nach dem erwähnten Brief wagte der Bischof etwas, das die Stadt Digne noch mehr erschütterte als seine Reise ins Räubergebirge. Er beschloss, ein früheres Mitglied des Konvents zu besuchen, einen gewissen G., der als Schreckgestalt galt. G. lebte einsam in einem abgelegenen Tal, fern jeder Straße. Die Menschen hielten ihn für einen Königsmörder, obwohl er nicht für den Tod des Königs gestimmt hatte. Man betrachtete ihn als gottlosen Revolutionär und sprach über ihn voller Abscheu.
Trotzdem dachte der Bischof immer wieder an G. Er wusste: „Dort lebt eine vereinsamte Seele.“ Zugleich spürte er selbst eine unbestimmte Abneigung gegenüber diesem Mann. Doch er erkannte, dass ein wahrer Hirte auch das verstoßene Schaf nicht meiden darf.
Als sich in der Stadt das Gerücht verbreitete, G. liege im Sterben, sagten viele: „Gott sei Dank!“ Der Bischof aber nahm seinen Stock und machte sich auf den Weg zu ihm.
Die Sonne stand schon tief, als er das abgelegene Tal erreichte. Mit klopfendem Herzen näherte er sich der Hütte. Er überquerte einen Graben, durchschritt einen verwilderten Garten und sah schließlich hinter einem Gebüsch eine einfache Hütte mit vergitterter Vorderseite. Davor saß ein alter Mann mit weißen Haaren im Rollstuhl und wärmte sich in der Sonne. Neben ihm stand ein Hirtenjunge mit einer Schale Milch.
Als der Bischof sich näherte, sagte der alte Mann zum Knaben: „Danke, ich brauche nichts mehr.“ Erstaunt sah er dann den Bischof an: „Seit ich hier lebe, ist dies der erste Besuch. Wer sind Sie?“
„Ich nenne mich Bienvenu Myriel.“
„Also mein Bischof?“
„Eigentlich!“
Der Greis lächelte und reichte ihm die Hand. Doch der Bischof erwiderte den Gruß nicht und meinte: „Man hat mir gesagt, Sie seien krank. Aber Sie sehen recht wohl aus.“
„Noch drei Stunden, dann bin ich tot“, entgegnete der Mann. „Ich spüre die Kälte in mir aufsteigen. Ich wollte noch einmal die Sonne sehen. Es ist gut, dass Sie gekommen sind. Ich will nicht allein sterben.“
Zum Hirtenjungen sagte er: „Geh schlafen. Du hast gewacht.“ Dann murmelte er: „Während er schläft, werde ich sterben. Der eine Schlaf stört den anderen nicht.“
Der Bischof fühlte sich seltsam unberührt. Die Szene erschien ihm nicht feierlich. Er war innerlich verletzt, weil der Sterbende ihn mit „Mein Herr“ ansprach – und nicht als Bischof.
Der Bischof, der sonst jede Neugier vermied, konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Denn für ihn stand ein Konventsmitglied außerhalb aller Gesetze – sogar außerhalb der Nächstenliebe.
G., der alte Mann, war erstaunlich kräftig. Trotz seines nahen Todes war sein Blick klar, seine Stimme fest. Nur seine Beine waren gelähmt. Es wirkte, als wolle er freiwillig sterben.
Der Bischof setzte sich und sagte trocken: „Ich muss loben, dass Sie wenigstens nicht für den Tod des Königs gestimmt haben.“
Doch der Greis entgegnete ernst: „Ich habe gegen den Tod des Tyrannen gestimmt – die Tyrannei der Unwissenheit.“ Er erklärte, nur die Wissenschaft können den Menschen wirklich leiten.
Der Bischof hörte nachdenklich zu. G. erklärte, er habe nicht den König, sondern die Ungerechtigkeit bekämpft. Er wollte Vorurteile, Unwissenheit und Elend abschaffen.
Der Bischof wandte ein: „Aber 1793?“
Der sterbende Greis richtete sich mühsam auf und sprach feierlich: „Aha, Sie kommen mit 1793! Eine Wolke, die 1500 Jahre gewartet hat, ist endlich geplatzt – und Sie klagen den Blitz an!“
Der Bischof entgegnete ruhig: „Der Richter spricht im Namen der Gerechtigkeit, der Priester im Namen des Mitleids. Auch der Blitz darf sich nicht irren. Und was ist mit Ludwig XVII.?“
G. packte ihn leicht am Arm und sagte: „Ein unschuldiges Kind zu töten ist immer Unrecht. Aber wenn wir über Ludwig XVII. trauern, dann auch über die Kinder des Volkes. Ihr Leid ist älter.“
Nach einer Pause sah G. den Bischof scharf an: „Warum sprechen Sie mit mir über Ludwig XVII.? Ich kenne Sie nicht. Ihr Ruf ist mir zu Ohren gekommen – lobend, ja. Aber das reicht mir nicht. Ich habe Ihre Kutsche nicht gehört, also haben Sie sie versteckt. Sie sagen, Sie seien Bischof. Aber was bedeutet das? Wer sind Sie wirklich?“
Der Bischof senkte den Kopf und sagte leise: „Vermis sum.“
Der Sterbende reagierte spöttisch: „Ein Erdenwurm mit Kutsche!“
Doch dann sprach der Bischof ruhig: „Erklären Sie mir bitte, wie mein Einkommen oder mein Palast beweisen sollen, dass Mitleid keine Tugend und Milde keine Pflicht ist.“
Der Mann des Convents hielt inne, bat um Verzeihung und gestand: „Ich habe Unrecht getan. Sie sind mein Gast.“
Dann fuhr er fort: „Sie sagten, 1793 sei unbarmherzig gewesen? Und Marat klatschte beim Anblick der Guillotine? Aber erinnern Sie sich an Bossuet, der die Verfolgung der Protestanten mit einem Tedeum feierte?“
Diese Antwort traf den Bischof tief. Doch der Greis redete weiter, trotz Atemnot: „1793 war die Antwort auf Jahrhunderte der Gewalt. Ich beklage Marie-Antoinette – aber auch die Hugenottin, die sterben sollte, weil sie ihren Glauben nicht verriet.“
Er schloss ruhig: „Die Revolution war heftig, aber sie brachte Fortschritt. Nach ihr war die Menschheit weiter.“
Der Bischof fühlte, wie alle seine inneren Einwände ins Wanken gerieten. Doch er sagte: „Fortschritt muss an Gott glauben. Das Gute braucht heilige Werkzeuge.“
Der Greis schwieg. Eine Träne rollte über seine Wange. Leise flüsterte er, in den Himmel blickend: „O du! Ideal, du allein bist!“ Der Bischof war tief erschüttert.
Nach einer Pause hob der Sterbende den Finger und sagte: „Das Unendliche ist dort. Wenn es kein Ich hätte, wäre es begrenzt – also ist Gott das Ich des Unendlichen.“
Diese Worte sprach er mit Kraft, dann schloss er die Augen. Die Anstrengung hatte ihn erschöpft, sein Tod stand kurz bevor. Der Bischof erkannte den Moment, beugte sich zu ihm und sagte: „Dies ist die Stunde Gottes. Es wäre schade, wenn unser Gespräch umsonst gewesen wäre.“
Der Greis öffnete die Augen, ernst, aber nicht feindlich.
Er sagte: „Ich habe mein Leben dem Denken gewidmet. Dann hat mein Land mich gebraucht, ich habe gedient. Ich habe Missstände bekämpft, die Freiheit verteidigt, unterdrückte Menschen unterstützt. Ich habe Klostertücher zerrissen – aber nur, um Wunden zu verbinden. Ich habe sogar Priester geschützt. Ich habe meine Pflicht getan, wurde dafür verfolgt und gehasst. Jetzt bin ich alt und sterbe. Was wollen Sie noch von mir?“
Der Bischof kniete nieder und bat: „Ihren Segen.“
Als er aufsah, war der Greis tot. Der Bischof ging schweigend nach Hause und betete die ganze Nacht.
Von da an war er noch gütiger zu den Armen. Auf Fragen über den alten Mann zeigte er nur nach oben.
***
Der Bischof von Digne war kein politischer Denker. Die Begegnung mit dem alten Revolutionsanhänger G. hatte ihn tief berührt, aber nicht verändert. Politik interessierte ihn wenig, doch in manchen Fragen zeigte er Haltung.
Nach seiner Ernennung zum Bischof machte Napoleon ihn zum Baron und rief ihn 1811 zur Bischofssynode nach Paris. Dort war Myriel jedoch bald unerwünscht. Seine einfachen Ansichten als armer Landbischof stießen auf Ablehnung und er kehrte bald zurück. Auf Nachfragen meinte er, seine Anwesenheit sei wie eine offene Tür gewesen: unbequem und störend.
Er kritisierte den Prunk vieler Bischöfe. Ein Priester, so glaubte er, solle arm leben, um sich ganz den Armen widmen zu können. Reichtum widersprach für ihn echter Mildtätigkeit.
Politisch war er zwar zurückhaltend, doch zeigte er gewisse Tendenzen. Er sympathisierte wohl eher mit dem Papst als mit dem Staat. Napoleons Fall ließ ihn unberührt. Nach 1813 unterstützte er oppositionelle Bewegungen und weigerte sich, während der Hundert Tage für den zurückgekehrten Kaiser beten zu lassen.
Mit seinen Brüdern, einem General und einem Präfekten, stand er in Kontakt. Den General mied er zeitweise, weil dieser Napoleon zwar zu bekämpfen vorgab, ihn aber absichtlich entwischen ließ.
Auch der Bischof blieb also nicht frei von den Spannungen seiner Zeit. Seine politische Haltung war schwach ausgeprägt, aber nicht völlig neutral. Ideal wäre es gewesen, hätte er sich ganz dem Geistlichen und nicht auch dem Weltlichen zugewandt.
Trotz allem war der Bischof gerecht, weise, bescheiden und mildtätig. Auch in politischen Fragen zeigte er Nachsicht. Ein Beispiel dafür war der ehemalige Gardeunteroffizier, der Kastellan des Rathauses. Er war Bonapartist und hatte das Ehrenkreuz bei Austerlitz erhalten. Doch als die Lilien das Bild Napoleons auf dem Orden ersetzten, trug er ihn nicht mehr. Er weigerte sich, das neue Symbol anzunehmen, verspottete Ludwig XVIII. und verlor deshalb seine Stelle.
Der Bischof ließ ihn kommen, sprach freundlich mit ihm und gab ihm eine neue Anstellung als Türhüter der Kathedrale.
So wurde der Bischof in Digne in nur neun Jahren ein geliebter Mann. Selbst seine Haltung gegenüber Napoleon nahm ihm das Volk nicht übel – zu sehr liebte es seinen gütigen Bischof.
***
In der Kirche ist es wie in der Welt: Viele junge Priester suchen die Nähe mächtiger Bischöfe, um Karriere zu machen. Wer dem Bischof gefällt, bekommt gute Stellen, wird befördert und kann bis nach Rom gelangen.
Doch Bischof Bienvenu gehörte nicht zu den einflussreichen Kirchenfürsten. Deshalb sammelten sich keine jungen Kleriker um ihn. Wer ehrgeizig war, wandte sich anderen Bischöfen zu. Denn Bienvenu galt als jemand, der niemandem zu Macht oder Wohlstand verhalf. Seine Mitarbeiter waren einfache, gute Männer.
Seine Bescheidenheit war für viele sogar abschreckend. Ein Heiliger, der sich selbst ständig zurücknimmt, wirkt ansteckend – und das war gefährlich für jene, die aufsteigen wollten. Daher mied man ihn.
Die Gesellschaft seiner Zeit verlangte Erfolg. „Dränge dich empor!“ lautete das Gebot. Erfolg wurde mit Talent verwechselt. Wer Glück hatte, galt als tüchtig. Derjenige, der reich oder berühmt wurde, wurde sofort bewundert – auch wenn er durch Zufall oder Betrug dorthin gelangte. Der wahre Verdienst wurde selten erkannt. Die Menge lobte lieber das, was glänzte, anstatt das, was wahrhaft groß war.
***
Ob Bischof Bienvenu alle kirchlichen Dogmen geteilt hat, lässt sich nicht sagen. Sicher ist nur: Er glaubte aufrichtig, so gut er konnte. Oft rief er: „Ich glaube an den Vater!“ und fand Frieden im Tun des Guten. Seine Güte ging weit über den Glauben hinaus. Er war voll Liebe – nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Er hatte Mitleid selbst mit Spinnen oder Ameisen. So konnte es geschehen, dass er sich den Fuß verrenkte, nur um einer Ameise auszuweichen. Einmal sagte er beim Anblick einer Spinne: „Armes Tier, es ist ja nicht seine Schuld.“
Solche zarten Gedanken erinnern an Franz von Assisi. Bienvenu war ein stiller, milder Mensch. Seine Milde war das Ergebnis vieler Lebenserfahrungen, nicht bloß ein Wesenszug. Sie hatte sich über die Jahre in ihn eingegraben wie Wasser in Stein.
1815 war er 75 Jahre alt, sah aber jünger aus. Er war klein, rundlich und hatte eine freundliche Ausstrahlung. Menschen nannten ihn oft einfach „einen guten Mann“. Doch wer länger mit ihm sprach, spürte seine innere Größe. Er strahlte Weisheit, Ruhe und Güte aus.
Der Bischof verbrachte seine Tage mit Beten, Arbeiten, Geben, Trösten, Lesen, Gärtnern, Fasten und Gastfreundschaft. Jeder Tag war erfüllt von guten Gedanken und Taten. Und dennoch schien ihm der Tag erst dann vollständig, wenn er abends, nachdem die Frauen zu Bett gegangen waren, noch Zeit im Garten verbringen konnte.
Allein unter dem Sternenhimmel versank er in stille Betrachtungen. In der Dunkelheit fühlte er Gottes Nähe. Er lauschte den Stimmen des Universums und ließ seine Gedanken frei. In solchen Momenten öffnete er sein Herz wie eine leuchtende Lampe in der Nacht.
Er dachte an die Größe Gottes, an Ewigkeit und Vergangenheit, an die Kräfte, die das Leben formen.
Er setzte sich auf eine alte Bank unter seinen Obstbäumen. Dieses kleine Gärtchen, so unscheinbar es war, genügte ihm völlig. Denn was brauchte ein Mensch mehr als einen stillen Platz auf der Erde – und den Himmel über sich?
***
Manche Leser könnten meinen, der Bischof von Digne habe eine eigene Glaubenslehre erfunden und sei vielleicht ein Pantheist gewesen. Doch wer ihn kannte, wusste: Er war einfach ein gütiger Mensch, der sich vom Herzen leiten ließ.
Er grübelte nicht über große Geheimnisse nach und versuchte nicht, das Wesen Gottes verstandesmäßig zu erfassen. Er war kein Denker wie Pascal, kein Träumer wie Swedenborg. Er wählte einen einfacheren Weg – den der Liebe und Barmherzigkeit, wie das Evangelium ihn zeigt.
Er forschte nicht nach den Ursachen, sondern bemühte sich, zu helfen. Er suchte das Mitgefühl in den Herzen der Menschen, so wie andere Gold aus der Erde gewinnen wollen. Dieser Dienst an den Leidenden war sein Lebensinhalt.
Sein Leitsatz lautete: „Kindlein, liebet euch.“ Als ihn ein Senator höhnisch darauf ansprach, antwortete er nur: „Wenn das eine Dummheit ist, so soll sich die Seele darin einschließen wie die Perle in die Auster.“
Das war seine ganze Philosophie – still, bescheiden und voller Güte.
Erster Teil, Zweites Buch. Der Fehltritt
An einem Oktoberabend 1815 betrat ein erschöpfter, staubiger Wanderer die Stadt Digne. Er war etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut, trug abgetragene Kleidung, einen vollgepackten Tornister und schwere Schuhe. Die Menschen beobachteten ihn misstrauisch. Er war offenbar den ganzen Tag marschiert und hatte am Brunnen Wasser getrunken. Schließlich ging er zum Rathaus und sprach dort vor.
Kurz darauf betrat er die beste Herberge der Stadt. Der Wirt Jacquin Labarre war in Digne angesehen.
Der Wanderer trat in die Küche, wo der Wirt gerade für eine Gesellschaft von Fuhrleuten ein Abendessen zubereitete. Ohne aufzusehen, fragte der Wirt: „Was wünscht der Herr?“
„Ein Abendessen und ein Nachtlager“, antwortete der Mann.
Als der Wirt den Fremden sah, ergänzte er misstrauisch: „Wer bezahlt?“
Der Mann zeigte eine volle Geldbörse und sagte: „Ich habe Geld.“
Daraufhin erklärte sich der Wirt bereit, ihn zu bewirten.
Der Mann stellte seinen Tornister ab und setzte sich ans Feuer. Während er sich wärmte, beobachtete ihn der Wirt unauffällig. Dann schrieb er ein paar Zeilen und schickte einen Jungen mit dem Zettel zum Stadthaus. Der Gast bemerkte davon nichts.
Als er nach dem Essen fragte, antwortete der Wirt nur kurz: „Gleich.“ Nach der Rückkehr des Jungen las der Wirt die Antwort, schüttelte den Kopf und trat zum Gast. „Ich kann Sie nicht aufnehmen.“
Der Mann bot an, vorauszuzahlen, aber der Wirt lehnte ab. Auch der Stall sei belegt, sogar Stroh könne er ihm nicht anbieten. Essen gebe es auch keines. Der Fremde protestierte, blieb sitzen und erklärte, er habe Hunger.
Da beugte sich der Wirt zu ihm und sagte eindringlich: „Gehen Sie!“ Dann fügte er hinzu: „Soll ich Ihnen sagen, wie Sie heißen? Jean Valjean. Und wer Sie sind? Ich habe im Stadthaus nachfragen lassen. Können Sie lesen?“
Bei diesen Worten überreichte der Wirt dem Fremden den Zettel. Der las ihn flüchtig. Nach einer Pause sagte der Wirt: „Ich bin aus Grundsatz gegen Jedermann höflich. Gehen Sie.“
Der Fremde senkte den Kopf, nahm seinen Tornister und ging. Er schlenderte durch die Stadt, ohne Ziel. Er drehte sich nicht um und bemerkte nicht, wie man ihm nachsah.
Eine Weile irrte er durch fremde Straßen. Dann kam der Hunger wieder. Die Nacht brach herein. Er suchte ein bescheidenes Logierhaus. In dem Moment sah er am Straßenende Licht – eine Schenke. Er trat ein.
„Wer ist da?“ rief der Wirt.
„Jemand, der um ein Abendessen und ein Nachtlager bittet.“
„Sehr wohl. Das kann man hier kriegen.“
Der Wirt sagte: „Hier ist ein Feuer. Im Topf kocht das Abendbrot. Kommen Sie näher, guter Freund und wärmen Sie sich!“
Der Fremde setzte sich. Sein Gesicht zeigte Erleichterung. Doch ein Gast erkannte ihn. Er flüsterte dem Wirt etwas zu.
Der Wirt ging zum Fremden, legte die Hand auf seine Schulter und sagte grob: „Mach, dass du fortkommst!“
Der Fremde drehte sich um. „Sie wissen also…?“
„Ja.“
„Ich bin aus der anderen Herberge hinausgewiesen worden.“
„Und hier wirst du auch weggejagt.“
„Wo soll ich denn hingehen?“
„Anderswohin.“
Der Fremde nahm seinen Stock, seinen Tornister – und ging. Als der Mann aus der Schenke kam, bewarfen ihn Kinder mit Steinen. Wütend lief er ihnen nach. Dann kam er am Gefängnis vorbei und klingelte. „Herr Schließer“, sagte er demütig, „würden Sie mir für die Nacht Unterkunft geben?“
Eine Stimme antwortete: „Ein Gefängnis ist keine Herberge. Erst müssen Sie verhaftet sein.“
Das Fenster schloss sich wieder. Er ging weiter, kam an kleinen Gärten vorbei und sah ein Haus mit erleuchtetem Fenster. Drinnen saß ein Mann mit einem Kind auf dem Schoß. Eine Frau stillte ein Baby. Der Tisch war gedeckt, das Licht warm. Der Fremde klopfte an die Fensterscheibe – dreimal.
Beim dritten Klopfen kam der Hausherr an die Tür. Der Fremde bat:
„Wenn ich bezahle – würden Sie mir etwas Suppe geben und einen Schlafplatz im Schuppen?“
„Wer sind Sie?“
„Ich komme von Puy-Moisson. Ich bin den ganzen Tag gelaufen. Ich bezahle.“
„Warum gehen Sie nicht in eine Herberge?“
„Die sind überfüllt.“
„Waren Sie bei Labarre?“
„Ja.“
„Nun?“
„Er hat mich nicht aufgenommen.“
„Und bei Dingrich?“
„Der auch nicht.“
Der Hausherr sah den Fremden plötzlich misstrauisch an und rief erschrocken: „Sind Sie etwa der Mann, der…“ Er stellte die Lampe ab, griff zur Flinte. Die Frau sprang auf, nahm die Kinder, flüchtete sich hinter den Mann und flüsterte: „Ein Räuber!“
Der Hausherr kehrte zur Tür zurück. „Mach, dass du fortkommst.“
„Ein Glas Wasser. Aus Erbarmen.“
„Eine Kugel durch den Kopf gehört dir!“
Die Tür flog zu. Drinnen wurden Riegel vorgeschoben, Fensterläden geschlossen. Dann war es draußen still. Der kalte Nachtwind kam von den Alpen. Der Mann entdeckte eine grasbedeckte Hütte in einem Garten, stieg über den Zaun und kroch hinein. Es war warm, ein Strohlager lag bereit. Er streckte sich erschöpft aus, begann, seinen Tornister abzuschnallen – da hörte er ein Knurren. Im Eingang erschien der Kopf einer großen Dogge. Er war in eine Hundehütte geraten. Mit Mühe schaffte er es aus dem Garten. Wieder auf der Straße, sank er auf einen Stein. „Ich habe es nicht einmal so gut wie ein Hund!“
Dann ging er weiter, aus der Stadt hinaus. Schließlich erreichte er einen Acker mit einem niedrigen, stoppelbedeckten Hügel. Der Himmel war tief schwarz, nur oben glänzte etwas Mondlicht. Die Erde war heller als der Himmel.
Die Landschaft war öde und trostlos. Auf dem Hügel stand nur ein krummer Baum, der sich im Wind bog. Der Wanderer empfand die Natur hier als unheimlich und kehrte rasch in die Stadt zurück.
Es war etwa acht Uhr abends. Ziellos wanderte er durch die Straßen, kam an der Präfektur, dem Seminar und dem Dom vorbei. Als er über den Domplatz ging, ballte er die Faust gegen die Kirche. Schließlich legte er sich erschöpft auf eine steinerne Bank.
Eine alte Dame kam aus der Kirche und sprach ihn an: „Was machen Sie da, guter Freund?“
„Ich lege mich schlafen.“
„Auf diese Bank?“
„Ich habe 19 Jahre auf Holz geschlafen, also geht das auch.“
„Sie waren Soldat?“
„Ja, gute Frau.“
„Warum gehen Sie nicht in eine Herberge?“
„Ich habe kein Geld. Ich habe an alle Türen geklopft.“
„Auch an die da drüben?“ – und sie zeigte auf ein kleines Haus.
„Nein.“
„Dann klopfen Sie dort an.“
***
Am selben Abend saß der Bischof in seinem Zimmer. Um acht Uhr stand er auf und ging ins Speisezimmer. Dort war bereits gedeckt. Fräulein Baptistine unterhielt sich mit Frau Magloire. Das Zimmer war rechteckig, hatte einen Kamin, eine Tür zur Straße und ein Fenster zum Garten.
Frau Baptistin erzählte später oft, was an diesem Abend im Haus geschah, sodass sich viele Leute an die Einzelheiten erinnern konnten.
Als der Bischof das Zimmer betrat, schimpfte Frau Magloire gerade über die Klinke an der Tür. Sie hatte beim Einkaufen erfahren, dass ein gefährlicher Landstreicher in der Stadt sei. Man solle sich vorsehen. Jeder müsse sein Haus gut verschließen.
Der Bischof saß vor dem Kamin, wärmte sich und dachte nach. Ihren Hinweis beachtete er kaum. Erst als Fräulein Baptistine nachfragte, drehte er sich halb um und sagte freundlich: „Nun, erzählen Sie! Was geht denn vor?“
Frau Magloire wiederholte nun mit viel Dramatik ihre Geschichte: Ein zerlumpter, gefährlicher Bettler halte sich in der Stadt auf. Jacquin Labarre habe ihn abgewiesen, später sei er am Boulevard Gassendi gesehen worden. Ein echter Strolch mit Galgengesicht!
Der Bischof meinte gelassen: „Was Sie sagen!“
Frau Magloire fuhr fort: Die Polizei tue nichts. Dann forderte sie, den Schlosser zu holen, um die alten Riegel an der Tür wieder anzubringen.
„Und Bischöfliche Gnaden rufen immer gleich: Herein!“, rief sie empört.
In diesem Moment klopfte es laut an die Tür.
„Herein!“ rief der Bischof.
***
Die Tür öffnete sich heftig und der Fremde, Jean Valjean, trat ein. Er blieb stehen, ließ die Tür offen und blickte finster in den Raum. Frau Magloire erstarrte vor Schreck, Fräulein Baptistine wandte sich dem Kamin zu. Der Bischof sah Valjean ruhig an.
Valjean sprach laut: Er sei ein entlassener Sträfling, heiße Jean Valjean, habe 19 Jahre im Bagno verbracht. Niemand habe ihn aufgenommen – nicht die Gasthäuser, nicht das Gefängnis. Eine Frau habe ihm geraten, hier zu klopfen. Er sei hungrig, müde, habe Geld – könne alles bezahlen. „Darf ich hierbleiben?“
Der Bischof antwortete: „Frau Magloire, noch ein Gedeck!“
Valjean zeigte seinen gelben Pass, erklärte nochmals, was er sei: ein gefährlicher ehemaliger Sträfling. „Wollen Sie mich aufnehmen? Haben Sie einen Stall?“
Der Bischof sagte: „Beziehen Sie das Bett im Alkoven mit frischen Laken.“
Frau Magloire gehorchte wortlos. Der Bischof wandte sich wieder an Valjean: „Setzen Sie sich, Herr Valjean, wärmen Sie sich. Wir essen gleich.“
Valjeans Gesicht veränderte sich. Ungläubig fragte er: „Sie jagen mich nicht fort? Sie sagen Herr Valjean zu mir? Ich bekomme ein Bett mit Laken? Wie heißen Sie? Sie sind doch ein Gastwirt?“
Der Fremde erfuhr, dass sein Gastgeber ein Priester war. Überrascht rief er: „Ein guter Priester! Dann verlangen Sie kein Geld? Jetzt sehe ich ja das Käppchen!“ Er legte Tornister und Stock ab und setzte sich. Fräulein Baptistine betrachtete ihn freundlich.
Der Bischof erkundigte sich, wie viel Geld er habe. „109 Franken und 15 Sous“, erwiderte Valjean. „Dafür habe ich 19 Jahre gearbeitet.“
Valjean berichtete, dass er in Grasse 25 Sous verdient habe und erzählte vom Gefängnis. Währenddessen schloss der Bischof die Tür. Frau Magloire kehrte mit dem Gedeck zurück. Der Bischof ließ in der Nähe des Kamins decken. „Sie frieren sicher, Herr Valjean.“
Jedes Mal, wenn der Bischof ihn „Herr“ nannte, leuchtete Valjeans Gesicht. Als die Lampe flackerte, brachte Frau Magloire zwei silberne Leuchter.
Valjean war gerührt. „Sie verachten mich nicht, obwohl ich Ihnen meine Vergangenheit erzählt habe.“
Der Bischof antwortete: „Dies ist nicht mein Haus, sondern das Haus Jesu Christi. Wer leidet, ist willkommen. Und ich kannte Ihren Namen schon, bevor Sie ihn sagten: Sie heißen mein Bruder.“
Der Gast sagte: „Ich hatte großen Hunger, als ich kam. Aber Sie sind so gut, dass ich ihn kaum noch spüre.“
Der Bischof fragte: „Haben Sie viel Schlimmes erlebt?“
Valjean erzählte von den harten Jahren im Bagno: Kälte, Hitze, Hunger, Arbeit, Strafen. „Ich bin 46. 19 Jahre war ich im Gefängnis. Und nun dieser gelbe Pass.“
Der Bischof sprach ruhig: „Sie kommen aus einem Ort des Jammers. Doch wenn Sie mit guten Gedanken zurückkehren, sind Sie besser als viele andere.“
Inzwischen hatte Frau Magloire das einfache Abendessen aufgetragen. Die Mahlzeit bestand aus Suppe, etwas Fleisch, Käse, Brot, Feigen – und einer Flasche alten Weins.
Der Bischof rief heiter: „Zu Tisch!“ und bat Valjean, an seiner Rechten Platz zu nehmen. Fräulein Baptistine setzte sich links. Der Bischof sprach das Tischgebet und reichte die Suppe.
***
Später schrieb Fräulein Baptistine in einem Brief: Der Gast aß gierig, sagte aber nach dem Essen: „Das ist alles viel zu gut für mich. Aber die Fuhrleute, die mich weggeschickt haben, essen besser als Sie.“
Der Bischof erwiderte: „Sie müssen auch mehr leisten als ich.“
Valjean meinte, der Bischof sei wohl arm und gar kein richtiger Pfarrer. Der Bischof sagte: „Gott ist mehr als gerecht.“
Dann erkundigte er sich nach Valjeans Ziel. „Ich muss nach Pontarlier. Morgen bei Tagesanbruch gehe ich weiter.“
Der Bischof sagte: „Sie kommen in eine gute Gegend. Ich war dort einst selbst arm, fand aber Arbeit in Papier- und Eisenwerken.“
Der Bischof erinnerte sich an Verwandte in Pontarlier und fragte seine Schwester. Sie erwähnte Herrn von Lucenet. Der Bischof nickte und sagte: „1793 musste man sich auf sich selbst verlassen. Ich habe gearbeitet. In Pontarlier gibt es eine einfache, aber ehrliche Industrie: die Käsereien.“
Während Valjean aß, wurde er ruhiger. Der Bischof schenkte ihm sogar Wein ein, den er selbst selten trinkt. Oft erwähnte er die Arbeit des Käsers, als wolle er Valjean einen Weg aus der Not zeigen. Nie erinnerte er ihn an seine Vergangenheit. Er nannte ihn „Herr Valjean“ und behandelte ihn wie jeden anderen Gast. Er fragte nicht nach seiner Herkunft und stellte keine moralischen Fragen. Einmal unterbrach er sich sogar, als er von ehrlichen Menschen in den Bergen sprach. Offenbar wollte er Valjean vergessen lassen, wer er war – zumindest für einen Abend.
Am Ende des Essens klopfte Mutter Gerbaud. Der Bischof küsste ihr Kind, bat seine Schwester um 15 Sous und gab sie der Frau. Valjean achtete kaum noch auf das Geschehen, wirkte erschöpft.
Der Bischof sprach das Dankgebet. Dann sagte er zu Valjean: „Sie sehnen sich sicher nach dem Bett.“
***
Nachdem der Bischof seiner Schwester gute Nacht gewünscht hatte, nahm er einen silbernen Leuchter, gab den zweiten Jean Valjean und sagte: „Ich bringe Sie jetzt in Ihr Zimmer.“
Valjean folgte ihm. Sie gingen durch das Schlafzimmer des Bischofs, wo Frau Magloire gerade das Silber in den Wandschrank legte. Im Alkoven stand ein frisches Bett bereit. Valjean stellte den Leuchter auf ein Tischchen. „Schlafen Sie wohl,“ sagte der Bischof. „Morgen bekommen Sie noch eine Tasse frische Milch.“
„Danke, Herr Abt,“ antwortete Valjean.
Doch plötzlich fuhr er auf, verschränkte die Arme, blickte wild und rief: „Sie geben mir wirklich ein Zimmer? Haben Sie sich das überlegt? Woher wissen Sie, ob ich kein Raubmörder bin?“
Der Bischof antwortete ruhig: „Das geht nur den lieben Gott etwas an.“ Dann segnete er Valjean und verließ den Raum. Vor dem Vorhang im Betzimmer kniete er noch kurz zum Gebet. Dann ging er in den Garten.
Valjean fiel angekleidet ins Bett und schlief sofort ein. Gegen Mitternacht kehrte der Bischof zurück. Bald war alles still.
***
Mitten in der Nacht erwachte Jean Valjean. Er stammte aus einer armen Bauernfamilie in La Brie. Seine Eltern starben früh und seine ältere Schwester zog ihn groß. Später kümmerte er sich um sie und ihre sieben Kinder. Er arbeitete hart, war still und zurückgezogen. Abends kam er müde heim und aß schweigend. Seine Schwester gab das Beste vom Essen den Kindern. Wenn die Kinder Milch borgten, bezahlte er sie heimlich bei der Nachbarin.
Er verdingte sich als Baumputzer, Hirt, Handlanger. Doch als ein strenger Winter kam, fand er keine Arbeit. Die Familie hatte nichts zu essen. An einem Abend schlug er aus Hunger die Fensterscheibe eines Bäckers ein und stahl ein Brot. Der Bäcker erwischte ihn. Valjean wurde verhaftet.
1795 wurde er wegen Einbruchs verurteilt. Da er ein Gewehr besaß und gewildert hatte, galt er als gefährlich. Er erhielt fünf Jahre Zwangsarbeit. Die Strafe war hart. Er wurde nach Bicêtre gebracht und an eine Sträflingskette geschmiedet. Ein alter Wärter erinnerte sich später noch an ihn: Valjean saß still in einer Ecke, weinte heftig und stammelte immer wieder: „Ich war Baumputzer in Faverolles.“
Er hatte gestohlen, um seine Familie zu ernähren. Seine Unwissenheit und Armut schützten ihn nicht. Das Urteil traf ihn wie ein Blitz. In seinem Herzen war nur der Schmerz über die Strafe, die ihm alles genommen hatte.
Jean Valjean wurde nach Toulon gebracht. Dort bekam er eine Nummer: 24601. Sein Name und seine Vergangenheit wurden ausgelöscht. Was aus seiner Schwester und ihren sieben Kindern wurde, interessierte niemanden. Die Familie zerbrach, als er weggesperrt wurde. Jahre später erfuhr er, dass seine Schwester mit dem jüngsten Kind in Paris lebte und als Falzerin arbeitete. Jeden Morgen brachte sie ihren Sohn zur Schule. Weil sie früh anfangen musste, wartete das Kind eine Stunde lang frierend im Hof. Wenn es regnete, durfte es bei der Portierfrau in der Ecke schlafen.
Im vierten Jahr seiner Haft floh Valjean erstmals. Zwei Tage war er auf der Flucht. Dann wurde er gefasst und bekam drei Jahre extra. Im sechsten Jahr versuchte er erneut zu entkommen, wurde wieder gefasst: fünf weitere Jahre. Im zehnten Jahr wieder ein Versuch, wieder scheiterte er: drei weitere Jahre. Ein letzter Fluchtversuch im dreizehnten Jahr brachte ihm nochmals drei Jahre Strafe. Insgesamt verbrachte Jean Valjean 19 Jahre im Gefängnis – für den Diebstahl eines Brots.
Er wurde 1815 entlassen. Als er das Gefängnis verließ, war er hart und verbittert. Was war in seiner Seele in dieser langen Zeit geschehen?
***
Jean Valjean war kein Unschuldiger. Er gestand sich ein, dass sein Brotdiebstahl falsch gewesen war. Gleichzeitig stellte er sich wichtige Fragen: „Warum hatte ein arbeitswilliger Mann wie er keine Arbeit gefunden? Warum war die Strafe für ein gestohlenes Brot so grausam? Waren die 19 Jahre Zwangsarbeit nicht selbst ein Unrecht?“
Er sah, dass die Gesellschaft gerade die Schwächsten am härtesten traf. Er kam zum Schluss, dass seine Strafe keine völlige Ungerechtigkeit, aber eine Unbilligkeit gewesen war. Sein Groll wuchs. Er sagte sich, dass er der Gesellschaft nichts mehr schulde. Im Gegenteil: Sie schulde ihm etwas.
Er empfand tiefen Hass – nicht nur auf die Menschen, sondern auch auf die höhere Macht, die diese Welt geschaffen hatte. Seit seiner Kindheit hatte er nie Güte erfahren. Deshalb beschloss er, seinen Hass zu pflegen – als Waffe für das Leben draußen.
Er lernte im Gefängnis lesen, schreiben und rechnen. Dieses Wissen wollte er nutzen – nicht für das Gute, sondern um seinen Hass zu stärken. Bildung war für ihn ein Werkzeug der Vergeltung.
Während der 19 Jahre im Zuchthaus veränderte sich Jean Valjean tiefgreifend. In ihm wuchsen Licht und Finsternis zugleich. Als er eingesperrt wurde, war er im Kern noch gut. Doch mit jedem Schlag und jeder Demütigung wurde er härter. Er begann, die Gesellschaft zu hassen – und schließlich sogar Gott.
Kann ein Mensch durch Leid völlig verändert werden? Kann ein gutes Herz durch Kälte, Hunger und Verachtung verdorren? In Valjeans Innerem blieb ein kleiner Funke zurück – göttlich, unzerstörbar, bereit zu glühen, wenn er Wärme fände. Aber in Toulon war alles nur Dunkelheit.
Ob Jean Valjean selbst diese Veränderungen verstand, bleibt fraglich. Vieles in ihm war unklar. Er wusste oft selbst nicht, was er fühlte. Nur manchmal, wenn der Zorn aufflammte, erkannte er kurz die Tiefe seines Schmerzes. Dann fiel das Licht wieder in sich zusammen und er tappte weiter im Dunkeln.
Die grausamen Strafen hatten ihn nicht nur gezeichnet, sondern auch seine Seele verwildert. Er handelte mehr aus Instinkt als aus Vernunft.
Dabei war Valjean von außergewöhnlicher Kraft. Er konnte Lasten tragen, für die es sonst vier Männer brauchte. Auch seine Geschicklichkeit war erstaunlich: Er konnte an Wänden emporklettern, sich bis auf Dächer ziehen, wo andere keinen Halt fanden. Seine Fähigkeiten machten ihn im Zuchthaus zu einem gefürchteten und bewunderten Mann.
Jean Valjean sprach kaum und lachte fast nie. Wenn er doch einmal lachte, klang es düster, wie das Echo eines bösen Geistes.
Sein Denken war wie das eines Korns zwischen Mühlsteinen – zermalmt von einer gnadenlosen Welt.
Aus dem einfachen Baumputzer von einst war ein gefährlicher Mann geworden – fähig zu spontaner Wut, aber auch zu geplanter Rache. Sein Denken war geprägt von Hass. Sein Herz war langsam vertrocknet. Als er das Gefängnis verließ, hatte er seit 19 Jahren keine Träne mehr geweint.
***
Ein Mann ist über Bord gefallen. Niemand hält das Schiff an. Es segelt weiter, vom Sturm getrieben. Der Mann taucht aus den Wellen auf, ruft um Hilfe, doch keiner hört ihn. Alle an Bord denken nur an den tobenden Sturm.
Der Mann sieht das Schiff kleiner werden, bis es ganz verschwindet. Eben war er noch Teil der Mannschaft, nun ist er allein. Die Wellen umkreisen ihn, reißen ihn unter, spritzen ihm ins Gesicht. Wasser dringt in Nase und Mund. Er kämpft verzweifelt, schwimmt, so gut er kann.
Doch das Schiff ist nur noch ein Punkt am Horizont. Der Sturm tobt, die Nacht bricht herein. Vögel fliegen über ihm. Aber sie helfen nicht. Er ist allein, schwimmt stundenlang, erschöpft. Niemand kommt. Keine Antwort, kein Licht, kein Gott. Da verliert er den Mut. Er gibt auf.
So geht es auch einem Menschen, den die Gesellschaft aufgibt. Auch eine Seele kann im Meer der Gleichgültigkeit untergehen – ohne Hoffnung auf Rettung.
***
Als Jean Valjean das Zuchthaus verließ, fühlte er große Freude. Er glaubte, ein neues Leben beginne. Doch bald merkte er, was „Freiheit mit gelbem Pass“ wirklich bedeutet.
Schon im Zuchthaus bekam er weniger Geld ausbezahlt, als er erwartet hatte. Statt 171 Franken erhielt er nur 109 Franken und 15 Sous. Er verstand die Rechnung nicht und dachte, man habe ihn betrogen.
Am Tag nach seiner Entlassung bot er in Grasse bei einer Destillation seine Hilfe an. Er arbeitete fleißig und glaubte, einen Tageslohn von 30 Sous zu bekommen.
Doch ein Gendarm verlangte seine Papiere und am Abend zahlte der Arbeitgeber ihm nur 15 Sous aus. Auf seine Beschwerde antwortete man kalt: „Für so einen, wie dich, ist es genug.“
Als er widersprach, drohte man ihm mit dem Gefängnis.
Valjean erkannte: Die Gesellschaft betrügt ihn immer wieder. Frei zu sein, heißt für ihn nicht, auch frei von Verurteilung zu sein.
***
Als Jean Valjean um zwei Uhr erwachte, war ihm das gute Bett ungewohnt. Seit fast 20 Jahren hatte er nicht so geschlafen. Er hatte nur vier Stunden geschlafen und konnte nicht wieder einschlafen. Gedanken wirbelten in seinem Kopf durcheinander, doch einer drängte sich immer wieder vor: das silberne Besteck. Er wusste, es lag im Schrank neben dem Bett. Massives Silber. 200 Franken konnte man dafür bekommen.
Er kämpfte mit diesem Gedanken, aber er ließ ihn nicht los. Um drei Uhr setzte er sich aufs Bett, zog die Schuhe aus und dachte weiter nach.
Schließlich stand er auf, ging zum Fenster und prüfte es. Es war nur leicht verschlossen und führte in den Garten. Der Mond schien. Die niedrige Gartenmauer schien leicht zu überwinden. Er kehrte zurück, holte aus seinem Tornister ein Werkzeug – eine kurze, spitze Eisenstange. Dann packte er alles zusammen, zog seine Mütze tief ins Gesicht und schlich zur Tür des Bischofs.
***
Jean Valjean horchte – kein Laut. Vorsichtig drückte er mit dem Finger die Tür an. Sie öffnete sich leise. Noch einmal drückte er sie, diesmal kräftiger und ein lautes Quietschen durchbrach die Stille. Erschrocken wich er zurück, das Herz pochte. Er erwartete jeden Moment ein Aufschreien, doch nichts rührte sich. Nach Minuten wagte er einen Blick ins Zimmer – alles blieb still.
Langsam trat er ein. In der Dunkelheit erkannte man nur verschwommene Umrisse: Papiere, Bücher, ein Lehnstuhl. Im Hintergrund hörte man gleichmäßiges Atmen – der Bischof schlief.
Plötzlich stand Jean Valjean vor dem Bett. In diesem Moment teilte sich eine Wolke. Der Mondschein fiel durch das Fenster auf das Gesicht des Bischofs. Er lag ruhig da, in einem braunen Hemd, die Hand mit dem Bischofsring hing über den Bettrand. Sein Gesicht wirkte friedlich, wie von innen heraus leuchtend. Der Schein des Mondes verstärkte diese Ruhe.
Jean Valjean war wie erstarrt. So viel Frieden hatte er noch nie gesehen. Er starrte auf den Schlafenden. In seiner Haltung lag Staunen, vielleicht auch Ehrfurcht. Was er dachte, blieb unklar – ob er den alten Mann angreifen oder ihm danken wollte.
Langsam nahm er die Mütze ab, hielt sie in der linken Hand, die Eisenstange in der rechten. Und er blickte weiter auf das Gesicht des Greises.
Plötzlich setzte er die Mütze auf, ging zum Schrank, sah den Schlüssel, öffnete ihn, nahm den Korb mit dem Silber, lief zurück ins Zimmer, öffnete das Fenster, sprang hinaus, verstaute das Silber im Tornister, warf den Korb weg, überwand die Mauer und floh durch den Garten.
***
Beim Sonnenaufgang ging der Bischof im Garten spazieren. Da kam Frau Magloire erschrocken gelaufen. „Bischöfliche Gnaden, wissen Bischöfliche Gnaden, wo der Korb mit dem Silberbesteck ist?“
„Ja“, sagte der Bischof und reichte ihr den Korb.
„Gott sei gepriesen! Aber wo ist denn das Silberbesteck?“
„Ach, das Silberbesteck wollen Sie haben? Ja, wo das ist, weiß ich nicht.“
„Herr des Himmels, es ist gestohlen! Der Fremde hat es gestohlen!“
Sie rannte ins Haus. Der Bischof betrachtete schweigend das zerdrückte Löffelkraut. Da schrie sie wieder: „Bischöfliche Gnaden, der Mann ist fort! Das Silber ist gestohlen!“
Der Bischof sah sie ruhig an. „Gehörte denn das Silber uns?“
Sie starrte ihn an. Dann sagte er: „Dieses Silberbesteck gehörte den Armen. Unser Gast war doch ein Armer.“
„Aber wovon sollen Bischöfliche Gnaden jetzt essen?“
„Als wenn es keine zinnernen Bestecke gäbe!“
„Zinn riecht schlecht.“
„Dann kaufen wir eiserne.“
„Eisen schmeckt bitter.“
„Dann nehmen wir hölzerne.“
Da klopfte es. Drei Gendarmen führten Jean Valjean herein.
Der Bischof trat rasch heran. „Ah! Da sind Sie! Ich hatte Ihnen auch die Leuchter geschenkt. Warum haben Sie die nicht auch mitgenommen?“
Valjean starrte ihn sprachlos an.
„Also, Bischöfliche Gnaden, ist es wahr, was der Mann gesagt hat? Wir haben ihn angehalten, er hatte das Silberbesteck bei sich.“
„Und er hat gesagt, ein alter Priester hätte es ihm geschenkt? Ja, das war ich.“
„Dann dürfen wir ihn laufen lassen?“
„Ohne Zweifel.“
Die Gendarmen ließen Jean Valjean los. „Also darf ich wirklich gehen?“ stammelte er.
„Na, kannst du nicht hören? Gewiss darfst du gehen“, sagte einer der Gendarmen.
Der Bischof trat an ihn heran. „Guter Freund, nehmen Sie auch die Leuchter mit. Ich hatte sie Ihnen geschenkt.“
Jean Valjean zitterte, nahm die Leuchter mechanisch entgegen. „Und nun gehen Sie in Frieden! Und wenn Sie wiederkommen, nehmen Sie bitte die Haustür. Sie ist nur zugeklinkt.“
Zu den Gendarmen sagte er: „Meine Herren, ich halte Sie nicht länger auf.“
Jean Valjean stand wie benommen da. Der Bischof beugte sich zu ihm: „Vergessen Sie nicht, Sie haben mir versprochen, ein ehrlicher Mann zu werden.“
Dann sagte er mit feierlicher Stimme: „Ich kaufe Ihre Seele los. Ich entreiße sie dem Bösen und gebe sie Gott.“
Jean Valjean floh aus der Stadt, verirrte sich stundenlang, ohne Ziel. In ihm tobte ein Sturm. Trauer, Reue und Zorn überkamen ihn. Am Abend saß er erschöpft auf einem öden Feld, allein mit seinen Gedanken.
Jean Valjean saß in Grübeleien versunken, als er plötzlich fröhlichen Gesang hörte. Ein etwa zehnjähriger Junge kam des Wegs, spielte mit ein paar Münzen und verlor dabei ein Zweifrankenstück, das bis zu Jean Valjean rollte. Dieser setzte den Fuß darauf.
Der Junge bemerkte ihn erst jetzt und bat freundlich: „Bitte um mein Zweifrankenstück.“
Jean Valjean fragte nur: „Wie heißt du?“
„Der kleine Gervais.“
„Mach, dass du fortkommst!“
Doch der Junge ließ nicht locker: „Geben Sie mir mein Geld wieder!“
Jean Valjean schwieg. Der Junge bettelte, flehte, weinte, zitterte – und schrie schließlich: „Werden Sie bald Ihren Fuß wegnehmen?“
Da fuhr Jean Valjean auf: „Bist du immer noch da? Willst du wohl machen, dass du fortkommst?“
Der Kleine erschrak, starrte ihn an, rannte dann wortlos davon. Aus der Ferne hörte man ihn noch weinen. Jean Valjean blieb lange regungslos. Die Sonne war untergegangen, die Kälte kam. Plötzlich sah er im Gras das Zweifrankenstück, das sein Fuß halb in die Erde gedrückt hatte. Da überkam ihn ein Schauer. Mit leerem Blick starrte er auf das Geld, als sei es ein Zeichen.
Als Jean Valjean das Geldstück im Gras sah, war es, als hätte ihn ein Blitz getroffen. Er starrte darauf, als blicke es ihn an. Dann stürzte er sich darauf, hob es auf und blickte sich verwirrt um. Doch die Ebene war leer. Er rannte los in die Richtung, in der der kleine Gervais verschwunden war. „Kleiner Gervais! Kleiner Gervais!“ rief er laut in die Dunkelheit. Keine Antwort. Immer wieder schrie er den Namen, doch niemand antwortete. Schließlich begegnete ihm ein Pfarrer. Jean Valjean fragte hastig nach dem Jungen. Der Pfarrer hatte ihn nicht gesehen. Jean Valjean gab ihm Geld für die Armen und rief verzweifelt: „Herr Abt, lassen Sie mich arretieren. Ich bin ein Dieb!“ Der Pfarrer floh erschrocken.
Jean Valjean irrte weiter, durchsuchte Büsche, rannte zu Schatten, die sich als Steine erwiesen. An einem Kreuzweg rief er nochmals: „Kleiner Gervais!“
Kein Echo, nur Nebel. Dann sackte er auf einen Stein, vergrub das Gesicht in den Händen und flüsterte: „Ich bin ein Elender!“
Jean Valjean fing an zu weinen – zum ersten Mal seit 19 Jahren. Die Worte des Bischofs klangen ihm unaufhörlich im Ohr: „Ich kaufe Ihnen Ihre Seele ab und weihe sie Gott.“ Jean Valjean spürte, dass dies ein Wendepunkt war. Wenn er jetzt der Güte des Bischofs widerstand, würde seine Härte siegen. Wenn er nachgab, musste er seinen Hass ablegen. Der Kampf in ihm war entscheidend.
Wahrscheinlich begriff er nicht völlig, wie tiefgreifend sein Erlebnis in Digne war. Doch tief in ihm wusste er: Es gab keinen Mittelweg mehr. Er würde entweder besser werden als der Bischof – oder schlimmer als je zuvor.