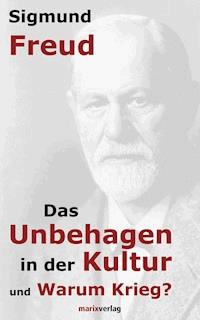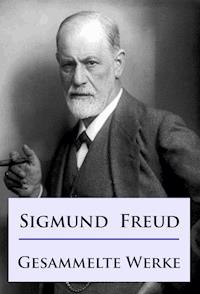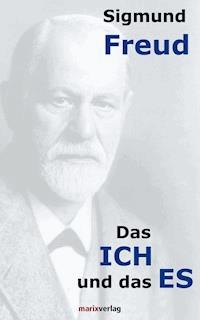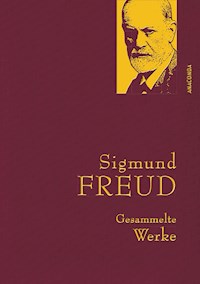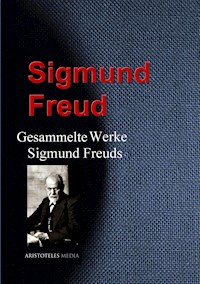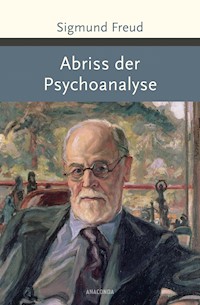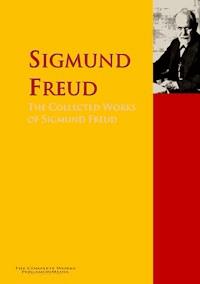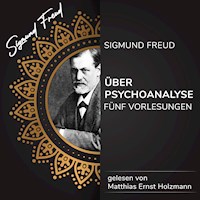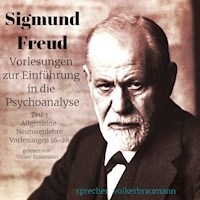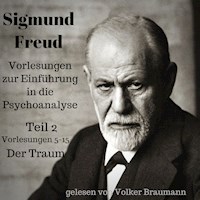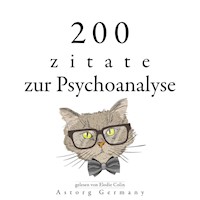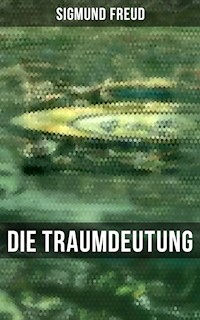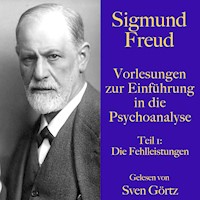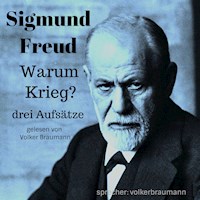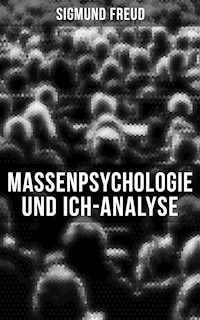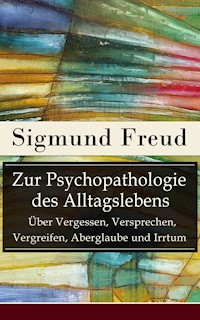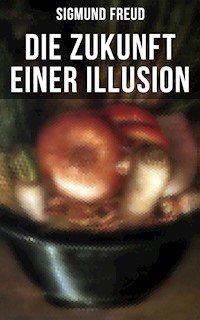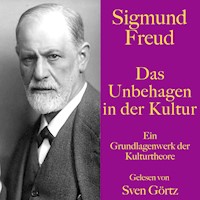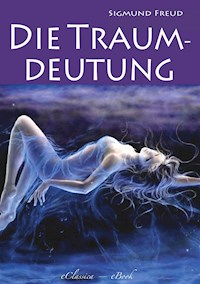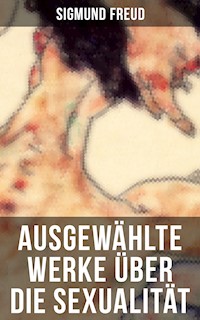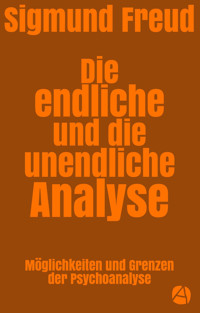
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sigmund Freud Werke
- Sprache: Deutsch
"Die endliche und die unendliche Analyse" ist eine der späten theoretischen Schriften Sigmund Freuds, erstmals 1937 veröffentlicht. In diesem Werk reflektiert Freud über die Möglichkeiten und Grenzen der psychoanalytischen Behandlung und zieht eine kritische Bilanz seiner langjährigen therapeutischen Erfahrung. Dabei stellt er die Frage, unter welchen Bedingungen eine Analyse als „beendet“ gelten kann – und wann sie sich potenziell ins Unendliche fortsetzt. Freud geht von der Beobachtung aus, dass viele Patienten trotz langfristiger Behandlung nicht vollständig von ihren Symptomen befreit werden. Er analysiert die Gründe für dieses Phänomen und identifiziert zwei Hauptfaktoren: die Stärke und Tiefe der Verdrängungen sowie die Widerstände, die sich gegen die Aufdeckung unbewusster Inhalte richten. Besonders das „Ich“ entwickelt vielfältige Abwehrmechanismen, um sich vor unangenehmen Wahrheiten zu schützen. Diese Widerstände können so hartnäckig sein, dass die Analyse in einem endlosen Prozess der Aufdeckung, Wiederholung und Bearbeitung gefangen bleibt. Ein zentrales Thema des Textes ist auch der sogenannte „negative therapeutische Effekt“. Freud beschreibt damit die paradoxe Reaktion mancher Patienten, auf Fortschritte in der Analyse mit einer Verschlechterung des Zustands zu reagieren. Dies erklärt er durch ein tief verankertes Schuldgefühl oder durch unbewusste Bestrafungswünsche, die Fortschritte sabotieren. Auch das Über-Ich spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem es sich als unnachgiebig und strafend erweist – selbst wenn das Ich bereit ist, Einsichten zuzulassen. Trotz dieser Schwierigkeiten betont Freud die grundsätzliche Wirksamkeit der Analyse. Er unterscheidet zwischen einer „endlichen Analyse“, bei der eine gewisse Stabilisierung und Symptomfreiheit erreicht wird, und einer „unendlichen Analyse“, die sich mit den tiefer liegenden Strukturen der Persönlichkeit befasst und theoretisch niemals vollständig abgeschlossen werden kann. Letztere entspricht eher einem idealtypischen Ziel als einer realistischen Perspektive. "Die endliche und die unendliche Analyse" gilt als ein realistisches, selbstkritisches und zugleich theoretisch anspruchsvolles Spätwerk Freuds. Es zeigt seine Reifung im Umgang mit therapeutischen Grenzen und eröffnet eine differenzierte Sichtweise auf Heilung, Veränderung und die Dauer analytischer Prozesse. Das Werk ist ein bedeutender Beitrag zur psychoanalytischen Theorie und Praxis und stellt grundlegende Überlegungen zur Reichweite und Begrenzung psychischer Veränderung im analytischen Setting an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sigmund Freud
Die endliche
und die unendliche
Analyse
Möglichkeiten und Grenzen
der Psychoanalyse
DIE ENDLICHE UND DIE UNENDLICHE ANALYSE wurde zuerst 1937 veröffentlicht.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2025
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-669-5
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
Die endliche und die unendliche Analyse
Impressum
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
N e w s l e t t e r
Links
Zu guter Letzt
I
Erfahrung hat uns gelehrt, die psychoanalytische Therapie, die Befreiung eines Menschen von seinen neurotischen Symptomen, Hemmungen und Charakterabnormitäten, ist eine langwierige Arbeit. Daher sind von allem Anfang an Versuche unternommen worden, um die Dauer der Analysen zu verkürzen. Solche Bemühungen bedurften keiner Rechtfertigung, sie konnten sich auf die verständigsten und zweckmäßigsten Beweggründe berufen. Aber es wirkte in ihnen wahrscheinlich auch noch ein Rest jener ungeduldigen Geringschätzung, mit der eine frühere Periode der Medizin die Neurosen betrachtet hatte, als überflüssige Erfolge unsichtbarer Schädigungen. Wenn man sich jetzt mit ihnen beschäftigen mußte, wollte man nur möglichst bald mit ihnen fertig werden. Einen besonders energischen Versuch in dieser Richtung hat O. Rank gemacht im Anschluß an sein Buch Das Trauma der Geburt (1924). Er nahm an, daß der Geburtsakt die eigentliche Quelle der Neurose sei, indem er die Möglichkeit mit sich bringt, daß die »Urfixierung« an die Mutter nicht überwunden wird und als »Urverdrängung« fortbesteht. Durch die nachträgliche analytische Erledigung dieses Urtraumas hoffte Rank die ganze Neurose zu beseitigen, so daß das eine Stückchen Analyse alle übrige analytische Arbeit ersparte. Einige wenige Monate sollten für diese Leistung genügen. Man wird nicht bestreiten, daß der Ranksche Gedankengang kühn und geistreich war; aber er hielt einer kritischen Prüfung nicht stand. Der Versuch Ranks war übrigens aus der Zeit geboren, unter dem Eindruck des Gegensatzes von europäischem Nachkriegselend und amerikanischer »prosperity« konzipiert und dazu bestimmt, das Tempo der analytischen Therapie der Hast des amerikanischen Lebens anzugleichen. Man hat nicht viel davon gehört, was die Ausführung des Rankschen Planes für Krankheitsfälle geleistet hat. Wahrscheinlich nicht mehr, als die Feuerwehr leisten würde, wenn sie im Falle eines Hausbrandes durch eine umgestürzte Petroleumlampe sich damit begnügte, die Lampe aus dem Zimmer zu entfernen, in dem der Brand entstanden war. Eine erhebliche Abkürzung der Löschaktion wäre allerdings auf diese Weise zu erreichen. Theorie und Praxis des Rankschen Versuchs gehören heute der Vergangenheit an – nicht anders als die amerikanische »prosperity« selbst.
Einen anderen Weg, um den Ablauf einer analytischen Kur zu beschleunigen, hatte ich selbst noch vor der Kriegszeit eingeschlagen. Ich übernahm damals die Behandlung eines jungen Russen, der, durch Reichtum verwöhnt, in völliger Hilflosigkeit, von Leibarzt und Pfleger begleitet, nach Wien gekommen warF1. Im Laufe einiger Jahre gelang es, ihm ein großes Stück seiner Selbständigkeit wiederzugeben, sein Interesse am Leben zu wecken, seine Beziehungen zu den für ihn wichtigsten Personen in Ordnung zu bringen, aber dann stockte der Fortschritt; die Aufklärung der Kindheitsneurose, auf der ja die spätere Erkrankung begründet war, ging nicht weiter, und es war deutlich zu erkennen, daß der Patient seinen derzeitigen Zustand als recht behaglich empfand und keinen Schritt tun wollte, der ihn dem Ende der Behandlung näherbrächte. Es war ein Fall von Selbsthemmung der Kur; sie war in Gefahr, grade an ihrem – teilweisen – Erfolg zu scheitern. In dieser Lage griff ich zu dem heroischen Mittel der Terminsetzung. Ich eröffnete dem Patienten zu Beginn einer Arbeitssaison, daß dieses nächste Jahr das letzte der Behandlung sein werde, gleichgiltig, was er in der ihm noch zugestandenen Zeit leiste. Er schenkte mir zunächst keinen Glauben, aber nachdem er sich von dem unverbrüchlichen Ernst meiner Absicht überzeugt hatte, trat die gewünschte Wandlung bei ihm ein. Seine Widerstände schrumpften ein, und in diesen letzten Monaten konnte er alle Erinnerungen reproduzieren und alle Zusammenhänge auffinden, die zum Verständnis seiner frühen und zur Bewältigung seiner gegenwärtigen Neurose notwendig schienen. Als er mich im Hochsommer 1914 verließ, ahnungslos wie wir alle der so nah bevorstehenden Ereignisse, hielt ich ihn für gründlich und dauernd geheilt.
In einem Zusatz zur Krankengeschichte (1923) habe ich schon berichtet, daß dies nicht zutraf. Als er gegen Kriegsende als mittelloser Flüchtling nach Wien zurückkam, mußte ich ihm dabei helfen, ein nicht erledigtes Stück der Übertragung zu bewältigen; das gelang in einigen Monaten, und ich konnte den Nachtrag mit der Mitteilung schließen, daß »der Patient, dem der Krieg Heimat, Vermögen und alle Familienbeziehungen geraubt hatte, sich seitdem normal gefühlt und tadellos benommen hat«. Die anderthalb Jahrzehnte seither haben dies Urteil nicht Lügen gestraft, aber doch Einschränkungen daran notwendig gemacht. Der Patient ist in Wien geblieben und hat sich in einer, wenn auch bescheidenen, sozialen Position bewährt. Aber mehrmals in diesem Zeitraum wurde sein Wohlbefinden durch Krankheitszufälle unterbrochen, die nur als Ausläufer seiner Lebensneurose aufgefaßt werden konnten. Die Geschicklichkeit einer meiner Schülerinnen, Frau Dr. Ruth Mack Brunswick, hat diese Zustände jedesmal nach kurzer Behandlung zu Ende gebracht; ich hoffe, sie wird bald selbst über diese Erfahrungen berichten. In einigen dieser Anfälle handelte es sich immer noch um Restbestände der Übertragung; sie zeigten dann bei all ihrer Flüchtigkeit deutlich paranoischen Charakter. In anderen aber bestand das pathogene Material aus Fragmenten seiner Kindergeschichte, die in der Analyse bei mir nicht zum Vorschein gekommen waren und sich nun – man kann dem Vergleich nicht ausweichen – wie Fäden nach einer Operation oder nekrotische Knochenstückchen nachträglich abstießen. Ich fand die Heilungsgeschichte dieses Patienten nicht viel weniger interessant als seine Krankengeschichte.
Ich habe die Terminsetzung später auch in anderen Fällen angewendet und auch die Erfahrungen anderer Analytiker zur Kenntnis genommen. Das Urteil über den Wert dieser erpresserischen Maßregel kann nicht zweifelhaft sein. Sie ist wirksam, vorausgesetzt, daß man die richtige Zeit für sie trifft. Aber sie kann keine Garantie für die vollständige Erledigung der Aufgabe geben. Man kann im Gegenteil sicher sein, daß, während ein Teil des Materials unter dem Zwang der Drohung zugänglich wird, ein anderer Teil zurückgehalten bleibt und damit gleichsam verschüttet wird, der therapeutischen Bemühung verlorengeht. Man darf ja den Termin nicht erstrecken, nachdem er einmal festgesetzt worden ist; sonst hat er für die weitere Folge jeden Glauben eingebüßt. Die Fortsetzung der Kur bei einem anderen Analytiker wäre der nächste Ausweg; man weiß freilich, daß ein solcher Wechsel neuen Verlust an Zeit und Verzicht auf den Ertrag aufgewendeter Arbeit bedeutet. Auch läßt sich nicht allgemein giltig angeben, wann die richtige Zeit für die Einsetzung dieses gewaltsamen technischen Mittels gekommen ist, es bleibt dem Takt überlassen. Ein Mißgriff ist nicht mehr gutzumachen. Das Sprichwort, daß der Löwe nur einmal springt, muß recht behalten.
S. die mit Einwilligung des Patienten veröffentlichte Schrift ›Aus der Geschichte einer infantilen Neurose‹ (1918). Die spätere Erkrankung des jungen Mannes wird dort nicht ausführlich dargestellt, sondern nur gestreift, wo es der Zusammenhang mit der Kindheitsneurose unbedingt erfordert.
II
Die Erörterungen über das technische Problem, wie man den langsamen Ablauf einer Analyse beschleunigen kann, leiten uns nun zu einer anderen Frage von tieferem Interesse, nämlich, ob es ein natürliches Ende einer Analyse gibt, ob es überhaupt möglich ist, eine Analyse zu einem solchen Ende zu führen. Der Sprachgebrauch unter Analytikern scheint eine solche Voraussetzung zu begünstigen, denn man hört oft bedauernd oder entschuldigend über ein in seiner Unvollkommenheit erkanntes Menschenkind äußern: »Seine Analyse ist nicht fertig geworden«, oder: »Er ist nicht zu Ende analysiert worden.«