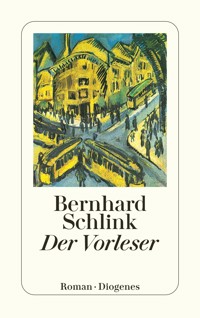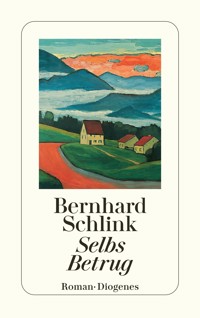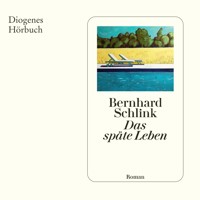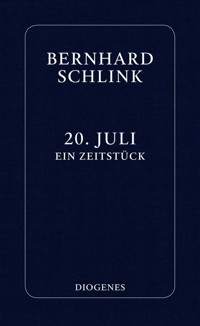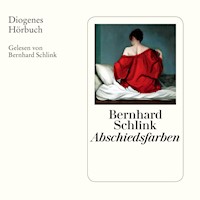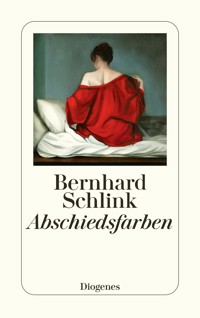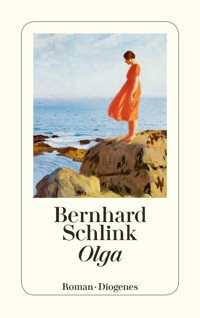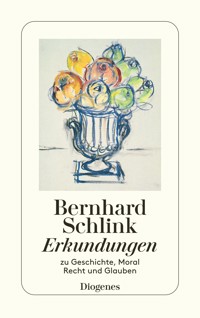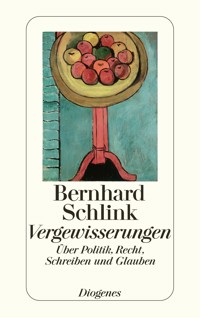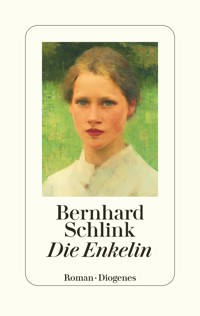
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Birgit ist zu Kaspar in den Westen geflohen, für die Liebe und die Freiheit. Erst nach ihrem Tod entdeckt er, welchen Preis sie dafür bezahlt hat. Er spürt ihrem Geheimnis nach, begegnet im Osten den Menschen, die für sie zählten, erlebt ihre Bedrückung und ihren Eigensinn. Seine Suche führt ihn zu einer völkischen Gemeinschaft auf dem Land – und zu einem jungen Mädchen, das in ihm den Großvater und in dem er die Enkelin sieht. Ihre Welten könnten nicht fremder sein. Er ringt um sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bernhard Schlink
Die Enkelin
Roman
Diogenes
Erster Teil
1
Er kam nach Hause. Es war zehn; donnerstags schloss er die Buchhandlung erst um neun, und wenn er um halb zehn die Gitter vor den Schaufenstern und der Eingangstür heruntergelassen hatte, nahm er den halbstündigen Weg durch den Park, länger als durch die Straßen, aber wohltuend nach dem langen Tag. Der Park war verwildert, die Rosenrabatte von Efeu überwuchert, die Ligusterhecke nicht geschnitten. Aber es roch gut, nach Rhododendron oder Flieder, Linde oder Götterbaum, gemähtem Gras oder nasser Erde. Er ging den Weg sommers wie winters, bei gutem wie bei schlechtem Wetter. Wenn er nach Hause kam, waren der Ärger und die Sorgen des Tags von ihm abgefallen.
Er wohnte mit seiner Frau in der Beletage eines mehrstöckigen Jugendstilhauses, vor Jahrzehnten billig gekauft, inzwischen wertvoll und ihre Altersvorsorge. Die breite Treppe, das geschwungene Treppengeländer, der Stuck, eine nackte Schöne, deren langes Haar die Treppe von Geschoss zu Geschoss begleitete – er mochte es, ins Haus zu treten, die Treppe hochzusteigen und die Tür mit dem blumenbunten Glaseinsatz aufzuschließen. Auch wenn er wusste, was ihn erwarten würde.
Im Flur lag Birgits Mantel auf dem Boden und waren zwei Taschen mit eingekauften Lebensmitteln umgefallen. Die Tür zum Wohnzimmer stand auf. Birgits Computer war wie die Wolldecke, die sie gerne über sich legte, vom Sofa auf den Boden gerutscht. Neben der Weinflasche war das Glas umgekippt und Rotwein auf den Teppich getropft. Ein Schuh lag in der Tür, der andere am Kachelofen; Birgit hatte wohl, wie sie das oft tat, die Schuhe von den Füßen gerissen und von sich geschleudert.
Er hängte seinen Mantel in den Schrank, stellte seine Schuhe neben die Kommode und ging ins Wohnzimmer. Jetzt sah er, dass auch die Vase mit den Tulpen umgefallen war; die Scherben und die welken Blumen lagen im Wasser neben dem Flügel. Er ging vom Wohnzimmer in die Küche. Neben der Mikrowelle lag eine leere Packung Reis mit Huhn, und im Spülbecken standen Birgits halbvoller Teller und das Geschirr vom gemeinsamen Frühstück. Er würde alles aufwischen und abwaschen und aufräumen.
Er stand und spürte seinen Zorn im Bauch und in den Händen. Aber es war ein müder Zorn. Er hatte ihn zu oft kommen und gehen lassen. Was sollte er auch machen? Wenn er Birgit am nächsten Morgen zornig konfrontieren würde, würde sie ihn beschämt und trotzig anschauen, dann den Blick abwenden und verlangen, in Ruhe gelassen zu werden, sie habe nur ein bisschen getrunken, dürfe sie nicht einmal mehr ein bisschen trinken, wie viel sie trinke, sei ihre Sache, wenn es ihn störe, dass sie trinke, könne er gehen. Oder sie würde in Tränen ausbrechen und sich anklagen und erniedrigen, bis er sie trösten würde, er liebe sie, sie sei gut, alles sei gut.
Er hatte keinen Hunger. Ihm reichte, was Birgit vom Reis mit Huhn übriggelassen hatte. Er wärmte es in der Mikrowelle und aß es am Küchentisch. Dann räumte er die eingekauften Lebensmittel in den Kühlschrank, trug Weinflasche und Glas, Scherben und welke Blumen aus dem Wohnzimmer in die Küche, wischte das Wasser auf, träufelte Zitronensaft auf den Rotweinflecken im Teppich, klappte den Computer zu, legte die Wolldecke zusammen und spülte das Geschirr. An die Küche schloss eine kleine Kammer an, ehemals Speisekammer, jetzt Wäschekammer; er füllte den Inhalt der Waschmaschine in den Wäschetrockner und den des Wäschekorbs in die Waschmaschine. Er kochte Wasser, machte Tee und setzte sich mit dem Teeglas an den Küchentisch.
Es war ein Abend wie viele andere. An manchen Abenden, wenn Birgit schon früh mit dem Trinken angefangen hatte, war mehr als zwei Taschen und ein Weinglas umgefallen und lag mehr als eine Vase in Scherben. An anderen Abenden, wenn sie erst kurz bevor er nach Hause kam, das erste Glas getrunken hatte, war sie fröhlich, gesprächig, zärtlich, und wenn’s nicht Wein, sondern Champagner war, von einer Lebendigkeit, die ihn glücklich machte und wehmütig wie alles Gute, von dem man weiß, dass es nicht stimmt. An diesen Abenden gingen sie zusammen ins Bett. Sonst lag sie, wenn er nach Hause kam, oft schon im Bett, oder sie lag auf dem Sofa oder auf dem Boden, und er trug sie ins Bett.
Danach saß er auf dem Hocker vor dem Schminktisch und sah sie an. Das faltige Gesicht, die welke Haut, die Haare in den Nasenlöchern, die Spucke in den Mundwinkeln, die aufgesprungenen Lippen. Manchmal zuckten ihre Augenlider, machten ihre Hände fahrige Bewegungen, sagte sie Worte, die keinen Sinn ergaben, stöhnte oder seufzte. Sie schnarchte, nicht so laut, dass er, wenn er sich später zu ihr legte, nicht hätte schlafen können, aber laut genug, dass er sich mit dem Einschlafen schwertat.
Schwer tat er sich auch mit ihrem Geruch. Sie roch nach Alkohol und krankem Magen, und manchmal erinnerte ihn etwas Stechendes in dem Geruch an die Mottenkugeln, die seine Großmutter in ihre Kleiderschränke gelegt hatte. Wenn sie sich, was zum Glück selten geschah, im Bett übergab, machte er das Fenster weit auf, hielt, wenn er sie und das Bett und den Boden vor dem Bett saubermachte, den Atem an und holte dazwischen am Fenster tief Luft.
Aber nie ließ er den Moment auf dem Hocker aus. Er sah sie an und sah im verwüsteten Gesicht das unversehrte, das Gesicht der guten Tage, das bei verschiedenen Stimmungen so verschieden aussehen konnte, dass es ihn manchmal verwirrte, das aber immer, selbst wenn verschlafen, erschöpft oder schlechtgelaunt, voller Leben war. Wie leblos ihr Ausdruck war, wenn sie getrunken hatte! Manchmal schienen im heutigen auch ihre früheren Gesichter auf, das entschlossene Gesicht der Studentin im blauen Hemd, das Gesicht der jungen Buchhändlerin, vorsichtig, verhalten, ihm oft ein Rätsel und ein Zauber, ihr Gesicht, nachdem sie zum Schreiben gefunden hatte, konzentriert, als denke sie immer über ihren Roman nach oder kriege ihn doch nie aus dem Kopf, ihr rosiges Gesicht, wenn sie, die spät im Leben das Fahrradfahren entdeckt hatte und gerne ein-, zweistündige Streifzüge mit dem Fahrrad machte, nach Hause kam.
Sie hatte ein altes Gesicht. Sie war alt. Aber ihres war das Gesicht, das er liebte. Zu dem er sprechen wollte und das zu ihm sprechen sollte, dessen warme braune Augen ihm das Herz wärmten, dessen Lachen ihn zum Lachen verführte, das er in die Hände nehmen und küssen mochte, das ihn rührte. Sie rührte ihn. Ihre Suche nach ihrem Platz im Leben, das Geheimnis, das sie um ihr Schreiben machte, ihr Traum vom späten Erfolg, ihr Leiden am Alkohol, ihre Freude an Kindern und Hunden – in alledem lag viel Unerfülltes, viel Unerfüllbares, das ihn rührte. War Rührung eine mindere Art der Liebe? Vielleicht, wenn sie alles war. Für ihn war sie nicht alles.
Wenn er vom Hocker aufstand, war er nicht versöhnt. Er hörte nie auf, es sich anders zu wünschen. Aber er war ruhig. So war es nun einmal. Er ging ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Sofa und las neu erschienene Bücher – wegen des nie versiegenden Stroms neuer Bücher war er Buchhändler geworden.
2
Aber als er an diesem Abend ins Schlafzimmer ging, um sich zu ihr zu setzen, lag sie nicht im Bett. Er ging in den Flur und die Treppe hoch zur Dienstbotenstube über der Küche. Sie war eng und niedrig, das Fenster war klein und ging auf den Hof, aber Birgit mochte die niedrige Enge, mochte die zwei Türen, die eine am unteren und die andere am oberen Ende der Treppe, und hatte die Stube zu ihrer Schreibstube gemacht. Er klopfte; Birgit wollte von ihm nicht gestört und erst recht nicht überrascht werden. Sie antwortete nicht, und er öffnete die Tür. Der Schreibtisch war aufgeräumt, links war ein Stapel Papier geschichtet, rechts lag der Füllhalter, den er ihr vor Jahren geschenkt hatte. Neben dem Fenster hing ein Zettel mit ihrer Handschrift. Er wusste, dass er ihn nicht lesen sollte. »Du hast …« Er las nicht weiter.
Er fand Birgit im Badezimmer. Sie lag in der Wanne, den Kopf unter der Wasseroberfläche, das dunkle Haar auf dem Wannenrand. Er hob ihren Kopf an, das Wasser war kalt, sie musste schon seit Stunden in der Wanne liegen. Er zog sie so weit heraus, dass er ihren Kopf auf den Wannenrand legen konnte. In einer modernen Wanne hätte sie nicht unter die Wasseroberfläche rutschen können. Warum hatten sie keine moderne Wanne! Sie hatten beide den Luxus der tiefen, langen Jugendstilwanne geschätzt, sie gerne gemeinsam benutzt und aufwendig restaurieren lassen.
Er stand und sah auf Birgit herab. Auf ihre Brüste, die linke ein bisschen größer als die rechte, auf ihren Bauch mit der Narbe, auf ihre ausgestreckten Arme und Beine, ihre Hände, die mit den Handrücken nach oben über dem Wannenboden zu schweben schienen. Er erinnerte sich an ihren oft geäußerten und nie verwirklichten Wunsch, sich die linke Brust verkleinern zu lassen, an seine Angst, als ihr Blinddarm entzündet war und entfernt wurde, an ihr Klavierspiel, das ihre langen Finger nicht hätten aufgeben sollen. Er sah auf sie herab und wusste, dass sie tot war. Aber dabei war ihm, als könne er ihr später erzählen, dass er sie tot in der Badewanne gefunden hatte, und mit ihr darüber reden. Als sei sie nur mal eben tot, nicht für lange, nicht für immer.
Er musste den Rettungsdienst anrufen. Aber da war nichts zu retten, es eilte nicht. Und er scheute die Unruhe, den mit Martinshorn und Blaulicht anfahrenden und vor dem Haus haltenden Rettungswagen, die Männer mit der Bahre, die Polizei, die Spuren sichern und ihn befragen würde, den neugierigen Hausmeister aus dem Souterrain. Er setzte sich auf den Wannenrand. Er war froh, dass Birgit die Augen geschlossen hatte. Wenn sie offen wären und Birgit ihn mit starrem, leerem Blick anschauen würde – ihm graute bei der Vorstellung. Sie wären offen, wenn Birgit vom Herzinfarkt oder Hirnschlag überrascht worden wäre. Nein, sie war eingeschlafen. Einfach so? Hatte sie nur zu viel getrunken? Oder hatte sie außerdem etwas genommen? Er stand auf, ging an den Medizinschrank, fand die Packung Valium nicht, die dort ihren Platz hatte, und klappte mit dem Fuß den Deckel des kleinen Abfalleimers auf. Da lagen die Packung und die geleerte Aluminiumfolie. Wie viele Tabletten mochte die Folie enthalten, wie viele mochte Birgit genommen haben? Wollte sie nur verlässlich einschlafen? Oder wollte sie nie mehr aufwachen? Er setzte sich wieder auf den Wannenrand. Was wolltest du, Birgit?
Seit Jahren wusste er von ihren Depressionen. Immer wieder hatte er versucht, sie zum Therapeuten oder zum Psychiater zu schicken; er hatte Freunde, die ihre Depressionen in Therapien besänftigt oder mit Tabletten blockiert hatten. Aber sie hatte nicht gewollt. Sie habe keine Depressionen, es gebe keine Depressionen. Es gebe melancholische Menschen, es habe sie immer gegeben, sie sei einer. Sie wolle sich nicht von Medikamenten in einen anderen Menschen verwandeln lassen. Dass jedermann ausgeglichen und zuversichtlich sein müsse, sei törichtes modernes Zeug. In der Tat war sie, auch wenn sie keine Depression hatte, nachdenklicher, ernsthafter, schwermütiger als andere. Nicht dass sie über eine lustige Begebenheit oder Bemerkung nicht hätte lachen können. Aber die spielerische Leichtigkeit, die ironische Überlegenheit, mit der im Freundes- und Kollegenkreis über Bücher und Filme, Gesellschaft und Politik geredet wurde, war ihr fremd, und erst recht fremd war ihr, dass Politiker und Künstler sich und das, was sie machten, selbst nicht ernst nahmen, sondern sich genügen ließen, dass es Aufmerksamkeit fand, staunende, lachende, befremdete Aufmerksamkeit, jedenfalls Aufmerksamkeit. Was ernst war, nahm sie ernst. Erst spät, nach der Wende, als er Buchhändler aus Ostberlin und Brandenburg näher kennenlernte, begriff er, dass Birgit darin ein Kind der DDR war, der proletarischen Welt, die mit preußischem sozialistischem Eifer bürgerlich werden wollte und Kultur und Politik ernst nahm, wie das Bürgertum es einst getan und inzwischen verlernt hatte. Er schaute seitdem mit neuen Augen auf sie, mit Achtung und auch mit Trauer über das, was seine Welt verlernt und verloren hatte.
Nein, ihre Melancholie hatte sie nicht in den Selbstmord getrieben. Sie und der Rotwein, noch ein Glas und noch eines, hatten sie müde gemacht. Dann wollte sie nicht warten, bis der Schlaf kam, sondern wollte ihn herbeizwingen. Und sie zwang ihn herbei, und er zwang sie nieder. Warum konntest du nicht warten, Birgit? Aber er wusste, dass sie ungeduldig war. Deshalb hielt sie sich nicht mit dem Ausziehen der Schuhe und dem Aufräumen der Einkäufe und dem Kochen und dem Abspülen und der Wäsche auf. Ein Tod aus Ungeduld.
Er lachte, Tränen im Hals. Er stand auf und rief den Rettungsdienst an. Dann rief er die Polizei an. Warum sollte er warten, bis der Rettungsdienst es täte. Er wollte alles hinter sich bringen.
3
Es dauerte zwei Stunden. Der Rettungsdienst kam und ging. Die Polizei, zwei Mann in Zivil und zwei in Uniform, sicherte den Tatort und suchte nach Spuren. Er beschrieb den Kriminalbeamten, wie er Birgit gefunden hatte, erklärte, warum er das Glas, aus dem sie getrunken hatte, abgespült hatte, zeigte ihnen die Packung und Alufolie im kleinen Abfalleimer und sah zu, wie sie vergebens nach einem Abschiedsbrief suchten. Sie ließen ein Beerdigungsunternehmen kommen, das Birgit in einen Leichensack packte und in die Gerichtsmedizin schaffte. Sie fragten ihn, wann er Birgit gefunden und was er am Nachmittag und Abend gemacht habe. Als er antwortete, er sei bis neun in der Buchhandlung gewesen, was Mitarbeiterinnen und Kunden bezeugen könnten, wurden sie freundlicher. Würde er am nächsten Tag bitte auf der Polizeidirektion vorbeischauen?
Er begleitete sie aus der Wohnung, machte die Tür zu und legte die Kette vor. Er wusste nicht, was er machen sollte. Er konnte nicht schlafen, nicht lesen, nicht Musik hören. Er hätte gerne geweint. Er ging in die Wäschekammer, trug die getrocknete Wäsche auf den Küchentisch und lud die gewaschene in den Trockner. Als er ein T-Shirt von Birgit in der Hand hielt, eines, das sie gemocht und oft getragen hatte, konnte er nicht mehr und ließ alles liegen.
Er stieg die Treppe zu Birgits Stube hoch, trat ein und setzte sich an den Schreibtisch. Jetzt las er zu Ende: »Du hast, was dir ein strenger Gott gegeben.« Von wem war das? Warum hatte Birgit es aufgeschrieben? Warum hatte sie es aufgehängt? Woran sollte es sie erinnern? Dann zog er den Stapel Papier zu sich. Es war ein Manuskript; den Namen der Verfasserin erkannte er als den Namen einer Frau, mit der Birgit in einer Schreibgruppe gewesen war. Aber er wollte nichts von irgendeiner Frau, er wollte etwas von Birgit lesen. Er zog die Schubladen des Schreibtischs auf, eine nach der anderen. In der oberen lagen leeres Papier, Stifte aller Art, Radiergummi und Bleistiftspitzer, Büroklammern und Kleberolle. In den beiden unteren fand er Mappen und darin maschinenschriftlich beschriebene Blätter, mal nur wenige Zeilen, mal lange Absätze, Zettel mit Birgits Handschrift, Briefe, Zeitungsausschnitte, Kopien, Fotografien, Broschüren. Die Mappen waren nicht beschriftet, und ihre Inhalte schienen nicht geordnet. Aber er kannte Birgit; das Durcheinander musste täuschen, die verschiedenen Mappen mussten für verschiedene Begriffe oder Aspekte oder Kapitel ihres Romans stehen, denen sich die Inhalte zuordneten. Aber er konnte sich nicht konzentrieren und die Ordnung nicht erkennen.
Zwischen den Mappen lag eine Postkarte. Sie zeigte das Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Liotard aus der Dresdener Gemäldegalerie. Er drehte die Postkarte um. Sie trug eine Briefmarke der DDR und keinen Absender. »Liebe Birgit, ich habe sie neulich gesehen, ein fröhliches Mädchen. Sie sieht Dir ähnlich. Deine Paula.« Er drehte die Postkarte wieder um und sah das Schokoladenmädchen genau an. Er konnte keine Ähnlichkeit entdecken. Achtsam, ja, achtsam konnte Birgit auch schauen, aber nicht mit dieser spitzen Nase und nicht mit diesem spitzen Mund. Und fröhlich, nein, fröhlich sah das Schokoladenmädchen eigentlich nicht aus.
Er dachte daran, dass in der Wohnung kein Bild von Birgit hing und dass auch keines auf seinem Schreibtisch in der Buchhandlung stand. Manche Freunde hatten in ihrer Wohnung über einer Kommode eine Galerie von Fotos in silbernen und schwarzen Rahmen hängen, Bilder von der Hochzeit, von Urlauben und Ausflügen, von den Eltern, von den Kindern. Birgit und er hatten keine Kinder. Und von ihrer Hochzeit 1969, deren sie sich, weil in den Augen ihrer Freunde ein überholtes Ritual, ein bisschen geschämt und von der sie kein Aufhebens gemacht hatten, gab es keine Bilder. Sie fotografierten nicht. Er nahm seinen Geldbeutel aus der Hosentasche und vergewisserte sich, dass Birgits Passbild, das er seit Jahren bei sich trug, noch neben dem Fahrzeug- und dem Führerschein steckte. Er würde es abfotografieren und vergrößern lassen.
Er fand in Birgits Schreibtisch nicht, wonach er suchte. In keiner Schublade lag ein Manuskript. In der unteren lag eine Flasche Wodka, und während er im Bücherregal an der Schmalseite der Stube vergebens weitersuchte, trank er. Als der Morgen graute, schlief er auf dem Boden ein. Vom Gesang der Vögel wachte er bald wieder auf. Für einen Augenblick wusste er nicht, wo er war. Für einen Augenblick erinnerte er auch nicht, was am Tag davor passiert war. Dann kam die Erinnerung; sie flutete zuerst den Kopf und dann den ganzen Körper. Endlich konnte er weinen.
4
Es vergingen Wochen, bis er wieder in Birgits Stube ging. Er konnte ihre Sachen nicht wegräumen, nicht die Mäntel und die Kleider aus den Schränken, nicht die Wäsche aus der Kommode, nicht die Haarbürste und die Flaschen und die Tiegel vom Schminktisch und aus dem Kosmetikschrank über dem Waschbecken, nicht die Zahnbürste aus dem Becher. Er öffnete nicht, worin ihre Sachen waren, auch nicht die Schreibstube. Dass, wie er es einmal in einem Film gesehen hatte, ein Mann sein Gesicht in den Kleidern der toten Frau bergen und ihren Geruch atmen konnte, war ihm unfasslich. Ihre Sachen sehen oder fühlen oder riechen – es war mehr, als er ertragen konnte. Er litt schon genug an der Umgebung, in die Birgit gehörte und in der sie fehlte. Er litt in der Wohnung und litt in der Buchhandlung und dachte daran, beides aufzugeben. Aber weil er auch litt, wenn er unterwegs war, konnte er nicht recht an einen neuen Anfang an einem neuen Ort glauben. Birgit würde ihn überallhin begleiten. Sie würde überall um ihn und nicht da sein.
Dann kam ein Brief von der Badischen Verlagsanstalt. Der Verlagsleiter Klaus Ettling stellte sich als Freund von Birgit vor, der seit langem mit ihr im Austausch gestanden und an ihrer Arbeit Anteil genommen habe. Er habe von ihr nicht viel gelesen, die wenigen Texte aber bewundert und mit ihr oft über weitere Texte und ihren Roman gesprochen. Er äußerte seine Trauer und sein Beileid. Und er fragte nach Birgits Manuskript, vollendet oder unvollendet. Unvollendete Bücher könnten wie unvollendete Symphonien vollendete Meisterschaft erkennen lassen und das Publikum beglücken.
Er kannte die Badische Verlagsanstalt. Ein kleiner Verlag mit gutem Programm und schönen Büchern, die er in der Buchhandlung gerne auslegte und verkaufte und bei denen er sich fragte, wie sie sich rechneten. Dem Verlagsleiter war er noch nie begegnet. Wie hatten Birgit und er einander kennengelernt?
Er sah Birgits Bild fragend an. Sie sah unbestimmt zurück; das Bild blieb auch in der Vergrößerung ein Passbild. Aber sie hatte das lockige dunkle Haar hochgesteckt, was er mochte, ihr Gesicht war voller als in den letzten Jahren, weiblicher, einladender, sie hatte die Mundwinkel zum Hauch eines Lächelns gehoben, und ihre braunen Augen hatten, vielleicht vom Blitzlicht geblendet, einen überraschten Ausdruck, keinen erschrockenen, sondern einen erfreuten, als begegne ihr gerade etwas Gutes. Was für Texte hast du ihm geschickt? Von welchen weiteren Texten hast du ihm erzählt?
Der Brief kam an einem Dienstag. Am Wochenende ging er in Birgits Stube, setzte sich an den Schreibtisch, nahm die Mappen aus den Schubladen, legte sie ordentlich aufeinander und schlug die oberste auf. Auf der ersten Seite stand in Birgits Handschrift: »Wie lernt sie, sie zu sein? Wenn sie nicht für sich sein kann, wenn sie nicht bei sich sein kann? Immer und überall Stimmen, Geflüster, Gestammel, Geschrei, Geheul, tags und nachts. Der Lärm, der Geruch, das Licht.« Nach einem Absatz ging es weiter: »Blendung. Aus dem warmen Dunkel ins grelle Licht. Geburt ist Blendung. Wenn die Kinder nicht brav waren, haben die Heime nachts das Licht angelassen. Oder angemacht und ausgemacht, angemacht und ausgemacht, an und aus, an und aus, an. Die Sonne blendet. Der Schnee blendet. Das Deckenlicht blendet. Die Taschenlampe blendet. Mit der Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, ob es schläft, mit der Taschenlampe aufs Geschlecht geleuchtet, ob es schreit. Das geblendete Gesicht. Das geblendete Geschlecht. Blendung bis zur Blindheit.« Es folgten Zeitungsausschnitte, Kopien und Broschüren über Waisenkinder in der DDR, über Adoptionen, Zwangsadoptionen, Familien- und Heimerziehung, Spezialheime, Werkhöfe, Erziehungs- und Arbeitslager und die Organisation und das Verfahren der Jugendhilfe.
Die nächste Mappe enthielt Material zu Verwahrlosung und Einzel- und Gruppengewalt von Jugendlichen, zu Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus, Skinhead- und Faschogruppen in der DDR und den neuen Ländern, wieder Zeitungsausschnitte, Kopien und Broschüren, außerdem Briefe an Journalisten und Forschungsstellen und deren Antworten. Wieder hatte Birgit mit der Hand ein paar Zeilen auf einen Zettel geschrieben: »Endlich / hauen, schlagen, stechen / frei. / Endlich / wie die Kerle saufen / gleich. / Endlich / Schweiß und Blut und Tränen / Brüder.« Eine weitere Mappe enthielt Fotografien von Straßen, Häusern, Gärten, Landschaften. Es waren Orte, die er nicht kannte und bei denen er auch nicht sah, was an ihnen wert war, fotografiert zu werden, und warum sie fotografiert worden waren; auf den Rückseiten war manchmal ein Datum aus den 1950er Jahren, aber sonst kein Hinweis vermerkt.
Er schlug eine weitere Mappe auf und fand Kopien von Artikeln der Sächsischen Zeitung aus dem Jahr 1964. Leo Weise bei der Einweihung des Abwasserpumpwerks, Leo Weise bei der Einweihung des Rinderoffenstalls der LPG, Leo Weise im VEB Waggonbau Niesky, Leo Weise bei der Begrüßung der Studentenbrigade. Leo Weise ist groß, hat ein offenes Gesicht und steht bei den offiziellen Anlässen entspannt unter den anderen, steifen Funktionären und Kadern. Bei der Begrüßung der Studentenbrigade lächelt er, und auch die Studenten und Studentinnen, die mit ihm auf dem Bild sind, lächeln. Eine unter ihnen ist Birgit. Sie trägt einen Arbeitskittel und ein Kopftuch, und der grobkörnige Druck und die verblasste Kopie nehmen ihrem Gesicht die Frische. Aber sie ist’s. Er fand einen Zettel, auf dem sie unter der Überschrift »Kaderentwicklung« Stationen von Leo Weises Karriere notiert hatte: ABF, FDJ-Instrukteur in Weißwasser, Jugendhochschule, 1. Sekretär der FDJ-Kreisleitung Görlitz, Zentralrat der FDJ, Parteihochschule, Diplomgesellschaftswissenschaftler, 2. Sekretär der SED-Kreisleitung Görlitz, 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Niesky.
Die letzte Mappe enthielt einen längeren maschinengeschriebenen Text, ohne Angabe einer Autorin oder eines Autors, wohl von Birgit. »In den 40 Jahren, in denen sie bestand, sperrte die DDR120000 Jugendliche in Heime. In normale Heime, Spezialheime, Sonderheime, Jugendwerkhöfe, Erziehungs- und Arbeitslager, Durchgangsheime. Bei der Aufnahme wurde der Leib visitiert, wurden die Körperöffnungen inspiziert, wurden die Haare geschoren. Zunächst wurde der Jugendliche in eine Einzelzelle mit Hocker, Pritsche und Eimer gesperrt. Danach kam er in eine Gemeinschaftszelle; wer renitent war, kam zu Brutalen, wer kulturell oder politisch aufbegehrte, zu Kriminellen, das Gewaltopfer zu Gewalttätern, das Opfer sexueller Gewalt zu Sexualtätern. Er kam dahin, wo er gebrochen wurde. Die anderen brachen ihn, weil er anders war, weil sie ihn brechen konnten, weil sie gebrochen waren. Machte er das Bett nicht richtig oder stellte er die Zahnbürste falsch in den Zahnputzbecher oder sagte er etwas, wenn er schweigen sollte, oder schwieg er, wenn er etwas sagen sollte, bestrafte die Leitung das Kollektiv und das Kollektiv ihn. Manche versuchten zu fliehen. Wenn das scheiterte, versuchten sie zu kämpfen. Wenn das scheiterte, erstarrten sie. Sie gefroren. Auch nach der Entlassung tauten sie nicht wieder auf; sie litten an Amnesie, Klaustrophobie, Agoraphobie, sie litten seelisch oder körperlich, sie wurden impotent oder frigide oder hatten Fehlgeburten, sie wurden Alkoholiker. So, wie Jugendliche in den Heimen der DDR erzogen, gebrochen wurden, war schon vor 1945 in deutschen Heimen erzogen, gebrochen worden, und wurde nach 1945 auch noch lange in …« So ging es weiter, zuerst allgemein, dann detailliert zu den verschiedenen Heimen und deren Behandlungs- und Misshandlungsweisen. Was immer der Text war, eine Abschrift oder das Ergebnis der Lektüre des Materials in der ersten Mappe, zum eigenen Gebrauch oder zur Veröffentlichung – es war nicht, was er suchte.
Er machte das kleine Fenster auf. Die Kastanie im Hof war noch kahl, aber in der Luft, die ins Zimmer zog, lag schon Frühling. Er hörte den Wechselgesang zweier Amseln, schaute nach ihnen aus, fand die eine, die nähere und lautere, auf dem Dachfirst des Hinterhauses und dahinter und leiser, auf der Spitze des Kirchturms, die andere. Er erinnerte sich, wie Birgit ihn vor Jahren eines Morgens weckte, weil die erste Amsel des neuen Jahres sang. Überhaupt hörte er die Amsel erst, seit Birgit ihn auf ihren Gesang zu achten gelehrt hatte.
Wie lange war es her, dass Birgit mit der Arbeit am Roman begonnen hatte? Eines Tages hörte sie auf, in der Buchhandlung zu arbeiten; aus der Auszeit wurde nach Monaten in einem Retreat in Indien der Abschied von der Buchhandlung. Birgit machte eine Ausbildung zur Goldschmiedin und eine zur Köchin, arbeitete im einen wie im anderen Beruf nur kurz, engagierte sich anschließend für den Schutz von Natur und Klima und organisierte Veranstaltungen, Aktionen, Demonstrationen. Davon erzählte sie gerne. Vom Roman erzählte sie nicht, nicht, warum sie ihn schreibe, nicht, wovon er handele, nur dass sie an ihm arbeite. Seit wann? Seit sechs, sieben oder sogar zehn Jahren? Was hast du gemacht, wenn du dich in deine Schreibstube zurückzogst? Im Kopf geschrieben? Auf Papier geschrieben und das Papier immer wieder zerknüllt und weggeworfen? Hast du aus dem Fenster gesehen und zugehört: den Amseln, den Spatzen, die im Sommer in der Kastanie lärmen, den Kindern, die im Hof spielen oder in den Nachbarwohnungen Klavier oder Geige üben, dem Regen, der in der Kastanie rauscht und auf das metallene Fenstersims schlägt? Hast du die Jahre verträumt?
In seiner Trauer, in der er Birgit immer und überall vermisste, als sei sie immer und überall um ihn gewesen, hatte er vergessen, wie oft und wie weit sie weg gewesen war.
5
Er wollte Birgit nicht bloßstellen und schrieb an den Verlagsleiter, er sei noch dabei, ihren Nachlass zu sichten und zu ordnen. »Sie fragen nach dem Manuskript von Birgits Roman. Bei der Sichtung und Ordnung würde mir helfen, wenn Sie mich, falls Sie es kennen, das Thema des Romans wissen ließen. Birgit war äußerst verschwiegen, wenn es um ihr Schreiben ging, und ich habe dies respektiert und sie weder nach ihrem Roman noch nach ihren anderen Texten gefragt. Jetzt, beim Umgang mit ihrem Nachlass, würde mir die Kenntnis ihrer Projekte helfen.«
Die Antwort kam rasch. Der Verlagsleiter schrieb, er und Birgit hätten sich vor fünf Jahren auf einer Yoga-Woche an der Ostsee kennengelernt. Er sei auf seinen Spaziergängen immer wieder an einer Düne vorbeigekommen, auf der sie gesessen und geschrieben habe, und schließlich habe er sich zu ihr gesetzt und sie gefragt, was sie schreibe. Sie habe ihm das Gedicht, an dem sie schrieb, ohne Zögern vorgelesen und auch die anderen Gedichte in ihrem Heft ohne Scheu gezeigt. Er erinnere sich an das Heft, den ledernen Umschlag und das lederne Band, das um das Heft geschlungen werden konnte. Sie habe ihm ihre Gedichte nie geschickt, obwohl er sie oft darum gebeten habe. Aber er habe sie in deutlicher Erinnerung, ihren auf eigentümliche, anrührende Weise zugleich kargen und lyrischen Ton, ihre verwirrenden Bilder, ihre manchmal erschreckenden Pointen. Sie habe gelacht, wenn er ihr sagte, er wolle ihre Gedichte in einem Band versammeln. Sie sei keine Gedichtedichterin. Sie sei eine Romandichterin. Wenn er sie nach dem Roman fragte, sagte sie, er handele vom Leben als Flucht. Von ihrem Leben als Flucht, von allem Leben als Flucht. Das habe ihn interessiert, und wenn Birgit und er, was ein- oder zweimal im Jahr passiert sei, ein langes Telefongespräch geführt hätten, habe er nach dem Roman gefragt und gehört, es gehe mit ihm voran. »Wenn Sie mir das Manuskript schicken, vollendet oder unvollendet, werde ich den Roman herausbringen. Und wenn Sie das Heft mit dem ledernen Umschlag und dem ledernen Band finden, werde ich mich freuen, endlich die Gedichte von Birgit Wettner in einem Band zu versammeln und zu veröffentlichen.«
Er hatte nie ein ledernes Heft gesehen, nicht gewusst, dass Birgit Gedichte geschrieben, nicht gewusst, dass sie mit dem Roman Fortschritte gemacht hatte. Er war gekränkt. Birgit hatte Gedichte geschrieben und einem Fremden ohne Zögern und ohne Scheu gezeigt – und ihm nicht? Sie hatte über ihr Schreiben mit einem Fremden gesprochen – und nicht mit ihm? Sie hatte über das Leben als Flucht, über ihr Leben als Flucht geschrieben – wo er ihr doch nicht nur zu fliehen, sondern auch anzukommen geholfen hatte?
Birgit fehlte ihm nicht weniger als davor. Ihre Gegenwart, ihr Körper, an den er sich nachts nicht schmiegen konnte, ihre Gesichter, das fröhliche, das ernste, das trotzige, das traurige, ihr Lachen, die Gespräche über Alltägliches oder eine Aktion, die sie plante, oder ein neues Buch, das er las, ihr Anblick, wenn sie im Bett lag und er auf dem Hocker saß. Aber in seine Liebe und Trauer stahl sich ein kleiner Groll.
Er brachte Birgits Computer zu dem Informatiker, der das Computersystem der Buchhandlung eingerichtet hatte und betreute. Könne er den dunklen Bildschirm zum Leuchten bringen? Der Informatiker schloss einen anderen Bildschirm an, auf ihm erschien die Frage nach dem Passwort. Kaspar kannte es nicht. Der Informatiker wollte wissen, wo und wann Kaspar und Birgit sich kennengelernt hatten, wo und wann Birgit geboren war, welchen Geburtsnamen sie und welche Vornamen ihre Eltern und Geschwister hatten, welche Daten und Orte und Namen noch für Birgit wichtig gewesen seien, welche Geheimnisse sie gehabt haben könnte. Berlin, 17. Mai 1964, Berlin, 6. April 1943, Hager, Eberhard und Irma, Gisela und Helga – ihm fiel noch der 16. Januar 1965 ein, der Tag, an dem Birgit in Berlin gelandet war, aber nichts davon führte zum Passwort, auch nicht sein Name, Kaspar Wettner, und auch nicht sein Geburtstag, 2. Juli 1944. Der Informatiker wusste nicht, wie er dem Computer beikommen sollte; er behielt ihn und versprach, sich etwas einfallen zu lassen.
Ja, am 16. Januar 1965 war Birgit in Tempelhof gelandet. In Berlin angekommen, bei ihm angekommen. Damals hatte ihr gemeinsames Leben begonnen, und ihm war gewesen, als hätte sein Leben eigentlich damals begonnen, sein erwachsenes Leben nach Kindheit und Jugend und gescheiterter Jugendliebe und verfehlter Studienwahl. Oder hatte es schon am 17. Mai 1964 begonnen?
6
Zwei Semester hatte Kaspar in seiner Heimatstadt studiert, zum Sommersemester 1964 wechselte er nach Berlin. Er floh seine Jugendliebe, die einen anderen gefunden hatte, er suchte die Aufregungen der Großstadt, er wollte an die von Studenten gegründete Universität, er hoffte, im Zentrum des Ost-West-Konflikts seien Leben und Studium spannender. Und er wollte Deutschland erleben, das ganze Deutschland, nicht nur den Westen, in dessen behäbigem, katholischem Rheinland er bisher gelebt hatte. Sein Vater war protestantischer Pfarrer; Kaspar war mit Luther und Bach und Zinzendorf aufgewachsen, und in den Ferien bei den Großeltern hatte er die vaterländischen Geschichtsbücher gelesen, in denen Deutschland seine Vollendung Preußen verdankte. Berlin, Ost wie West, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, alles Land östlich der Elbe war sein Deutschland ebenso wie das im Westen und Süden.
Er kam an einem Samstag mit dem Interzonenzug in Berlin an und bezog ein Zimmer in einer studentischen Wohngemeinschaft in Dahlem. Am nächsten Morgen stand er früh auf und lief zweieinhalb Stunden durch die sonntäglich stille Stadt bis zum Brandenburger Tor, um einen Blick über die Mauer zu tun. Dann fuhr er mit der S-Bahn zur Friedrichstraße, wurde von Grenzbeamten in grünen Uniformen kontrolliert, wechselte westdeutsches in ostdeutsches Geld, trat auf die Straße und schickte sich an, sich in ganz Berlin, in ganz Deutschland heimisch zu machen.
Er lief bis in den Abend. Er hatte keinen Plan und kein Ziel, er ließ sich treiben. Er stieg in eine U-Bahn und fand sich im Osten der Stadt, folgte der Karl-Marx-Allee von Osten nach Westen, von den Häusern der 1950er Jahre mit ihren Gliederungen, ihren Arkaden und ihrem Zierrat zu den glatten Plattenbauten der 1960er Jahre, sah den Alexanderplatz, den Dom und die Universität Unter den Linden, fand über die Museumsinsel zum Prenzlauer Berg, den breiten Straßen mit Kopfsteinpflaster, den einst prächtigen, jetzt schäbigen Bürgerhäusern, den gelegentlichen Parks. Die Stadt war im Osten grauer als im Westen, es gab mehr Baulücken, es gab weniger Verkehr, die Autos rochen anders. Aber auf seinem morgendlichen Weg zum Brandenburger Tor war er durch genug leere Straßen mit grauen Häusern gekommen, um die Unterschiede gering zu finden. Ohnehin war er nicht in den Osten gekommen, um Unterschiede, sondern um Gemeinsames zu finden. Auch die großen Plakate verbuchte er unter Gemeinsamem; im Osten kündigten sie das Pfingsttreffen der deutschen Jugend an, im Westen priesen sie Persil oder Zuban-Zigaretten oder Elbeo-Strümpfe.
Am Nachmittag belebte sich die Stadt. Aus dem kühlen, diesigen Morgen war über Mittag ein warmer, sonniger Frühlingstag geworden. Am Rand des Volksparks Friedrichshain fand er einen Stand, an dem es Bockwurst mit Kartoffelsalat und Limonade gab. Er setzte sich damit auf eine Betonbank an einen Betontisch und sah den Kindern beim Spielen und den Müttern beim Reden zu. Ein Mann grüßte, setzte sich gegenüber, wartete, bis Kaspar aufgegessen und ausgetrunken hatte, und fragte ihn, ob er ihn etwas fragen dürfe. Kaspar nickte und erfuhr, sein Gegenüber wolle den Kugelschreiber haben, der in der Tasche seines Hemds steckte. Er arbeite in einem Ministerium, schreibe wichtige Dokumente, und die heimischen Kugelschreiberminen schmierten.
Jetzt sah Kaspar den Mann genauer an. Mittleres Alter, dünne Haare, Verdruss und Eifer im Gesicht, beige Windbluse über beigem Hemd. Wie seltsam, ging Kaspar durch den Kopf, dass der Mann, um seinem Staat und seiner Klasse besser zu dienen, den Klassenfeind aus dem Feindstaat anbettelte. Sozialistischer Beamteneifer. Aber Beamtenseelen wie seine gab es auch im Westen. Kaspar, ausgezogen, Gemeinsames zu finden, fand es auch in seiner ersten Begegnung mit einem Bürger der DDR. Er lächelte sein Gegenüber an und gab ihm den Kugelschreiber.
Im Filmtheater am Friedrichshain sah er Schwarzer Samt, einen Kriminalfilm, dessen komplizierte Geschichte von Ost- und Westagenten und einem perfekten Baukran handelte, den die DDR entwickelt hatte und auf der Leipziger Messe präsentieren wollte und den die Westagenten zu zerstören suchten, um die DDR zu blamieren. Auch hier fand Kaspar Gemeinsames; der Ostagent war ein James Bond, nur biederer, einfach gekleidet, technisch bedürfnislos, kulinarisch anspruchslos, humorlos.
Schon am nächsten Tag fuhr er wieder nach Ostberlin, diesmal an die Humboldt Universität, und verlangte an der Pforte so beharrlich, den Dekan der Philosophischen Fakultät zu sprechen, dass ein Student geholt wurde, der ihn hinbrachte. Er studiere Germanistik und Geschichte – ob er für ein Semester als Student zugelassen werden könne? Der Dekan nannte eine Fülle von Gründen, aus denen das nicht gehe, von Immatrikulations- und Verwaltungsproblemen bis zum Status von Berlin und dem Fehlen friedlicher Koexistenz zwischen den beiden deutschen Staaten. Immerhin nahm der Student, der Kaspar abgeholt hatte, ihn mit in die Mensa, ehe er ihn wieder an der Pforte ablieferte. Er schwärmte von der Gegenwart als dem Beginn der Zukunft, die Marx und Engels vorausgesagt hatten, und belehrte Kaspar über Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit und das Ende der Ausbeutung und die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR. Kaspar versuchte vergebens, über Persönliches zu sprechen, über die Arbeitsbelastung im Studium, die beruflichen Perspektiven, die Reiseziele in den Ferien. Der andere blieb bei Marx, Engels und der DDR.
Kaspar war entmutigt. Wie sollte er sich in ganz Berlin, in ganz Deutschland heimisch machen? In den nächsten Wochen beschränkte er sich auf gelegentliche Besuche im Berliner Ensemble. In seinen Vorlesungen und Seminaren an der Freien Universität lernte er Studenten kennen, die wie er auf das Pfingsttreffen der deutschen Jugend als die Gelegenheit warteten, die Altersgenossen im Osten kennenzulernen. Es begann am 16. Mai.
7
Die Aufmärsche und Fahnenprozessionen auf dem Marx-Engels-Platz wurden Kaspar bald langweilig. Er lief herum. Er war zu schüchtern, eines der Mädchen oder einen der Jungen im blauen Hemd anzusprechen. Sie waren in Gruppen unterwegs, saßen auf den Plätzen und in den Parks, hörten und sahen Musik- und Theateraufführungen zu, tanzten. Viele waren in seinem Alter. Aber er hatte das Gefühl, in ihren Hemden und ihren Gruppen seien sie einander genug und würden ihn, wenn er sich zu ihnen gesellte, befremdet anschauen.
Immerhin überlegte er, wen er am ehesten ansprechen könnte. Manche scherten sich nicht darum, dass die blauen Hemden ihnen zu groß oder zu klein waren und schlecht saßen. Sie trugen sie wie eine ungeliebte Uniform. Andere trugen sie stolz und als hätten sie an ihrer Stelle am liebsten schon einen Waffenrock an. Manche Mädchen strafften die blauen Hemden über die Brüste, ließen die oberen Knöpfe auf und sahen verlockend und zugleich ganz anders aus, als die Mädchen im Westen verlockend aussahen. Ein paar hatten einen dünnen Pullover übergezogen oder ein buntes Tuch umgelegt, als wollten sie das blaue Hemd verbergen. Waren sie offen für eine Begegnung mit einem Studenten aus dem Westen?
Am ersten Abend kam er unzufrieden nach Hause, unzufrieden mit dem Tag, unzufrieden mit sich. Der nächste Tag musste anders werden. Er würde wieder rübergehen. Er würde seine Schüchternheit überwinden. Er würde jemanden ansprechen. Wenn er beim ersten Mal keinen Erfolg hätte, würde er es ein zweites und ein drittes Mal versuchen.
Auf dem Bebelplatz sah er Studenten, die er aus der Vorlesung kannte, im Gespräch mit Blauhemden und stellte sich dazu. West redete gegen Ost, Ost gegen West, ein routinierter, verbissener Schlagabtausch, dem Kaspar nur zuhörte, weil ein Mädchen im blauen Hemd zwar auch sagte, was die anderen sagten, aber mit Charme. Überdies sah sie mit ihrem offenen, lockigen braunen Haar, ihren braunen Augen, den starken Wangen und dem großen, geschwungenen Mund hinreißend aus. Zufällig sahen sie sich auf dem Alexanderplatz wieder, kamen ins Gespräch, fanden Gefallen aneinander und verbrachten den Rest des Treffens zusammen, schauten, hörten, redeten, lachten, tanzten zusammen und lernten zusammen andere Studenten und Studentinnen aus Ost und West kennen. Daraus entstand ein Freundeskreis, der sich immer wieder traf.
Wenn Kaspar erzählte, wie er Birgit kennen- und lieben lernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Als er sie auf dem Bebelplatz sah, lebhaft, strahlend, schlagfertig und, anders als die anderen, nicht ideologisch borniert, sondern voller Lust am Wortgefecht, war er überwältigt. Er fand keine Möglichkeit, sie anzusprechen, ging, warf sich vor, dass er keine Möglichkeit gefunden hatte, wäre am liebsten zurückgegangen, traute sich aber nicht. Ihr später auf dem Alexanderplatz wieder zu begegnen erlebte er als Geschenk des Himmels. Als gebe Gott, an den Kaspar nicht glaubte, dem ersten Blick, den er auf dem Bebelplatz auf Birgit gerichtet und der ihn überwältigt hatte, seinen Segen.
Kaspar war sonst nicht schnell. Er hatte sich nur langsam in seine Jugendliebe verliebt, die nicht zu ihm und zu der er nicht passte, hätte sich, wenn sie ihn nicht verlassen hätte, auch nur langsam von ihr gelöst, hatte sich nur langsam für seine Studienfächer entschieden und konnte sich beim Kauf eines neuen Kleidungsstücks oder einer Kaffeemaschine oder eines Fahrrads nur schwer entscheiden. Aber jetzt ging alles schnell. Als er und Birgit sich am Ende des Semesters verabschiedeten, er zu einem Volontariat in einem Verlag in seiner Heimatstadt und sie zum Einsatz mit einer Studentenbrigade im Ferienheim an der Ostsee, war klar, dass sie zusammenbleiben würden. Seinen Vorschlag, in die DDR auszuwandern, verwarf sie sofort. Also würde er sie aus der DDR in den Westen holen. Er wusste noch nicht, wie, aber er würde einen Weg finden.
Zu Beginn des Wintersemesters fand er Studenten, die Fluchthilfe leisteten und Leute kannten, die gefälschte Papiere verkauften. Er nahm Verbindung zu ihnen auf und wurde in ein Café in Neukölln bestellt. Sie fuhren in einem schwarzen Mercedes Coupé mit Weißwandreifen vor, wie Rosemarie Nitribitt es berühmt gemacht hatte, trugen Kamelhaarmäntel und an den Händen Ringe mit großen Klunkern. Am 15. Januar könne Birgit fliehen. Die Flucht gehe über Prag nach Wien. Birgit müsse einen Antrag auf eine Wochenendreise nach Prag stellen und Kaspar Passbilder und 5000 DM besorgen, die Passbilder sofort, das Geld bis Anfang Januar. Das Gespräch war kurz, der Handel wurde mit einem Handschlag bekräftigt.
Als Kaspar nach Hause kam, zitterte er, und ihm war, als habe er Fieber. Auf einmal war die Flucht nicht mehr eine Idee, sondern stand fest. Er war im Wort und in der Pflicht. Er musste Papiere über die Grenze bringen, die nicht bei ihm gefunden werden durften. Würden die Papiere gefunden, kämen Birgit und er ins Gefängnis. Birgit musste das Gefängnis auch noch fürchten, bis sie die Tschechoslowakei durchquert und Österreich erreicht hatte. Die Gefahren waren nicht mehr ein Phantom. Sie waren real. Kaspar hatte Angst.
Und er war völlig erschöpft. Er legte sich zitternd ins Bett, schlief ein und wachte nach zwei Stunden schweißnass auf. Erstaunt stellte er fest, dass die Angst vergangen war. Jahre später wachte er manchmal nachts mit pochendem Herzen auf, weil er eine Kontrolle, bei der er etwas zu verbergen, oder ein Verhör, bei dem er etwas zu verheimlichen suchte, geträumt hatte. In den Wochen bis zu Birgits Flucht kehrte die Angst nicht einmal im Traum wieder. Bei allem, was zu tun war, war Kaspar ganz ruhig.
8
Zugleich erlebte er alles mit größter Intensität. Am nächsten Tag fuhr er mittags nach Ostberlin, um die Passbilder zu besorgen. Birgit hatte kein Telefon, er konnte sie nicht anrufen und sich nicht anmelden, er konnte nur hoffen, sie zu Hause anzutreffen. Er war einmal bei ihr zu Hause gewesen, hatte Großmutter, Mutter und Schwestern begrüßt, Helga, die wie Birgit noch zu Hause wohnte, und Gisela, die gerade zu Besuch war, wurde auf Kaffee und Kuchen ins Wohnzimmer gebeten, saß dort auf dem Sofa, auf dem Birgit nachts schlief, wurde gemustert und war froh, als Birgit und er ins Theater aufbrachen. Er erinnerte sich an den Weg: aus der S-Bahn unter der S-Bahn durch, über eine große Straße in eine kleine, an einer Schule aus Backstein mit Bögen und Säulen um die Ecke, wo auch die Straßenbahn mit kreischenden Rädern um die Ecke fuhr, über die Straße und vorbei an einer kleinen Bäckerei. Er fand das Haus, klingelte, wartete vergebens auf das Summen, drückte gleichwohl gegen die Tür. Die Tür blieb zu.
Es war drei Uhr. Kaspar lief um den Block und sah, als er zurückkam, eine Frau, die sich im ersten Stock mit einem Kissen unter den Armen aus dem Fenster lehnte. Was sollte er sagen, wenn wieder niemand auf sein Klingeln reagieren und sie ihn fragen würde, zu wem er wolle? Sie würde ihm ansehen, dass er aus dem Westen kam. Seine Freunde und Freundinnen aus dem Osten hatten ihm einmal lachend aufgezählt, woran alles er als Westler erkennbar war, und ihn belehrt, was er anzuziehen hatte, als er nach Potsdam fuhr und Sanssouci besichtigte, was er als Westler nicht durfte. So hätte er sich wieder anziehen müssen. Was dachte die Frau, wenn ein Westler noch mal und noch mal an der Tür auftauchte? Was für eine war sie? Eine misstrauische? Eine gutmütige? Witterte sie eine Bedrohung durch den Klassenfeind? Dachte sie an Jugend und Liebe? Kaspar hätte gerne in ihrem Gesicht nach Misstrauen und Gutmütigkeit gesucht, hätte dafür aber näher an sie heran müssen, als ihm sicher erschien. Er drehte sich um, lief diesmal um zwei Blocks und beim nächsten Mal, als sie immer noch aus dem Fenster lehnte, um drei und fand sich an der Spree.
Der Dezembernebel lag tief und grau über der Stadt, dämpfte die Geräusche und trübte die Sicht. Aber für Kaspar war alles eigentümlich klar und nah, die Häuser, die Straßen, der Fluss. Als habe die Gefährlichkeit seines Vorhabens seinen Blick so geschärft, dass die Dinge eine härtere Gestalt annahmen. Und nicht nur sein Blick, alle seine Sinne waren geschärft. Die Säge in der Schreinerei klang so laut, der Abfall in der Tonne roch so streng, er spürte den leichten Wind auf seiner Wange so deutlich, als sei nichts mehr zwischen ihm und der Welt.
Er setzte sich ans Ufer und sah aufs Wasser. Birgit hatte ihm von den langweiligen Sonntagen ihrer Kindheit erzählt, den gehassten Spaziergängen entlang der Spree, bei Regen wie bei Sonne, den immer gleichen Ausblicken auf Wasser, Lastschiffe und Lagerhäuser und, wo die Häuser bis an die Spree reichten und der Spazierweg vom Ufer zur Straße wechselte, auf Häuser mit und ohne Vorgärten, bis die Köllnische Heide erreicht, hinein- und hinausgegangen und wieder zurückgekehrt wurde. Auch er erinnerte sich an Sonntage seiner Kindheit, an denen ihm langweilig war. An denen ihn nichts lockte und nichts hielt, kein Spiel und kein Buch, an denen er sich treiben ließ, bei der Schwester ins Zimmer schaute, in der Küche einen Apfel nahm, durch den Garten ging, sich ins Gras legte und bald wieder aufstand, den Ball an die Wand kickte und liegen ließ. Es waren schöne Erinnerungen an einen Zustand wohliger, dösiger Leere. Auch jetzt gab es für Kaspar nichts zu tun, nicht einmal etwas zu denken. Er hätte seinen Kopf leer machen und leer lassen und den Zustand wohlig und dösig genießen können. Aber er war erregt, gespannt, auf dem Sprung.
Dann fror ihn. Der Tag war mild, der Wind, der am Fluss wehte, lau. Aber der Boden war kalt. Er stand mit steifen Gliedern auf und ging zurück. Die Frau lehnte nicht mehr aus dem Fenster, aber das Fenster war offen, und als er wieder klingelte und wieder niemand aufmachte, hörte er von oben: »Zu wem wollen Sie, junger Mann?« Er sah nicht nach oben, machte mit Schultern und Händen eine Geste der Vergeblichkeit und des Bedauerns und ging.
Jetzt ging er selbst den Weg zur Köllnischen Heide und zurück, den Birgit beschrieben hatte. Es gab nichts zu sehen, und er verstand die Langeweile, unter der sie gelitten hatte. Langeweile kann nur allein genossen werden, nur wenn man sich von ihr treiben lassen kann, nicht an der Hand der Mutter oder einer großen Schwester, die einen hierhin und dorthin zerrt.
Dann wurde es dunkel. Als Kaspar wieder vor dem Haus stand, war das Fenster, aus dem sich die Frau gelehnt hatte, zu, und er sah die helle Lampe hinter dem dünnen Vorhang. Die Fenster, hinter denen er Birgits Wohnung vermutete, waren dunkel, und wieder wurde die Tür auf sein Klingeln nicht geöffnet. Er bekam Angst. Dafür, dass Birgit und Helga nicht zu Hause waren, gab es viele Gründe. Aber die Großmutter war schlecht zu Fuß, und wenn auch sie nicht zu Hause war, mochte das einen Unfall anzeigen, nach dem die Familie im Krankenhaus am Krankenbett ausharrte. Das konnte lange dauern. Er musste vor Mitternacht an der Friedrichstraße sein.
Er kaufte in der Bäckerei zwei Brötchen und steckte sie in die Manteltasche. Dann stand er unschlüssig auf dem Bürgersteig. Die Schule gegenüber lag im Dunkel. Er überquerte die Straße, fand im Eingang hinter einer Säule eine Nische, in die er sich stellen, in der er schlecht und recht auch auf dem Sockel der Säule sitzen und von der er den Eingang zum Haus im Auge behalten konnte. Er aß die beiden Brötchen.
Auf der Straße war wenig los. Selten fuhr ein Auto mit knatterndem Motor und stinkendem Auspuff vorbei. Alle zehn Minuten kam eine volle Straßenbahn aus der einen Richtung, zwei Minuten später eine fast leere aus der anderen. Auch im Abstand von zehn Minuten kamen Menschen bei der Schule um die Ecke; die S-Bahn brachte sie auf den Feierabend aus den Fabriken und Büros der Stadt. Kaspar sah sie im Licht der Straßenlaternen, im Mantel, mit Jacke, mit Schal, im Blaumann, mit Hut, mit Kopftuch, mit Aktentasche, die Arme schwingend oder die Hände in den Taschen vergraben, müden oder forschen oder ruhigen Schritts. Manche verschwanden in den Hauseingängen auf der anderen Straßenseite, und wenig später ging in einer Wohnung das Licht an. Je mehr es auf den Abend ging, desto weniger Menschen brachte die S-Bahn.
Noch nie hatte Kaspar vorbeigehende Menschen beobachtet. Natürlich war er schon wo gestanden oder gesessen, und Menschen waren vorbeigegangen, und er hatte sie gesehen. Aber dabei hatte er mit jemandem gesprochen oder ein Buch aufgeschlagen oder einem Gedanken nachgehangen. Jetzt machte er nichts anderes als die Menschen beobachten, und ihm wurde bewusst, wie viele Leben an ihm vorbeigingen, Leben, die ihre Arbeit und ihre Wohnung, ihre Familie oder ihre Einsamkeit, ihr Glück und ihre Sorgen hatten, die sich in ihre Welt geschickt hatten oder mit ihr haderten. Er hatte sein Leben gelebt, und die anderen Leben um ihn herum waren für ihn wie die Häuser und Straßen und Bäume, die ihn umgaben. Es sei denn, er hatte mit ihnen und sie mit ihm zu tun; dann hatte er ein Gefühl für sie und dafür, was sie für ihn waren. Jetzt hatte er erstmals ein Gefühl dafür, wie sie für sich waren, jedes einzelne Leben eine ganze Welt, vollständig, vollkommen. Ja, er liebte Birgit, und sie liebte ihn, sie wollte nicht, dass er zu ihr in den Osten kam, sondern wollte zu ihm in den Westen. Aber sie hatte ihr Leben, auch es war auf seine Weise vollständig und vollkommen, nur kannte er es nicht und wusste nicht, was an ihm gut und was an ihm schlecht war. Sie hatte ihn in ihr Leben geholt. Und doch fühlte er sich auf einmal als Eindringling und erschrak.
Dann war es still. Nur noch selten bog ein Fußgänger um die Ecke oder fuhr ein Auto vorbei, das Kaspar schon von weitem kommen hörte. Nicht weit von der Schule war eine Kirche, die Kaspar auf dem Weg von der S-Bahn gesehen hatte und von deren Glockenschlag er sich gerne durch die Stunden hätte begleiten lassen. Aber er wartete vergeblich; die Uhr war kaputt, oder der Glockenschlag einer kirchlichen Uhr war im Sozialismus nicht gelitten. Die Straßenbahn kam verlässlich, nicht mehr alle zehn, sondern alle zwanzig Minuten, zwei erleuchtete gläserne Gehäuse mit wenigen und manchmal ohne jeden Menschen. In den meisten Fenstern war das Licht bläulich geworden. Was die Menschen wohl sahen?
Kaspar trat hinter der Säule hervor und ging ein paar ziellose Schritte. Die Bewegung tat ihm gut. Aber ein zielstrebiger Passant musterte ihn mit argwöhnischem Blick und trieb ihn wieder in die Nische. Ihm ging durch den Sinn, wie oft er auf Zugfahrten, wenn das Ziel erreicht war, am liebsten sitzen bleiben würde, nicht weil ihn die Ferne lockte, sondern weil er sich im Zug zu Hause fühlte. Die Nische hinter der Säule, das Dunkel der Nacht, das sparsame Licht der seltenen Straßenlaternen, die wenigen Geräusche der Straße, das Kreischen der Räder der Straßenbahn – er mochte es. Wenn er nicht die Angst gehabt hätte, Birgit käme nicht rechtzeitig nach Hause und er schaffte es nicht rechtzeitig zur Friedrichstraße, hätte er sich in der Nische zu Haus fühlen können.