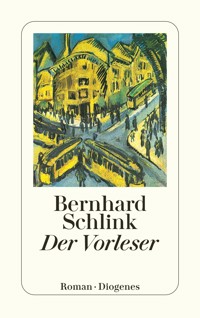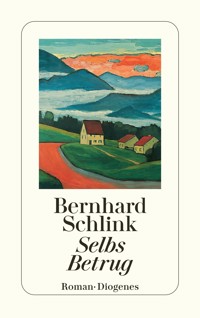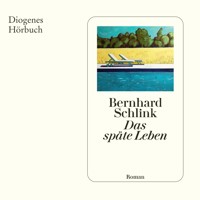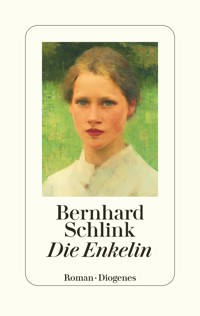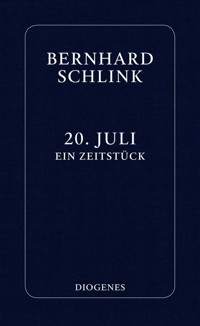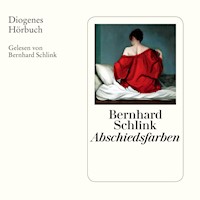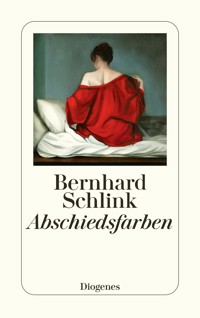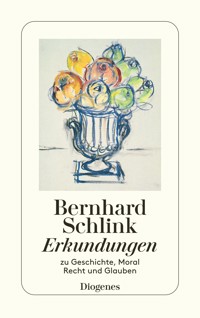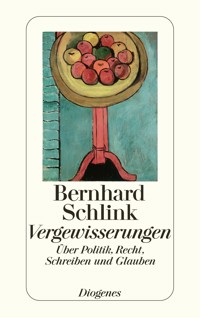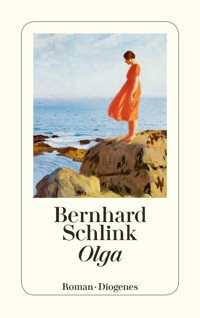
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Liebe zwischen einer Frau, die gegen die Vorurteile ihrer Zeit kämpft, und einem Mann, der sich mit afrikanischen und arktischen Eskapaden an die Träume seiner Zeit von Größe und Macht verliert. Erst im Scheitern wird er mit der Realität konfrontiert – wie viele seines Volks und seiner Zeit. Die Frau bleibt ihm ihr Leben lang verbunden, in Gedanken, Briefen und einem großen Aufbegehren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bernhard Schlink
Olga
Roman
Diogenes
Erster Teil
1
»Sie macht keine Mühe, am liebsten steht sie und schaut.«
Die Nachbarin, bei der die Mutter die Tochter abgab, mochte es erst nicht glauben. Aber so war es. Das Mädchen, ein Jahr alt, stand in der Küche und sah eines nach dem anderen an, den Tisch mit vier Stühlen, die Anrichte, den Herd mit Pfannen und Kellen, das Spülbecken, mit einem Spiegel darüber zugleich das Waschbecken, das Fenster, die Vorhänge, zuletzt die Lampe, die von der Decke hing. Dann machte es ein paar Schritte und stand in der offenen Tür zum Schlafzimmer und sah auch hier alles an, das Bett, den Nachttisch, den Schrank, die Kommode, das Fenster und die Vorhänge, zuletzt wieder die Lampe. Es schaute interessiert, obwohl die Wohnung der Nachbarin nicht anders geschnitten und kaum anders möbliert war als die der Eltern. Als die Nachbarin dachte, nun habe das kleine, stumme Mädchen alles gesehen, was es in der Zweizimmerwohnung – das Klo war im Treppenhaus – zu sehen gab, half sie ihm auf einen Stuhl am Fenster.
Das Viertel war arm, und hinter jedem der hohen Häuser kamen ein enger Hof und noch ein Haus. Die schmale Straße war voll mit den vielen Menschen aus den vielen Häusern, der Straßenbahn, Karren, aus denen Kartoffeln und Gemüse und Früchte verkauft wurden, Männern und Frauen, die aus Bauchläden Tand und Zigaretten und Zündhölzer verkauften, Jungen, die Zeitungen verkauften, Frauen, die sich verkauften. An den Ecken standen Männer und warteten auf eine Gelegenheit, irgendeine Gelegenheit. Alle zehn Minuten zogen zwei Pferde einen Wagen über die Schienen, und das kleine Mädchen klatschte in die Hände.
Auch als es älter wurde, wollte das Mädchen stehen und schauen. Nicht dass es sich mit dem Gehen schwergetan hätte, es ging gewandt und sicher. Es wollte beobachten und verstehen, was um es herum geschah. Seine Eltern redeten kaum miteinander und kaum mit ihm. Dass das Mädchen Worte und Begriffe hatte, verdankte es der Nachbarin. Sie sprach gerne und viel, konnte nach einem Sturz nicht mehr arbeiten und sprang oft für die Mutter ein. Wenn sie mit dem Mädchen das Haus verließ, konnte sie nur langsam gehen und musste immer wieder stehen bleiben. Aber sie redete über alles, was es zu sehen gab, erklärte und beurteilte und belehrte, und das Mädchen konnte nicht genug hören, und das langsame Gehen und viele Stehenbleiben war ihm recht.
Die Nachbarin fand, das Mädchen solle mehr mit anderen Kindern spielen. Aber in den dunklen Höfen und Hausfluren ging es rauh zu, wer sich behaupten wollte, musste kämpfen, und wer nicht kämpfte, wurde drangsaliert. Die Spiele der Kinder waren eher eine Vorbereitung auf den Daseinskampf als ein Vergnügen. Das Mädchen war nicht ängstlich oder schwächlich. Es mochte die Spiele nicht.
Es lernte lesen und schreiben, noch ehe es in die Schule kam. Die Nachbarin wollte es ihm zunächst nicht beibringen, damit es sich in der Schule nicht langweile. Aber dann tat sie es doch, und das Mädchen las, was es bei ihr fand, Grimms Märchen, Hoffmanns 150 moralische Erzählungen, die Schicksale der Puppe Wunderhold und Struwwelpeter. Lange las es im Stehen, an die Anrichte oder an die Fensterbank gelehnt.
Gelangweilt hätte das Mädchen sich in der Schule auch, wenn es noch nicht hätte lesen und schreiben können. Der Lehrer bleute den vierzig Schülerinnen Buchstaben um Buchstaben mit dem Stock ein, und das Vor- und Nachsprechen, Vor- und Nachschreiben war öde. Aber das Mädchen lernte begierig rechnen, damit es beim Einkaufen den Händler kontrollieren konnte, es sang gerne, und im Heimatkundeunterricht unternahm der Lehrer Ausflüge mit der Klasse, und das Mädchen lernte Breslau kennen, die Stadt und die Umgebung.
2
Es lernte, dass es in Armut aufwuchs. Dass die Schule, ein neuer Bau aus rotem Backstein mit gelben Sandsteinsimsen und -pilastern, schöner war als die anderen Häuser im Viertel, bedeutete noch nicht, dass die anderen Häuser schäbig waren. Die Schule war die Schule. Aber als das Mädchen die stattlichen Wohnhäuser an den breiten Straßen, die Villen mit Gärten, die prächtigen öffentlichen Bauten und großzügigen Plätze und Anlagen sah und an den Ufern und auf den Brücken freier atmete, begriff es, dass in seinem Viertel die Armen lebten und dass es eine von ihnen war.
Sein Vater war Schauermann, und wenn es im Hafen keine Arbeit gab, saß er zu Hause. Seine Mutter war Wäscherin, holte bei besseren Leuten Wäsche ab, trug sie in einem Bündel auf dem Kopf nach Hause und brachte sie gewaschen und gebügelt und in ein Laken gehüllt auf dem Kopf wieder zurück. Sie hatte tagein, tagaus Arbeit, aber die Arbeit brachte nicht viel ein.
Als der Vater beim Kohleumschlag tagelang nicht zum Schlafen und aus den Kleidern kam, wurde er krank. Kopfschmerz, Schwindel, Fieber – die Mutter kühlte ihm mit nassem Tuch die Stirn und die Waden. Als sie über den rötlichen Hautausschlag an Bauch und Schultern erschrak und den Arzt holte, war auch ihr schwindlig und fiebrig, und der Arzt diagnostizierte Fleckfieber und ließ beide ins Krankenhaus bringen. Der Abschied vom Mädchen war kurz.
Es sah seine Eltern nicht wieder. Es sollte sich nicht anstecken und durfte sie nicht im Krankenhaus besuchen. Von der Nachbarin, die es zu sich genommen hatte, hörte es, die Eltern würden schon wieder werden, bis nach einer Woche der Vater starb und nach zehn Tagen die Mutter. Es wäre gerne bei der Nachbarin geblieben, und die Nachbarin hätte es gerne behalten. Aber die Mutter des Vaters entschloss sich, das Mädchen zu sich nach Pommern zu nehmen.
Schon während der Tage, an denen die Großmutter sich um die Beerdigung kümmerte, den Haushalt auflöste und das Mädchen von der Schule abmeldete, lief es zwischen den beiden nicht gut. Die Großmutter war mit der Heirat ihres Sohnes nicht einverstanden gewesen. Sie hielt sich etwas auf ihr Deutschtum zugute und lehnte Olga Nowak, auch wenn sie fließend Deutsch sprach, als Frau für ihren Sohn ab. Sie war auch nicht damit einverstanden gewesen, dass die Eltern dem Mädchen den Namen der Mutter gegeben hatten. Einmal unter ihrer Obhut, sollte das Mädchen statt des slawischen einen deutschen Namen bekommen.
Aber Olga ließ sich ihren Namen nicht nehmen. Als die Großmutter die Nachteile eines slawischen und die Vorzüge eines deutschen Namens zu erklären versuchte, sah Olga sie verständnislos an. Als die Großmutter ihr die deutschen Namen anbot, die sie gut fand, von Edeltraud bis Hildegard, weigerte sie sich, sich für einen zu entscheiden. Als die Großmutter erklärte, jetzt sei Schluss und sie heiße Helga, fast wie Olga, verschränkte sie die Arme, redete nicht mehr und reagierte nicht auf die Ansprache mit Helga. So ging es auf der Bahnfahrt von Breslau nach Pommern und in den ersten Tagen nach der Ankunft. Dann gab die Großmutter nach. Aber Olga war für sie von da an ein trotziges, ungezogenes, undankbares Mädchen.
Alles war Olga fremd: nach der großen Stadt das kleine Dorf und das weite Land, nach der Mädchenschule mit vielen Klassen die Schule für Jungen und Mädchen in einem Raum, nach den lebhaften Schlesiern die ruhigen Pommern, nach der herzlichen Nachbarin die abweisende Großmutter, nach der Freiheit zu lesen die Arbeit auf dem Feld und im Garten. Sie fügte sich, wie arme Kinder es von früh an tun. Aber sie wollte mehr als die anderen Kinder, mehr lernen, mehr wissen, mehr können. Ihre Großmutter hatte keine Bücher und kein Klavier, und Olga ließ dem Lehrer keine Ruhe, bis er ihr Bücher aus seiner Bibliothek gab, und dem Organisten, bis er ihr die Orgel erklärte und an ihr zu üben erlaubte. Als sie im Konfirmandenunterricht war und der Pfarrer abfällig über das Leben-Jesu-Buch von David Friedrich Strauß sprach, brachte sie ihn dazu, es ihr zu leihen.
Sie war einsam. Auf dem Dorf wurde weniger gespielt als in der Stadt, die Kinder mussten arbeiten. Wurde gespielt, ging es nicht weniger rauh zu, und Olga war geschickt genug, sich zu behaupten. Aber sie gehörte nicht wirklich dazu. Sie sehnte sich nach anderen, die ebenfalls nicht dazugehörten. Bis sie einen fand. Auch er war anders. Von Anfang an.
3
Kaum konnte er stehen, wollte er auch schon laufen. Weil es ihm nicht schnell genug ging, wenn er Schritt vor Schritt tat, hob er den einen Fuß an, ehe er den anderen abgesetzt hatte, und fiel hin. Er stand auf, machte einen Schritt und noch einen, fand sich wieder zu langsam, brach wieder mit dem einen Fuß auf, ehe er mit dem anderen angekommen war, und fiel wieder hin. Aufstehen, hinfallen, aufstehen – er machte ungeduldig und unverdrossen weiter. Er will nicht gehen, er will rennen, dachte seine Mutter, die ihm zusah, und schüttelte den Kopf.
Als er gelernt hatte, dass der eine Fuß den Boden erst verlassen darf, wenn der andere ihn erreicht hat, mochte er gleichwohl nicht gehen. Er trippelte mit flinken kleinen Tritten, und wenn die Eltern ihm das Geschirr anlegten und ihn an der Leine führten, wie es damals gerade Mode wurde, waren sie belustigt, weil der kleine Knabe auf dem Spaziergang zuckelte wie ein kleines Pony. Zugleich waren sie ein bisschen betreten; die anderen Kinder liefen besser im Geschirr.
Mit drei Jahren rannte er. Er rannte durch das weitläufige Haus mit den drei Geschossen und zwei Dachböden, die langen Gänge entlang, die Treppen rauf und runter, durch die Zimmer, die sich ineinander öffneten, über die Terrasse in den Park und zu den Feldern und zum Wald. Als er in die Schule kam, rannte er in die Schule. Nicht dass er beim Aufstehen gesäumt oder beim Zähneputzen getrödelt hätte und anders zu spät gekommen wäre. Er wollte einfach lieber rennen als gehen.
Anfangs rannten die anderen Kinder mit. Sein Vater war der reichste Mann im Dorf, gab auf seinem Gut vielen Familien Lohn und Brot, schlichtete Streitigkeiten, kümmerte sich um die Kirche und die Schule und sorgte dafür, dass die Männer richtig wählten. Das ließ die anderen Kinder zum Sohn aufschauen und ihm nacheifern, bis der Respekt, den der Lehrer ihm erwies, und die Unterschiede in Manieren, Sprache und Kleidung ihn den anderen entfremdeten. Vielleicht wären sie gerne sein Gefolge geworden, wenn er gerne ihr Anführer gewesen wäre. Aber daran hatte er kein Interesse, nicht aus Dünkel, sondern aus Eigensinn. Die anderen sollten ihre Spiele spielen, er spielte seine. Er brauchte die anderen nicht. Er brauchte sie zumal nicht zum Rennen.
Als er sieben war, schenkten ihm die Eltern einen Hund. Weil sie England bewunderten und Victoria, die Witwe des Kaisers Friedrich, verehrten, wählten sie einen Border Collie, einen englischen Hütehund, der den rennenden Sohn begleiten und beschützen sollte. Das tat er auch, immer vorneweg, mit häufigem Blick zurück und gutem Gespür dafür, wohin der Sohn wollte.
Sie rannten auf Feldwegen und Ackerrainen, Holzwegen und Waldschneisen, oft auch querwald- und -feldein. Der Sohn liebte das freie Feld und den lichten Wald, aber wenn das Korn hoch stand, rannte er durch die Ähren, die er an den nackten Armen und Beinen spüren wollte, und er rannte durch das Unterholz, damit es ihn kratzte und zauste und er sich losreißen konnte, wenn es ihn festhalten wollte. Als Biber einen Damm gebaut und den Bach zum Tümpel gestaut hatten, rannte er durch den Tümpel. Nichts sollte ihn aufhalten, nichts.
Er wusste, wann der Zug in den Bahnhof einfuhr und wann er ihn verließ, rannte zum Bahnhof und mit dem Zug los und neben ihm her, bis der letzte Wagen ihn überholt hatte. Je älter er wurde, desto länger konnte er mit dem Zug mithalten. Aber darum ging es ihm nicht. Der Zug nahm ihn mit zu dem Punkt, an dem das Herz nicht schneller schlagen und der Atem nicht schneller gehen konnte. Er konnte den Punkt auch alleine erreichen, fand aber schöner, vom Zug mitgenommen zu werden.
Er hörte das Keuchen seines Atems und spürte das Pochen seines Herzens. Er hörte seine Füße auf den Boden schlagen, gleichmäßig, sicher, leicht, und in jedem Aufschlagen lag schon das Abheben, und in jedem Abheben ein Schweben. Manchmal war ihm, als flöge er.
4
Seine Eltern hatten ihn Herbert getauft, weil der Vater mit Leib und Seele Soldat gewesen war, nach der Schlacht bei Gravelotte das Eiserne Kreuz bekommen hatte und sich seinen Sohn als einen Herbert wünschte, einen strahlenden Krieger. Er erklärte dem Sohn die Bedeutung des Namens, und Herbert war stolz auf ihn.
Er war auch auf Deutschland stolz, das junge Reich und den jungen Kaiser, auf seinen Vater, seine Mutter, seine Schwester und auf das Gut der Familie, den ansehnlichen Besitz, das stattliche Haus. Nur die Asymmetrie der Vorderseite bekümmerte ihn. Die Eingangstür war nach rechts verrutscht und hatte unter fünf symmetrisch plazierten Fenstern in den oberen Geschossen und im Dach drei Fenster zur linken und eines zur rechten Seite. Niemand hatte eine Erklärung für die Störung des Gleichmaßes; das Haus war schon mehr als zweihundert Jahre alt und erst seit einer Generation im Besitz der Familie.
Als der Großvater das Gut von einem verarmten Adligen gekauft hatte, hatte er gehofft, er werde eines Tages geadelt werden und wenn nicht er, dann doch der Vater, der Held von Gravelotte. Auch der Vater hoffte auf den Adelstitel zum Rittergut und Eisernen Kreuz. Aber es blieb bei Schröder, woran Herbert später mit Bindestrich den Namen des Guts hängte, weil er nicht ein Schröder unter vielen sein wollte.
Trotz ihrer Träume von Höherem waren Großvater und Vater nüchtern und tüchtig. Sie brachten das Gut hoch, bauten eine Zuckerfabrik und eine Brauerei und hatten genug Geld, mit Aktien zu spekulieren. Der Familie fehlte es an nichts, und den Geschwistern Herbert und Viktoria wurde jeder Wunsch erfüllt, wenn er denn vernünftig war, nicht der nach Urlaub von Schule und Kirche, aber der nach einer Reise nach Berlin, nicht der nach Romanen, aber der nach vaterländischen Geschichtsbüchern, nicht der nach einer englischen Modelleisenbahn mit dampfbetriebener Lokomotive, aber der nach einem Boot und einem Gewehr. Nachdem sie vier Jahre lang mit den Kindern des Dorfs die Volksschule besucht hatten, bekamen die Geschwister Hausunterricht; sie hatten einen Lehrer für Mathematik und Natur und eine Lehrerin für Kultur und Sprachen. Herbert lernte Geige und Viktoria Klavier und Gesang. Überdies half Herbert auf dem Gut, damit er später wüsste, was er vom Verwalter und von den Knechten und Mägden erwarten konnte.
Als für Herbert der Konfirmandenunterricht anstand, ging Viktoria, obwohl ein Jahr jünger und an sich noch zu jung, mit. Die Eltern wollten die Geschwister wie die Volksschule auch den Konfirmandenunterricht mit den Kindern des Dorfs teilen lassen, aber Viktoria deren Derbheit nicht ohne den Schutz des großen Bruders aussetzen. Nicht dass Viktoria vor den anderen Kindern Angst gehabt hätte. Beide Geschwister waren von der hochmütigen Furchtlosigkeit derer, die in ihrem Leben kein Leid zu erdulden noch zu befürchten haben. Aber Viktoria konnte es nicht schaden, die Grazie der schwachen Frau zu lernen, und Herbert nicht, die Ritterlichkeit des starken Mannes zu üben. Beide fanden an ihren Rollen Gefallen. Herbert versuchte manchmal, die anderen Kinder zu Grobheiten zu provozieren, um Viktoria beschützen zu können. Aber die anderen Kinder ließen sich nicht provozieren. Sie wollten mit den beiden nichts zu tun haben.
Bis auf Olga. Herbert und Viktoria fanden die Neugier und Bewunderung, mit der Olga sich für ihre Welt interessierte, unwiderstehlich. Dass sie so schnell mit ihr Freund wurden, zeigte, wie einsam sie gewesen waren, obgleich sie es nicht gewusst hatten.
5
Eine Fotografie zeigt die drei im Garten. Viktoria sitzt auf einer Schaukel, trägt ein bauschiges Kleid und ein Hütchen mit Krempe und Blumen, hat einen Sonnenschirm aufgespannt, kreuzt die Füße und neigt den Kopf zur Seite. Zu ihrer Linken stützt sich in kurzen Hosen und weißem Hemd Herbert auf die Schaukel, zu ihrer Rechten in dunklem Kleid mit weißem Kragen Olga. Die beiden sehen einander an, als verabredeten sie, gleich gemeinsam die Schaukel anzustoßen. Alle drei schauen ernst und eifrig. Stellen sie eine Szene aus einem Buch nach? Huldigen Herbert und Olga Viktoria? Weil sie die Jüngste ist? Weil sie den großen Bruder und die ältere Freundin zu dominieren versteht? Was immer sie wollen – sie wollen es mit ernstem Eifer.
Die drei Kinder sehen wie achtzehn aus, obwohl auf der Rückseite vermerkt ist, das Bild sei einen Tag vor der Konfirmation aufgenommen worden. Die Mädchen sind beide blond, Viktorias offene Locken quellen unter dem Hütchen hervor, Olgas glattes Haar ist am Hinterkopf zu einem Dutt gerafft. Viktoria hat einen schmollenden Zug um den Mund, der verrät, dass sie, wenn mit der Welt nicht im Frieden, verdrießlich werden kann. Olga hat zu ihrem festen Kinn starke Wangenknochen und eine breite, hohe Stirn, ein kraftvolles Gesicht, an dem der Blick sich desto mehr freut, je länger er auf ihm verweilt. Beide schauen gewichtig, bereit zu heiraten, Kinder zu kriegen und ein Haus zu führen. Sie sind junge Frauen. Herbert will ein junger Mann sein, ist aber noch ein Bub, klein, stämmig, kräftig, der die Brust hebt und den Kopf reckt und die beiden Mädchen doch nicht überragt und auch nie überragen wird.
Auch auf späteren Fotografien wirft Herbert sich gerne in Pose; er tut es dem jungen Kaiser nach. Viktoria wird bald füllig; das Essen versöhnt sie mit der Welt, die Fettpolster tilgen das Verdrießliche und geben ihr überdies einen kindlich-sinnlichen Charme. Von Olga sind über lange Zeit keine weiteren Bilder erhalten; nur Herberts und Viktorias Eltern konnten sich einen Fotografen leisten, und Olga wäre auch auf die eine Fotografie nicht geraten, wenn sie nicht gerade da gewesen wäre.
Im Jahr nach der Konfirmation begann Viktoria zu betteln, nach Königsberg aufs Mädchenpensionat geschickt zu werden. Bei einer Abendgesellschaft auf einem benachbarten Rittergut hatte ihr die Tochter vom Leben im Pensionat erzählt, als sei es ein Leben des Luxus und der Eleganz und als verbiete sich für ein Mädchen, das auf sich halte, unter Bauern aufzuwachsen. Zuerst wollten die Eltern nicht, aber Viktoria war starrsinnig. Starrsinnig hielt sie, nachdem sie sich durchgesetzt hatte, auch daran fest, das bescheidene Leben im Pensionat sei das vornehme Leben schlechthin.
Olga wollte auf das staatliche Lehrerinnenseminar in Posen. Dafür musste sie in einer Aufnahmeprüfung die Kenntnisse der oberen Klasse der Höheren Mädchenschule nachweisen. Sie hätte gerne jeden Morgen die sieben Kilometer zur Höheren Mädchenschule in die Kreisstadt bewältigt und jeden Abend die sieben Kilometer zurück. Aber sie hatte weder das Geld für die Schule noch einen Fürsprecher, der für sie um Befreiung vom Schulgeld geworben hätte; der Lehrer und der Pfarrer im Dorf fanden höhere Schulbildung für Mädchen überflüssig. So beschloss sie, sich die Kenntnisse der oberen Klasse selbständig anzueignen.
Als sie in der Höheren Mädchenschule in Erfahrung bringen wollte, was man am Ende der oberen Klasse wissen müsse, war sie vom großen Gebäude, den breiten Treppen, langen Fluren und vielen Türen, der Leichtigkeit, mit der sich die Mädchen in der Pause zwischen dem einen und anderen Klingeln lachend und schwatzend auf dem Flur tummelten, und der Sicherheit, mit der die Lehrerinnen erhobenen Haupts in die Klassenzimmer gingen und aus ihnen kamen, so eingeschüchtert, dass sie aus der Ecke bei der Treppe, aus der sie beobachtete, nicht herausfand. Bis sie einer Lehrerin auffiel, für die der Unterricht zu Ende war. Sie hörte sich an, was Olga, den Tränen nahe, als Anliegen vortrug, nahm sie am Arm, führte sie aus der Schule und brachte sie zu sich nach Hause.
»Religion, Deutsch, Geschichte, Rechnen, Erd- und Naturkunde, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang, Handarbeit – schaffst du das?«
Den Katechismus hatte Olga im Konfirmandenunterricht gelernt, sie hatte Schillers Dramen, Freytags Romane und Saegerts Vaterländische Geschichte der Preußen gelesen und kannte Gedichte von Goethe und Mörike, Heine und Fontane und viele Lieder aus Erks Deutschem Liedergarten auswendig. Die Lehrerin ließ Olga ein Gedicht aufsagen, ein Lied vorsingen und Rechenaufgaben im Kopf lösen. Sie inspizierte das Handtäschchen, das Olga gehäkelt hatte, und hatte danach keinen Zweifel an Olgas Handarbeits- und auch Zeichen- und Schönschreibfähigkeiten. Schwachstellen waren Erdkunde und Naturkunde; Olga kannte viele Bäume, Blumen und Pilze, hatte aber noch nie von den Stammbäumen der Pflanzen und Tiere und Carl von Linné und Alexander von Humboldt gehört.
Die Lehrerin fand Gefallen an Olga und gab ihr ein Lehrbuch der allgemeinen Erdkunde und eines für Haushaltungs- und Naturkunde mit. Wenn sie wieder Rat brauche, könne sie wiederkommen. »Und lies mir die Bibel und den Faust!«
Herbert wusste, dass er mit achtzehn ins Garderegiment zu Fuß eintreten würde. Bis dahin musste er das Abitur machen. Gutwillig ließ er sich vom Hauslehrer und der Hauslehrerin darauf vorbereiten. Aber seine Leidenschaft gehörte dem Schießen und der Jagd, dem Reiten, Rudern und Rennen. Er wusste, dass er eines Tages das Gut mit Zuckerfabrik und Brauerei übernehmen sollte und dass der Vater recht daran tat, ihn in den Betrieb und die Geschäfte einzuführen. Aber er sah sich nicht als Guts- und Fabrikherr. Er sah das weite Land und den weiten Himmel. Wenn er rannte, kehrte er nicht um, weil er erschöpft war, sondern weil es dunkel wurde und die Mutter sich keine Sorgen machen sollte. Er träumte davon, mit der Sonne zu rennen, durch einen Tag, der nicht endet.
6
Nach Viktorias Weggang brauchten Olga und Herbert eine Weile, bis sie zu zweit eine neue Vertrautheit fanden. Es war etwas anderes, ihn zu besuchen als Viktoria und ihn; Olga bemerkte die argwöhnischen Blicke der Eltern und ließ die Besuche. Herbert hasste das wissende Lächeln, mit dem die Leute aus dem Dorf ihn und Olga anschauten, wenn sie ihnen begegneten, und vermied die Spaziergänge und Ruderpartien, die sie zu dritt unbefangen unternommen hatten.
Weil die Großmutter, wie der Lehrer und der Pfarrer, höhere Bildung für Olga überflüssig fand und ihr, die sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten wollte, zu Hause keine Ruhe ließ, auch wenn sie ihre Hilfe nicht brauchte, flüchtete Olga im Sommer mit ihren Büchern an eine einsame Stelle am Waldrand. Dort besuchte Herbert sie. Er brachte seinen Hund mit und manchmal sein Gewehr, und er zeigte Olga einen Jagdsitz, auf dem sie bei Regen lernen konnte. Oft hatte er für sie eine kleine Gabe dabei: eine Frucht, ein Stück Kuchen, eine Flasche Most.
Meistens war er, wenn er kam, gerannt, legte sich außer Atem neben sie ins Gras und wartete, bis sie ihre Arbeit unterbrach. Dann war seine erste Frage: »Was weißt du, was du heute Morgen noch nicht wusstest?«
Sie antwortete gerne. So merkte sie, was sie behalten und was sie schon wieder vergessen hatte und noch mal lesen musste. Er war besonders an Erdkunde und Naturkunde und daran interessiert, wie man von dem leben kann, was das Land bietet.
»Kann man Flechten essen?«
»Du kannst Isländisches Moos essen. Es ist ein Heilmittel gegen Erkältung und Bauchweh und taugt auch als Lebensmittel.«
»Wie kann man bestimmen, ob ein Pilz giftig ist?«
»Du musst dir die Pilze einprägen, entweder die dreihundert genießbaren oder die dreihundert ungenießbaren.«
»Was für Pflanzen wachsen in der Arktis?«
»In der Tundra wächst …«
»Ich meine nicht die Tundra, ich meine …«
»Die Eiswüste? In der Eiswüste wächst nichts.«
Auf ihre Bitten brachte er seine Lehrbücher mit, und sie sah, dass sie sich vor ihm nicht schämen musste. Nur in Sprachen war er ihr voraus; seine Lehrerin sprach Englisch und Französisch mit ihm, während mit ihr niemand sprach. Sie brauchte die Sprachen nicht für die Aufnahmeprüfung, aber wollte eines Tages nach Paris und London reisen, Städte, über die sie in Meyers Konversationslexikon gelesen hatte und in denen sie sich besser auskannte als Herbert.
7
Wie Herbert von Olga hören wollte, was sie lernte, wollte er ihr erzählen, was er dachte. Eines Tages eröffnete er ihr, dass er Atheist geworden war.
Er war wieder gerannt, blieb vor ihr stehen, vorgebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, und sagte atemlos, gehetzt: »Gott gibt es nicht.«
Olga saß im Schneidersitz mit Buch im Schoß. »Gleich.«
Er wartete, bis sein Atem ruhig ging, legte sich neben sie ins Gras, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und richtete die Augen mal auf sie und mal auf den Hund, sie zu seiner Rechten, den Hund zu seiner Linken, oder in den tiefblauen Sommerhimmel mit den schnellen weißen Wolkenfetzen. Jetzt sagte er es noch mal, ruhig und bestimmt, als hätte er eine Entdeckung gemacht oder, eher noch, einen Entschluss gefasst. »Gott gibt es nicht.«
Olga sah von ihrem Buch auf und sah Herbert an. »Sondern?«
»Sondern?«
»Was gibt es an seiner Stelle?«
»Nichts.« Herbert fand ihre Frage komisch und schüttelte lachend den Kopf. »Es gibt die Welt, aber keinen Himmel und keinen Gott.«
Olga legte das Buch beiseite, streckte sich neben Herbert ins Gras und sah in den Himmel. Sie mochte den Himmel, blau oder grau und auch bei Regen oder Schnee, wenn man nur blinzelnd in die niederfallenden Tropfen oder herabschwebenden Flocken sehen konnte. Gott? Warum sollte er nicht im Himmel wohnen? Und manchmal auf die Erde kommen, in die Kirche oder auch in die Natur?
»Was machst du, wenn er plötzlich vor dir steht?«
»Wie Livingston vor Stanley? Ich würde mich leicht verbeugen und die Hand ausstrecken. ›God, I presume?‹«
Herbert war von seinem Witz begeistert, schlug mit den Händen auf den Boden und lachte. Olga stellte sich die Szene vor, Herbert in ledernen Kniebundhosen und kariertem Hemd und Gott in weißem Anzug und mit Tropenhelm, beide ein bisschen irritiert, beide vollendet höflich. Sie lachte mit. Aber sie fand, man sollte über Gott keine Witze machen. Man sollte auch nicht über Witze lachen, die andere über Gott machten. Aber vor allem wollte sie in Ruhe gelassen werden und lernen. Mit Gott, wenn er ihr helfen wollte, und wenn nicht, dann ohne ihn.
Aber Herbert ließ sie nicht in Ruhe. Er hatte die letzten Fragen entdeckt. Ein paar Tage später fragte er: »Gibt es die Unendlichkeit?«
Sie lagen wieder nebeneinander, ihr Gesicht im Schatten des Buchs, das sie in den Händen hielt, seines im Licht der Sonne mit geschlossenen Augen und einem Grashalm zwischen den Lippen.
»Parallelen schneiden sich in der Unendlichkeit.«
»Das ist das dumme Zeug, das sie in der Schule lehren. Wenn du zwischen Eisenbahnschienen weiter- und weitergehst – glaubst du, du kommst einmal dahin, wo sie sich schneiden?«
»Ich kann zwischen Eisenbahnschienen nur endlich weit gehen, nicht unendlich. Wenn ich rennen könnte wie du …«
Herbert seufzte. »Mach dich nicht über mich lustig. Ich will wissen, ob Unendlichkeit für endliche Menschen im endlichen Leben eine Bedeutung hat. Oder sind Gott und die Unendlichkeit dasselbe?«
Olga legte das aufgeschlagene Buch auf ihren Bauch, ließ es aber nicht los. Sie hätte es am liebsten wieder hochgehalten und weitergelesen. Sie musste lernen. Die Unendlichkeit war ihr gleichgültig. Aber als sie Herbert den Kopf zuwandte, sah er sie sorgen- und erwartungsvoll an. »Was hast du mit der Unendlichkeit?«
»Was ich mit ihr habe?« Herbert setzte sich auf. »Was unendlich ist, ist auch unerreichbar, oder? Aber gibt es etwas, das unerreichbar ist, nicht nur zur heutigen Zeit und mit heutigen Mitteln, sondern schlechthin?«
»Was willst du mit der Unendlichkeit, wenn du sie erreichst?«
Herbert schwieg und richtete den Blick in die Ferne. Olga setzte sich auch auf. Was sah er? Rübenfelder. Grüne Pflanzen und braune Furchen in langen Reihen, die Reihen zunächst gerade, dann wegen einer Senke geschwungen auf den Horizont zulaufend und schließlich in eine grüne Fläche verschmelzend. Einzelne Pappeln. Eine Gruppe Buchen, eine dunkle Insel im hellen Meer der Rübenfelder. Der Himmel war wolkenlos, die Sonne stand in Olgas und Herberts Rücken und ließ alles für sie leuchten, das Grün der Pflanzen und Bäume und auch das Braun des Bodens. Was sah er?
Er wandte ihr das Gesicht zu und lächelte verlegen, weil er nicht weiterwusste, obwohl er sicher war, es müsse für seine Frage eine Antwort, für seine Sehnsucht eine Erfüllung geben. Sie hätte ihn in den Arm nehmen und ihm über den Kopf streichen mögen, traute sich aber nicht. Seine Sehnsucht berührte sie wie die Sehnsucht eines Kindes nach der Welt. Aber weil er kein Kind mehr war, spürte sie in seiner Sehnsucht, seiner Frage, seinem Rennen eine Verzweiflung, von der er nur noch nichts wusste.
Wieder ein paar Tage später wollte er von ihr wissen, ob es Ewigkeit gibt. »Sind Unendlichkeit und Ewigkeit dasselbe? Unendlichkeit bezieht sich auf Raum und Zeit und Ewigkeit nur auf Zeit. Aber geht beides auf die gleiche Weise über das hinaus, was wir haben?«
»An manche Menschen erinnert man sich noch nach vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob ewig, aber Achill und Hektor sind zwei- oder dreitausend Jahre tot, und wir wissen immer noch von ihnen. Willst du berühmt werden?«
»Ich will …« Er stützte sich auf den rechten Arm und wandte sich ihr zu. »Ich weiß nicht, was ich will. Ich will mehr, mehr als das hier, die Felder, das Gut, das Dorf, mehr als Königsberg und Berlin und mehr als die Garde, nicht weil es die Garde zu Fuß ist, mit der Garde zu Pferd wäre es nicht anders. Ich will etwas, das all das hinter sich lässt. Oder unter sich – ich habe gelesen, dass Ingenieure eine Maschine bauen wollen, mit der man fliegen kann, und denke …« Er sah über ihren Kopf zum Himmel. Dann lachte er. »Wenn man die Maschine erst einmal hat und auf ihr sitzt und mit ihr fliegt, ist sie auch nur ein Ding wie andere Dinge.«