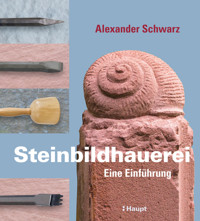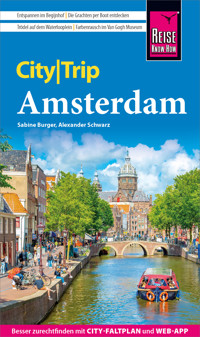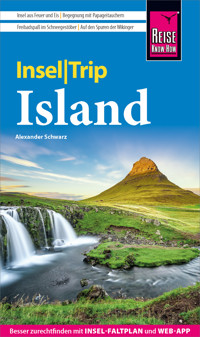10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe
- Sprache: Deutsch
Der Mut einer unbeirrbaren Forscherin
1691: Nach der Scheidung von ihrem Mann zieht die talentierte Künstlerin Maria Sibylla Merian nach Amsterdam. Schon früh lernte sie die Fertigkeit des Kupferstechens, und in der neuen Stadt will sie sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen – und sich ihren Traum erfüllen: eine Reise nach Südamerika, um im tropischen Regenwald die faszinierende Vielfalt der Raupen und Schmetterlinge zu erforschen. Fieberhaft knüpft sie Kontakte und sucht Financiers. Eine Überseereise ist für eine alleinstehende Frau ein großes Wagnis, doch Maria ist es gewohnt, sich unter Männern zu behaupten und Grenzen zu überschreiten. Und so bricht sie auf ins ferne Suriname – und in das Abenteuer ihres Lebens.
Die Geschichte einer wagemutigen Frau, die nach Unabhängigkeit strebte und alle Fesseln abstreifte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Als Maria Sibylla mit ihren Töchtern in Amsterdam ankommt, liegt all ihre Hoffnung auf diesem Neuanfang: Hier will sie sich etwas aufbauen und frei ihre Kunst leben können – und von hier aus will sie ins ferne Suriname reisen, um dort über die besonderen Insekten und schillernden Schmetterlinge des Dschungels zu forschen. Für eine Frau ein schier undenkbares Unterfangen, und so stößt Maria Sibylla bei einflussreichen Männern der Stadt auf Spott und Missgunst. Doch sie lässt sich nicht entmutigen und versucht trotz aller Rückschläge, Unterstützer für ihren Plan zu finden. Ihr Glaube an sich selbst zahlt sich aus, und so scheint ihrer Reise nach Südamerika nichts mehr im Weg zu stehen. Maria Sibylla ahnt allerdings nicht, dass dieses Wagnis sie für immer verändern wird.
Über Alexander Schwarz
Alexander Schwarz, geboren 1964 in Stuttgart, studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Mediävistik, Linguistik und Politikwissenschaften in Freiburg im Breisgau und Utrecht, wohin es ihn noch während seines Studiums in die Niederlande zog. Seit 1990 wohnt er in den Niederlanden, nur unterbrochen von einem sechsjährigen Aufenthalt in Island. Er arbeitete zwanzig Jahre lang als Verleger. Heute ist er selbstständiger Literaturagent, er schreibt und fotografiert seit mehr als fünfundzwanzig Jahren.
Mehr Informationen unter www.mariasibyllamerian.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Alexander Schwarz
Die Entdeckerin der Welt
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1 — Amsterdam 1691–1699
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil 2 — Surinam 1699–1701
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil 3 — Amsterdam 1701–1705
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Teil 1
Amsterdam 1691–1699
Kapitel 1
»Vorsichtig, passen Sie doch auf!« Maria Sibylla Merian stand an der Kade im friesischen Harlingen neben dem Pferdekarren, der sie und ihre beiden Töchter seit dem frühen Morgen von Wieuwert hierhergebracht hatte.
»Sie sollen die Kisten abladen, nicht einfach herunterpurzeln lassen.«
Der Kutscher brummte verärgert etwas Unverständliches.
»Wenn Sie den vereinbarten Betrag in Gänze wollen, dann sorgen Sie besser dafür, dass nichts kaputt geht.«
Schon am frühen Morgen waren Maria Sibylla und dieser griesgrämige Kutscher aneinandergeraten.
»So viel Gepäck nehme ich nicht mit«, hatte der lapidar gesagt, als sie von Schloss Waltha in Wieuwert aufbrechen wollten.
»Was soll das denn heißen?«, fragte Maria Sibylla. »Das sind unsere Sachen, und die gehen mit.«
»Aber nicht für den vereinbarten Preis.«
Maria Sibylla sah ein, dass sie mehr Gepäck bei sich hatten, als es normalerweise üblich war, und um die Sache abzukürzen, bot sie ihm gleich einen Betrag, den er wohl akzeptieren würde.
»Also gut, ich gebe Ihnen einen ganzen Gulden, aber damit hat es sich.«
Der Kutscher lächelte linkisch und murmelte etwas.
Maria Sibylla war froh, dass dieser Kerl noch nicht bemerkt hatte, wie schwer vor allem einige der Holztruhen waren, die sie hütete wie ihre Augäpfel. Sein leises Fluchen beim Anheben der Truhen ignorierte Maria Sibylla denn auch geflissentlich. Sie hielt es schlicht für unnötig, diesen ungehobelten Kutscher darüber aufzuklären, dass sich darin praktisch ihr ganzes Kapital befand, das ihr den Neuanfang in der großen Stadt ermöglichen sollte: einhundertdreißig Kupferplatten, die sie für ihre beiden ersten Bücher gestochen hatte, die Drucke auf Papier, die Malereien auf Pergament, ihre Malutensilien, ihre kleine Bibliothek und schließlich die Laden mit den lebenden Raupen, aufgespießten Schmetterlingen und allem weiteren Untersuchungsmaterial an getrockneten Pflanzen und präparierten Tieren.
Maria Sibylla schaute über das flache Weideland und atmete tief durch. Die sechs Jahre, in der sie abgeschottet in einem Schloss der pietistischen Labadistensekte ihr Leben gefristet hatte, waren endgültig vorbei. Sie sehnte sich regelrecht danach, endlich wieder in einer Stadt leben, sich wieder mit gebildeten und kunstinteressierten Leuten austauschen zu können. Amsterdam war nach London und Paris in den letzten Jahrzehnten in rasantem Tempo zur drittgrößten Stadt in ganz Europa herangewachsen. Vor allem dank der Schifffahrtshandelsrouten und der Vereenigde Ostindische und West-Indische Compagnien zog die Stadt Händler aus aller Herren Länder, aber auch Gelehrte und Künstler von Rang an. Hier, so dachte sich Maria Sibylla, würde ihre Arbeit auf Resonanz stoßen, hier würde sie für sich und ihre Töchter ein Auskommen erwirtschaften können, hier würde sie für das, was ihr so am Herzen lag, ein Publikum finden. In ihre Heimatstadt Frankfurt oder gar zu ihrem Mann nach Nürnberg wollte sie nicht zurück. Jetzt war es Zeit für ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ihrem Plan, in Amsterdam erfolgreich arbeiten zu können und vielleicht gar zu etwas Ruhm und Ehre und einem bescheidenden Wohlstand zu kommen, schien nichts mehr im Wege zu stehen.
Den umständlichsten Teil ihrer Reise hatten sie hinter sich. Zwar hatten sie keine Möbel bei sich und waren ihre Habseligkeiten sowieso eher bescheiden, ihre Arbeitsutensilien dagegen waren nicht wenige. Das Aufladen ihres Gepäcks auf den Pferdekarren, das Abladen und das Beladen des Schiffs, das sie auf die andere Seite der Zuiderzee nach Nord-Holland brachte, hatte darum auch Zeit gekostet und ein breit gefächertes Sammelsurium an Flüchen und Verwünschungen des Kutschers hervorgebracht. Der Wind war lau, und so entschied sie sich, nur die kurze Überfahrt nach Hoorn zu machen und den Rest des Weges mit der Treckschute, einem dieser modernen geschlossenen Boote, die erstmals zum regelmäßigen Transport von Personen oder Gütern gedacht waren, zurückzulegen.
Gern hätte sie, endlich auf der holländischen Seite in Hoorn angekommen, in der kleinen Schänke Het Onvolmaeckte Schip gleich neben der Anlegestelle zur Erfrischung noch ein Glas Limonade mit ihren Töchtern getrunken, aber dafür blieb keine Zeit mehr. Der Treiber mahnte schon zur Eile. Er habe schließlich einen Fahrplan einzuhalten, sonst könne er seine Lizenz und damit seinen Broterwerb verlieren. Der Kutscher fluchte, aber es half nichts, an eine Pause war nicht zu denken. Die Holztruhen mussten so schnell wie möglich an Bord. Er werde jedenfalls seinem Pferd rechtzeitig die Zügel geben, meinte der Treiber.
Mit seinen großen Handflächen streichelte er über die Nüstern des Pferds, zog kräftig an seiner Pfeife und sah zu, dass alle Passagiere sicher an Bord gingen.
In der Zwischenzeit standen auch die Umzugstruhen der drei Frauen um den hohen Mast auf dem Vordeck. Um diesen war das Tau gewickelt war, dessen anderes Ende am Zaumzeug des Pferdes befestigt war.
Sobald alle Passagiere unter Deck an den beiden langgezogenen, sich an den Längsseiten gegenüberliegenden Holzbänken Platz genommen hatten, spornte der Treiber sein Zugpferd an und begann, das Ross am Wasserweg entlang zu treideln. Der Schiffer sorgte am Ruder stehend dafür, dass die Treckschute nicht gegen das Ufer stieß, und der Treiber dafür, dass das Pferd auf dem parallel zum Kanal laufenden Leinpfad ruhig und stetig seinen Dienst verrichtete.
Sobald die Treckschute in Bewegung kam, wurde Maria Sibylla etwas ruhiger und setzte sich zu ihren Töchtern auf eine der Holzbänke unter Deck. Sie schaute sich um. Die Treckschute konnte bis zu dreißig Leute aufnehmen, sie war aber nur zur Hälfte gefüllt, was Maria Sibylla ganz recht war. Denn kaum saßen sie, begannen die männlichen Passagiere ihre Langpfeifen mit Tabak zu stopfen und sie ordentlich zu paffen. Die Luft war schnell geschwängert vom übelriechenden Tabakrauch. Die Frauen auf den Bänken begannen zu hüsteln. Doch das half nichts. Die ein oder andere Flasche machte die Runde, was zur Folge hatte, dass die Lautstärke, in der man sich unterhielt, zunahm.
Na, das kann ja was werden, dachte sich Maria Sibylla.
Die Fahrt von Hoorn in Noord-Holland bis zum Anlegeplatz Buiksloot im Norden Amsterdams dauerte gut fünf Stunden. Zum Glück war es ein schöner Sommertag. So konnten Maria Sibylla und ihre Töchter immer mal nach draußen an Deck gehen, um frische Luft zu schnappen.
Tatsächlich hielt es ihre dreizehnjährige Tochter Dorothea nicht lange in dem stickigen Innenraum aus.
»Ja, geh nur nach draußen und genieße die Sonne, meine Liebe«, sagte Maria Sibylla und wandte sich an ihre Älteste.
»Und Jacob holt uns an der Anlegestelle in Buiksloot auch sicher ab?«
In Maria Sibyllas Stimme klang noch immer Anspannung und Unsicherheit. Sie mochte es nicht, von anderen abhängig zu sein. Und auch wenn sie Jacob, den Verlobten ihrer ältesten Tochter, als zuverlässig kennengelernt hatte, ganz wohl war ihr bei dieser ganzen Unternehmung nicht. Außerdem wusste sie noch nicht, wo sie eine Wohnung finden würde. Zunächst würde sie mit Dorothea bei Johanna und ihrem Jacob einziehen. Eine hoffentlich vorläufige und vor allem kurzfristige Lösung. Sie wollte so schnell wie möglich ihr Atelier einrichten, so dass sie ihre Arbeit aufnehmen konnte. Außerdem wollte sie dem jungen Paar nicht auf die Füße treten.
Jacob war den Frauen vorangereist und hatte sich um eine Wohnung gekümmert. Er hatte auch für den Umzug der wenigen Möbel, die sie besaßen, gesorgt. Als Überseekaufmann hatte er, mit den richtigen Papieren und Empfehlungsschreiben ausgestattet, bei der West-Indische Compagnie schnell eine Anstellung in deren Amsterdamer Kontor erhalten.
Maria Sibylla versank in Gedanken. Nach all der Abgeschiedenheit in den letzten sechs Jahren würde eine solch große Stadt wie Amsterdam sicherlich nicht einfach werden, auch für Johanna und Dorothea nicht. Sie hätte schon viel früher aus Wieuwert weggehen sollen, gleich nach dem Tod ihrer Mutter. Was hatte sie nur so lange in dieser Sekte gehalten? Die Geborgenheit der Lebensgemeinschaft? Nun ja, die hatte sie teuer bezahlt. Wortwörtlich. Sie lächelte bitter. Erst hatte sie alle Besitztümer und ihr Geld abgeben müssen und dann nicht mal in ihrem eigenen Beruf arbeiten dürfen. Kunst sei eitel. Immerhin die naturkundlichen Arbeiten hatte sie fortsetzen dürfen. Maria Sibylla atmete hörbar aus. Jetzt würde ein neues Leben beginnen, und es galt, in Amsterdam Fuß zu fassen. Sie würde schon einen Weg finden.
Ihr wurde bewusst, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich selbst gestellt war. Von ihrem Mann hatte sie sich scheiden lassen, ein Leben mit ihm erschien ihr einfach nicht mehr möglich. Sie wollte nicht mehr daran denken, versuchte, ihre Erinnerungen auszulöschen, und war jedenfalls heilfroh, dass sie sich dafür entschieden hatte, Andreas zu verlassen.
Die Gemeinschaft der Labadisten machte ihre Scheidung in gewisser Weise auch einfacher. Sie fühlte sich dort aufgehoben, dafür war sie ihnen dankbar. Sich als Frau scheiden zu lassen, war noch immer ein Unding, und sie hätte wohl sowieso nicht nach Nürnberg zurückgehen können und aus Frankfurt wegziehen müssen, um soziale Ächtungen zu vermeiden. Da kam ihr der Umzug mit ihrer Mutter und ihren beiden Kindern nach Wieuwert gerade recht.
Von diesem Tag an musste sie für sich selbst und ihre Töchter aufkommen. Jedenfalls für die jüngste, Dorothea, die noch bei ihr wohnen würde. Johanna hatte ja ihren Jacob.
Der hatte ihr geschrieben, dass er für Johanna und sich eine kleine Wohnung an der Vijzelgracht gefunden habe und dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass in der Straße um die Ecke wohl eine Wohnung zur Miete stand. Maria Sibylla konnte nur hoffen, dass er Recht behielt und dass sich die Wohnung auch als Atelier eignete. Sie freute sich, dass ihre Tochter einen solch aufmerksamen jungen Mann gefunden hatte.
»Ja, Mama, Jacob wird uns sicher abholen, das hat er fest zugesagt«, riss Johanna ihre Mutter aus ihren Gedanken. Sie freute sich sehr auf das Wiedersehen mit Jacob Hendrik Herolt, ihrem Jacob. Sie hatte ihn vor ein paar Jahren in Wieuwert kennen- und schließlich auch lieben gelernt. Noch vor ihrer Reise hatten sie sich verlobt. Nach dem Ritus der Labadisten waren die beiden sogar schon verheiratet, aber dies musste nach dem Aufgebot in Amsterdam erst auch noch von den hiesigen staatlichen Stellen bestätigt werden.
»Ich bin schon richtig gespannt auf die Wohnungen, die er für uns gefunden hat«, schwärmte Johanna. »Und es wäre doch ein Glück, wenn ihr tatsächlich etwas gleich um die Ecke bekommen könntet.«
»Ja, das würde uns so einiges an Mühe ersparen«, antwortete Maria Sibylla. »Und ich hoffe, dass wir genug Platz haben für meine Arbeitsmaterialien und die Druckpresse.«
Ihr fiel plötzlich auf, wie die anderen Passagiere sie musterten. Sie trug ein einfaches Kleid aus einem dunkelbraunen Leinenstoff, einen breiten weißen, gestärkten Kragen und eine kleine weiße Haube. Sie sah die Verwunderung der anderen, denn ihre einfache Kleidung stand im Kontrast zu ihren vorwitzigen, klaren und lebendigen Augen. Vor allem ihre Hände fielen auf. Sie waren schlank und fein, nicht die groben und von der Arbeit rauen Hände, wie sie bei einer – ihrer Kleidung nach zu urteilen – eher armen Frau erwartet wurden.
Maria Sibylla kümmerte sich nicht darum, was die anderen über sie und ihre Töchter dachten. Es machte ihr sogar heimlich Freude, die verdutzten Gesichter zu sehen. Sie wusste ja gar nicht, was man in Amsterdam trug. Und so musterte sie jetzt ihrerseits ihre Mitpassagiere.
Die Männer trugen meist Schuhe mit großen Schnallen an der Außenseite. Ihre Beine wurden bedeckt von langen Kniestrümpfen, die bis zu dunklen Kniehosen reichten. Dazu trugen sie ein manschettenloses Hemd, darüber einen Wams mit einer langen Knopfreihe und darüber wiederum einen weißen, mit Spitzen verzierten Kragen. Auf ihren Köpfen trugen sie entweder einen Dreispitz oder einen recht hohen Hut mit breiter Krempe.
Maria Sibylla schnappte immer wieder Fetzen von ihren Gesprächen auf, die sich um die abschwächende Wirtschaft drehten, darüber, dass immer weniger Schiffe immer weniger Waren aus den Kompanien mitbrachten. Dass es zu viele Kaper gäbe, die die bis unter den Bauch gefüllten Schiffe nur allzu gern ausraubten. Und natürlich auch, welche Geschäfte sie in Amsterdam zu tätigen gedachten.
Die Frauen an Deck der Trekschute verhielten sich leiser. Sie trugen allesamt bodenlange Kleider, darunter ein Hemd mit Puffärmeln, einen weiten, weißen Kragen und eine Haube.
Dorothea konnte ihre Augen kaum von einer Frau lassen, deren Kleidung aus feiner Wolle gewebt war. Vor allem die feinen Stickereien auf dem Stoff hatten es ihr angetan. Sie zupfte ihre Schwester, die sich in der Zwischenzeit wieder neben sie gesetzt hatte, aufgeregt am Ärmel.
»Schau mal da, diese Muster auf dem Kleid, sind die nicht wunderschön?«
»Ja, aber starr sie doch nicht so an, das gehört sich nicht, Dorothea«, ermahnte Johanna sie.
»Und der weiße Kragen, ganz aus Spitze gehäkelt.« Dorothea kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. »So was möchte ich auch.«
Johanna beugte sich zu ihrer Schwester hinunter und flüsterte ihr ins Ohr: »Mir wäre die goldene Brosche mit der Perle, die den Kragen zusammenhält, noch viel lieber.« Sie kicherten.
Die Broschen der anderen waren nur aus Silber und Bernstein gefertigt. Immerhin, selbst solche Eitelkeiten hatte sich in Wieuwert niemand erlauben dürfen.
Als die Frau mit dem wollenen Umhang und der goldenen Brosche zu ihnen herübersah, drehten sie schnell ihre Köpfe in eine andere Richtung.
Sie sprachen Deutsch miteinander, waren aber sehr wohl auch der niederländischen Sprache mächtig.
»Fahren Sie zu Besuch nach Amsterdam?«, fragte ihre Sitznachbarin Maria Sibylla. Sie war schon etwas älter, hatte einen Korb auf ihrem Schoß und schaute sie mit freundlichen Augen an.
»Nein, wir möchten uns in Amsterdam niederlassen«, antwortete Maria Sibylla.
»Na, da sind Sie nicht die Einzige«, sagte die Frau. »So viele haben in den letzten Jahrzehnten ihr Glück in der Stadt gesucht.«
Maria Sibylla war nicht wirklich an einem Gespräch interessiert. Sie antwortete der alten Frau höflich, ermunterte sie aber auch nicht, weiter zu erzählen.
Ihre Gedanken kreisten vielmehr um ihre ersten Wochen in Amsterdam. Dorothea hielt es drinnen nicht lange aus und war schon wieder oben. Maria Sibylla nutzte die Gelegenheit, in Ruhe mit ihrer Ältesten zu reden. Sie drehte sich zu ihr um.
»Wenn wir in Amsterdam ankommen, wird sich unser Leben doch sehr verändern. Bist du dir dessen bewusst?« Sie schaute Johanna sorgenvoll an.
»Ja«, antwortete Johanna und lächelte, »ich werde mit Jacob eine Familie gründen.«
»Ja, das auch.« Die Sorgenfalten Maria Sibyllas wurden tiefer. »Vor allem meine ich aber, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ich werde wieder Malunterricht geben, wir werden neue Bücher malen und schreiben, und dafür müssen wir Raupen und Schmetterlinge fangen, Blumen finden, Farben mischen und insbesondere Leute kennenlernen, die uns gewogen sind. Die Zeiten, in denen – wenigstens was das betrifft – in Wieuwert für uns gesorgt wurde, sind ein für alle Mal vorbei.«
Johanna begriff so langsam die Sorgen der Mutter, beschloss aber, das Ganze von der sonnigen Seite zu sehen. Schließlich war Amsterdam eine große Chance, die sie nutzen wollte. Hier wollte sie nach dem Leben in Wieuwert, wo sie sich mit der Zeit doch immer mehr eingeschlossen gefühlt hatte, ein neues Leben in Freiheit beginnen, ihre Familie gründen und gemeinsam mit ihrer Mutter weiter Kunst betreiben und Malunterricht geben. Und sie war sich sicher, dass das auch für ihre Mutter galt. Warum sollten sie sonst dieses Wagnis eingehen?
»Du hast einiges von mir gelernt, Johanna, beim Zeichnen und Malen machst du eine gute Figur; du kannst kupferstechen, und das Präparieren von Schmetterlingen geht dir gut von der Hand. Du hast wirklich Talent«, lobte ihre Mutter, und ihre Gesichtszüge hellten sich etwas auf. »Aber deine Schwester steht erst am Anfang. Sie muss noch so viel lernen.«
»Ich glaube, auch sie hat Talent. Und sie ist ein sehr neugieriges Persönchen«, meinte Johanna.
»Ja, da hast du recht«, sagte Maria Sibylla lächelnd. »Neugierig und wissbegierig ist sie sicher. Wenn sie nur nicht so ungeduldig wäre.«
Sie schaute sich kurz um, doch die anderen Fahrgäste schienen vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein. Nach einer kurzen Pause wandte sie sich wieder an ihre Tochter.
»Ich habe nachgedacht, Johanna. Es wäre am besten, wenn wir anfangs alle unter demselben Namen arbeiten, meinem Namen. Damit würden wir sicherlich am besten Geld verdienen.«
»Deine beiden Bücher Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumen-nahrung sind immer noch in aller Munde, sowohl bei Künstlern als auch bei den Naturwissenschaftlern und Gärtnern. Das haben wir sogar in Wieuwert noch mitbekommen«, sagte Johanna.
»Ja, der Ansatz war neu und ist noch immer einzigartig.« Maria Sibylla war immer noch stolz auf diese beiden Bücher. Ihre drei Blumenbücher, die sie noch in Nürnberg herausgebracht hatte, waren vor allem dazu gedacht, ihren Schülerinnen und Handwerkern Vorlagen an die Hand zu geben, die Blumen und Insekten abzumalen oder zu schnitzen. Und auch die beiden Raupen-Bücher – das zweite hatte sie verlegt, als sie zwischenzeitlich wieder in Frankfurt wohnte – richteten sich tatsächlich nicht nur an Künstler. Wissenschaftler und Naturkundige hatten ihre Arbeit als bahnbrechend gelobt, weil sie nicht wahllos Raupen und Schmetterlinge gemalt hatte, sondern diese in Verbindung mit den Blumen setzte, von denen sich die Raupen ernährten.
»Damit hast du dir wirklich Respekt verschafft«, sagte Johanna anerkennend.
»Meist signiere ich meine Blätter sowieso nicht. Aber ich glaube, wenn wir unsere Kunst signieren, sollten wir es alle unter meinem Namen machen. Dann verkaufen wir sie einfacher und besser. Das ist zwar etwas schade, schließlich sollt ihr beiden ja auch irgendwann mit eurer Kunst auf eigenen Beinen stehen, aber im Moment ist es vor allem wichtig, dass wir so schnell wie möglich Geld verdienen.« Maria Sibylla war sich nicht sicher, wie ihre Älteste diesen Vorschlag aufnehmen würde. Schließlich stand sie auf der Schwelle zur Selbstständigkeit, zumindest in ihrem Privatleben. Dass sie weiterhin zusammenarbeiten würden, war ihnen beiden klar, und so wollten sie es ja auch. Malkurse für andere Frauen geben, Farben mischen und verkaufen, das würden wahrscheinlich zunächst die Haupteinnahmequellen sein. Natürlich hoffte sie darauf, dass sie schnell Illustrations- oder Malaufträge bekamen. Und vor allem nach und nach immer mehr Zeit und die Freiheit dafür hatten, ihre Kunst frei auszuüben.
»Das ist schon in Ordnung«, meinte Johanna. »Damit kommen wir wahrscheinlich schneller auf einen grünen Zweig.«
Maria Sibylla war stolz auf ihre Tochter. Nicht nur auf ihr unübersehbares Maltalent, sondern auch auf ihren Charakter, darauf, wie erwachsen sie in der Zwischenzeit geworden war, wie sie sich selbstverständlich als Künstlerin sah.
»Dann nennen wir das Ganze einfach eine ›Jungfern-Compagnie‹«, scherzte Maria Sibylla jetzt fast heiter.
Johanna musste lachen. »Das klingt doch wunderbar«, stimmte sie ihrer Mutter zu. »Und so machen wir aus der vermeintlichen Schwäche gleich unsere Stärke. Angriff ist die beste Verteidigung.«
»Dann kann niemand auf den Gedanken einer Hierarchie kommen, wie sie die Bezeichnung ›Merian und Töchter‹ hätte. Das ist auch für die Zukunft ein guter Schritt.«
Johanna war überrascht. Sie wusste, dass ihre Mutter über ihre Kunst und ihre selbstständige Arbeit gründlich nachdachte. Aber dass sie sich schon um einen Namen Gedanken gemacht hatte, wo sie doch noch nicht einmal angekommen waren und die Arbeitsmöglichkeiten ausloten konnten, verwunderte sie. Es gab ihr aber auch ein Gefühl der Geborgenheit. Ihre Mutter hatte schon immer gut für ihre Töchter gesorgt. Nach der Scheidung von ihrem Vater vielleicht sogar noch mehr als zuvor. Johanna konnte sich noch gut daran erinnern, wie ihr Vater vor dem Eingangstor zu Schloss Waltha darum gebettelt hatte, eingelassen zu werden. Aber die Labadistenbrüder und ihre Mutter waren hart geblieben. Sie und Dorothea hatten geweint, ihre Mutter gebeten, ihren Vater doch zu ihnen zu lassen, aber alles Flehen hatte nichts geholfen. Seitdem hatten sie ihren Vater nicht mehr gesehen.
Sie wusste nicht, warum ihre Mutter ihren Vater verlassen hatte. Ja, ihr Vater konnte durchaus aufbrausend sein, aber sie kannte von Freundinnen noch ganz andere Erzählungen. Vielleicht war ja etwas zwischen ihren Eltern vorgefallen, von dem sie nichts wusste. Am wahrscheinlichsten schien es ihr aber, dass ihre Mutter genug davon hatte, immer nur als seine Frau wahrgenommen zu werden. Außerdem durfte sie in Nürnberg kein Mitglied einer Zunft werden. Immer stand sie im Schatten ihres Mannes. Dass die beiden sich immer weniger vertrugen, das hatte sie schon einige Zeit vor der Scheidung gespürt, und ihr war nicht entgangen, wie ihre Mutter aufblühte, als sie mit ihr und Dorothea allein bei ihrer Großmutter in Frankfurt wohnte. Das machte ihr deutlich, dass das ein oder andere geschehen sein musste. Aber ihre Mutter lehnte jedes Gespräch darüber unwirsch ab. Johanna hatte ihren Vater nicht mehr gesehen, seit er in Wieuwert aufgetaucht war und erfolglos darum gebeten hatte, eingelassen zu werden. Die Frage blieb eine offene Wunde in Johannas Herzen.
»Na, dann fange ich so schnell wie möglich an, Dorothea das Zeichnen und Illustrieren beizubringen.« Maria Sibyllas Worte brachten Johanna wieder zurück ins Hier und Jetzt.
»Schaut mal!« Dorothea platzte von draußen herein. »Da vorne stehen ganz viele Häuser.«
Maria Sibylla und Johanna standen auf, gingen die paar Stufen an Deck und erblickten zum ersten Mal die Stadt am Horizont, die ihre neue Heimat werden sollte: Amsterdam.
Kapitel 2
Als sie in Buiksloot, dem trockengelegten Moor nördlich von Amsterdam ankamen, stand Jacob Hendrik Herolt mit einem breiten Karren bereit. Wieder wurden alle Gepäckstücke umgeladen, wieder stöhnten die Arbeiter beim Hochheben der schweren Kisten und wunderten sich über den Inhalt, und wieder ließ Maria Sibylla Merian sie im Dunkeln darüber, was sich in den Kisten befand.
Jacob war ein stattlicher Mann Anfang dreißig. Johanna hatte sich in diesen hübschen Kerl mit seinen gleichmäßigen Gesichtszügen und seiner offenen und ehrlichen Art Hals über Kopf verliebt, als sie vor sechs Jahren ins niederländisch-friesische Wieuwert gezogen waren. Heimlich zunächst, aber als sie spürte, dass er ihre Gefühle erwiderte, wurden die beiden schließlich ein Paar.
Maria Sibylla war anfangs nicht so angetan gewesen von den Geschichten, die ihre Tochter mit roten Wangen und voll Inbrunst über diesen jungen Kerl erzählte. Als sie ihn aber besser kennenlernte, wuchsen ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu ihm. Es stellte sich heraus, dass er sich als Händler gut machte und sich liebevoll um ihre Tochter kümmerte. Sie hoffte für Johanna, dass dies auch so bliebe, schließlich hatte sie selbst mit der Zeit andere, schmerzhafte Erfahrungen machen müssen.
»So, alles ist auf dem Karren verstaut. Bitte höflichst aufzusteigen, meine Damen«, rief Jacob, den Staub von seinem Überrock abklopfend. Er lächelte, als er den dreien hinaufhalf. Sie mussten sich mit einem offenen Karren zufriedengeben. Da saß man zwar eher ungemütlich direkt auf den groben Holzbalken unter freiem Himmel, eine Kutsche aber hätten sie sich einfach nicht leisten können. Die war den wenigen Auserwählten mit einem gut gefüllten Geldbeutel vorbehalten.
Johanna bestieg als Letzte den Karren. Jacob lächelte, seine Augen musterten sie liebevoll, und die beiden deuteten einen flüchtigen Kuss an.
Jacob fragte, ob sie gleich etwas von der Stadt sehen wollten, aber die drei waren erschöpft von der langen Reise und wollten nur noch schlafen. Also wies Jacob den Kutscher an, auf dem kürzesten Weg zur Vijzelgracht zu fahren, wo er eine kleine Wohnung auf der zweiten Etage gefunden und angemietet hatte.
Kapitel 3
Jacob hatte nicht zu viel versprochen. Die Wohnung, die er für Maria Sibylla und Dorothea gefunden hatte, war zwar nicht sehr groß, aber sie würden gut darin leben und arbeiten können.
Maria Sibylla fiel auf, dass alle Häuser hier im Viertel neu gebaut waren. Die Stadt hatte großartige Pläne entwickelt, in der Erwartung, dass der Bevölkerungszuwachs – wie er sich zu Anfang des Jahrhunderts entwickelt hatte – anhalten würde. Der angefangene Halbbogen der großen Grachten sollte auch im östlichen Teil der Stadt weitergeführt und bis zum nördlichen Meeresarm hin geschlossen werden. Dafür mussten alte Stadtmauern und Wehre ab- und neue wieder aufgebaut werden. Die Stadtverwaltung wollte den Patriziern und Neureichen der Stadt dabei Baugrund offerieren. Doch der Bevölkerungszuwachs ließ auf sich warten, und so waren noch immer nicht alle teuren Bauplätze verkauft. Manche versuchten, auch mit den ursprünglich als Kutschhäuser gedachten Gebäuden etwas Geld zu verdienen, indem sie sie vermieteten. Da diese einen eigenen Eingang hatten, brauchte man sich nicht mit den Mietern abzufinden. Außerdem hatte man so keinen Verkehr etwaiger ungewollter Kreaturen unter Stand an der Vorderfront der Gracht zu befürchten. Einige der Parzellen an der Kerkstraat waren von vorneherein als Ladengeschäfte und kleinere Handwerksbetriebe gedacht.
Vor solch einem stand Maria Sibylla Merian mit ihren Töchtern und Jacob nun.
»Das wird also unser neues Zuhause?«, fragte Dorothea und schaute an der weiß gestrichenen Fassade hoch. Das Haus war aus dem für Amsterdam so typischen roten Backstein gemetzelt.
»Ja«, sagte Jacob fröhlich. »Die ersten beiden Etagen jedenfalls. Die oberen Stockwerke sind an jemand anderen vermietet.«
»Na, dann lasst uns erst mal hineingehen und unser neues Reich inspizieren«, schlug Maria Sibylla vor.
»Nach dir, verehrte Maria Sibylla«, sagte Jacob und streckte einladend seinen rechten Arm zur Eingangstür hin aus.
Sie gingen die drei Stufen nach oben. Maria Sibylla holte tief Luft. Ihr war bewusst, dass hier ein neues Leben für sie begann. Ein Leben voller Ungewissheiten in einer fremden Umgebung, in der sie noch niemanden kannte und in der sie sich von Anfang an behaupten musste. Sie musste es unbedingt schaffen, wenigstens Dorothea und sich durchzubekommen; und alles, was ihr hierfür zur Verfügung stand, waren ihr Talent als Künstlerin, ihre alten Kupferstiche und Bücher und was sie Neues würde schaffen können. Aber würde das genug sein? War ihre Kunst in dieser Stadt überhaupt gefragt? Wie sollte sie die richtigen Leute kennenlernen?
Diese Gedanken schossen ihr durch den Kopf, und für einen Moment war sie sich nicht mehr so sicher, ob sie mit dem Umzug nach Amsterdam die richtige Entscheidung getroffen hatte. Doch sie wusste, in Wieuwert zu bleiben, wäre unmöglich gewesen. Der Aufenthalt bei den Labadisten schränkte ihr Leben auf Dauer viel zu sehr ein.
Maria Sibylla fasste sich wieder, schob diese Dämonen zur Seite, drückte ihren Rücken durch und öffnete die linke der beiden Türen. Die Vorderseite des Hauses bestand aus einer großen Glasfront mit kleinen, viereckigen Gläsern, jeweils einfasst in einen feinmaschigen, rautenförmigen Rahmen aus hell gestrichenem Holz.
»Dieses Haus war eigentlich als Ladenwohnung gedacht, darum die Glasfront und die hohe Decke über zwei Stockwerke«, sagte Jacob. »Aber ihr braucht ja viel Licht zum Arbeiten.«
Der vordere Raum zur Straße hin erstreckte sich über die gesamte Breite des Hauses und war sonnendurchflutet.
»Die Druckpresse stellen wir hier vorne ans Fenster«, richtete Maria Sibylla den Raum sogleich in Gedanken ein. »Die Schränke mit den Kupferplatten, das Papier und Pergament und alle Utensilien zum Drucken stellen wir links und rechts etwas dahinter.«
Maria Sibylla öffnete zwei Schiebetüren und betrat den hinteren Teil des Raumes, der nur noch halb so hoch war wie der vordere Bereich.
»Die Kabinette mit den Sammlungen bringen wir hier nach hinten«, rief sie den anderen zu, die noch im großen Zimmer standen.
Am Ende des Raums befand sich die Feuerstelle. Dort konnten sie einen Tisch und Stühle hinstellen. Eine schmale Tür ermöglichte den Zugang zum Innenhof.
»Da wir bisher noch gar keine Druckerpresse haben, wäre es geschickt, wir würden unsere Arbeitstische vor die Fensterfront stellen.«
Maria Sibylla verharrte einen Moment, schloss die Augen und atmete tief ein.
»Das Holz riecht noch so frisch«, stellte sie fest.
»Das ist kein Wunder«, sagte Johanna, »das Haus ist ja auch fast neu.«
Erst jetzt fiel ihnen auf, dass sich über den Flügeltüren nach hinten ein weiteres Zimmer befand. Darum war der hintere Teil des Hauses also nicht so hoch. Eine steile Treppe mit schmalen Stufen führte hinauf. Maria Sibylla stieg die Stufen nach oben, die anderen folgten ihr.
»Die ist ja wirklich steil«, staunte Dorothea.
»Hier in der Stadt geht man mit dem Platz in den Häusern sehr sparsam um. Deshalb sind die Treppen fast überall ziemlich eng und steil«, sagte Jacob.
»Wir werden uns daran gewöhnen«, rief Maria Sibylla von oben.
»Hoffentlich bevor eine von uns mit dem Hintern zuerst unten wieder ankommt«, sagte Dorothea lachend.
»Also wirklich, ich muss doch schon bitten«, sagte Maria Sibylla, musste insgeheim aber schmunzeln.
Die Vorderseite dieses Raumes war ebenfalls mit Glasrauten über die gesamte Front bestückt.
»Herzlichen Dank, Jacob, für deine Mühen. Diese Wohnung hat alles, was wir zum Leben und Arbeiten brauchen. Und ich bin wirklich froh über die großen Fenster«, sagte Maria Sibylla.
»Praktisch ist, dass wir um die Ecke wohnen und ich keinen langen Weg zur Arbeit habe«, sagte Johanna.
»Na dann.« Maria Sibylla klatschte zufrieden in die Hände. »Hoffen wir, dass wir hier tatsächlich bald einziehen und uns einrichten können.«
Kapitel 4
»Da steht jemand vor unserer Haustür!«
Dorothea nahm ihre Haube, die sie neben sich auf den Arbeitstisch gelegt hatte, strich sich ihre Haare nach hinten und setzte die weiße Haube auf. Maria Sibylla stand auf und richtete ihr Kleid.
»Wer will uns denn besuchen?«, fragte sich Johanna. Sie waren erst seit ein paar Tagen eingezogen und hatten noch keine Bekanntschaften gemacht. Freundlicherweise hatte ihnen der Hauseigentümer gestattet, die Wohnung schon im Voraus zu beziehen. Jacob hatte sich für sie verbürgt, und der Vermieter schien ein gutgläubiger Mann zu sein.
Sie hatten die Zeit genutzt, um Kabinette einzurichten und alle Arbeitsutensilien an ihren Platz zu stellen.
Maria Sibylla schaute sich kurz um, ob es auch nicht mehr allzu unordentlich aussah, strich mit ihren Händen über die Haube und gab dann ihrer jüngsten Tochter ein Zeichen, die Tür zu öffnen.
Ein schlanker Herr trat mit forschem Schritt ein. Er deutete ein kurzes Nicken an und begrüßte Maria Sibylla mit einer Verbeugung. Maria Sibylla erwiderte seine Begrüßung mit einem Knicks.
»Guten Tag, gnädige Frau. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so impertinent bin, einfach so bei Ihnen anzuklopfen. Simon Schijnvoet der Name. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie Maria Sibylla Merian aus Frankfurt sind? Mir wurde zugetragen, dass Sie vor ein paar Tagen in unsere schöne Stadt gezogen sind, und wie es der Zufall so will, wohl genau in die Straße, in der auch ich wohne.«
»Aber bitte, kommen Sie doch herein.« Sie trat einen Schritt zur Seite. »Ja, ich bin Maria Sibylla Merian. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs?«
Sie musterte den Besucher aufmerksam. Er trug eine lange Perücke und hatte gleichmäßige Gesichtszüge. Seine großen Augen mit dem warmen Blick zogen ihre Aufmerksamkeit auf sich. Den dunkelgrünen Überrock trug er, ebenso wie das weiße Hemd darunter, ein ganzes Stück weit offen. Seine Hände wirkten kräftig, obwohl seine Finger schmal waren. Vor allem aber fiel Maria Sibylla auf, wie gepflegt sie waren.
»Nun, Ihr guter Ruf eilt Ihnen voraus, mevrouw Merian. Wie ich höre, haben Sie ein paar Jahre nicht mehr gemalt, und ich hoffe, dass Sie diese Tätigkeit hier in Amsterdam wieder aufnehmen werden?«
»Verehrter Herr, Ihr seid zu gütig.« Maria Sibylla errötete bei so viel unerwartetem Lob leicht. Die Situation war ihr etwas peinlich. Sie neigte ihren Kopf zur Seite, hob die Augenbraue und schaute Simon Schijnvoet vorsichtig lächelnd an. Sie wusste noch nicht so recht, was sie von diesem Schijnvoet halten sollte.
»Außerdem scheinen Sie ja gut informiert zu sein. Genau das habe ich vor«, bestätigte Maria Sibylla. »Zu unterrichten, Farben herzustellen und zu verkaufen, überhaupt alle Materialien, die zum Malen nötig sind, anzubieten und selbstverständlich auch wieder selbst ins Kupfer zu stechen, zu illustrieren und zu malen.«
Simon Schijnvoet schien sich darüber zu freuen. Er machte den Eindruck, als könnte er es kaum glauben, dieser bekannten Künstlerin in ihrem eigenen Atelier gegenüberzustehen.
Maria Sibylla fuhr fort: »Und seien Sie versichert, ich habe in den letzten Jahren auch nicht stillgestanden. Zusammen mit meinen Töchtern habe ich meine Kunst weiterentwickelt, meine Beobachtungen und Studien vorangetrieben. Ich nehme an, Sie kennen meine Bücher zur Entwicklung der Raupen?«
Sie wollte ihn testen, diesen Kerl, der so ganz ohne Vorankündigung bei ihr hereingeplatzt war. Wollte ihn aus der Reserve locken und wissen, wer er eigentlich war.
»Aber selbstverständlich, Frau Merian!«, sagte Simon Schijnvoet. »Wie ich ja schon sagte, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Und ich darf hinzufügen, dass ich ein großer Bewunderer Ihrer Kunst bin. Umso glücklicher preise ich mich, heute Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen.« Wieder verbeugte er sich kurz.
»Da Sie neu sind in der Stadt, darf ich davon ausgehen, dass Sie noch nicht viele Leute kennen?« Um ihr die vielleicht peinliche Antwort zu ersparen, fuhr er ohne eine solche abzuwarten fort: »Es wäre mir eine große Ehre, Sie mit ein paar meiner Freunde bekannt zu machen.«
Das klang nur allzu verlockend, doch noch immer wusste Maria Sibylla nicht genau, wer dieser Herr war. Zugegeben, er sah gut aus und hatte eine angenehme Ausstrahlung. Es schien ihr fast, als wären seine Intentionen aufrichtig.
Zu oft aber war es schon geschehen, dass sie enttäuscht wurde. Ihre gescheiterte Ehe war ihr Mahnung genug. Aber auch in geschäftlicher Hinsicht war es ihr immer wieder passiert, dass Männer ihr so lange geschmeidig daherkamen, wie es für sie von Nutzen war. Sobald sie hatten, was sie wollten, booteten sie sie einfach aus. Wenn Männer bei ihren Geschäften allein sein wollten, hatte eine Frau auf einmal keinen Platz mehr.
»Nun, werter Herr Schijnvoet, Ihr Angebot ehrt mich. Es würde mich aber noch mehr ehren, wenn ich wüsste, wer dieser edle Herr, der so überraschend in meinem bescheidenen Atelier aufgetaucht ist, denn eigentlich ist und wem er mich vorstellen möchte.«
»Ich bitte meine Unhöflichkeit zu entschuldigen. Ich kann schließlich nicht erwarten, dass Sie, gerade erst hier angekommen, wissen können, wer ich bin. Ich bin Architekt und Bildhauer, gestalte aber auch Gärten. Ich habe zwar keines dieser Fächer gelernt, aber mir einige Kenntnis und Kunstfertigkeit in diesen Disziplinen erworben, und so habe ich die Ehre, für wohlangesehene Herrschaften und Städte zu arbeiten. Außerdem bin ich Adjutant des Gerichts und sammle leidenschaftlich gern, und da bin ich nicht der Einzige hier in der Stadt.«
»Und was, wenn ich fragen darf, sammeln Sie?«
Maria Sibylla hatte schon eine Vermutung, worum es ging. Sie hatte bereits in Wieuwert gehört, dass es in Amsterdam bei den Reichen und Wichtigen und solchen, die sich gerne dafür hielten, Mode sei, alle möglichen Naturalien, sowohl Pflanzen als auch Tiere zu sammeln. Vor allem über die holländischen Handelsstützpunkte und Kolonien aus den Überseegebieten kam so manches teuer bezahlte Exponat in die Stadt. Konnte man seltene Ausstellungsstücke vorweisen, wurde man mit einem Besuch der Reichen und Einflussreichen beehrt und durfte sich in dem Glauben wähnen, auch dazuzugehören. Maria Sibylla hasste dieses Gebauchpinsel, diese vorgetäuschten Freundschaften, die nichts wert waren, sobald der andere nicht mehr von einem profitieren konnte. Auf der anderen Seite wusste sie, dass sie sich in diesen Kreisen bewegen musste – äußerst behutsam, vor allem als Frau zwischen lauter Männern –, um überhaupt eine Chance zu haben, ihre Kunst verkaufen und sich in dieser sich so schnell entwickelnden Stadt zu behaupten.
Ihr war bewusst, dass sie mit dem Zeichnen von Raupen und Schmetterlingen auf gewisse Weise in das Beuteschema dieser Sammler passte. Diese Sammler wiederum besaßen unter Umständen aber wiederum ihrerseits Stücke, die Maria Sibylla liebend gern in Kupfer stechen würde. Sie hoffte, dass diese Leute, die offensichtlich über gute Kontakte zu den Handelskompanien und Kolonien verfügten, auch Exponate aus Suriname in ihren Sammlungen besaßen. Diesen Simon Schijnvoet könnte also der Himmel gesandt haben. Sie könnte durch ihn jede Menge Zeit sparen, wenn er sie tatsächlich in die hohen Kreise einführen würde, ohne dass sie sich selbst anbiedern müsste. Maria Sibylla verfügte über ein gesundes Selbstbewusstsein, und sich in einer Gesellschaft einschmeicheln zu müssen, von der sie spätestens seit ihrem Weggang aus Frankfurt nicht mehr Teil war, war ihr ganz furchtbar zuwider.
»Naturalien, geschätzte Frau Merian.« Seine Antwort riss sie aus ihren Gedanken. Genau das also, worauf sie gehofft hatte. »Meine Sammlung enthält bereits eine durchaus ansehnliche Menge an Muscheln, Fliegen, Skeletten und auch ausgestopften Tieren und Feuchtpräparaten. Aber Sie wissen ja, wie das ist, als Sammler hat man nie genug und ist immer auf der Pirsch nach neuen Exponaten«, verkündete Schijnvoet stolz.
»Besitzen Sie auch Schmetterlinge aus Suriname oder gar die entsprechenden Raupen?«
Dorothea verdrehte ihre Augen. »Nicht schon wieder Suriname«, flüsterte sie verärgert ihrer Schwester zu.
»Ich hoffe auch, dass sie sich das endlich aus dem Kopf schlägt. Wir sind doch gerade erst hier angekommen«, antwortete ihr Johanna leise.
Für Simon Schijnvoet dagegen kam dieser Wunsch wohl nicht ganz unerwartet. Schließlich kannte er Maria Sibyllas Bücher, mit den Kupferstichen und Illustrationen der Raupen und Schmetterlinge aus deutschen Gefilden, und konnte sich vorstellen, dass sie wissen wollte, was für Schmetterlinge in anderen Breiten zu finden wären. Nur allzu gern zeigte er seine Schätze und freute sich über Lob und Anerkennung, das Seelenbrot eines jeden Sammlers.
»Es wäre mir eine ganz besondere Freude, Sie in meinem Haus begrüßen und Ihnen meine Sammlung zeigen zu dürfen, verehrte Frau Merian.« Simon Schijnvoet deutete eine Verneigung an. »Sollen wir sagen, heute in einer Woche?«
»Wie außerordentlich großzügig von Ihnen, Herr Schijnvoet. Wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht, würde ich Ihre Sammlung nächste Woche gern besuchen.«
Da war sie also, die Chance, in die für sie so wichtigen Kreise eingeführt zu werden, Leute kennenzulernen, die in der Stadt etwas zu sagen hatten, die sich für Kunst interessierten und zahlungskräftig und willig waren, dafür Geld auszugeben, mit der sie ihre Leidenschaft für die Natur und deren Erkundung teilen konnte, und bei den Sammlern, über deren Sammlungen sie schon die sonderbarsten Dinge gehört hatte, Tiere und Pflanzen zu sehen, wie sie sie bisher nicht vor Augen bekommen hatte, ja, von deren bloßer Existenz bis jetzt sie nicht einmal gewusst hatte.
»Die Ehre ist ganz meinerseits. Und wenn Ihre Töchter ebenfalls Interesse haben, sind selbstverständlich auch sie mir willkommen.«
Simon Schijnvoet wandte sein Gesicht halb zu Johanna und Dorothea hin. Die beiden erröteten und senkten ihre Augen.
»Da freuen sich die beiden bestimmt. Schließlich arbeiten wir zusammen in unserer Jungfern-Compagnie. Mein wohlgemeinter Dank, Herr Schijnvoet, für Ihr großzügiges Angebot«, sagte Maria Sibylla.
»Wohlan, Frau Merian. Dann überlasse ich die Damen wieder ihrer Arbeit und empfehle mich mit den besten Grüßen.«
Maria Sibylla begleitete Simon Schijnvoet zur Tür.
Kaum hatte er sie hinter sich zugezogen und Maria Sibylla sich wieder umgedreht, platzte es aus Dorothea heraus.
»Ich habe noch nie einen solch schick angezogenen Mann gesehen. Sind euch die verzierten Schnallen an seinen Schuhen aufgefallen? Wie elegant, wie modisch!«
»Meine Lieben, dieser Mann kann sehr wichtig für uns werden«, sagte Maria Sibylla und konnte ihre Freude über den unerwarteten Besuch kaum verhehlen.
»Und ich habe nichts anzuziehen, um dort standesgemäß erscheinen zu können«, befürchtete Johanna.
»Also gut, es wird sowieso Zeit, dass wir die Stadt besser kennenlernen«, sagte Maria Sibylla. »Ich muss mich nach einem gut sortierten Buchhandel mit einer vernünftigen Druckerei umschauen.«
»Da wäre noch diese Sache mit der Gemeinde zu regeln.« Jacob schien sich doch mehr Sorgen zu machen, als er anfangs hatte zugeben wollen, wie Maria Sibylla an diesen Wisch kommen sollte. »Du brauchst die Bestätigung der Stadt, dass du eine Wohnung mieten darfst.«
Kapitel 5
Jacob hatte sich in den Wochen, in denen er schon hier war, mächtig ins Zeug gelegt. Er konnte Maria Sibylla nicht ersparen, dass sie selbst bei der Stadt vorsprechen musste, um an eine Wohnung zu gelangen. Und da gab es noch einen Haken: Eine alleinstehende, zumal geschiedene Frau hatte kein Recht auf eine Wohnung in der Stadt, hatte er in Erfahrung gebracht.
»Nun, dann werde ich mir etwas einfallen lassen müssen«, hatte Maria Sibylla gesagt, als er sie darauf angesprochen hatte. Sie sah die tiefen Falten im Gesicht ihres Schwiegersohns. »Sei nicht so besorgt, das wird schon.«
In Wirklichkeit war Maria Sibylla besorgter, als sie klang. Aber sie vertraute darauf, dass sie bekam, was sie wollte.
»Ich bin doch nicht hierhergekommen, um mich von einer Formalität aufhalten zu lassen. Ich bin hierhergekommen, weil es in Amsterdam seit Jahren die besten Buchdrucker und Kupferstecher der Welt gibt. Wo sonst erleben die Künste und die Wissenschaften eine solche Blüte? Wo kann ich mich also besser niederlassen als im Zentrum der Buchdruckkunst?
Ich brenne darauf, endlich wieder Grabstichel und Pinsel in die Hand zu nehmen, zu kreieren und veröffentlichen zu dürfen. Sechs lange Jahre war mir dies von den Labadisten verwehrt. Verstehst du, ich muss einfach wieder malen, jede Faser in mir lechzt geradezu danach.«
Maria Sibylla unterstrich ihre Worte mit ausladenden Handbewegungen.
»Hast du denn schon konkrete Pläne?«, fragte Jacob. Er wusste, dass Maria Sibylla selten etwas dem Zufall überließ.
»Ja, natürlich! Ich plane den dritten Band meiner Raupen-Bücher. Man kennt sie in den einschlägigen Kreisen in Amsterdam auch, du wirst schon sehen. Ich werde nicht mein Leben lang nur auf Bestellung gefällig Blumen und Tiere malen und danach in Vergessenheit geraten. Ich werde vielmehr meine eigentliche Arbeit fortsetzen, die mir so am Herzen liegt: den Lauf der Natur zu beschreiben, in Text und Bild, und damit Gottes wunderbare Schöpfung in eine Ordnung zu bekommen.«
»Deshalb also Amsterdam«, sagte Jacob.
»Ja, natürlich«, sagte Maria Sibylla im Brustton der Überzeugung. »Außerdem zählt die Stadt in der Zwischenzeit so viel Reiche und Kunstmäzene, dass es doch gelacht wäre, wenn ich meine Kunst hier nicht an den Mann bringen könnte.
Zudem dürfte das der Ort sein, an dem ich am einfachsten zahlungskräftige Schülerinnen für meine Malkurse finden kann, schließlich wollen wir in der Zwischenzeit ja nicht nur trocken Brot essen. Vor allem aber möchte ich mit den besten Buchdruckern zusammenarbeiten. In dieser Hinsicht bin ich wohl von zu Hause sehr verwöhnt. Schließlich galt mein Vater als einer der größten Kupferstecher und Drucker, die es jemals gab. Und warum sollte ich Kompromisse eingehen, wenn ich selbst etwas Einzigartiges schaffen kann?«
»Gründe zuhauf also, um nach Amsterdam zu ziehen«, sagte Jacob und hoffte, dass sie es schaffen würde, die Klippen der Bürokratie zu umschiffen. Jedenfalls hatten sie noch eine Menge vor, und er mahnte zur Eile.
Schließlich wollte Maria Sibylla nicht nur ins Rathaus, um sich die Bestätigung für die Wohnung zu holen. Sie wollte, wenn sie schon einmal in der Nähe war, auch die Gelegenheit nutzen, Buchhändler und Drucker kennenlernen.
Als Maria Sibylla mit ihren Töchtern und Jacob aus dem Haus ging, staunten sie nicht schlecht. Die Vijzelgracht erwies sich tagsüber als umtriebige Gracht. Schiffe löschten ihre Ladung in die Packhäuser oder fuhren noch weiter in die Stadt hinein. Andere kamen von dort, schon wieder vollgestaut mit Waren, um sie zu ihren neuen Eigentümern irgendwo ins holländische Hinterland oder in ferne Orte auf anderen Kontinenten zu bringen, so weit die Handelsbeziehungen Amsterdams reichten.
Sie gingen Richtung Norden und kamen schon nach kurzer Zeit auf einen ausladenden, länglich angelegten Platz, den Schapenplein, auf dem links ein etwas verloren wirkender, großer Turm mit einem angebauten stattlichen Gebäude stand. Früher verlief hier die Stadtmauer, mit der Erweiterung der Stadt hatte der Turm seine ursprüngliche Funktion verloren.
Sie hatten den Platz gerade erst betreten, als vom Carillon aus dem Turm eine Melodie erklang. Vorbeigänger strömten auf den Platz, um ihn in Richtung Osten in die Doelensluis, Amstel oder Reguliersdwarsstraat wieder zu verlassen. Andere eilten in die entgegengesetzte Richtung. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, und niemand außer den Neuankömmlingen schien dem Carillon besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
»Kommt, wir gehen hier weiter«, sagte Jacob und zeigte Richtung Norden auf das Rokin.
»Sollen wir gleich zum Rathaus gehen, um dich als Wohnungssuchende einzuschreiben, oder möchtest du erst bei Buchhändlern vorbeischauen? Die meisten haben ihre Werkstätten und Läden in direkter Nähe des Rathauses«, fragte Jacob.
»Lass uns zuerst ins Rathaus gehen, dann haben wir das hinter uns.«
Maria Sibylla wollte sich für die Buchhändler und Drucker Zeit nehmen. Schließlich ging es darum, sich die besten für eine Zusammenarbeit auszusuchen.
Kaum hatten sie den Platz überquert und waren in den Rokin eingebogen, schien es, als bevölkerten hier noch mehr Menschen die Straße als an der Vijzelgracht oder dem Schapenplein.
»Aus dem Weg, Mensch!«, hörte Maria Sibylla plötzlich eine raue Männerstimme hinter sich rufen. Sie drehte sich um und sah drei breitschultrige Arbeiter auf sich zukommen, die riesige Fässer vor sich herrollten.
»Habt ihr keine Augen im Kopf? Auf die Seite, verdammt nochmal!«
Maria Sibylla und ihre Töchter sprangen einen Schritt zur Seite und drückten sich gegen die Häuserwand. Die Männer rollten die Fässer über die Straße von der Kade zum Bodenspeicher. Die Arbeiter waren raue Burschen und konnten sich einen Spaß daraus machen, unbedarften Frauen einen Schreck einzujagen oder ihnen wenigstens ein paar schlüpfrige Bemerkungen unter heiserem Lachen hinterherzurufen. Mit Jacob als Begleitung waren sie dieses Mal wenigstens davor gefeilt.
»Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Macht, dass ihr hier wegkommt!«, brüllte ein anderer Arbeiter sie an und wies mit ausgestrecktem Arm nach oben.
Maria Sibylla sah hinauf. Sie standen direkt unter einem prall gefüllten Sack, der nur an einem dicken Tau hing. Wenn er fiele, würde er sie unter sich begraben. Maria Sibylla trat rasch von der Häuserwand zurück auf die Straße, zog ihre Töchter mit sich, und war froh, dass der Kutscher, der hier auf sie zukam, seinem Pferd rechtzeitig die Zügel straffte.
Maria Sibylla atmete erst mal tief durch. Solch eine Umtriebigkeit hatte sie noch nie erlebt.
»Da ist man ja seines Lebens nicht mehr sicher«, sagte Maria Sibylla, schaute zurück und sah, wie der Sack beinahe die Höhe von der aufgeschlagenen Flügeltür erreicht hatte, in denen andere Arbeiter schon darauf warteten, den Sack in Empfang zu nehmen und ins Innere zu ziehen. Auf der Straße zogen die Arbeiter über einen Flaschenzug in gleichmäßigen Zügen an dem Tau die kostbare Fracht nach oben.
»Deshalb sind die Häuser hier so schief gebaut«, sagte Dorothea langsam.
»Würde man die Fassaden nicht etwas nach vorne gebeugt bauen, würde wahrscheinlich die Hälfte der getakelten Fracht an den Häuserwänden zerschellen«, erklärte Jacob.
»Was ist denn das?«, rief Johanna erstaunt aus.
Maria Sibylla schaute in die Richtung, in die Johanna zeigte, weiter nach Norden auf den Rokin hinein.
»Lasst uns weitergehen«, sagte Jacob rasch, winkte zum Zeichen, dass sie ihm folgen sollten, und ging los. Nach ein paar Schritten drehte er sich um und sah, dass die drei noch immer an derselben Stelle standen und auf das Gebäude vor ihnen starrten.
»So etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte Dorothea und sprach damit aus, was auch Maria Sibylla dachte.
Zwischen den Schiffsmasten hindurch sahen sie ein eindrucksvolles Gebäude, das sich über das Wasser spannte. Der Eingang des Prachtbaus diente gleichzeitig als Brücke, an deren höchsten Punkt das Stadtwappen Amsterdams prangte.
Der Brückenbogen war so hoch gebaut, dass zumindest Boote und kleinere Schiffe mit einem beweglichen Mast hindurchfahren konnten. Der Innenhof war umrahmt von Rundbögen, die mit einem überdachten Gang entlang der Mauern offenen Einblick auf den Hof gab. Dort standen überall in ihre dunklen Umhänge gekleidete Männer, manche von ihnen trugen Schwerter, die in kleineren Gruppen eifrig miteinander diskutierten.
»Unglaublich«, brachte Maria Sibylla hervor. »Ist das eine Kirche?«
»Der Einzige, der hier angebetet wird, ist der schnöde Mamon«, sagte Jacob. »Das hier ist die Börse.«
»Die was?«, fragte Dorothea. Jacob erklärte ihr das noch recht neue Prinzip des Wertpapierhandels, den sich dauernd ändernden Wert eines Rohstoffes oder Produkts.
Maria Sibylla begriff, warum sich die Gesprächsfetzen der vorbeilaufenden Herren um Kaffeebohnen und Zucker drehten. Über erwartete Ankünfte von Schiffen aus dem »Osten« und wie gefüllt deren Laderäume sein mochten. Maria Sibylla wunderte sich darüber, was diese Herren arbeiteten. Mit solchen Spekulationen ließ sich vielleicht Geld verdienen, aber befriedigend konnte das nicht sein. Nur darauf zu wetten, was morgen oder übermorgen der Preis für dies oder das sein würde, schaffte ja noch keinen Wert. Es trug nichts bei zu dieser Welt. Würde sie so etwas tun, sie wäre todunglücklich. Worin lag nur der Sinn dieses Spekulierens, dieses modernen Börsengetues? Nur wenn man etwas machte, etwas kreierte, erkundete, erfand, hatte man doch etwas zum Leben beigetragen, zum Miteinander.
Wie auch immer, dachte Maria Sibylla, was mein Ziel ist, das weiß ich ganz genau.
»Nehmen diese Schiffe nach Übersee nur Waren auf oder transportieren sie auch Passagiere?«, fragte Maria Sibylla vorsichtig.
»Beides«, antwortete Jacob.
»Jetzt fang doch nicht schon wieder damit an, Mutter«, sagte Dorothea halb verärgert, halb ängstlich. Jacob schaute sie fragend an.
»Meine Mutter hat diesen irrsinnigen Wunschtraum, einmal nach Suriname zu reisen«, klärte ihn Johanna auf.
»Träumen darf man ja wohl noch«, sagte Maria Sibylla und schaute auf die Schiffe, die an der Kade lagen.
»Und was soll dann aus uns werden, solange du weg bist? Wir können doch nicht einfach ohne dich weiterarbeiten?« Dorothea schmiegte sich an ihre Mutter.
Maria Sibylla seufzte und drückte sie an sich. Tatsächlich hatte sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was in der Zwischenzeit wohl mit ihrer Jungfern-Compagnie geschehen würde, wenn sie es tatsächlich schaffte, eine solche Reise anzutreten. Ob ihre Töchter die Unternehmung allein führen könnten? Aber vor allem Dorothea musste noch viel lernen, und Johanna besaß nicht Maria Sibyllas Unternehmergeist, war bei Verhandlungen noch nicht stark genug. Vor allem als Frau musste sie darauf achten, dass die Männer sie als Verhandlungspartnerin ernst nahmen und sie nicht einfach über den Tisch zogen.
»Kommt, wir sollten weiter«, versuchte Jacob, die drei auf andere Gedanken zu bringen und sie an das Ziel des heutigen Tages zu erinnern. »Nur noch an der Längsseite der Börse entlang, und dann sind wir auch schon auf dem Dam, dem Platz, auf dem das Rathaus steht.«
Tatsächlich standen sie schon wenige Häuser weiter auf einem großen Platz. Hier ging der Rokin über in den Damrak, wandelte sich von einer schmalen Straße in einen weiträumigen Platz, dem umtriebigsten Ort der Stadt, ihrem Herz.
Jacob zeigte, sobald sie in den Platz einbogen, nach links.
Während die drei noch über das Börsengebäude staunten, überstieg das, was sie jetzt sahen, schlicht ihr Vorstellungsvermögen.
Vor ihnen stand ein großes, noch recht neues Gebäude und beherrschte vom Rand der westlichen Seite aus den gesamten Platz, als ob dieser nur hierfür geschaffen sei. Das sechsstöckige Bauwerk strahlte eine enorme Autorität aus. Das Sinnbild für den Reichtum der Stadt, den sie mit ihrem Handelsgeist in Übersee erlangt hatte.
»Ein Königspalast wie im Märchen«, hauchte Johanna ehrfürchtig.
»Holland hat keinen König, nur einen Statthalter«, sagte Jacob. »Das ist das Rathaus. Das alte ist abgebrannt, und da sie wohl nicht mehr wussten, wohin mit ihrem Reichtum und ihrem Stolz, haben sie sich für diesen Prunkbau entschieden.« Er fügte scherzhaft hinzu: »Du darfst deinen Mund auch wieder schließen, Johanna.« Sie errötete leicht.
Maria Sibylla wandte den Blick vom Rathaus ab und schaute sich um.
»Das bedeutet ja wohl, dass hier eine Menge Geld umgeht und dass die Künste und die Wissenschaft hier tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen könnten«, sagte sie mehr zu sich selbst.
Ihr Blick schweifte über die immensen Gebäude und den Platz, in dessen Mitte sie standen. Die schiere Größe von allem, der Reichtum, der hier zu herrschen schien, das scheinbar unablässige bunte Treiben auf den Straßen, das alles überwältige Maria Sibylla. Kinder spielten mitten auf dem Platz, Männer gingen an ihnen vorbei und waren miteinander in Gespräche über die Börse vertieft, Frauen flanierten in bunten, auffallenden Kleidern vorüber.
Maria Sibylla registrierte, dass sich ihre Töchter sichtlich für ihre einfache Kleidung schämten, die sie am Leib trugen und die so gar nicht der hiesigen Mode zu entsprechen schien. Zeit, sich hierüber Gedanken zu machen, blieb ihr nicht.
Auf dem Dam wurde vor allem Handel getrieben. Gemüsefrauen boten ihre Ware aus den Handkarren heraus feil, andere verkauften Kräuter, die sie in geflochtenen Körben bei sich trugen. Bäcker priesen ihr in Karren gestapeltes Brot, Kinder tobten auf dem Platz herum, ihre Mütter versuchten meist vergeblich, sie einzufangen, andere spielten mit Murmeln an Häuserwänden. Der Geruch der Kräuter und des frischen Brotes vermischte sich mit dem Salz des Meeres. Möwen flogen über ihre Köpfe hinweg, in der Hoffnung, etwas Essbares aufpicken zu können.
Matrosen rollten schwere Fässer aus den Bootsanlegern, die sich dem Rathaus an der gegenüberliegenden Seite des Platzes befanden. Dieses Mal standen sie nicht im Weg, sondern konnten ihnen aus sicherer Entfernung bei ihrer Arbeit zusehen. Dazwischen stand ein schon fast klein wirkendes Gebäude, in das die Seemänner die Fässer rollten. Es war die größte Waage der Stadt.
Oben auf der Treppe zum ersten Stockwerk stand ein Wachturm und vor ihm eine Handvoll bewaffneter Soldaten, die darauf achteten, dass das muntere Treiben in ruhigen Bahnen verlief.
»Ich glaube, ich habe in den sechs Jahren in Wieuwert nicht so viele Menschen gesehen wie in dieser letzten Stunde«, sagte Maria Sibylla und stöhnte auf.
Kapitel 6
Die Angelegenheit im Rathaus war schnell erledigt, wenn es auch einige Zeit brauchte, bis Maria Sibylla und Jacob sich in diesem riesigen Gebäude zurechtfanden. Nachdem sie endlich das richtige Zimmer gefunden hatte, wurde sie für ein fehlendes Formular in eine weitere Amtsstube geschickt. Bei der Einschreibung als Wohnungssuchende zögerte sie einen Moment, als sie gefragt wurde, wie es um ihren Familienstand bestellt sei. Dann gab sie kurzerhand an, dass sie Witwe und ihr Mann in Deutschland gestorben sei. So würde man der Sache auch nicht weiter nachgehen, kalkulierte sie. Das bewahrte Maria Sibylla vor peinlichen Fragen. Auch half es, dass Jacob mit ihr war. Er verwies darauf, dass er schon ein Auge auf eine Wohnung geworfen, mit dem Eigentümer gesprochen habe und dass die Einkünfte Maria Sibyllas durchaus zureichend seien und somit einer Einigung mit dem Hauseigentümer nichts mehr im Wege stehe.
Erleichtert verließen die beiden das Rathaus und stießen wieder zu Johanna und Dorothea. Die standen nur ein paar Meter vom Eingang entfernt, genossen den Trubel und wirkten neugierig auf dieses neue Leben in Amsterdam, das nun vor ihnen lag.
»Es gibt hier um das Rathaus herum einige Buchhändler. Einer gleich hier um die Ecke am Beginn der Kalverstraat«, sagte Jacob. Sie überquerten den Platz wieder Richtung Rokin, bogen aber kurz davor rechts in eine Seitenstraße ein. Nach nur wenigen Minuten standen sie vor der Buchhandlung.
Maria Sibylla öffnete die Tür und wollte gerade eintreten, als ihr ein Lehrling mit einer langen Schürze entgegenkam. Er verneigte und entschuldigte sich dafür, dass der Meister im Moment leider nicht zugegen sei, sie sollten um die Mittagsstunde noch einmal vorbeischauen.
Währenddessen schaute sich Maria Sibylla in dem Raum um, sah die Druckerpresse und auf einem langgezogenen Tisch Grabstichel neben einigen Kupferplatten liegen. Vor einer der Kupferplatten saß ein Mann vornübergebeugt und führte tief konzentriert den Stichel in das Kupfer. Er ließ sich von dem Besuch nicht im Geringsten stören, schaute nicht einmal auf und sprach kein Wort, setzte nur immer wieder mit ruhiger, aber bestimmter Hand den Grabstichel an und ritzte lange, gleichmäßige Striche ins Kupfer. An der Wand hingen Drucke von Stadtansichten. Nur allzu gut kannte Maria Sibylla solche Blätter von ihrem Vater, der darin zu wahrer Meisterschaft gelangt und weit über die Grenzen Deutschlands bekannt geworden war. Vielleicht waren es diese Drucke, die ihr ein vertrautes Gefühl vermittelten. Vielleicht war es auch die Aufgeräumtheit, die der ganze Raum ausstrahlte, das konzentrierte Arbeiten des Kupferstechers. Sie hatte das Gefühl, dass dies ein Ort war, der dazu beitrug, dass Amsterdam den Ruf erstklassiger Kupferstecher, Buchmacher und Verleger hatte. Ein Ort, an dem auch sie neu anfangen konnte. Maria Sibylla dankte dem Lehrling und versicherte ihm, später wiederzukommen.
»Wenn du noch einen anderen Buchhändler kennenlernen möchtest«, schlug Jacob vor, »ich habe von einem gehört, der nur ein paar Straßenzüge weiter arbeitet. Er ist wohl recht umtriebig und dafür bekannt, dass er viele Bücher verlegt.«
»Ja, gerne«, meinte Maria Sibylla, »das kann ja nicht schaden.«
Sie bogen rechts in den schmalen Gapersteeg ab, der die Kalverstraat mit dem Rokin verband, gingen auf der Brücke vor der Börse über die Gracht, auf der noch immer jede Menge Betrieb herrschte, und liefen auf der Nes ein kleines Stückchen in südliche Richtung.
Schon nach ein paar Schritten rümpfte Dorothea die Nase. Zwar hatten sie sich allmählich an den Fäkaliengestank aus den Grachten gewöhnt, aber hier kam noch ein weiterer unangenehmer Geruch hinzu, der immer stärker wurde. Dorothea hielt sich angeekelt die Hand vor die Nase.
»Was ist denn das nur für ein fürchterlicher Gestank!«
»Dorothea, zunächst einmal ist es für uns, die wir die Natur untersuchen, einfach nur ein Geruch. Wir verbinden keine Werte damit, nehmen nur wahr«, sagte Maria Sibylla etwas strenger, als sie beabsichtigt hatte. »Das ist außerordentlich wichtig für unsere Arbeit, verstehst du? Wenn wir nicht neutral auf die Dinge sehen können, würde uns viel verborgen bleiben. Ein vorschnelles Urteil macht dich blind. Versuche den Geruch einzuatmen und zu erkennen, was du eigentlich riechst.«
Maria Sibylla war es wichtig, dass Dorothea lernte, so zu denken. Schließlich sollte sie mit ihr und Johanna zusammenarbeiten, und das bedeutete nun mal weit mehr, als nur am Zeichentisch zu sitzen.
Dorothea blieb stehen. Sie atmete ein, versuchte, ihren Ekel zu verdrängen und zu ergründen, welche Gerüche sie wahrnahm.
Auch die anderen blieben stehen und beobachteten sie.
»Fisch«, sagte Dorothea schließlich. »Ich rieche Fisch.« Und nach einer kurzen Pause: »Aber auch noch irgendetwas anderes.«
»Ich denke, du hast recht«, bestätigte Maria Sibylla stolz. Es freute sie, dass ihre Jüngste so lernbegierig war. »Lasst uns weitergehen und schauen, was wir antreffen.«
Als sie an der Kreuzung zum Sint Pietershalsteeg standen, wurde ihnen der Grund des penetranten Geruchs klar: Sie standen vor dem Fischmarkt der Stadt. Die Stände befanden sich in der Mitte des Stegs wie auch links und rechts an die Häuserwände angelehnt. Kurioserweise befanden sich in den beiden Gebäuden links und rechts des Marktes Fleischhallen. Knechte liefen mit großen, manchmal noch blutigen Fleischstücken über der Schulter aus den großen Flügeltüren, legten sie auf Karren und gingen davon. So erklärte sich auch der andere Geruch, den Dorothea zunächst nicht hatte deuten können.
Nicht nur das olfaktorische Erlebnis nahm an Intensität zu, auch der Lärmpegel war auf dem Markt wesentlich höher. Marktfrauen priesen ihre Ware in den höchsten Tönen und vor allem lautstark an, was sie nicht hinderte, immer wieder auch derbe Witze über die Vorbeigehenden zu reißen, die sich nicht zu einem Kauf bei ihnen entscheiden konnten.
»Da laufen ja Störche!«, sagte Johanna verwundert und zeigte auf eines der gefiederten Tiere.