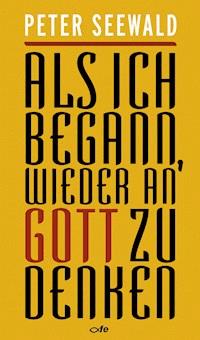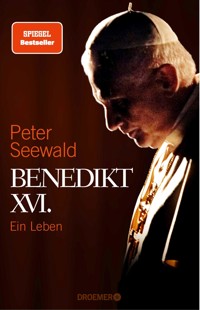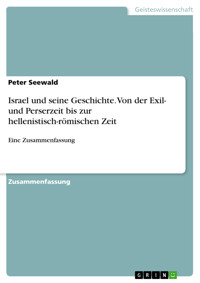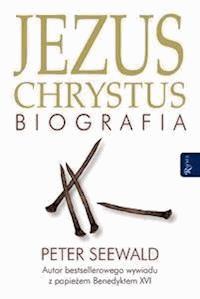Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die maximale Tragödie – so sehen viele Menschen den Tod. Peter Seewald ist überzeugt: Der Verlust des Jenseitsglaubens hat unsere Gesellschaft in eine existenzielle Leere gestürzt. Viele leben, als ob das Leben auf dieser Erde alles wäre. Doch was, wenn das Beste erst noch kommt? Lebensklug und mit Humor begibt sich Seewald auf eine Spurensuche zu dem größten Trip unseres Lebens. Er hinterfragt den Traum von Longevity und ewiger Jugend und prangert eine Anti-Aging-Kultur an, die das Alter zur Krankheit erklärt. Zugleich ergründet er, warum es klug ist, das Leben vom Ende her zu denken. Wenn der Himmel keine Utopie ist, verändert diese Hoffnung alles. Dann sind wir wertvoll und bleiben es. Ein aufrüttelndes Plädoyer für einen radikalen Perspektivwechsel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Peter Seewald
Die Entdeckung der Ewigkeit
Vom Leben auf Erden und dem Himmel darüber
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: © FinePic
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print 978-3-451-60148-4
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-84038-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-84039-5
»Der Mensch braucht die Ewigkeit, jede andere Hoffnung ist für ihn zu kurz. Dass es diese Zukunft gibt, ändert die Gegenwart.«
Benedikt XVI.
Inhalt
Vorwort
1 Und plötzlich bist du weg
2 Die Stunde der Wahrheit
3 Jetzt und dann
4 Eine Frage der Endlichkeit
5 Zwischendurch: Reisefieber
6 Vom Ende her denken
7 Nicht mehr meine Welt
8 Der veruntreute Himmel
9 Mensch vom Menschen
10 Das höchste aller Ziele
11 Die Entdeckung der Ewigkeit
12 Das Beste kommt noch
Bibliografie
Über den Autor
Über das Buch
Vorwort
Es gibt nicht diesen einen Moment, in dem man sich entschließt, alt zu sein. Es passiert. Wie ein Geräusch, das langsam leiser wird.
Nicht nur der Körper, auch das Verhältnis zur Zeit verändert sich. Tage werden kürzer, Jahre schneller. Das Schöne ist, was man an Spannkraft verliert, wird ausgeglichen durch Dinge, nach denen man sich ewig sehnte: Zufriedenheit, Gelassenheit, die monatliche Rente. Und Einsichten wie, dass Verzeihen stärker ist als Rechthaben.
Vielleicht geht es im Leben nicht darum, es zu verlängern, sondern darum, es zu begreifen. In seiner Schönheit. In seinem Schwinden. Wir reden vom Tod, als sei er das Problem. Aber vielleicht ist es das Leben, das uns überfordert.
Einmal, vor Jahren, hörte ich einen Pater sagen: »Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Moment, in dem Gott uns anblickt.« Es war einer dieser Sätze, die später in einem Kopf kreisen, leise, aber hartnäckig. Durch den Tod zum Leben. Ist das so? Oder ist es ganz anders? Etwa so, wie es der österreichische Lyriker Ernst Jandl beschrieb: »Jetzt sind wir die Menschen auf den Wiesen … dann sind wir die Menschen unter den Wiesen«?
Weltweit sterben jährlich fünfzig bis sechzig Millionen Menschen. Pro Tag sind das bis zu 164 000 Mitbürger, die uns für immer verlassen. Wie brüchig unsere Existenz ist, hat nicht nur die Corona-Pandemie mit ihren sieben Millionen Toten vor Augen geführt. Zwingt uns die veränderte Welt nicht geradezu, Altern und Sterben neu zu denken? Durch Kriege, Umweltkatastrophen, eine moderne Medizin, die noch Halbtote der Pein einer Chemotherapie aussetzt? Nicht zuletzt durch die in die Jahre gekommenen Babyboomer, der größten Kohorte aller Zeiten, die nun merken, dass sie sich so schwer tun mit dem Altern wie noch keine Generation zuvor. Und mit dem Sterben erst recht.
Seltsam, auch wenn ich jedes Jahr an Allerheiligen am Grab meiner Eltern stand, der Tod hatte mich nie sonderlich beschäftigt. Vielleicht als theologische Herausforderung, aber nicht als etwas, das mich persönlich betrifft. Über das definitiv größte Ereignis meines Lebens wusste ich so gut wie nichts. Was geschieht mit mir, wachte ich eines Nachts erschrocken auf, wenn ich einmal für immer die Augen schließe? Bin ich dann: nichts? Sollte unsere Existenz tatsächlich so banal und am Ende so hoffnungslos, ja erbärmlich sein?
Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll meinte, wir hätten nur deshalb eine Sehnsucht nach dem ganz Anderen in uns, nach zeitlosem Glück und Gerechtigkeit, weil »wir alle eigentlich wissen – auch wenn wir es nicht zugeben –, dass wir hier auf der Erde nicht ganz zu Hause sind. Dass wir also noch woanders hingehören.«
Wer stirbt, ist noch lange nicht tot, sagt der Glaube (übrigens in allen Religionen der Welt). Schon die Höhlenbewohner waren überzeugt, dass das, was den Menschen ausmacht, niemals verloren gehen kann. Im Alten Ägypten galt der Tod keineswegs als das Stopp-Schild am Ende einer Sackgasse. Die antiken Philosophen bewiesen allein durch Logik, dass zumindest die Seele nicht sterben kann. Doch erst die Erscheinung Christi hatte die Macht, alles, was zuvor über die Ewigkeit gedacht, geglaubt und philosophiert wurde, zu überhöhen und Gewissheit zu schaffen.
Nie wurde Größeres verkündet. Der Mensch ist nicht für den Untergang ins Leben gerufen, so die Botschaft des Mannes aus Nazareth, sondern für die Auferstehung. Das Evangelium spricht von Vollendung, nicht von Vernichtung. Sterben heiße, hineingeboren zu werden in ein neues Leben. »Ja, liebe Brüder und Schwestern, vor allem ihr Älteren«, erinnerte Papst Franziskus, »das Beste im Leben liegt noch vor euch.«
Die Auferstehung Christi veränderte die Welt, wie sie noch nie verändert wurde. Ohne Auferstehung kein modernes Europa. Keine allgemeinen Menschenrechte. Keine Kathedralen. Kein Michelangelo, keine »Matthäuspassion« von Bach und keine »Auferstehungs-Symphonie« von Mahler. Jeder Gottesdienst dreht sich im Grunde um Auferstehung. Das ganze Kirchenjahr läuft auf diesen einen Sprengsatz zu, der in der Osternacht explodiert wie ein Feuerwerk. Der Sonntag, der erste Tag der Woche, ist nicht dem Wochenend-Stau auf der Autobahn gewidmet, sondern dem Sieg Christi über den Tod. Und wenn Kirchen gen Orient ausgerichtet sind, der aufgehenden Sonne entgegen, drückt diese »Orientierung« aus: Es ist vollbracht. Die Schranke ist offen. Der Weg in die Ewigkeit ist frei. Zumindest für jene, die da auch hinwollen.
Es macht einen Unterschied, ob man lebt, als ob es nur diese eine so kurze Weile gibt, in der man dann alles hineinpacken muss, was es hineinzupacken gilt, mit aller Hetze und Gereiztheit. Oder ob man sich an Werten orientiert, die weniger auf das Haben und mehr auf das Sein zielen, dass man davon ausgeht, einmal Rechenschaft ablegen zu müssen – aber mit dem Trost lebt, nicht nur Windhauch zu sein, ein unbedeutendes Nichts im Zeitlauf der Evolution, sondern wertvoll zu sein und wertvoll zu bleiben.
Vielleicht müssen wir wieder lernen, im Menschen beide Seiten zu sehen: seine zeitliche und seine ewige. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Glaube gibt uns dabei Hilfen zur Hand, geistige Prinzipien besser verstehen zu können. So zeigt etwa die Quantenphysik, dass es zwischen Geist und Materie keine Barrieren gibt. »Wenn man in diesen subatomaren Bereich schaut«, erläuterte der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der Begründer der Quantenmechanik, »so entdeckt man, dass unsere Welt aus geistigen Strukturen von unglaublicher Schönheit besteht, so dass eigentlich Platon mit seiner Aussage, dass unsere Welt geistig sei und wir nur einen Schatten davon wahrnehmen können, völlig recht hatte.«
Dass wir heute den Jenseitsgedanken mehr und mehr verlieren, ist keine Lappalie, sondern eine gesellschaftliche Katastrophe, und bestimmt nicht die kleinste von allen. Das Bewusstsein um Unsterblichkeit half all den Generationen vor uns, die Grundfragen menschlicher Existenz zu klären. Nach unserem Ursprung. Nach dem Lebenssinn. Nach unserer Berufung. Die Reise zur Entdeckung der Ewigkeit zeigt uns:
Altern ist keine Krankheit, sondern ein Transformationsprozess, der auf ein höheres Level führt.
Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Neubeginn in einer vollendeten Wirklichkeit.
In Würde zu altern und in Würde zu sterben geht nur, wenn wir uns auf diese wichtigen Lebensphasen vorbereiten und sie annehmen.
Mit dem Blick auf die ökologische Situation der Erde haben wir gelernt, vom Ende her zu denken, um unsere Lage zu erkennen. Dieses Prinzip gilt nicht weniger für den Einzelnen, um bemessen zu können, was richtig und wirklich wichtig ist.
Vieles in dem gewaltigen Raum der Schöpfung bleibt im Verborgenen. Fest steht: Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wenn Gott der »Liebhaber des Lebens« ist, wie es das biblische »Buch der Weisheit« bezeugt, ist er der Liebhaber beider Leben. Ist es nicht so? Sobald wir an unser Ende denken, spüren wir gleichzeitig, wie schön und aufregend allein es schon ist, das Leben im Hier und Jetzt leben zu dürfen. Und das, bitte, noch so lange, wie es nur irgendwie geht.
München, Mariä Himmelfahrt 2025 Peter Seewald
1 Und plötzlich bist du weg
Wenn der Horizont des Lebens immer näher rückt
»Alle sind gleich gebrechlich, keiner ist sicherer als die anderen, dass er den nächsten Tag erleben wird.«
Seneca
1
Der Flieger nach Krakau war nicht gerade überbucht. In der Reihe vor mir genoss es ein gut genährter Mann, drei Plätze für sich alleine zu haben, und während die Stewardessen Kaffee servierten, segelte die Maschine so sanft über den Wolken, als läge man auf einem fliegenden Teppich.
Es gab zwei Gründe für meine Reise. Der erste war ein Gelübde. Ich hatte gelobt, in der Kirche der Jasna Góra in Tschenstochau eine Kerze anzuzünden, falls bei der Geburt meines zweiten Enkels alles glattliefe. Inzwischen war der Junge zwei Jahre alt, und ich wollte nicht warten, bis er volljährig ist. Der zweite Grund war, mir eine kleine Auszeit zu gönnen. In Krakau warteten das Galicia Jewish Museum und andere Sehenswürdigkeiten, und abends konnte ich im Hotel Polonia erstklassigen Slivovitz trinken.
Als wir unsere Flughöhe erreicht hatten, nahm ich meine Reiselektüre zur Hand, eine abgegriffene Taschenbuchausgabe von Ein Blick ins Nichts. Der niederländische Krimiautor Janwillem van de Wetering hatte darin seine Erfahrungen in einem amerikanischen Zen-Kloster beschrieben. Er suchte »die Erklärung des Lebens« und wollte über »die Bedeutung des Nichtwissens« den Schlüssel zum »Mysterium« finden. Eine der Stellen im Buch ging so:
Schüler: »Kannst du mir das Wesen der Liebe erklären?«
Meister: »Keine Lust.«
Im Kloster lernte Janwillem verschiedene Atemtechniken, fühlte beim Meditieren im Lotussitz höllischen Schmerz in den Beinen und versuchte, mit seinem Kōan, einem bestimmten Ausspruch, den ihm der Meister auftrug, eins zu werden. Vielleicht waren es der samtene Sound des Textes und das Ausgreifen nach dem ganz Anderen, den geheimnisvollen Räumen jenseits des Alltags, die mich am »Blick ins Nichts« faszinierten. Vielleicht auch, mich auf Dinge einzulassen, etwa »auf ein Meer illusorischer Zeit«, über die ich bisher kaum nachgedacht hatte.
Ich war 70 Jahre alt. Verheiratet. Zwei Kinder. Zwei Enkel. In meiner Brieftasche steckte ein Rentnerausweis, und in meinem Elektronischen Postfach landete Werbung für Potenzmittel und Sterbeversicherungen. Ich war weit davon entfernt, in einem Lokal nach dem Seniorenteller zu fragen, aber wenn ich für meine Frau und mich von unserem indischen Restaurant Chicken Tikka Masala holte, genügte uns eine einzige Portion, um satt zu werden. Seltsam: Obwohl wir nur noch halb so viel aßen wie früher, nehmen wir doppelt so schnell zu.
Für die Jüngeren ist man mit 70 ein Grufti, für die Älteren ein Teenager. Solange man sich seine Hosen im Stehen anziehen kann und kein Rollator vor der Tür steht, meinen die Älteren herablassend, zählt man zur Jugend. Ich selbst fand mich zu jung, um mich alt zu fühlen, und gleichzeitig zu alt, um mich jung zu fühlen. Anti-Aging war eher nicht mein Ding, sondern Aging. Um darin zu wachsen. Alt und würdig und weise und milde zu werden. »Das Alter ist für mich kein Kerker«, so drückte es die Dichterin Marie Luise Kaschnitz aus, »sondern ein Balkon, von dem man zugleich weiter und genauer sieht.« Doch ohne es anfangs bemerkt zu haben, hatte ich angefangen, mehr und mehr weniger zu werden.
Während Begleiterscheinungen wie Arthritis und nächtlicher Harndrang zunahmen, verlor ich täglich an Körpergröße. Die Hände wurden runzeliger, das Gedächtnis bekam Löcher, und wenn ich mit meinem Freund Christian telefonierte, klang das immer häufiger wie eine Neuauflage der beiden Alten aus der Muppet Show:
»Boris Becker hat doch diesen serbischen Tennisspieler trainiert. Wie hieß der noch mal?«
»Novosibirsk?«
»Nee. Irgendwas mit ... fällt mir grad nicht ein. Aber wie hieß doch gerade der Franzose, der Winnetou gespielt hat.«
»Jean-Paul Belmondo, oder?«
»Altern heißt, sich über sich selbst klar zu werden«, schrieb Simone de Beauvoir. Aber wie soll das gehen, wenn alles um einen herum mehr und mehr von einem Schleier der Vergesslichkeit überzogen ist? In unserem Eisfach barsten Prosecco-Flaschen, die ich mal kurz kaltstellen wollte, weil die Erinnerung an sie wie durch Zauberkraft aus meinem Gedächtnis verschwunden war. Im Supermarkt verließ ich den Getränkeautomaten, ohne darauf zu achten, die Pfandtaste zu drücken. Meine Lesefehler bei der Zeitungslektüre machten aus Rom, der »Hauptstadt der Krippen«, eine »Hauptstadt der Kippen«, aus »vier Tore in 22 Minuten« umgehend »vier Tote in 22 Minuten«. Der Klassiker: Wo ist die Brille, die Brieftasche, der Zahnstocher … Es kostete eine halbe Ewigkeit, etwas zu suchen, das man 30 Sekunden zuvor irgendwo abgelegt hatte. Goethe nannte es das »stufenweise Zurücktreten aus der Erscheinung«.
Angeblich altert man im vierten, siebten und achten Lebensjahrzehnt am allerschnellsten. Auch Angst macht alt, sagt die Wissenschaft, und Einsamkeit sowieso. Hoher Alkoholkonsum, hieß es in einer Studie, könne bei Männern die Lebenszeit um 3,1 Jahre verkürzen. Seltsamerweise bei Frauen nur um 1,0 Jahre. Und wer als Mann ab einem Alter von 40 täglich mehr als 10 Zigaretten qualmt, verliert 9,4 Lebensjahre, bei einer Frau sind es 7,3. Fiese Typen wiederum sind laut eines Forscherteams aus Neuseeland fünf Jahre schneller am Exit-Point als nette. Typisch für alte Leute, hatte ich irgendwo gelesen, seien im Übrigen Schwerhörigkeit, Sehschwäche, Schlafstörungen und der Missbrauch von Alkohol und Medikamenten. Wahnhafte Störungen kämen hingegen eher selten vor.
Auch das Vergessen kostet Lebenszeit. Andererseits ist Vergesslichkeit nach ärztlicher Erkenntnis für ein funktionierendes Gehirn sogar existentiell. Schließlich müsse in all dem Müll und Geschwätz von gestern wieder Platz für Neues geschaffen werden. »Oh ja. Ich singe plötzlich längst vergessene Kinderlieder«, berichtete die Künstlerin Mary Baumeister, als sie 86 geworden war. »Dieses Rückwärtsgehen im Kopf, das ist eine Gnade.«
In der Summe sind es 30 bis 40 Prozesse, die uns alt und gebrechlich machen. Schon ab 25 Jahren nimmt die Fruchtbarkeit der Frau ab. Beim Mann sinkt der Testosteronspiegel. Zwischen 30 und 40 beginnt der Knochenabbau den -aufbau zu überwiegen. Mit 65 sind in Europa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung dement. In der Altersgruppe 80 bis 85 sind es laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 14 Prozent. Ein junger Körper verfügt über rund 100 Billionen Zellen. Um alle zu zählen, bräuchte man mehr als 3 Millionen Jahre, rechnet der Krebsforscher Oliver Müller vor. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird das Zählen leichter, weil es dann eine Million Zellen weniger gibt. Pro Sekunde. Sie werden nicht mehr repariert oder ersetzt, und der Zug, in dem die restlichen Zellen sitzen, rast unweigerlich Richtung Finsternis.
Tag für Tag sterben weltweit etwa 170.000 Menschen, rund 62 Millionen pro Jahr. Das entspricht der Bevölkerung von Schweden, Norwegen, Belgien, Österreich und Australien zusammen. Viele davon durch Unfälle, Gewalt, Krieg, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und irgendeiner Form von Demenz. Häufigste Todesursache nach wie vor: Abtreibung. Ihr fallen nach Schätzungen der WHO jedes Jahr 73 Millionen Ungeborene zum Opfer. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben nimmt ab dem 20. Lebensjahr langsam ab, ab dem 35. Lebensjahr aber leider wieder zu. Wer es jedoch schafft, 70 zu werden, hat viele der Gefahren überlebt, die seinen Zeitgenossen zum Verhängnis wurden. Anders gesagt: Je älter ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch älter werde.
Der uneinholbare Rekordmeister, der für immer älteste Mensch der Welt also, war biblischen Aufzeichnungen zufolge Methusalem. Er starb mit 969 Jahren. Wie viele Kinder und Frauen er hatte, ist nicht überliefert. Stammvater Abraham schaffte noch 175 Jahre. Danach ging es steil bergab. Während das langlebigste Wirbeltier des Planeten, der Grönlandhai, es auf eine Lebenszeit von 500 Jahren bringt (die heute lebenden Exemplare waren also bereits auf der Welt, als Michelangelo seine Statue »David« präsentierte und Christoph Columbus auf seiner letzten Expedition auf Jamaika strandete), kam der Mensch des Mittelalters noch auf einen Schnitt von 35, und nur wenige Menschen wurden über 70 Jahre alt. Dabei blieb es erst mal. Bis sich innerhalb eines einzigen Jahrhunderts, von 1870 bis 1970, die durchschnittliche Lebenszeit auf rund 70 Jahre verdoppelte. Heute liegt sie in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei Männern bei 78,2, bei Frauen bei 83,0 Jahren.
Der amtlich bezeugte älteste Mensch unserer Zeit ist Jeanne Louise Calment aus der Provence. Sie starb 1997 mit 122 Jahren. Jeanne Louise hatte nie auch nur einen Tag gearbeitet. Niemals verzichtete sie auf den Genuss ihrer Zigaretten. Sie aß jede Woche ein Kilo Schokolade, trank jeden Tag nach dem Mittagessen ein Glas Portwein – und erfreute sich bis zum Schluss einer robusten Gesundheit. »Ich hatte nie mehr als eine Falte«, kokettierte sie noch als Hundertjährige, »und auf der sitze ich.«
Madame Calment verhalf ihr hohes Alter im Übrigen zu einem vortrefflichen Geschäft. Als sie 1965 in finanzielle Schwierigkeiten geriet, übernahm ein Anwalt ihre Wohnung auf Leibrente. Kein schlechter Deal, dachte sich der Jurist. Die alte Dame war immerhin schon 90. Am Ende starb der Anwalt vor ihr, und zwar 30 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrags. Er hatte 900.000 Francs für eine Wohnung bezahlt, die er nie beziehen konnte.
Bisher zweitältester Mensch ist die Klosterschwester André aus Südfrankreich. Sie wurde 118 Jahre alt. Als ein Reporter sie nach dem Geheimnis ihres langen Lebens fragte, meinte sie: »Der liebe Gott will mich nicht.«
Älter werden ist so eine Sache. Als 15-Jähriger findet man es cool, als 30-Jähriger bereits bedenklich. Noch keine Generation tat sich allerdings so schwer damit wie die meine, die der Babyboomer, der geburtenstärksten Jahrgänge aller Zeiten. Geniale Idee: Um langsamer zu altern, deklarierten wir fünfzig als das neue vierzig, sechzig als das neue fünfzig. Mit siebzig ist man kein Senior oder Rentner, sondern Gold- oder Super-Ager, lässt sich sein erstes Tattoo stechen und träumt ungeachtet dessen, dass man bereits mit einem Fuß in der Grube steht, davon, sich mit dem Austausch des Partners neu zu »erfinden«.
Altern. Für meine Freundin Susanne hieß das, künftig Klassentreffen ähnlich zu meiden wie Straßenkreuzungen ohne Ampeln. Alle würden hier nur noch über neue Kniegelenke, Hüftprobleme und überstandene Herzinfarkte sprechen. Natürlich falle es auch ihr inzwischen »brutal viel schwerer«, mit dem Alter umzugehen, schrieb sie in einem Beitrag für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Immerhin lägen drei Viertel ihres Lebens nun schon hinter ihr. Mit Floskeln wie: »dass man immer nur so jung ist, wie man sich fühlt«, dürfe man ihr allerdings nicht kommen. Oder auch – ganz schlimm –, »dass man nicht alles so negativ sehen soll«. »Verdrängt das Alter«, rief Susanne ihren Lesern zu. Denn was, bitte, sei »reizvoll daran, auf den Pflegedienst zu warten, der siebeneinhalb Minuten Zeit hat, einem die Windel zu wechseln, die Blutdrucktabletten in die Hand zu zählen und tschüss?«
Ich hatte mir vorgenommen, möglichst wenig zu klagen. Mein Gott, die Welt ist schön. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Was sollte schon passieren? Aber dann saß ich im Wartezimmer eines Internisten und bewunderte 70 Minuten lang geduldige Mitpatienten mit Krücken oder Turbans aus weißem Verbandszeug auf dem Kopf. Als mir eine Praxisangestellte Blut aus den Adern zapfte, musste ich an die Berge von Zigaretten denken, die ich im Laufe der Jahre vernichtet und die Seen von Bier, Wein und Calvados, die ich trockengelegt hatte. 30 Jahre Vollgas. Schlafentzug wie in einem sibirischen Gulag. Der Stress mit Deadlines, mit Nachbarn, Kollegen, der eigenen Familie. Gäbe es keine Friedhöfe, müsste ein kontaminierter Körper wie meiner, schoss es mir durch den Kopf, nach dem Exitus auf die Sondermülldeponie.
Nachdem der Arzt meine Lunge abgehört, die Halsschlagader geprüft und meine Blutwerte überflogen hatte, zeigte er sich überrascht: »Ganz erstaunlich«, schüttelte er den Kopf, »wie es aussieht, haben Sie die Organe eines 30-Jährigen. Weiter so! Sie wissen ja: Sport, mediterrane Kost, wenig Alkohol. Alles Gute.«
Durch das Bullauge im Flieger blickte ich auf die schmutziggrauen Wolken, die uns wie aus einer fernen Zukunft entgegenkamen. Sie federten hoch und nieder, als wollten sie mir etwas zurufen. War es ein Versäumnis, dass ich mir nie die Mühe machte, meine Ess- und Trinkgewohnheiten zu hinterfragen, geschweige denn, sie zu ändern? Ich lebte, als ob dieses Leben einfach nur immer so weiterginge. Aber kommt nicht für jeden von uns auch einmal der Punkt, an dem ihm klar wird, dass er längst nicht mehr all die Optionen hat, von denen er dachte, sie noch zu haben?
Okay, der Gesundheitszustand eines heute 65-Jährigen entspricht etwa dem eines 55-Jährigen von 1970. Waren schon mal zehn Jahre gewonnen. Und was den Body-Mass-Index betraf, hieß es inzwischen, leichtes Übergewicht sei besser als Normal- oder Idealgewicht. Der Clou: Mittagsschlaf verjüngt. Zumindest das Gehirn. Und zwar um mehr als sechs Jahre, wie britische Forscher nach Auswertung der Daten von 35.000 Engländern herausfanden, die offenbar gerne mal einen Gang niedriger schalten. Wer es dann auch noch schafft, 70 zu werden, hat angeblich gute Chancen, mindestens bis Mitte 80 durchzuhalten. Gelingt freilich nicht jedem.
Luciano Pavarotti hatte seinen 70. Geburtstag gefeiert. Aber schon ein Jahr später lag er auf dem Sterbebett und ließ ein von ihm gesungenes Lieblingsstück auf den Plattenteller legen: »Erbarme dich, o Herr, meinem Leiden. Niemals soll ich verdammt sein.«
Länger Leben hat eine eigene Qualität. Die Wahrnehmung für das, was wichtig ist, verändert sich. Und wenn du dann einen Sonnenuntergang siehst, spürst du ihn auch. Wie alt will ich werden, überlegte ich. So alt wie mein Urgroßvater und mein Großvater, die es in der frischen Luft des Böhmerwaldes bei harter Arbeit auf 94 brachten?
Aber würden die Ärzte irgendwann nicht auch einem multimorbiden Greis gegenüberstehen, der morgens, mittags und abends noch mehr Pillen schlucken muss als jetzt schon, um die Lecks zu stopfen, die auf Dauer nicht zu stopfen sind?
Es gab da diese eine Szene, die mich nachdenklich werden ließ. Es war, als wir eines Sonntags mit dem Auto in München an der Säule mit dem weltberühmten Friedensengel vorbeifuhren. Auf der Rückbank saß mein Enkel Vincent. Wie aus dem Nichts heraus kam diese Frage: »Opa, wann stirbst du?« Ich war erst mal sprachlos. Schon kam der nächste Schuss. »Magst du mich auch noch, wenn du tot bist?«
Kinder stellen sich diese existentiellen Fragen noch. Wir Erwachsenen sind zu bequem geworden dafür. Den Anstoß für Vincents Frage gab freilich weniger ein philosophischer Impuls oder die Sorge um meine Gesundheit, sondern der Tod seiner geliebten Katze. Sie war nach Auskunft seiner Eltern nun im Katzenhimmel und führte ein fröhliches Katzenleben. »Sie darf jetzt immer kotzen«, wusste der Kleine, »ohne geschimpft zu werden«.
Vielleicht sollte man überirdische Dinge ähnlich lässig angehen wie Vincent. Wie sagte Jesus? »Ich müsst werden wie die Kinder. Anders kommt ihr nichts ins Himmelreich.« (Mt 18,3)
2 Die Stunde der Wahrheit
Warum tun wir uns so schwer, an unser Lebensende zu denken?
»Lebe so, als ob du morgen sterben würdest. Lerne so, als ob du ewig leben würdest.«
Mahatma Gandhi
1
Der Nachteil der Geschichte aus meiner Arztpraxis war, dass sie viele Jahre zurücklag. Inzwischen waren mir mehrere Stents in die Arterien geschoben worden, damit mein Herz wieder ausreichend mit Blut versorgt werden konnte. Mein Leben habe auf des Messers Schneide gestanden, meinte der Operateur. Der Stationsarzt drückte mir eine Liste mit Medikamenten in die Hand. Morgens sechs, abends vier, damit komme man wieder auf die Beine, meinte er aufmunternd.
Seltsam, eben noch demonstrierte man gegen den Krieg in Vietnam, hatte mit seiner Freundin die erste gemeinsame Wohnung bezogen, die Kinder zur Schule gebracht, seine erste Titelgeschichte gefeiert – und plötzlich soll’s das auch schon wieder gewesen sein? Ausgerechnet dann, wenn man endlich ein wenig Zeit für sich selbst hat?
Die Uhr des Lebens wird nur einmal aufgezogen, und niemand hat die Macht, die Zeiger vor- oder zurückzustellen. Wenn sie aufhört zu ticken, schließt ein Mensch die Augen – und macht sie niemals wieder auf. »Der Tod ist eingetreten«, heißt es dann in ärztlichen Bulletins, und das ist wörtlich zu nehmen. Tatsächlich kann niemand dem »Silent Highway-Man«, wie eine alte englische Karikatur den Tod während der Cholera-Epidemien nannte, die Tür versperren, weder Milliardär noch Bettelmann, weder Mann noch Frau, und noch nicht einmal jemand, von dem man sagt, er sei in der Blüte seiner Jugend.
Tod, muerte, la mort, death – was für ein dunkles Wort! –, der so viele Facetten hat, so viele Riten kennt, so viele Dichter, Denker, Komponisten und Maler beschäftigte. Man kann ihn hassen, wie der bekennende Atheist Elias Canetti es tat, der sich an seinem »Buch gegen den Tod« die Finger wundschrieb und erst im Alter von 87 Jahren resignierte. »Ich komme allmählich darauf«, hielt er zwei Jahre vor seinem Hinscheiden fest, »dass nichts vulgärer, banaler, trivialer, demagogischer ist als mein Kampf gegen den Tod.« Man kann ihn herbeisehnen, wie Hermann Hesse es tat. »Bruder Tod«, »Auch zu mir kommst du einmal«, dichtete Hesse, »Du vergißt mich nicht/ Und zu Ende ist die Qual/ Und die Kette bricht.« Man kann ihn sogar verehren, wie es Franz von Assisi in seinem »Sonnengesang« machte: »Gelobt seiest du, Herr, durch unsern Bruder, den leiblichen Tod.«
Er ist stets gegenwärtig, dieser Bruder Tod. Von allen Seiten kann er uns »überfallen«, sinnierte der französische Essayist Michel de Montaigne, kaum dass er 39 Jahre alt geworden war. Er hänge »über uns, wie der Felsblock über dem Haupte des Tantalus«. Stimmt. Ein Herzinfarkt. Ein Unfall. Demenz. Und plötzlich bist du weg. Wie heißt es in den Psalmen? Das Leben ist ein »Windhauch«. Es »währet siebzig Jahre, und wenn es hochkommt, sind es achtzig.« Das Beste daran sei »Mühsal und Beschwer, rasch geht es vorbei, wir fliegen dahin.« (Psalm 90,10 f.)
In meinem Flieger stellte ich die Rückenlehne nach hinten und machte es mir bequem, soweit das in der Economy-Class überhaupt möglich ist. Ich schloss die Augen, um mich meinen Gedanken hinzugeben. Im Oktober 2024 hatte die Europäische Raumfahrtagentur ESA den ersten Teil ihres Himmelsatlas vorgestellt. Er zeigte 14 Millionen Galaxien sowie Dutzende Millionen von Sternen in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Es war lediglich ein kleiner Ausschnitt des Universums mit insgesamt Milliarden von Galaxien im Umkreis von zehn Milliarden Lichtjahren.
Die Wissenschaft spricht von einem gewaltigen Meteoriteneinschlag, der vor Milliarden von Jahren die Erdachse veränderte und in einen anderen Winkel zur Sonne brachte. Mit einem Schlag entstand Leben auf dem Planeten. Seine Größe, seine Form, seine Länge, seine Achse, der Abstand zur Sonne (149,6 Millionen Kilometer), zum nächsten Fixstern (Alpha Centauri, 40 Millionen km), sein Umfang (40.045 km), die Rotationsgeschwindigkeit (1666 km/h) sind bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt. Schon geringe Abweichungen könnten das Leben wieder zum Erlöschen bringen. Und wohin man mit unseren neuen Weltraumteleskopen bisher auch sah, nirgendwo gibt es etwas, das unserem kleinen blauen Planeten mit seinen wunderschönen Bergen und Wäldern, den grünen Flüssen und azurblauen Meeren auch nur annähernd gleichkommt. Und noch nie tauchte bisher ein Wesen auf, wie wir es sind. Kein Mensch, nirgends. Allerdings auch kein Gott auf einem Himmelsthron.
Grotesk. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen nicht, warum wir auf der Erde sind. Wir wissen noch nicht einmal, wohin wir gehen. Wir wissen nur, dass wir hier nicht überleben werden. Wobei jeder nur den anderen für sterblich hält, wie Sigmund Freud bemerkte – und niemals sich selbst.
Was ist das, der Tod? Was passiert mit uns, wenn wir, wie es heißt, Ab-Leben? Kommt da noch was? Was erwartet die Bürger des Universums nach ihrem irdischen Finale? In einer Zivilisation postmortem, in der Ewigkeit, die im Übrigen schon vor Abermilliarden von Jahren begonnen hat? Oder ist mit dem letzten Atemzug alles vorbei? Schluss, aus und Sense?
Wir sprechen nicht darüber. Mehr noch: Wir haben den Tod, das existentiellste Ereignis für jeden Einzelnen von uns, das in früheren Epochen ein bedeutender ritueller wie sozialer Fixpunkt war, ausgesourct in Krankenhäuser, Sterbezimmer und Bestattungsinstitute. Die soeben noch warmen Körper der Verblichenen werden eiligst beiseitegeräumt, als schäme man sich ihrer. Eine Million Menschen sterben jährlich in Deutschland, aber kaum jemand hat je einen Toten hautnah zu Gesicht bekommen. »Schockiert«, »erschüttert« und »tief bewegt« zeigt man sich dann insbesondere beim Abgang von Prominenten, auch wenn manch einer sich wundert, dass der eben Verblichene überhaupt noch am Leben war.
La hora de la verdad, »Stunde der Wahrheit«, lautet im Spanischen der Ausdruck für das Momentum zwischen Sein und Nichtsein, diese eine wahre Stunde, in der sich alles entscheidet. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was könnte bedeutender sein als jener Augenblick? »Was einer ist, wie einer war«, notierte der Dichter Hans Carossa, »beim Scheiden wird es offenbar.« Und nicht nur, was er war, sondern auch, was er wird. Zumindest aus christlicher Sicht, nach der die Zukunft eines Menschen kein Rätsel, sondern exakt vorhersehbar ist. Ist es eine kollektive Amnesie, überlegte ich auf meinem Fensterplatz im Flieger, dass wir heute die todsicherste Tatsache unseres Lebens für dessen unwahrscheinlichste Zukunft halten?
Terror-Management-Theorie, so heißt das Konzept, das all jene unbewussten Strategien beschreibt, die Menschen entwickeln, um mit dem Wissen um die eigene Sterblichkeit fertig zu werden. Sobald es um den eigenen Tod geht, schalten wir zuallererst auf Abwehr. Durch Verdrängung, durch Verleugnung, durch sich darüber lustig machen. Erst danach beginnen wir, uns wirklich damit zu befassen. Und warum auch nicht? »Vom Zeitlosen trennt uns nur ein Atemzug«, erinnerte Ernst Jünger. Für Todgeweihte, für Kriegsverletzte im Schützengraben, für Krebspatienten im Endstadium ihrer Krankheit mag das tröstlich sein, aber können wir das Fallbeil, das im Grunde zu jeder Minute über unserem Kopf schwebt, anders ertragen, als es einfach nicht wahrzuhaben? Goodbye my friend, it’s hard to die, heißt es in dem Welt-Hit Seasons in the Sun von Terry Jacks von 1974. But the wine and the song, like the seasons, have all gone.
Der Kaffee war kalt geworden, und der Himmel hatte sich verdunkelt. Anstatt von Wolken begleitet zu werden, war der Flieger in ein graues Nebelmeer eingetaucht. Das Sterben, der Tod, das ewige Leben, in meiner journalistischen Arbeit war all das immer wieder Thema gewesen. Und doch ist es ein Schock, gerade in einem höheren Alter, wenn man zum ersten Mal realisiert, so, dass es einem, wie man sagt, durch Mark und Bein geht, dass einem die Zeit wie Sand durch die Finger rieselt. Und niemand wird die Sanduhr deines Lebens noch einmal umdrehen.
»Alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit«, so sagt der Prediger Salomo in brutalstmöglicher Nüchternheit, »geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit.« (Koh 3,1) Während ich gedankenverloren in den grauen Himmel blickte, musste ich mir unwillkürlich Fragen stellen, die schwer zu ertragen sind. Wie oft noch würde ich im Mai das frische Grün und die blühenden Kirschbäume erleben? Wie oft noch meine Freunde in Paris besuchen können, die auch nicht mehr die Jüngsten waren? Besonders schmerzhaft: Wie oft noch mit der Familie den Christbaum schmücken? Die eigenen Kinder hatten uns alt gemacht, jetzt hielten uns die Enkel jung. Aber wie oft noch könnten wir zusammen im Sommer ans Meer fahren? Fünf Mal? Zehn Mal? Weniger? Und würden die gezählten Jahre bei anhaltender Zeitbeschleunigung nicht sogar schneller dahinsausen als die ungezählten davor?
»Wir sind einsam, ja, stimmt«, resümierte der Schriftsteller Ferdinand von Schirach in einem Interview, »wir alle sind es, weil wir alle sterblich sind.« In einer Theateraufführung trat Schirach sichtlich betroffen an den Rand der Bühne, um seinem Publikum so nah wie möglich zu kommen: »Verstehen Sie das? Ich meine, ist Ihnen das wirklich bewusst? Sie werden sterben. In Kürze sind Sie tot.«
Als Ministrant hatte ich unzählige Tote gesehen. Sie lagen offen aufgebahrt in der Aussegnungshalle. Sterben war eine öffentliche Angelegenheit. Wenn in unserem Dorf die Sirenen heulten, war klar, dass es irgendwo brennt. Und wenn die Glocken zu ungewöhnlichen Zeiten läuteten, wusste man, es ist wieder jemand gestorben. Wie es Brauch war, durften wir Ministranten nach der »Leich« zu einer »Totensuppe« ins Dorfwirtshaus mitkommen. Wir saßen brav in einer Ecke, genossen je zwei Paar Wienerwürstchen mit Senf und Brot, warteten darauf, dass uns jemand ein kleines Trinkgeld zusteckte, und versuchten herauszubekommen, ob die Trauer bei den Hinterbliebenen echt oder nur vorgetäuscht war.
Nach der Heiligen Schrift wird eine Person mit dem Tode nicht einfach zu einer Sache, der man sich möglichst kostengünstig entledigen sollte, das lernten wir schnell. Im Religionsunterricht erfuhren wir, dass jenes Ritual, das vom Sterbebett an greift, zu nichts anderem dient als der Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Klang ein wenig nach Science-Fiction, aber Christen glauben im Grunde an eine außerirdische Intelligenz, von der die Menschheit fortwährend besucht wird, teils unsichtbar, teils sichtbar. Ganz am Ende, quasi für den Übertritt ins ewige Leben, halfen dem Menschen spezielle Gebete, Salbungen, Segnungen, Rosenkranz, die Aussegnung und das Requiem, die letzte Reise möglichst gut vorbereitet antreten zu können. Wenn der Priester drei Mal Erde auf den Sarg des Verstorbenen warf, war das deshalb kein Sinnbild für Auslöschung, sondern für die »Abberufung in die Ewigkeit«. »Von der Erde bist du genommen«, lautete der liturgische Text, den der Geistliche sprach, »und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken.«
Fast jede Woche gab es einen Leichenzug. Das Kreuz voran, die Fahnen wehten, die Kriegsveteranen salutierten. Nirgendwo erreichen einen so melancholischen Gedanken, wie wenn man in der Stille eines ländlichen Vormittages, begleitet von der Litanei des Vorbeters und dem Klang der Glocken, im Trott der Trauernden einem Toten im Sarg zu seiner (vorübergehenden) Ruhestätte folgt. Spätestens dann, wenn der Priester zum Abschluss des Begräbnisses für jenen noch Unbekannten betet, der dem Verstorbenen als Nächster folgen wird, gibt es keinen Ausweg, sich nicht auch selbst angesprochen zu fühlen und jene Grenzerfahrung zu bedenken, auf die man ungebremst zurast.
Warum tun wir uns so schwer damit, an unser Lebensende zu denken? Das alles entscheidende Ereignis, das größte Rätsel der Menschheit? Noch immer versichern Christen im großen Credo: »Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.« In jedem Gotteshaus brennt Tag und Nacht ein »ewiges Licht«, um uns zu jeder Stunde an diese Glaubenswahrheit erinnern zu können. Die heilige Kommunion gilt als die »Wegzehrung« für die »Pilgerreise« vom Diesseits ins Jenseits. Zu nichts anderem wurden Gotteshäuser einmal mit mehrdimensional anmutenden bunten Fresken und ausladenden himmlischen Szenerien im Gewölbe gestaltet, als die Gläubigen beim Blick nach oben schon mal einen Vorgeschmack auf ihre jenseitige Existenz bekommen zu lassen. Beethoven lässt im Schlusschor seiner gewaltigen Neunten Sinfonie singen: »Droben, überm Sternenzelt, muss ein ewger Vater wohnen.« Im Grunde ist die ganze Liturgie mit all ihren Zeichen, Texten, ihren seraphischen Klängen und meditativen Gebeten dazu da, ein wenig von der Glückseligkeit des Himmels auf die Erde zu bringen. »Ich glaube an den Heiligen Geist«, beten evangelische wie katholische Christen in ihren Gottesdiensten, die »Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.«
Die Auferstehung Jesu und die Verheißung des ewigen Lebens bilden die Kernaussage des Christentums. Papst Benedikt XVI. nannte sie »die größte Revolution der Weltgeschichte und die kräftigste Explosion des Lebens« überhaupt. Man könne hier von dem entscheidenden »Sprung in ganz Neues hinein« sprechen: Aus dem grenzenlosen Dunkel sei das »hellste Zeichen einer grenzenlosen Hoffnung« geworden. Jede Zeile des Evangeliums ist davon durchtränkt. »Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören«, mahnte Jesus, »sondern sammelt euch Schätze im Himmel« (Mt 6,19–21).