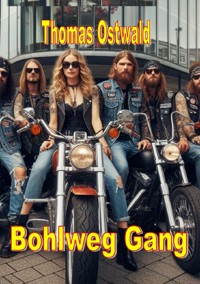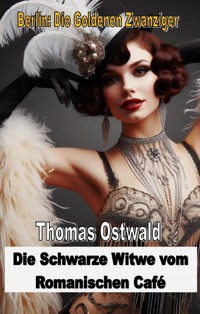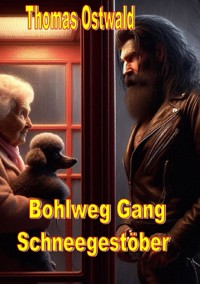Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte der Familie Spiegelberg in Braunschweig geht weiter. Die nächsten Generationen wachsen in unruhigen Zeiten heran, der Erste Weltkrieg bricht aus, gefolgt von den Jahren ab 1918 mit Streiks und der Revolution auch im Freistaat Braunschweig. Aber schon bald führen die Spiegelbergs wieder ein großes Haus, unter ihren Gästen finden sich alle prominenten Zeitgenossen der Stadt. Erneut steigen die Unternehmen dieser Familie zu bedeutenden Firmen auf, die großen Einfluss auf ihre Umgebung haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Ostwald
Die Erben des Jutekönigs
Thomas Ostwald
Die Erben des
Jutekönigs
Die Jahre 1905 bis 1920
Historischer Roman
Edition Corsar D. und Th. Ostwald
Braunschweig
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Thomas Ostwald
Cover unter Verwendung eines Bildes von Eudard Ritter
Verantwortlich
für den Inhalt:Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
1. Kapitel: Im großen Club
Zahlreiche Droschken hielten an diesem Donnerstagabend in der Breiten Straße vor dem Hotel d’Angleterre. Es waren ausschließlich gut gekleidete Herren, die in das Clubzimmer strebten, darunter auch einige Offiziere in schwarzer Attila mit den auffallenden, goldenen Verschnürungen. Sie gehörten zum Husarenregiment Nr. 17 und waren die einzigen Soldaten, die nicht die bis zum Jahre 1892 erneuerten blauen Uniformen erhielten. Ihre Pferde wurden an den eisernen Ringen an der Hauswand festgemacht, dann blickten sie noch unschlüssig die Breite Straße hinunter und schienen jemand zu erwarten. Schließlich gab der Älteste unter ihnen ein Zeichen, und öffnete die Eingangstüre.
Die Offiziere trugen ihre Pelzmützen in der Hand, als sie das Hotel betraten, und standen zu Beginn des heutigen Treffens ein wenig abseits, um sich auszutauschen. Aber nach und nach strömten weitere Clubmitglieder in den gediegen eingerichteten Clubraum, darunter zahlreiche Fabrikbesitzer der Stadt Braunschweig. Man legte die dicken Wintermäntel an der Garderobe ab, Handschuhe und Schal dazu, dann wurden die Überzieher abgestreift. Es war kalt in Braunschweig an diesem Novembertag geworden, und es hatte auch schon am Vortag geschneit. Allerdings blieb von der weißen Pracht nicht viel übrig, doch der restliche Schneematsch zwang die Herren, über ihre guten Schuhe die Überzieher zu streifen.
Unter den Neuankömmlingen befand sich auch Johann Georg Zwilgmeyer, Leinenhersteller aus der Langen Straße. Freudig trat der greise Isaak Spiegelberg auf ihn zu, um ihm die Hand zu drücken.
Zwilgmeyer war erstaunt über den festen Händedruck des alten Herrn, der trotz seiner 64 Jahre mit durchgedrücktem Rücken sehr aufrecht ging, und seinen Stock dabei lässig schwang – ganz so, als wäre er nicht auf ihn angewiesen. Spiegelbergs
dichtes, schlohweißes Haar war sorgfältig nach hinten gebürstet. Seinen kleinen, dünnen Schnurbart ließ er regelmäßig sorgfältig ausrasieren. Allerdings zeigten viele Falten sein Alter an, auch wenn er sich alle Mühe gab, frisch und jugendlich aufzutreten. Doch die leicht geröteten Wangen und seine strahlenden Augen vermittelten das Bild eines Menschen, den man vom ersten Augenblick an leiden mochte.
„Herr Spiegelberg, welche Freude! Sie waren nun schon ein paar Wochen nicht mehr bei uns, und ich fürchtete schon um Ihre Gesundheit!“
„Vollkommen unnötig, lieber Freund! Ich war auf Reisen, und zwar in Berlin, habe dort ein paar interessante Besuche gemacht und bin erst gestern wieder in Braunschweig eingetroffen. Dank der guten Zugverbindung in die Hauptstadt ist das jetzt ja eine Kleinigkeit geworden, so zu reisen!“
Der alte Herr lachte fröhlich, dann gab er Zwilgmeyer einen kleinen Stups mit dem Ellbogen in die Seite und erkundigte sich: „Und die Geschäfte, wie läuft das Geschäft mit dem edlen Leinen?“
Auch Johann Georg Zwilgmeyer lachte, als er antwortete: „Nun, sicher nicht so prächtig wie bei der Jute, aber ich kann nicht klagen. Die Geschäfte gehen gut, und unsere alte Firma scheint für die nächsten einhundert Jahre gerüstet zu sein.“
„Ausgezeichnet, Herr Zwilgmeyer. Lassen Sie uns doch dort drüben bei der Raucherrunde Platz nehmen und uns vom Clubdiener einen wärmenden Cognac reichen!“
„Eine fabelhafte Idee. Apropos, Herr Spiegelberg, haben Sie die heutige Zeitung gelesen? Ich meine die Notiz über Wilhelm Voigt!“, erkundigte sich Zwilgmeyer, kaum, dass sie in den bequemen Sesseln Platz genommen hatten und sich aus der Zigarrenkiste bedienten.
„Wilhelm Voigt? Sie meinen gewiss den berühmten Hauptmann von Köpenick?“
„Eben diesen Herren meine ich. Hier, ich fand zwei Artikel in den heutigen Zeitungen und habe sie extra für das Clubtreffen mitgebracht. Einfach zu köstlich!“, erzählte Zwilgmeyer. „Darf ich kurz vorlesen, ist kein langer Artikel!“
„Natürlich, lieber Herr Zwilgmeyer. Aber vielleicht etwas gedämpft, ich weiß nicht, ob die Herren Offiziere dort drüben über diesen Herrn Hauptmann lachen können!“ Der Clubdiener brachte die beiden Cognacschwenker, und der Leinenfabrikant zog aus der Rocktasche eine der Braunschweiger Zeitungen und las mit gedämpfter Stimme vor: „Was der Hauptmann von Köpenick wert ist. Nicht weniger als 150.000 Mark hat ein unternehmender Mann, ein bekannter Manager, der Polizei für die Überlassung des Hauptmanns von Köpenick geboten. Der Mann will sich verpflichten, den genialen Schuster nach 3 Monaten wieder zurückzubringen, sämtliche Kosten für die permanente Überwachung durch Kriminalbeamte zu tragen und den Voigt zu allen Terminen rechtzeitig vorzuführen. Auch dem Hauptmann wurde eine nette Summe als Honorar zugesichert. Die Polizei hat dies drollige Anerbieten abgelehnt.“
„Das ist ein Scherz, oder?“, erwiderte Spiegelberg erstaunt.
„Nein, keineswegs, hier steht es schwarz auf weiß!“
Die beiden Herren brachen in schallendes Gelächter aus.
„Der Mann hat jedenfalls einen ausgeprägten Geschäftssinn! Kaum ist diese Tat von Voigt vollbracht worden, schon wittert jemand ein Geschäft und will den Mann wohl auf den Jahrmärkten zeigen. Na, Erfolg hätte er sicher damit, denn die balkendicken Zeitungsüberschriften waren ja schon eine gute Werbung. Aber – unglaublich!“
Beide Herren schüttelten die Köpfe und nahmen dann einen Schluck von dem echten, französischen Cognac.
„Ein Verwandter in Berlin schickte mir noch ein Exemplar vom Cöpenicker Dampfboot. Die Zeitung hatte noch am Abend des 16. Oktober ein Extrablatt mit den Geschehnissen herausgebracht!“
Gerade wollte Spiegelberg noch eine Bemerkung zu Wilhelm Voigt machen, schwieg aber, als bei den Husarenoffizieren ein neuer Gast eintraf. Die drei Männer sprangen auf, nahmen Haltung an und grüßten einen wesentlich älteren Offizier.
„Donnerwetter, das ist doch wahrhaftig der General Georg Wilhelm von Braunschweig!“, raunte Isaak Spiegelberg seinem Gegenüber zu. „Ich habe ihn mal auf einer Geschäftsreise in Danzig kennenlernen dürfen, übrigens in einem ähnlichen Kreis wie hier in unserer Stadt.“
„Der General hat welche Aufgabe? Ich meine, er ist doch trotz seines Namens nicht in Braunschweig stationiert, oder?“, erkundigte sich Zwilgmeyer und reckte den Hals, um einen Blick auf den General zu werfen.
„Nein, er ist Kommandierender General der XVII. Hauptquartier des Armeekorps in Danzig, wurde mir vorgestellt und wir plauderten ein wenig über die Ausrüstung des Heeres miteinander. Ich hatte vorgeschlagen, für das Marschgepäck der Soldaten Jute zu verwenden.“
„Interessante Idee! Was wurde daraus?“
„Man war höheren Ortes interessiert. Aber mir scheint, der General kommt zu uns herüber!“, sagte Isaak Spiegelberg und erhob sich, als die vier Offiziere vor Ihnen stehen bleiben.
„Herr Spiegelberg, welch glücklicher Zufall! Ich hatte gehofft, Sie hier zu treffen!“, begrüßte ihn General von Braunschweig. „Auf ein Wort, werter Herr, und bitte unter vier Augen!“
„Oh, das scheint mir wichtig zu sein. Sie entschuldigen mich, Herr Zwilgmeyer? Wir sprechen später weiter.“
Die Zivilisten verbeugten sich, das Militär grüßte zackig, dann folgte Isaak Spiegelberg den Soldaten in einen kleinen, separaten Raum, der von den Clubmitgliedern gern für private Besprechungen genutzt wurde. Hier blieben die drei Husarenoffiziere vor der Tür, nahmen Aufstellung wie eine Wache und verursachten dadurch bei Isaak ein mulmiges Gefühl.
‚Was hat das alles zu bedeuten?‘, fragte er sich. Gleich darauf brach ein derartiges Unwetter an harschen Worten über ihn herein, dass er sich fragte, ob er nicht einfach aufstehen und den Raum verlassen sollte. Aber der durchdringende Blick, mit dem ihn der General betrachtete, und seine scharfen Worte machten ihm klar, dass General von Braunschweig ein solches Verhalten nicht dulden würde. Er hatte ganz harmlos mit seiner Rede begonnen.
„Sie wissen, dass ich Ihnen wohlgesonnen bin, Herr Spiegelberg. Ihre Ideen, Teile der militärischen Ausrüstung durch Material aus Jute zu ersetzen, hat durchaus etwas für sich. Aber was ich jetzt der Presse entnehmen musste, wird alle weiteren Geschäftsverbindungen mit Ihrer Firma in Frage stellen. Dabei können Sie von Glück reden, dass ich davon erfuhr, als ich mich auf einer Dienstreise von Berlin nach Braunschweig befand. Wie konnte das nur geschehen?“
„Aber, bester Herr General, ich habe ja nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen!“, erwiderte Isaak Spiegelberg kläglich.
Der General griff in seinen Uniformrock und zog eine zusammengefaltete Zeitung heraus. Trotz der harschen Anrede dachte Isaak in diesem Moment: ‚Heute scheint der Tag der Zeitung zu sein!‘ Aber schon ein Blick auf die Zeitung ließ seinen Humor verschwinden. Der General hielt eine Beilage zur Volksstimme in der Hand. Ausgerechnet! Eine Zeitung der Sozialdemokraten! Und dann kam es Schlag auf Schlag, als General von Braunschweig ihm die ersten Zeilen mit geradezu donnernder Stimme vorlas.
„Kapitalistische Kindesausbeutung! Schon diese Überschrift würde Seine Majestät sehr verärgern, wenn er erfährt, dass es sich dabei um Ihre Firma handelt! Die Einleitung ist unwichtig, aber hier geht es los, dass es einem die Zornesröte ins Gesicht treiben muss: Die dankbaren Arbeiter! O ja, sie haben wirklich Ursache, dankbar zu sein, diese Arbeiter! Stehen sie doch in ‚Lohn und Brot‘ bei den Herren des Jutebetriebs. Ist auch der Lohn niedrig, sehr niedrig, wird auch ihre Gesundheit in der durch Wolken feiner Jutepartikel verdickten Luft schnell und mit tödlicher Sicherheit ruiniert, gehen sie auch infolge der schlechten Ernährung und der furchtbar ungesunden Beschäftigung wie wandelnde Leichen einher, diese Jutearbeiter müssen dankbar sein!‘“
„Aber das ist doch…!“, empörte sich Isaak, und der General bestätigte: „Ein Skandal, Spiegelberg, ein Skandal. Aber es kommt ja noch viel schlimmer! Hier, sehen Sie selbst, weiter unten wird es konkreter: ‚Diese Werksleitung beläßt es nicht bei der Ausnutzung der erwachsenen Personen. Sie stellt Kinder in die Fabrik, an die Maschinen, die noch nicht einmal dem schulpflichtigen Alter entwachsen sind, und glaubt angeblich dabei, daß diese Kinder Alter jugendlicher Arbeiter erreicht haben. Die Arbeiter lachen über diese Leichtgläubigkeit der Direktion und – der Ortspolizeibehörde, denen von dem Agenten für Menschenware ‚amtliche‘ Zeugnisse angeblich von den galizischen Behörden übermittelt worden, nach denen diese Kinder das Alter jugendlicher Arbeiter haben sollen…‘ Und so weiter und so fort, mit ganz konkreten Beispielen. Spiegelberg, diese sogenannten Sozialdemokraten waren in der Jutefabrik in Vechelde und haben die Missstände protokolliert, auch in den Arbeiterwohnungen. Menschenskind, sorgen Sie dafür, dass diese Schweinerei sich ändert, sonst kann ich für nichts garantieren. Sollte jemals Seine Majestät davon erfahren, wird er Ihren Betrieb schließen.“
Isaak starrte wie benommen zu Boden. Als er bemerkte, dass der General die Zeitung zusammenfaltete, blickte er ihn wieder an.
„Aber – ich weiß nicht, was ich tun soll, Herr General! Das… das stimmt so alles nicht, das sind Verleumdungen, und ich kann mich auf die Leute in Vechelde ebenso verlassen wir hier in Braunschweig!“
General von Braunschweig zeigte eine versteinerte Miene. Dann gab er ihm die Zeitung in die Hand und erwiderte nur: „Sorgen Sie für Abhilfe, Spiegelberg. Ist die Jutefabrik betroffen, wird es auch keine Aufträge mehr für die Textilfabrik gleichen Namens geben. Ich war nur ein unfreiwilliger Leser, weil man mir dieses … Drecksblatt zugespielt hat. Nehmen Sie es als dringende Warnung, und handeln Sie, Mann!“
Damit stürmte der General an ihm vorüber und ließ die Tür offen.
Fassungslos sah ihm Isaak nach, wie er mit großen Schritten, gefolgt von den drei Husaren, hinüber in den Clubraum eilte.
‚Wir sind erledigt!‘, schoss ihm der Gedanke durch den Kopf. Kaum waren die Offiziere im Nebenraum verschwunden, kam ein neuer Gast herein, grüßte freundlich in alle Richtungen und eilte dann auf Isaak Spiegelberg zu. Er schien nur unwesentlich älter zu sein als der andere, wirkte in seinem ganzen Auftritt aber sehr auffallend. Neben einem dunkelgrünen Jagdrock trug er englische Breeches zu hohen Stiefeln, und sein von der Kälte gerötetes Gesicht verriet, dass sich durch das Wetter sein Stiefbruder Karl Friedrich Neugebauer nicht vom Reiten abhalten ließ.
„Isaak, du siehst aus, als hätte dir etwas die Petersilie verhagelt!“, begrüßte ihn Karl Friedrich lächelnd und reichte ihm die Hand. Die beiden ungleichen Stiefbrüder hatten nach dem Tod ihres Vaters Julius die Jutefabrik als Geschäftsführer der Aktiengesellschaft fortgeführt. Inzwischen hieß sie Braunschweigische Aktiengesellschaft für Jute- und Flachs-Industrie und hatte noch immer englische und schottische Gesellschafter, die sich jedoch in das Geschäft nicht weiter einmischten. Julius Spiegelberg war ganz überraschend auf einer Reise nach Köln im Jahre 1897 gestorben und wurde auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig beigesetzt, obwohl er inzwischen zurückgezogen mit seiner Frau in England lebte. Zur Beisetzung nicht mehr rechtzeitig, kehrte auch Jonathan Spiegelberg aus Amerika zurück und trat ebenfalls in die Firma ein. Über seine amerikanischen Unternehmungen hielt er sich merkwürdig zurück, war aber offenbar trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit einigem Vermögen nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sich ebenfalls finanziell eingebracht. Aber als der Älteste der Familie lebte er ruhig und zurückgezogen auf seinem Alterssitz in Vechelde. Scherzhaft nannte ihn seine Familie „den Herzog“, denn so, wie einst Herzog Ferdinand, der als vierter geborene Bruder des Regierenden Herzogs Carl einst seinen Wohnsitz in das alte Schloss verlegte, so hatte sich auch Jonathan zurückgezogen und genoss sein Leben auf dem Lande. Die Ortschaft Vechelde, einst als Tagelöhnerdorf im 18. Jahrhundert entstanden, hatte noch immer die erste Jutefabrik als größten Arbeitgeber im Braunschweiger Land.
„Bitte, komm auf ein Wort hinüber in dieses Zimmer, hier sind wir ungestört!“, erwiderte Isaak mit tonloser Stimme und versteinerter Miene. Wortlos folgte ihm Karl Friedrich und war schon auf schlechte Nachrichten gefasst. Aber als er den Zeitungsartikel las, den ihm Isaak übergab, wurde er blass.
„Das ist… das ist übel! Da haben sich unsere Arbeiter offenbar bei den Sozialdemokraten beschwert. Wir müssen sofort eine Petition an den Vizekanzler Karl Heinrich von Boetticher richten, wie es Vater schon vor Jahren getan hat. Und dann müssen wir dieses Drecksblatt verklagen, ich werde gleich morgen unsere Rechtsanwälte aufsuchen.“
Isaak Spiegelberg schüttelte heftig den Kopf.
„Die Petition schreiben wir, aber ich fürchte, sie wird so wenig Erfolg zeigen wie die unseres Vaters damals. Aber von der Klage halte ich nichts, Karl Friedrich. Das setzt uns in ein noch schlechteres Licht, denn wir werden wenig von diesen Vorwürfen widerlegen können. Nein, lass uns gemeinsam beraten, wie wir vorgehen sollten. Und ich möchte gern in dieser Runde auch John Landauer dabei haben.“
„Landauer? Weshalb? Weil er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde ist?“
Jetzt musste Isaak trotz seiner schlechten Laune unwillkürlich wieder lächeln.
„Nein, Karl Friedrich. Wie du weißt, ließ sich schon unser Vater taufen. Nein, uns verbindet eine langjährige Freundschaft, und John ist immerhin ein bekanntes Mitglied der Kaiserlichen Leopoldino-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Ich denke, sein Wort hat Gewicht in einer solchen Angelegenheit. Zumal er als Inhaber einer Fabrik für Baumwoll- und Leinenprodukte ähnliche Probleme haben mag.“
„Gut, dann lass uns ihm einen Boten senden und für den morgigen Vormittag zum Gespräch bitten. Die Sache verlangt unverzügliches Handeln.“ Karl Friedrich blickte nachdenklich zu Boden, dann atmete er tief durch und fuhr fort: „Kommst du noch auf ein Glas Wein hinüber zu den anderen?“
„Danach ist mir jetzt nicht. Ich kehre nach Hause zurück!“
„Ach komm, da hast du auch keine Ruhe. Ein paar Gespräche zu anderen Themen werden dich ablenken, ein Glas Wein tut dir gut!“ Damit griff Karl Friedrich Neugebauer den Arm seines Stiefbruders und zog ihn unter seinen. „Keine Widerrede, du wirst sehen, das hilft dir jetzt!“
Scheu blickte sich Isaak Spiegelberg rasch um und entdeckte zu seiner Erleichterung die Offiziere nicht mehr. Wenig später befand er sich im angeregten Gespräch mit Heinrich Büssing, Bernhard Meyersfeld und dem Juristen Otto Magnus. Es konnte nicht lange dauern, bis er auf das Thema zu sprechen kam, das ihn bedrückte: Die Arbeiter in den Fabriken und die Sozialdemokraten. Den Zeitungsartikel aus der Volksstimme behielt er wohlweislich in seiner Jackentasche, aber manchmal kam es ihm so vor, als würde der dort auf seiner Haut brennen.
Zweites Kapitel: Die Kundgebung
Karl Friedrich Neugebauer, seine Söhne Gustav und Wilhelm, sowie Isaak Spiegelberg mit den Söhnen Eliot und David, saßen zusammen mit Otto Magnus, Johann Georg Zwilgmeyer und John Landauer schon seit zwei Stunden in dem Konferenzraum der Jutefabrik in Braunschweig, als plötzlich Lärm vor der Tür zu ihnen hereindrang. Gleich darauf wurde die Tür heftig aufgerissen, und mehrere Personen drängten herein.
Karl Friedrich sprang auf, als er die ungebetenen Gäste erblickte, aber sein Sohn Gustav legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm, als sein Vater gerade lospoltern wollte.
„Was soll das? Was erlauben Sie sich?“, sagte Isaak Spiegelberg und wunderte sich dabei, wie er auf das unerhörte Eindringen dieser Fremden reagierte.
„Herr Direktor Spiegelberg?“, rief eine Frau, und die anderen, offenbar alles Arbeiter, drängten sich dicht hinter ihr zusammen.
„In Person!“, antwortete Isaak. „Und Sie sind?“
„Minna Faßhauer!“, antwortete die Frau selbstsicher. „Und hier neben mir sind als Vertreter der Arbeiter Augusta Baumhauer und Hermann Schuster. Die anderen sind Arbeiter aus Ihrer Jutefabrik, Sie werden die Namen wohl nicht kennen.“
„Wie kommen Sie dazu, hier so mir nichts dir nichts einzudringen? Zutritt im Direktionsgebäude haben unsere Arbeiter nicht, schon gar nicht fremde Personen!“, wies sie Karl Friedrich Neugebauer scharf zurecht.
„Trotzdem werden Sie sich anhören müssen, was wir zu sagen haben!“, erwiderte Minna Faßhauer.
„Das werden wir nicht, Frau Faßhauer!“, ergriff nun auch Gustav Neugebauer das Wort. „Sie dringen hier widerrechtlich ein, stören unsere Versammlung und führen sich auf, als wären Sie die Fabrikbesitzer!“
„Haben Sie Kenntnis von den Missständen in der Fabrik in Vechelde? Haben Sie einmal in eine Arbeiterwohnung geschaut? Wissen Sie, wie viele Kinder unter 14 Jahren in Ihren Fabriken arbeiten?“
Gustav ging um den Tisch herum, und wer ihn dabei beobachtete, erkannte, wie es in seinem Gesicht arbeitete. Die Stirnadern waren dick angeschwollen, seine Kiefer mahlten, die Hände hatte er zu Fäusten geballt. Aber als er vor der Gruppe stehen blieb, gelang es ihm, seinen Zorn zu beherrschen. Nur seiner Stimme war die Erregung anzuhören.
„Das alles ist uns bekannt und schon lange ein wichtiges Thema bei uns. Schon unsere Väter haben zusammen mit der Baronin von Westerberge alles dafür unternommen, das Wohl der Arbeiter zu stärken. Ein Sanatorium für Schwindsüchtige wurde von der Baronin errichtet, mein Großvater ließ gute Arbeiterhäuser bauen und eine Kantine nebst eigener Küche in Vechelde errichten. Und noch moderner wurden die Anlagen hier bei uns in Braunschweig.“
„Das ist doch ein hanebüchener Unsinn!“, rief einer der Arbeiter.
Gustav reckte den Hals, um sich das Gesicht des Mannes zu merken.
„Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, und jetzt muss ich sie alle auffordern, sofort das Haus und das Fabrikgelände zu verlassen!“
Die Arbeiter wichen nicht, sondern schienen auf eine Entgegnung der Frau zu warten, die sie hier hereingebracht hatten. Die aber blickte hinüber zu Isaak Spiegelberg, der einen Telefonhörer aufgenommen hatte, die Kurbel drehte und sich jetzt vom Fräulein vom Amt verbinden ließ.
„Ich glaube, hier erreichen wir nichts weiter. Die Herren Kapitalisten sind nicht bereit, über Versäumtes zu reden. Direktor Spiegelberg hat eben das Polizeipräsidium angerufen. Deshalb schlage ich vor, wir legen unsere Forderungen auf den Direktionstisch und verlassen das Gelände, bevor die Polizisten hier eintreffen!“
Mit diesen Worten trat sie vor, legte ein Papier auf die äußerste Ecke des großen Tisches, an denen die Männer schweigend saßen und sie mit finsteren Blicken musterten. Dann zogen sich die Arbeiter langsam zurück, verließen das Zimmer der Direktoren und eilten dann wesentlich rascher polternd die Treppen hinunter. Als sie die Tür erreicht hatten, liefen sie jetzt in panischer Flucht über den Fabrikhof und verstreuten sich auf der Straße in verschiedenen Richtungen. Tatsächlich hörte man bereits das Klappern von Hufen auf der Straße. Die Polizei war sehr schnell gekommen, und Minna Faßhauer, die zusammen mit ihren beiden Vertrauten Augusta Baumhauer und Hermann Schuster in die nächste Seitenstraße abgebogen war, blieb hier stehen und holte erst einmal tief Atem.
„Das ist gut gegangen. Ich hätte nicht geglaubt, dass die berittenen Polizisten so schnell hier eintreffen.“
„Aber unser Auftritt war doch kein Erfolg, Minna!“,. brummte Hermann.
„Abwarten!“, erwiderte sie. „Wir werden es ja nicht dabei belassen. Die Volksstimme ist bereit, das Thema immer wieder aufzugreifen, das hat man mir versichert.“
„Ja, aber die Volksstimme erscheint in Magdeburg! Wir bräuchten hier einen solchen Bericht!“
Minna Faßhauer winkte verächtlich ab.
„Das wird leider nichts, unsere konservativen Zeitungen werden mit Rücksicht auf die hiesigen Industriellen nichts davon berichten.“
„Wir haben unseren Bildungsverein jugendlicher Arbeiter ja nicht zum Spaß gegründet. Zusammen mit weiteren Arbeitern aus den Braunschweiger Fabriken werden wir den Industriellen zeigen, dass sie ohne uns nichts sind. Wir gehen so oft vor die Fabriktore, bis sich etwas verändert, zugunsten der Arbeiter. Und vor allen Dingen müssen diese unhaltbaren Zustände der Kinderarbeit endlich verschwinden!“
Hermann schüttelte den Kopf, und Augusta meinte, dass ja auch die letzte gesetzliche Verordnung von 1904 nicht greift. „Es hält sich niemand daran, dass es ein Verbot gibt, Kinder unter 14 Jahren in den Fabriken einzustellen.“
„Zusammen mit dem Sozialdemokratischen Arbeiterverein für Gliesmarode werden wir in so großer Anzahl vor den Fabriktoren erscheinen, dass man uns wahrnehmen muss!“, erwiderte Minna. „Sonst bleibt uns das stärkste Mittel!“
„Du redest von Streik?“, erkundigte sich Augusta erschrocken. „Natürlich! Was den Hafenarbeitern von Hamburg schon vor zehn Jahren gelungen ist, den Arbeitern im Ruhrgebiet, das werden wir ebenso machen!“, erklärte Minna.
„Na, dann los. Wann rufen wir die Genossen zur Versammlung auf?“
„Das übernehme ich zusammen mit Georg. Ihr redet bitte mit den Gliesmarodern.“
„Gut, und treffen wir uns wieder bei euch in der Weststraße?“
„Natürlich. Am Sonntag um 10.00 Uhr. Dann ist die Beteiligung mit Sicherheit größer, weil niemand arbeiten muss!“
Damit gingen die drei auseinander. Alle wohnten in der Gegend der Weststraße und Frankfurter Straße, dem ausgesprochenen Fabrikviertel. Hier gab es ein Gaswerk, die Zuckerfabrik von Buchler, Maschinenbau- und Konservenfabriken, die Wilke-Werke. Neben Luthers Maschinen- und Mühlenbauanstalt, die seit langer Zeit ihren Sitz hier hatte, kamen auch neue Fabriken dazu wie die Braunschweigische Blechwarenfabrik 1903. Überall entstanden mehrgeschossige Miethäuser mit kleinen Wohnungen. Häufig befand sich die Wasserstelle im Treppenhaus auf den Etagen für mehrere Parteien gleichzeitig. Die sanitären Anlagen waren unzureichend, Plumsklos auf den Hinterhöfen waren Standard. Aber trotzdem wirkten diese neuen Mietshäuser der Arbeiter noch wie Häuser der gehobenen Bürgerschaft gegenüber den Wohnverhältnissen in den Arbeiterhäusern der Fabriken. Das wurde allen Beteiligten noch einmal überdeutlich am folgenden Sonntag gemacht, als sich etwa einhundert Arbeiter vor der Jutefabrik in Braunschweig versammelten.
Minna Faßhauer stand auf einer umgedrehten Holzkiste und verkündete mit erstaunlich lauter Stimme: „Genossen! Arbeiter! Freunde! Hört mir zu! Die Verhältnisse in den Arbeiterquartieren der Jutefabrik Vechelde sind menschenunwürdig! Wir haben uns vor Ort umgesehen! Eine Wohnung ist drei Meter breit, vier Meter lang und zwei Meter sechzig hoch. Die schmutzigen Wände sind zum großen Teil klatschnass. Möbliert ist ein Raum mit zwei primitiven Bettstellen und einer kleinen Wiege, in denen sich kurz und klein gelagertes feuchtes Stroh befindet. – Acht, acht Menschen, lebende Menschen wohnen und schlafen in dieser Höhle! Das Zimmer teilen sich ein alter Mann und ein Ehepaar mit vier Kindern: ein 18jähriger Sohn, die übrigen Kinder 7 bis 2 Jahre alt sowie ein 18jähriges Mädchen als Logisgängerin der Familie. Alle schlafen in den dicht nebeneinander stehenden beiden einzigen ‚Betten‘. Für dieses leere Zimmer müssen jede Woche 4 Mark Miete bezahlt werden. Wir waren entsetzt und glaubten, dass diese ‚Wohnung’ nur eine Ausnahme sei. Wir sollten bitter enttäuscht werden.“
Unruhe kam unter den Zuhörern auf, aber die Rednerin fuhr entschlossen fort. Aber kaum hatte sie den nächsten Satz begonnen, als lautes Hufgeklapper von der Straße herüberdrang, und gleich darauf eine Abteilung Braunschweiger Polizisten um die Ecke bog und die Arbeiterschar mit einem Dutzend Beamten zu Pferd umfasste. Die Menschen, vor denen jetzt die großen Pferde aufragten, wichen ängstlich zurück. Aber ein lauter Aufschrei ging durch die Menge, als die Polizisten auf ein Kommando ihre Säbel zogen und zugleich ihre Pferde antrieben.
Jetzt war kein Halten mehr.
In Panik drängte jeder nach vorn, wo jedoch die Mauer des Fabrikgeländes keinen Ausweg bot. Schreie wurden laut, zuerst wütende, dann schmerzerfüllte, als die ersten Menschen strauchelten und unter die Füße der Menge gerieten. Heftig warfen sich mehrere kräftige Männer gegen das hölzerne Fabriktor, das dieser Attacke nicht lange standhielt.
„Hier entlang, Augusta!“, rief Minna der Freundin zu, und mit den Ellbogen kämpften sich die beiden Frauen durch die Masse der Menschen bis zum Fabriktor. Hier gab es heftige Rangeleien und viel Geschrei, bis sich die Nächststehenden hindurchgepresst hatten und auch die beiden Frauen eine Lücke fanden, als ihr Freund Hermann an ihrer Seite auftauchte und mit ein paar gezielten Faustschlägen Platz schuf. Endlich waren sie durch diesen Engpass und ließen das Geschrei der Menge hinter sich.
Aber wohin?
„Mir nach, ich kenne mich aus!“, rief ihnen Hermann zu und stürmte in die Richtung der kleinen Arbeiterhäuser. Die beiden Frauen rafften ihre Röcke, um besser laufen zu können, und eilten ihrem Freund nach. Aus den Häusern traten nun einige Männer und Frauen, die den Lärm gehört hatten und sich verwundert umsahen. Jetzt aber waren die ersten Reiter auf dem Gelände und preschten entlang den langgestreckten Fabrikgebäuden durch die schmalen Gassen der Arbeitersiedlung.
„Hier herüber, schnell!“, rief Hermann den Frauen zu, als er die blitzenden Säbel bemerkte, die zwei Reiter hoch über ihren Köpfen schwenkten.
Die Oker hier an der Jutefabrik fror meistens sehr schnell zu, denn das Wasser floss nur sehr langsam. Jetzt standen die drei direkt am Ufer der Oker und starrten auf das schmutzig-braune Wasser, das durch einige Löcher im sonst zugefrorenen Teil gluckste. Hier schien es nur einen einzigen Ausweg zu geben – über das Eis auf das andere Ufer. Einen Reiter würde das nicht sichere Eis auf keinen Fall aushalten.
„Du willst doch nicht wirklich da rüber, Hermann!“, rief Minna entsetzt aus. „Es ist November, und die Oker hat nur dünnes Eis! Wenn wir einbrechen, sind wir verloren!“
„Ich kann nicht schwimmen!“, schrie Augusta verzweifelt.
„Ich halte euch beide!“, antwortete ihnen Hermann, packte sie jeweils links und rechts mit seinen kräftigen Händen und zog die Frauen das Ufer herunter. Das laute Schreien eines Reiters, der eben hinter ihnen auftauchte, beflügelte ihre Schritte.
„Dort drüben sieht es gut aus, vertraut mir ruhig, ich habe früher immer das Eis aus der Oker für die Brauerei geschnitten! Ich kenne mich aus!“
Mit diesen Worten trat Hermann zunächst prüfend mit einem Fuß auf das Eis am Ufer, dann schritt er zügig aus, die beiden Frauen fast hinter sich herziehend. Dabei knisterte und knackte es unheimlich unter ihren Füßen, und als plötzlich Augusta mit einem Fuß einbrach, schrie sie verzweifelt auf. Aber Hermann ließ ihre Hand nicht los, riss sie weiter, und mit einem völlig durchnässten, schweren Schuh, bemühte sich die Arbeiterin, weiter zu eilen.
Schon war das gegenüber liegende Ufer nahe, als hinter ihnen der Polizist mit donnernder Stimme rief: „Stehen bleiben, oder ich schieße!“
„Schieß und sei verdammt!“, rief Hermann zurück, und tatsächlich krachte gleich darauf ein Schuss hinter ihnen, und beide Frauen schrien laut auf.
„Mein Gott, seid ihr getroffen worden?“
„Nein, nur erschrocken!“, gab die couragiertere Minna zurück. „Nur noch ein kurzes Stück, das schaffen wir!“
Ein ängstlicher Blick über die Schulter zu dem Polizisten. Aber der Mann hatte wohl nur einen Warnschuss abgebeben, In dem Augenblick, in dem sie sich bemühten, die glitschige Uferkante zu erklimmen, warf Minna erneut einen Blick zurück. Der Polizist hängte sich den Karabiner wieder über die Schulter, wendete sein Pferd und ritt zurück durch die Straße der Arbeitersiedlung.
Augusta brach auf dem jenseitigen Ufer in die Knie.
„Geschafft! Wir haben es geschafft!“, rief sie unter Tränen aus.
„Kannst du noch laufen mit dem nassen Schuh?“, wollte Hermann wissen.
Augusta biss die Zähne zusammen und nickte.
„Dann vorwärts!“, gab Minna von sich. „Wir laufen zur Weststraße, zu unserer Wohnung. Georg hat für reichlich Holz gesorgt, wir können uns aufwärmen und ich mache uns den restlichen Suppentopf noch heiß!“
Doch als Minna Faßhauer eben das Haus Nr. 46 in der Weststraße betreten wollte, sprangen zwei Polizisten aus dem Hauseingang und packten sie an den Armen. „Sie sind verhaftet, Minna Faßhauer!“, brüllte der eine von ihnen, ein Mann mit einem Gesicht wie eine Bulldogge. Er funkelte Minna mit wütenden Augen an und gab sich, als wolle er sie am liebsten zu Boden schlagen.
„Aber weshalb denn, ich habe überhaupt nichts gemacht!“, stieß Minna Faßhauer aus.
„Halt’s Maul, Aufrührerin! Mit deinesgleichen fackeln wir nicht lange, verstanden? Im Gefängnis hast du genug Zeit, über dein Verhalten nachzudenken. Und jetzt vorwärts, da kommt der Wagen für das Gesindel!“