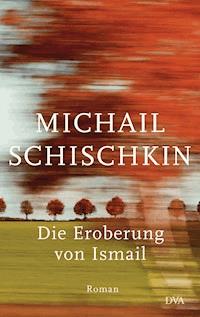
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der sich aufschwingt durch Zeiten und Räume und die russische Geschichte von ihren wüsten Anfängen bis ins betrübliche Heute erfasst.
Es beginnt mit der Erschaffung der Welt – in einem Abteil der Belebeier Schmalspurbahn, tief in der russischen Provinz. Und damit, dass Alexander Wassiljewitsch, gestandener Provinzadvokat und Anwalt der Erniedrigten und Beleidigten, seinen Lebenslauf fürs Kompendium der Gerichtsrede zu schreiben hat. Daraus erwächst eine große Abrechnung, etwas wie Russlands Jüngster Tag. Im Zeugenstand die hohe Literatur: von Tolstois »Auferstehung«, dem berühmtesten aller russischen Gerichtsromane, über Dostojewskis »Verbrechen und Strafe« bis hin zu Olga, Katja, Mascha, Larissa, all den tapfer beharrenden und tragisch vergehenden Frauen im Roman wie im Leben. Und immer wieder schieben sich die Erlebnisse eines jungen Mannes dazwischen, der Michail Schischkin heißt und vom chaotischen Moskau der 1990er Jahre einen langen Abschied nimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 767
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Es beginnt mit der Erschaffung der Welt – in einem Abteil der Belebeier Schmalspurbahn, tief in der russischen Provinz. Und damit, dass Alexander Wassiljewitsch, gestandener Provinzadvokat und Anwalt der Erniedrigten und Beleidigten, seinen Lebenslauf fürs Kompendium der Gerichtsrede zu schreiben hat. Daraus erwächst eine große Abrechnung, etwas wie Russlands Jüngster Tag. Im Zeugenstand die hohe Literatur: von Tolstois »Auferstehung«, dem berühmtesten aller russischen Gerichtsromane, über Dostojewskis »Verbrechen und Strafe« bis hin zu Olga, Katja, Mascha, Larissa, all den tapfer beharrenden und tragisch vergehenden Frauen im Roman wie im Leben. Und immer wieder schieben sich die Erlebnisse eines jungen Mannes dazwischen, der Michail Schischkin heißt und vom chaotischen Moskau der 1990er Jahre einen langen Abschied nimmt.
Ein Roman, der sich aufschwingt durch Zeiten und Räume und die russische Geschichte von ihren wüsten Anfängen bis ins betrübliche Heute erfasst. Ein monumentales Werk von einem »mächtig ausgreifenden Erzähler und Wortgläubigen mit Klassikerpotenz, wie man ihn schon lange nicht mehr sah in der russischen Weltliteratur« (NZZam Sonntag).
Zum Autor
Michail Schischkin ist einer der meist gefeierten russischen Autoren der Gegenwart. Er wurde 1961 in Moskau geboren, studierte Linguistik und unterrichtete Deutsch. Seit 1995 lebt er in der Schweiz. Seine Romane »Venushaar« und »Briefsteller« wurden national und international vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt er als einziger alle drei wichtigen Literaturpreise Russlands. 2011 wurde ihm der Internationale Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt in Berlin verliehen. Sein Roman »Die Eroberung von Ismail« wurde u.a. mit dem Booker-Prize für das beste russische Buch des Jahres (2000) ausgezeichnet und gilt als sein kompromisslosestes Werk.
Michail Schischkin
Die Eroberungvon Ismail
Roman
Aus dem Russischenvon Andreas Tretner
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Francesca
Siebte Lektion
Narratio est rei factae, aut ut factae, utilis ad persuadendum expositio.1
Quintilian
In der Sache Kramer errang der legendäre Advokat Urussow einen Freispruch für seine Mandantin – dem Geständnis derselben und einem unzweifelhaft vorliegenden Corpus delicti zum Trotz, das noch dazu ein Damenstrumpf war, der, aus der Tüte gezogen, als lebloses Wölkchen auf den für Beweisstücke vorbehaltenen Tisch sank. Als der Freispruch verkündet war, der Saal applaudierte noch tosend, trat die Kramer vor ihren siegreichen Verteidiger hin, doch anstelle von Dankbarkeit, wie man sie hätte erwarten können, verabreichte sie ihrem Retter aus der Not eine schallende Ohrfeige. Dies nun verhalf der bis dato niemandem bekannten Musiklehrerin zu Ruhm und brachte so manche Feder zum Glühen, nur vermochte die in unserer Presse entfachte Diskussion über die bei einer Strafverteidigung gesetzten moralischen Grenzen dem delikaten Gegenstand kaum gerecht zu werden. Und das muss niemanden wundern! Denn wer angetreten ist, die Menschheit zu retten, wird früher oder später der Gesetzlosigkeit das Wort reden müssen, der Unmoral beistehen, mag gar versucht sein, ein Verbrechen zu decken, der Rechtsprechung höhnen. Wie in diesem Fall, wo die Angeklagte selbst zugab, getötet zu haben, es am Ende aber so aussieht, als könnte sie es gar nicht gewesen sein. Und alles nur deswegen, weil der Anwalt die Geschichte der Kramer mit eigenen Worten erzählt hat. Worin das vorgebliche Ereignis unauffindbar war! Die ganze sogenannte Schöpfung ist labil und ätherisch, heute sind Sie hier, wischen sich die Schuppen von den Schultern – aber wo werden Sie morgen sein? Da hat das Wort doch ein ganz anderes Gewicht. Was das Fräulein wirklich auf dem Kerbholz hat, wird keiner je erfahren, und wen schert es – aber wenn Urussow zu schildern anhebt, wie die Angeklagte sich das Kleid über den Kopf zog und das Haar sich im Häkchen verfing, ist der Freispruch eine Frage der Zeit. Was will man ihm vorwerfen? Nullum crimen, nulla poena sine lege! Man kann nicht belangt werden für etwas, das zum Zeitpunkt der Verübung nicht strafbar war. Und dieses Etwas – nichts Geringeres ist es als die Erschaffung der Welt. Stellt euch nur mal vor, meine lieben jungen Freunde, es wäre nichts da. Absolut nichts: Es gäbe weder euch noch mich, noch dieses stickige Auditorium, man hat nach der letzten Vorlesung wieder mal zu lüften vergessen. Nicht dieses Stummelchen Kreide in meinen Fingern, das eben noch über die Wandtafel schabte, und eine Prise Mehl ist gerieselt. Nicht die Zeit in ihrem Sonnenlauf, die einen jeden am linken Handgelenk gepackt hält, als wie: Jetzt hab ich dich, du entkommst mir nicht mehr, ich werde dich allzeit longieren. Nicht den Schneesturm draußen vor dem Fenster, hören Sie ihn heulen? Es ist zappenduster. Leere und Finsternis sind die Voraussetzung, wenn eine Welt zu erschaffen ist. Ziehen muss es wie Hechtsuppe, rütteln und tosen wie im letzten Wagen der Belebeier Schmalspurbahn. Welch ein Stumpfsinn, welch ein Sehnen! Und da es also an allem fehlt, ist alles bereit für die Erschaffung der Welt, möchte man meinen – und dennoch fehlt da noch was. Irgendein Funke vielleicht. Also wird diese triste baschkirische Finsternis urplötzlich von einem Funken durchblitzt. Der glüht auf und erlischt wieder. Dann eine Weile nichts, und wieder ein Funken, und noch einer, als suchte wer ein Streichholz anzureißen, irgendein Ursubjekt, göttlicher Funkenschläger, Perun oder so. Ritscht und flucht, die Hölzer sind feucht geworden, scheints. Und in diesem Moment entfleucht seinem Ohr – oder dem Oberschenkel, wie es in den frühen Mythologien zu lesen steht (höchlich naiv, aber desto rührender, finden Sie nicht?, jedenfalls viel interessanter als die ungeflügelte Dreifaltigkeit) oder, kann sein, aus dem Nabel, in der Dunkelheit ist nichts zu erkennen – entfleucht ihm sein Visavis, Nächster zur Nacht, göttlicher Gegenspieler, lebensfroh und trotzköpfig, mit einem Wort: Weles. Macht sich hüstelnd bemerkbar, räuspert sich, ächzt und seufzt, gebärt die Zeit:
»Geht schon auf sieben, denk ich mal. Nicht dass wirs noch verpassen!«
Perun indes reibt sich die Augen, reißt gähnend den Mund auf, scheidet das Licht aus dem Dunkel mit einem Wort:
»Gleich wird es hell.«
Danach ist die Erschaffung der verschneiten Steppe jenseits des eisverkrusteten Fensters nicht mehr aufzuhalten. Der Himmel lichtet sich. In seine kratzige Decke gehüllt, schaut Perun hinaus in die noch zwielichtige, noch unklare Welt, und dieser Blick genügt. Er äugt nach unten, wo prompt das Gleisbett hindurchhuscht, Schwellen flirren; äugt nach oben, wo umgehend die Telegrafendrähte aus dem Grau tauchen im schnellen Auf und Ab, als hielte eine Kinderhand den Stift und malte Wellen. Er denkt an ein Dorf, und schon hebt sich etwas Schwarzes ab im weißen Einerlei, Rauchsäulen steigen in den frostigen Himmel. »Jetzt ein Teechen!«, raunt er sehnsüchtig, denkt es mehr, als er es ausspricht, und sofort klopft es an die Tür:
»Hier kommt ein Tee für Sie, schön heiß!«
Der Untersatz zu groß, als sollte das Glas erst noch hineinwachsen, der Tee schwappt mutwillig gegen die Lippen, sie zu verbrühen.
»Wir halten!«, verkündet Perun, aus dem Fenster sehend; die Finger, zwischen denen das Zuckerstück klemmt, verharren knapp über dem heißen Tee, der Wagen schlenkert über eine Weiche, der Tee schwappt gegen die Raffinade, ein güldener Fleck breitet sich aus auf dem weißen Leib.
»Tschebyri«, entziffert Weles das Stationsschild. »Sieh an, auch hier lebt man.«
Der Bahnsteig verlangsamt sein Tempo, kommt ruckend zum Stehen. Dampfschwaden, in denen ein halber Mensch unterm Fenster vorbeigeht, gefolgt von weiteren solchen, die an das Ende des Zuges eilen, die Unterleiber abgeschnitten vom Fensterrand.
»Leben tät ich das nicht nennen, Grigori Wassiljewitsch«, entgegnet Perun, vom Tee nippend; zwischendurch pustet er, betrachtet den abziehenden Rauch so angewidert wie eine Milchhaut, die es zu entfernen gilt. »Genauso gut ließe sich sagen, dass einer hinterm Polarkreis lebt mit der Parascha an seiner Seite. Wen die Strafe trifft, der muss sich halt einrichten.«
Der Bahnsteig hat sich wieder in Bewegung gesetzt, kriecht unterm Fenster vorbei.
»Das wars schon. Tschebyri – passé!«, seufzt Weles. »Wie will man beweisen, dass es das wirklich gibt? Na, egal. Gedulden wir uns noch zwei, drei Jährchen, dann hat die Sache ein Ende. Ich mit vollen Bezügen plus Altersgeld und Ihr mit den halben. Damit können wirs uns wohl sein lassen …«
Und das Spiel setzt sich fort: Einer murmelt etwas in seinen Bart, zum Beispiel: »Fluss!« – gehorsam poltert der Zug auf geharnischten Sohlen über eine Brücke, unter der eine Spur sich im Pulverschnee hinzieht wie ein Türkettchen, das die Ufer miteinander verhakt.
Oder: »Hosenträger!« – als hätten sie nur darauf gewartet, rutschen sie halb von der oberen Pritsche und schwingen sich zum Pendel auf.
»Die Welt – ein Kaff!«
In diesem Moment hat das neugeborene Licht den weißen Raum zur Gänze, bis zum kurz geschorenen Horizont ausgefüllt. Und hier kommt Belebei. Da wären wir.
Der Wagenschaffner schiebt sich den Rubel Trinkgeld in die Tasche, schlägt von den Treppenstufen sein Kreuz über den Ausgestiegenen: »Wie heißt es so schön: Wer nicht richtet, wird nicht gerichtet werden. Hals- und Beinbruch!«
Schnell ruckt der Zug wieder an, noch bei offener Tür. Sie wird eilends zugeschlagen.
Der Bahnsteig knirscht unter den Sohlen. Über Nacht hat es geschneit.
Aus der frischen Morgenluft schält sich Swarog, in ein Dampfwölkchen verbissen. Er ist mit demselben Zug angekommen.
»War das wieder eine Nacht, herrje. Man spürt jeden Knochen. Und ein Mitmensch ist mir untergekommen – so ein Schnarchen hat die Welt noch nicht gehört … Bestimmt hats nicht mal frische Zeitungen in dieser Einöde.«
Die Gerichtsverhandlung findet im Kaufmannsklub gleich gegenüber dem Bahnhof statt.
Der Saal ist überheizt. Das Kreuz auf dem Kirchturm vorm Fenster trägt Achselklappen aus Schnee. Der Gerichtsaufseher riecht nach Kölnischwasser. In den Facetten der Karaffe auf der purpurnen Tischdecke zerlegt sich die Kachelhaut des Ofens in viele salatgrüne Rhomben.
Bevor es losgeht, prüft Perun, ob alles an seinem Platz ist: die Brille im Etui, das Lämpchen brennend vor der Ikone, und ob das Bildnis des großen Justizreformers nicht schief hängt. Er wickelt die Glocke mit dem beinernen Griff aus dem Zeitungspapier.
Weles spitzt mit dem Federmesser seinen Bleistift an, schabt die Mine und pustet die Graphitschnitzelchen weg, während der Gerichtsaufseher seine Regularien herunterleiert.
Swarog bekommt die Liste der Geschworenen vorgelegt, damit er sie nach Gutdünken zusammenstreichen kann. Großmütig verzichtet er auf dieses Anrecht.
Perun wirft die Billetts in eine Schachtel, mischt und zieht eins nach dem anderen wieder hervor, verliest die Namen kopfschüttelnd, mit hochgezogenen Brauen, als wie: Mit was für Namen die Menschen doch geschlagen sind.
Die Aufgerufenen werden zum Eid aufgefordert. Ein dissonanter Chor leiert das Ich-schwöre-bei-Gott-dem-Allmächtigen herunter.
Der Pope legt das Kreuz ins Evangelium, schlägt sein Epitrachelion darum, klemmt das Ganze untern Arm und verlässt den Saal.
Und da ist Mokosch. Sie hat ihre pralle Brust aus dem Mieder gezogen und säugt ihr Kind. Schaut dabei abwesend zum Fenster hinaus, wiegt sich, scheint ein Schlaflied vor sich hin zu summen. Richtet ihrem Bündelchen die Windeln. Grinst, als sie bemerkt, wie der strammstehende Rekrut mit den roten Kragenspiegeln der Inneren Abwehr heimlich zu ihr herüberschielt.
Inzwischen ist man so weit, die Anklage vorzutragen.
»Am dritten Munichion dieses Jahres ging die Zeugin Soundso, deren piepsige Stimme eine Zumutung ist, morgens zum Austreten auf den Hof, wandte sich zum Nachbarzaun und sah …«
»Bitte die Seherin aufzurufen.«
»Nein, bloß nicht, ist doch sowieso alles klar! Dem Stier widerfährt nur, was seiner Stiernatur entspricht, dem Weinstock, was des Weinstocks ist.«
»Na schön. Dann übernimm du, Weles!«
Der stand auf, ließ den Blick über die Reihen schweifen, nahm umständlich die Uhr vom Arm und legte sie vor sich hin, stemmte die Fäuste gegen die Tischplatte und seufzte.
»Es wird in diesen materiellen Zeiten viel Aufhebens um die leibliche Unantastbarkeit gemacht, die Seele indes hat zu leiden. Was muss einer nicht alles hören und sehen, der unterwegs ist in der Belebeischen Ödnis! Calibane und Calibaninnen kommen beileibe nicht nur auf jener namenlosen Insel vor, wo Prospero das Sagen hat, o nein! Wer wie ich diesem Amte über zwanzig Jahre frönt, der wundert sich über gar nichts mehr. Obscuri viri2! Nie werde ich den Anblick jener Dämchen vergessen, die ihre auf dem Jahrmarkt erworbenen Regenschirme spazieren trugen, darunter einherwandelten im schönsten Sonnenschein, sie jedoch zuklappten, als es zu regnen anfing, damit sie nicht verdarben, und stattdessen die Rocksäume über den Kopf rafften. Barbaren, wie sie im Buche stehen: lebten wie das viehe / erschlugen eyner den andern / assen yegliches vnreine / kanten den ehstand nit / raubten vnd entfürten lustig jhre bräut / lebten gleych wilden thieren im walt / gossen schandt rede auß / vor vättern und schnurn! Wie ich noch im Orenburg’schen meinen Dienst versah, kam es vor, dass ich zum Tatort eilte, und statt einer Leiche in den erwartbaren Umständen und Gegebenheiten fand ich den Toten fein säuberlich gewaschen unter der Ikone liegend vor, die Hütte geputzt wie vor dem Feste. ›Wir haben die Wartezeit genutzt, Euer Gnaden, und gleich ein bisschen aufgeräumt‹, hieß es, ›das war ja nicht zum Ansehen!‹ Was soll einer dazu sagen. Einem zivilisierten Menschen will es freilich nicht in den Kopf und erst recht nicht ins Herze hinein, wie eine die eigne Mutter, blind noch dazu, in frostiger Winternacht unter freiem Himmel sich selbst überlassen kann! Man fährt Eisenbahn, liest etwas oder sinnt vor sich hin, während die Räder über die Schienenstöße rattern, tritt vielleicht einmal hinaus in den eisigen Vorraum, um frische Luft zu schnappen, da klebt der Reif fingerdick an der Türscheibe. Reibt sich mit einem Fünfer ein Guckloch zurecht und schaut in die Nacht, sieht irgendwo ein Häuflein Glutbröckchen in den Schnee geworfen und denkt, aha, da wohnt jemand und trinkt vielleicht just in dieser Minute seinen Tee, gemütlich am warmen Ofen – dort aber in der Schneewehe steckt Ihr, geblendet von zu viel Gesehenem, gepeinigt von zu viel Durchlebtem, unnütz und vergessen liegt Ihr da und verreckt unter dem Großen Wagen, der sieht jetzt aus wie eine große Kelle, und man fragt sich, welch Barmherziger die Euch hinhält für einen letzten Schluck. Und es bleibt Euch nichts weiter, als zu warten und zu verzeihen, ein jegliches und einem jeden. Für den Muttermörder sah das römische Recht Ersäufen in einem Sack mit einem Hund, einem Hahn, einer Schlange und einem Affen vor. Kämpfen wir gegen den Bakterienbefall im Organismus unserer Gesellschaft, leisten wir solch gefährlicher progéniture3 keinen Vorschub, halten wir die Natur sauber und das Herz rein!«
»Die Verteidigung hat das Wort.«
»Ihr glaubt mir nicht und werdet es auch fürderhin nicht tun – nicht nur, weil ihr über meine Mandantin insgeheim längst den Stab gebrochen habt, sondern auch, weil ich in euren Augen, die mich heute zum ersten Mal im Leben sehen, von vornherein zur Gilde der Wortverdreher zähle. Na also, ich sehe schon das Lächeln in den Gesichtern der uniformen Magistratur, das will sagen: Jetzt hebt hier der Budenzauber an, jetzt drischt er sein Stroh, dieser Balalaikin! Mag sein. Schließlich muss ja auch ich mein Brot verdienen, muss ins Joch, da beißt die Maus keinen Faden ab. Geht man davon aus, dass die Kultur einer Person sich an der Fülle gewonnener Eindrücke bemisst, so ist man geneigt zu sagen: Je kulturvoller eine Frau, desto vielfältiger ihr Tun, in Sonderheit ihr kriminelles. Doch gegen diese weitverbreitete Ansicht hätte ich etwas einzuwenden. Vorletzte Woche hat man in Pereljub über ein Kindermädchen Gericht gesessen, das weder lesen noch schreiben konnte. Sie war entlassen worden, und bevor sie ging, hat sie den Herrschaften noch gedroht: Der liebe Gott wird es rächen! Und tatsächlich fing das Kind zu kränkeln an, kaum dass sie weg war, quälte sich vier Tage ganz fürchterlich, bis man bemerkte, dass ihm ein Fingerchen abgebunden war mit einem Haar, der Knoten sorgfältig verborgen. Das Haar schnitt in den Finger ein, der sich davon entzündete, Wundbrand war schon im Entstehen … Der Fall, der uns heute beschäftigen wird, liegt hingegen längst nicht so klar. Zwei Frauen in einem Haus, Mutter und Tochter, beide nicht glücklich, vom Schicksal gebeutelt, das Leben freudlos und ohne Sinn, beide träumen sie vom einfachen menschlichen Glück, das ihnen jedoch nicht vergönnt ist, stattdessen leiden sie, wie eine Frau nur leiden kann. Die Mutter ist im Alter erblindet, wenn sie vor die Tür will, muss Mokosch sie hinausführen. Das geht eine Weile gut, doch einmal kommt etwas dazwischen: Wehen, Fruchtwasser, Sturzgeburt und so weiter. Von wem das Kind ist? Was gehts uns an! Sei es von einem Zimmermann, einem römischen Legionär oder einem Lichtstrahl mit Goldstäubchen. Jedenfalls, als sie die Sache glücklich hinter sich hat, schläft sie vor Erschöpfung ein. Nicht jede ist es gewohnt, wie die Katzen zu hecken. Letzten Sommer war da ein Fall beim Bezirksgericht anhängig, Grigori Wassiljewitsch kann es bezeugen, er hat die Anklage übernommen, und ich war zum Pflichtverteidiger bestellt – so eine dralle, gesunde Maid im vollen Saft hat es vor den Eltern verheimlicht, einfach den Bauch eingezogen, und dann war die Zeit heran. Sie hat es tot geboren und vor lauter Schreck in den Ofen geworfen. Hat sich, so erzählt sie, auf den Küchentisch gestützt, und da kam etwas aus ihr hervorgerutscht. Sie hat es ins Papier gewickelt, das da von den Heringen lag, und ab ins Ofenloch damit. Die Mutter hat dann die Spuren vom aufgewischten Blut am Boden gesehen, den Ofen mit Wasser gelöscht, und so kam die kleine Leiche halb verkohlt wieder zutage. Die ärztliche Expertise besagte, dass der Säugling lebend ausgetragen wurde und auch noch eine gewisse Zeit nach der Geburt weitergelebt haben muss, denn in den Lungen befand sich Luft. Mokosch aber drückt ihr Söhnlein an sich und schlummert ein. Und die alte Frau, die ihre geplagte Tochter nicht wecken mag, beschließt allein austreten zu gehen. Tut das und findet nicht zurück. Stolpert über ein Holzscheit, schlägt lang hin. Ruft, aber keiner hört. Mit nichts als einem dünnen Jäckchen überm Nachthemd ist man im Nu erfroren. So hat man sie denn am anderen Morgen gefunden – in der Schneewehe hockend, die Hände flach gegeneinandergepresst, wie zum Gebet. Also ist es ein Leichtes für uns, diesem arglosen, minderbemittelten Geschöpf hier mit seinen Henkelohren, Hutchinson-Zähnen, dem hohen Gaumen, der Neigung zum Nägelknabbern und den verminderten Sohlenreflexen die Schuld zu geben. Aber wollen wir rechtgläubigen Menschen uns wirklich von diesem Signore Lombroso leiten lassen? Klagt sie nur an, dann sind ihr Heulen und Zähneklappern beschieden. Barmherzigkeit ist die Seele der Gerechtigkeit. Nehmt dem Körper die Seele, und ihr habt eine Leiche. Nehmt dem Recht die Barmherzigkeit, und ihr habt den toten Buchstaben. O ich Unglückseliger, dass ich zu schreiben vermag!, rief einmal ein römischer Kaiser, als er ein Todesurteil zu unterschreiben hatte. Doch bin ich gewiss, euer Obmann, wenn er den Freispruch unterschreibt, wird anderes fühlen: Ach, bin ich froh, schreiben zu können! Es werde Recht gesprochen! Ich bezweifle nicht, dass ihr werdet Milde walten und das dumme Ding in Frieden ziehen lassen, vielleicht sammelt ihr noch ein Sümmchen Geld zu ihrer Unterstützung.«
In der Pause hat einer von den Geschworenen am Büfett schon so ausreichend getankt, dass er zu grölen anfängt: »Wenn ich bloß will! Ich sperr sie ein! Ich sprech sie frei! Wie ich es will!«
Perun mahnt in seinem Schlusswort an, sich bei der Urteilsfindung ausschließlich von innerer Überzeugung, reinem Gewissen und dem gesunden Menschenverstand leiten zu lassen. »Gesetze haben weite Maschen«, sagt er, »das wisst Ihr selbst am besten. Auch schuldiges Blut naget einem das Herz, geschweige was das unschuldige tut. Kein Urteil ohne kühlen Kopf, hinter fremder Wange schmerzt kein Zahn.« Vor Großmut müsse man sich wahrlich nicht fürchten, sie habe noch keinen verdorben, doch selbst bösen Naturen veredele sie das Herz. »Bedenkt es!«, so schließt er.
Kaum ist das Schwurgericht aus der Tür, kommt es, sich gegenseitig schiebend, auch schon wieder herein.
Alles erhebt sich. Der Obmann schlägt vor der Ikone das Kreuz, räuspert sich und beginnt: »Ein jegliches Geschöpf sucht sein Glück und scheut das Leiden …«
So fängt die Zukunft an.
Das Kind wird Mokosch genommen und in ein Heim gegeben, wo man nachts kräftig anzuheizen pflegt und die Kinder in ihren Bettchen nackt auf dem Wachstuch liegen lässt, um das Waschen der Windeln zu sparen.
Die Mutter vergießt im Gefängnis manche Träne, bis eine Kameradin sie darauf bringt, sich schwachsinnig zu stellen.
»Du wirst sehen«, sagt sie, »erst stecken sie dich zu den Tobsüchtigen, und anschließend berufen sie eine Kommission ein. Dann bleibt dir Kolyma erspart.«
So geht Mokosch dazu über, des Nachts zu schreien wie am Spieß, zu jaulen und zu keifen, sich unversehens zu entblößen, mit den eigenen Fäkalien zu beschmieren. Und tatsächlich steckt man sie ins Tollhaus, wo die Wärter keinen Ton von sich geben, ihre Filzstiefel auch nicht. Die Kommission bilden ein mit allen Wassern gewaschener Arzt und sein junger Kollege, eben vom Studium delegiert und überhaupt den ersten Tag im Dienst, den der Arzt flüsternd ins Benehmen setzt:
»Den Simulanten zu erkennen, Dmitri Michailowitsch, ist ein Kinderspiel …«
»Dmitri Nikolajewitsch«, berichtigt ihn der Angesprochene zaghaft und errötet, da er Mokosch im Stehen mit gerafftem Rock auf den Teppich urinieren sieht.
»Ach ja, Pardon, nach so einer Nachtschicht gerät einem im Kopf bisschen was durcheinander. Eine Insassin hat heute Nacht Zwillinge geboren. Hat ordentlich gedauert. Ein Junge und ein Mädchen. Sooft es einem unterkommt, man freut sich jedes Mal wie ein Schneekönig. Wie sollen sie denn heißen?, hab ich die Kreißende gefragt. Sascha und Sascha. Ja, wie denn das, wer kommt denn auf so eine Idee?, wundere ich mich, darauf sie: Ist mir doch egal. Dem Vater zu Ehren! Wozu ihm, wende ich ein, der doch einen Menschen umgebracht hat? – Das ist dem recht geschehen. So siehts aus, mein verehrter Dmitri Michailowitsch! Aber mit dem Dämchen hier werden wir ruck, zuck fertig, passen Sie auf!«
Und darauf mit lauter Stimme, sodass sie es hören kann: »Wir verabreichen ihr Chloroform! Dann schläft sie ein, und der Anfall geht vorüber!«
Und dabei drückt er Mokosch, die sich in Krämpfen auf dem Boden windet, einen Bausch mit Pfefferminzöl vor die Nase.
Ihre Zuckungen werden prompt schwächer, schließlich liegt sie still.
»So einfach ist das, mein lieber Dmitri Michailowitsch. Sie nennen das hier markieren: Jeder markiert den Irren, so als wären wir selbst die Idioten – denn natürlich hat keiner Lust, bei Polarlicht in ungeheizter Baracke Schnee zu fressen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie man das Gutachten ausfüllt!«
Und so würde Mokosch ins Lager nach Potma in Mordwinien verschickt, gelänge es ihr nicht die Nacht zuvor, sich mit dem Handtuch am Fenstergitter zu erhängen. Die Zellenkameradin wird auf dem Transport davon berichten, kurz nachdem der Hering ausgeteilt ist, draußen wischt gerade ein Bahnhofsschild vorbei: Saraktasch. Die Aufseherin, sagt sie, habe beim Anblick der Erhängten das große Zittern bekommen. »Ist doch klar, die müssen auch um ihre Stellen bangen, da gibt es bestimmt genug Anwärter.«
Swarog wird im Strandrestaurant von Pizunda unterm Strohdach seiner Frau beim Kuchenessen zusehen und wie sie beim Sprechen die Creme vom Teller auf das Gäbelchen stippt. Später wird man auf ihrer Datscha in Werbilki den Kübel mit der Palme ins Haus tragen, die den Sommer über deutlich an Größe zugelegt hat. »Ein Regenbogen!«, wird sein Sohn zwei Jahre später plötzlich ausrufen, als das Kindermädchen beim Bügeln den Mund voll Wasser genommen hat und über die Wäsche verspritzt. Noch ein Jahr später wird Swarog seine Mutter in den Sarg betten, und sie wird plötzlich lächeln, sodass er erschrocken zurückspringt und die Angestellte ihm erst erklären muss, dass das nichts Ungewöhnliches sei, manchmal würde ein Muskel des Toten noch zucken. Den Sommer darauf wird er sich, Hände an die Bordwand geklammert, von einem Boot über den Teich ziehen lassen, darin sitzt seine neue Frau, die ihm Erdbeeren in den offenen Mund steckt. Und seine letzte Verteidigungsrede beendet er mit erhobenem Zeigefinger, den er kreuzweise durch die verbrauchte Luft fahren lässt: »Kein Verbrechen, also keine Strafe!« Denn beim nachfolgenden Mittagessen sprudelt ihm plötzlich das Blut aus der Kehle, in den Teller hinein.
Weles hinwiederum wird einmal viele Jahre später schlaflos im Bett liegen und plötzlich den Gedanken haben: Lieber Gott, hab Dank für dieses Kind, das da in seinem Bettchen vor sich hin schnauft, und für die Frau an meiner Seite, und für den Streifen Licht an der Decke, und jetzt für die Sirene vom Güterzug, und für die zwei Sterne da im oberen Fenster …
Während Perun sich mit dem Taschentuch den Schweiß aus dem Nacken wischt und sagt: »Von mir aus kann es gewittern!«
Worauf gehorsam ein Donner von ferne über den Dächern der Datschas grollt.
»Schau dir das an, Bello«, sagt Perun, mit dem Finger in Richtung Wäldchen deutend, »was für eine saftige Pflaume da hängt!«
Auf die Wipfel der Birken gestützt, walzt dort ein Weltuntergang heran: dräuend, grummelnd, flackernd.
»Als ich so klein war wie du«, wird Perun zu seinem Hund sagen, denn da ist keiner, mit dem er sonst reden könnte, »nur dass du schon ein alter Herr mit Hängeschwanz bist, aber ich war in deinem Alter wirklich noch klein und eine richtige Leseratte, da war in einem Buch von einem Hund die Rede, der zum Grab seines Herrn kam und dort blieb und auf ihn wartete. Los, komm da raus, schien er sagen zu wollen, wir wollen unsere alltägliche Runde gehen: erst zum Bäcker, dann Milch holen und zum Zeitungskiosk und dann durch den Park – ich mit der Zeitung in der Schnauze! Den Friedhofsleuten brach es das Herz, als sie ihn dort sahen, sie legten ihm Brotkanten vor die Nase und Eier und sonst was, aber der Hund verschmähte das alles und ist aus lauter Treue und vor Entkräftung gestorben. Begraben wurde er neben seinem Herrchen, sodass sie nun endlich wieder beisammen waren und ihre Runde gehen konnten: Bäcker, Milchladen, Zeitungskiosk, Park, und jedes Mal trug er die Zeitung zwischen den Zähnen. Da kannst du mal sehen, Bello, was es für Hunde gibt! Wenn ich eines Tages sterbe, was wird dann aus dir? Ich wüsste nicht mal, wer dich aufnehmen sollte. Du wirst verloren sein, mein armes Hündchen!«
Zuerst überzieht sich das Dach von Nachbars Scheune mit dunklen Sprenkeln, dann ist es mit einem Mal gleichmäßig nass und erglänzt in den düsteren Farben des Himmels. Die Pappeln hinterm Zaun beginnen hektisch zu werden, die Kiefern werfen dürre Zweige auf die Straße. Vom Fliederbusch her Getrommel. Aus der Dachrinne zunächst ein schütteres Tröpfeln, doch bald schon ergießt sich ein satter Strahl, dann ein reißender Strom, in hohem Bogen über das Wasserfass hinausschießend, mitten in den Phlox hinein, ein Gemisch aus Staub, Ziegelgrus und Wasser.
In der Veranda will die Gardine mit einem Mal zum Fenster hinaus, Perun bekommt sie gerade noch am Saum zu fassen.
Und schneeballartig wird die Welt sich zur Hölle auswachsen mit allem Drum und Dran, wird schnaufen und gurgeln und röcheln und schmatzen und schnalzen und grummeln und lispeln und näseln bis ans Ende aller Zeiten, bis einer das Buch zuklappt, sodass man den Umschlag mit dem schönen Sternenmuster sehen kann.
Nun war die Ehre wohl auch an mir.
Freut euch, Athener!
An den hochwerten Hypereides vom muffigen Kompendium für russische Gerichtsredner. Hiermit teilen wir Ihnen mit. Eingestandnermaßen. Was bleibt uns weiter übrig. In Vorbereitung der anstehenden Neuauflage hielten wir es für denkbar und in gewisser Weise sogar – wenn schon lügen, dann richtig – wünschenswert, einen Artikel über Ihre Wenigkeit in unser renommiertes Lexikon aufzunehmen und damit wohl oder übel Ihr langjähriges verdienstvolles Wirken auf dem Felde der Wahrheitsfindung gebührlich zu würdigen, so man die Wahrheit, wie in den Statuten verankert, als Ausfluss der Gerichtsrede definiert. Neider und sonst wie übelwollende Existenzen sind ja auch nicht allmächtig, nicht wahr, wodurch dir, Kamerad, in Anbetracht deines Dienstalters nun endlich ein Artikel dritter Klasse zufällt, lieber spät als postum. Von daher ergeht an dich, stachliger, aber großherziger Hypereides, der du Nachsicht auch gegenüber Schwerenötern mit angewachsenen Ohrläppchen hervorzukitzeln weißt, die Bitte, es auch uns nachzusehen und mit eingeschriebener Post ein photographisches Bildnis nebst zweiseitigem Lebenslauf zu übersenden, aus dem hervorgehen sollte, wie viele verirrte Fischlein aus dem Menschenmeer du vor dem Haken bewahrtest und ob du als Kind deiner Amme die Warzen zerbissen.
So saß ich, meinen Lebenslauf niederzuschreiben, doch die Feder, nach der ich gegriffen, erwies sich als stotternd.
Dies und jenes probierte ich aus, begann von hinten und von vorne – immer fühlte es sich wie ein Nachruf an. Ich nahm einen der Bände aus dem Regal und blätterte: Herrgott, das ist doch ein Friedhof und kein Kompendium.
Aber so ließe sich beginnen: Er braucht seine Ruhe. Hat mehr als genug erlebt.
Oder so: Der Entschlafene war ein Produkt seiner Zeit, die so verrückt und verbohrt war, Menschen unter ihrem Mühlstein zu zermahlen, wenn jemandem danach war … Wer war dieser Jemand?
Ich trank Tee und sah zum Fenster hinaus. Ein Schwarm Vögel kreiste über den Bäumen wie Teeblätter um den rührenden Löffel im Glas.
Jetzt half nur ein Spaziergang. Ich ging zu Anetschka hinüber. Mein Engelchen reckte sich mir entgegen, freute sich und sabberte. Ich trug das Kind nach unten, setzte es in den Wagen. Wir gingen in den Snamenka-Park spazieren. Als wir ankamen, war es dort schönster Herbst. Guck dir das an, sage ich zu Anetschka, so sieht der September aus. Das hier ist ein Ahornblatt, greif zu! Das können wir zu Hause in eine Vase stellen oder in ein Buch legen und vergessen, oder wir lassen es hier, behalten es einfach in Erinnerung. Dieser Weg hier führt zur Wolga hinunter, die Wolga ist ein Fluss, der randvoll bis zu seinen sandigen Ufern mit Infusorien gefüllt ist. Die Wolga fließt ins Hyrkanische Meer. Dort drüben spielen die Kinder hinter den Bäumen Verstecken. Und da, sieh mal, die Sonne in der Pfütze! Das da sind Astern. Sie blühen gerade. Das ist eine Kiefer. Sie wirft mit Kienäpfeln. Und die Luft, riech mal, wie sie duftet. Dort oben zwischen den Ästen wohnt der liebe Gott. Und jetzt: Spürst du den Wind? Er nimmt die Vergangenheit mit … So schwätze ich vor mich hin, und mein Liebling lächelt selig.
Als ich zurück war, griff ich mich am Schlafittchen und zerrte mich an den Schreibtisch. Blätterte wieder im alten Kompendium. Warum bloß das Ganze, für wen und wozu? Abdrucken werden sie sowieso nur ein paar hohle Zeilen petit und daneben ein Photo, das ein Exponat aus dem Wachsfigurenkabinett zeigt. Was hat das zu tun mit diesem Zimmer, in dem die Bücher wie Ziegelsteine gestapelt sind und das mir zum Hals heraushängt? Mit meiner rapide welkenden Haut, dem Rechtshänder im Spiegel?
So plagte ich mich ein Weilchen, ehe ich es fürs Erste sein ließ. Kann warten, die Sache. Nächste Woche gehe ich dran. Und dann rückt gefälligst zusammen, ihr hochnäsigen Mitbenutzer des Alphabets! Ich komme mit meinem Bündel zu euch auf die Pritsche der Ewigkeit gekrochen! Der Buchstabenfresser, das im Archiv hausende Kerbtier, soll mich kennenlernen! Wenn ich mal tot bin, wird dies Buch mein einzig verbleibender Aufenthaltsort auf Erden sein. Unter dem Buchdeckel werde ich mich verbergen, zwischen den Seiten ansitzen und warten aufs Jüngste Gericht: ob nicht irgendwer, um ein quengelndes Kind zu beruhigen, gerade diesen Folianten aus dem Regal nimmt.
»Da hast du, Manetschka, schau dir die Bilder an …« Und ich klappe auf aus der Versenkung, und der Kinderfinger tippt mir vorsichtig an den Bart – könnte ja sein, dass ich zuschnappe.
Wo bist du, Hypereides, erwacht in tiefer Nacht? Wie hat es dich hierher verschlagen? Was sind das für Stimmen, wer diese Leute?
Alles scheint verschwommen, schwankend und schillernd. Mal ein Wispern, unklares Raunen. Alles fremd und sonderbar. Die Menschen nicht gänzlich am Leben, die Toten nicht ganz tot. Ist dieser September womöglich der Hades? Dreh dich um! Sieh genau hin! Atme ein aus voller Brust! Ringsum ist asphodelisches Schwemmgebiet. Hinter dem Wäldchen erstrecken sich die stygischen Sümpfe, da tragen sie jedes Jahr eimerweise Torf- und Preiselbeeren raus. Rotbäckiges Laub rieselt in den eiskalten Acheron, von dem man nicht glauben mag, dass er einmal schiffbar war, so viel trübes grünes Geschling. Im Schilf ersterben die Kröten, da sie meine Schritte hören, im Wasserloch die Wolken. Pfeifend kommt mein Vater des Weges, die Schöße seines offenen Mantels verhaken sich im Klettenbusch. Jetzt ist er stehen geblieben, scharrt mit der Schuhspitze einen Kieselstein hervor, der, wer weiß warum, seine Aufmerksamkeit erregt, brummelt etwas, läuft weiter.
»Vater!«
Er hört nicht.
»Vater, warte doch!«
Er wendet sich um. Furcht die Stirn, äugt umher, lauscht. Hebt den Ast auf, der eben unter seinem Fuß geknackt hat, wirft ihn in den Fluss. Platsch. Das zieht Kreise. Auf dem schwarzen Wasser klebendes Laub kommt ins Schaukeln wie Kinder auf ihren Schaukelpferdchen.
»Mensch, Vater, deine Augen werden wirklich immer schlechter. Ich bins. Hier meine Hand. Lass dich umarmen.«
Ich will ihn anfassen, den verschlissenen, mit Birkensamen bestreuten Mantel berühren, doch die Hand fällt ins Leere. Diese Leere im Inneren meines Vaters ist wie Gallert.
Er lacht. »Sag ich doch die ganze Zeit! Der menschliche Körper besteht aus Fruchtsuppe, einer Suppe aus Atomen, die ihrerseits aus Buchstaben bestehen.«
Der Vater des Verblichenen war Direktor einer Schule, wo im Blumentopf auf dem Fensterbrett ein Apfelgriebs liegt, und aus der Toilette kriechen die Urinschwaden.
Aber horch! Was sind das für sphärische Klänge, die durch die abendlich leeren Flure hallen? Wes dreiste Schritte stören die Einkehr der Bildnisse und Zitate? Wem hinterher hüpft das Echo über das spiegelblank gewichste Parkett des Medwednikow-Gymnasiums?
Da schlägt ein helmblitzender Knabe die unsichtbaren Sarazener. Er selber ist geschlagen mit einer Schielbrille, deren eines Glas verklebt ist, und mit der krankhaften Furcht, eine Spinne zu verschlucken. Zum sechsten Geburtstag bekam ich vom Vater eine Ritterrüstung geschenkt, die seine Schüler im Werkunterricht gefertigt hatten: Helm und Harnisch in passender Größe, ein Schild, das einem Topfdeckel glich, ein Schwert, beidseitig geschliffen, und eine langschattige Lanze. Abends, wenn das Haus für die Nacht zugesperrt worden war, entfloh ich der väterlichen Dienstwohnung, die sich im Seitenflügel befand, und ging in die Offensive, fegte mit Gebrüll durch die dunklen Korridore und teilte kräftig aus nach links und nach rechts, Feinde zu Dutzenden niedermähend. Dies war mein Haus, das zu besetzen sie sich erdreistet, meine Burg, meine Festung. Köpfe und Turbane rollten, Stockwerk für Stockwerk ward die Schule gesäubert von der garstigen Brut.
Ich war der Einzige, denke ich, der meinen Vater nicht fürchtete. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, auch mir bisweilen mulmig werden konnte unter seinem Blick, der einen jeden Rabauken und noch die in geschlossener Front rebellierende Klasse zum Einknicken brachte. Mein Vater gab Mathematik, außerdem Logik. Das Anzünden seiner Pfeife kommentierte er so: »Das Angenehme ist mitunter verwerflich, und alles Verwerfliche ist schädlich. Folglich kann es vorkommen, dass das Schädliche angenehm ist.«
Und wenn ich mich weigerte, die verhassten wollenen Leibchen anzuziehen: »Wollene Kleidung hält die Wärme im Körper. Dinge, die Wärme halten, sind schlechte Wärmeleiter. Folglich sind zu den schlechten Wärmeleitern wollene Kleider zu zählen.«
Derlei Sprüche machten schwindlig, und ich gab allen Widerstand auf.
Manchmal ließ er sich erweichen und erzählte mir vor dem Einschlafen unerhörte Geschichten von ganz wunderlicher Art. Sie spielten immer irgendwo in Indien oder Afrika. Da kam zum Beispiel eine Ägypterin mit ihrem kleinen Sohn zu den Ufern des Nil, und ein Krokodil sprang aus den Fluten und schnappte sich das Kind. Der Junge hieß selbstverständlich wie ich und war ebenso alt, sah auch so aus, trug eine halb verklebte Brille. Die Ägypterin brach in Tränen aus und flehte das Krokodil an, es solle ihm ihr Kind zurückgeben.
Ich spürte die schwere Krokodiltatze in meinem Nacken, roch den Odem des Todes aus seinem Schlund, hörte das Klacken der schiefen Zähne an meinem Ohr.
Und das Krokodil sprach: »Du kriegst ihn zurück, wenn du zuvor errätst, ob ich dir deine Bitte erfüllen werde oder nicht.«
»Du wirst es nicht tun«, riet die Mutter.
Darauf das Krokodil: »Ha! Nun kann ich dir den Jungen auf gar keinen Fall zurückgeben. Denn wenn deine Antwort zutrifft, so behalte ich das Kind, wie du es sagst. Trifft sie nicht zu, bekommst du das Kind nicht zurück, weil unsere Abmachung es so will.«
Doch an dieser Stelle geschah das Wunder.
»Ha!«, entgegnete die Mutter triumphierend. »Dann ist es ja so, wie ich es vorhergesagt habe, und du musst mir mein Kind zurückgeben. Ist es aber nicht so, gibst du es mir sowieso.«
Die Kinnlade des Krokodils klappte auf, und ich war gerettet.
Jetzt aber kann ich nicht einschlafen, weil ich immerzu an Vater denken muss. An unsere Wohnung, Mama.
Wie geschickt er beim Frühstück im Sonnenschein sein Ei köpft: mit einem Knack. Wie er zum Abschlussexamen in der Aula das Kuvert mit den Aufsatzthemen entsiegelt, und plötzlich springt ihm die Schere aus den Fingern und segelt lärmend übers Parkett. Wie er an Mamas Geburtstag ein Ständchen auf dem Klavier spielt, und in den Chopin mischt sich leises Kastagnettenklappern, weil er sich immer die Fingernägel spitz feilt. Wie Mama meine Hausaufgaben abfragt, während sie sich das Haar für die Nacht zu einem dünnen Zopf flicht. Und wie sie mir den Gutenachtkuss gibt, bevor sie ins Theater geht, dabei löst sich unbemerkt der Stecker von ihrem Ohr und fällt in mein Bett.
Sie passten absolut nicht zueinander: Vater, ein ewig nörgelnder Pedant – Mutter, zerstreut und vergesslich, die Finger immerzu fleckig von Chemikalien. Sie unterrichtete Chemie, obwohl sie keine Ahnung davon hatte. Das Fach war ihr zuwider, aber das mochte sie nicht gern zeigen. Experimente, die sie vorführte, gingen regelmäßig schief. Klappte es doch einmal, dass Weiß zu Rot wurde, Feuer zu Wasser und Stein zu Spänen, staunte sie selbst am allermeisten darüber. Solange der Versuch lief, murmelte sie vor sich hin – als betete sie zum Chemiegott, der in ihrer Ablufthaube wohnen mochte.
Sie brachte es fertig, im kreidebemehlten Jackett oder mit hervorblitzendem Unterrock durch die Aula zu spazieren. Ihre Nachlässigkeit machte Vater rasend, dennoch erhob er nie die Stimme, äußerte höchstens irgendeinen verschrobenen Syllogismus, den ich nicht verstand, Mama dafür umso besser, denn in der Folge herrschte zwischen ihnen eisiges Schweigen, das konnte tagelang so gehen.
Überall – am Esstisch, an der Kommode, unter jedem Stuhl, gar auch an meinem Bett – klebten diskrete Marken mit Inventarnummer. Selbst die Bilder an der Wand waren amtlich. Mein Vater legte keinen Wert auf Besitz, denke ich. Er fürchtete wohl, die Leichtigkeit, die an ihm war, mit Dingen zu beschweren.
Und wenn ich ihm als Kind auf die Nerven fiel, war er es, der den erstbesten Folianten aus dem Regal nahm und mir vor die Nase hielt: »Hier, Saschenka, guck dir die Bilder an!«
Auf denen waren sonderbare Menschen in Schürzen, mit Schakal- und Krokodilköpfen zu sehen. Gemessen an der Dicke des Buches gab es davon jedoch nicht viel. Aber sowieso war es der Text, der mich an diesen Erwachsenenbüchern interessierte, mehr reizte als alle Kaschtankas. Auch wenn das meiste über meinen kindlichen Verstand ging – ich las es und war hingerissen. Zum Beispiel Osiris: dass er mit seiner Schwester vermählt war, erstaunte mich nicht, wohl aber, dass die Hochzeit schon vor ihrer beider Geburt erfolgte. Genauso unbegreiflich war, dass eine Daunenfeder mehr Gewicht auf die Waage bringen konnte als ein Herz. Ein Kind von einem Toten empfangen, wie ging das? Und was war ein Phallus? … Anderes wiederum kam einem bekannt vor: Wenn Osiris in einer Truhe in den Nil geworfen wurde, ließ das an Puschkins Märchen vom Zaren Saltan denken: Wolken ziehn am Himmel schwer, und das Fass schwimmt auf dem Meer … Der Vogel Phönix schillerte gewiss nicht prächtiger als unser russischer Feuervogel, und die Särge mit den Mumien darin wurden gerade so wie Matrjoschkas ineinandergeschachtelt.
Ich wollte es genauer wissen und hing also bald wieder an des Vaters Rockzipfel: »Wird denn jeder Mensch, wenn er stirbt, ein Osiris?«
Er saß am Tisch und korrigierte Hefte.
»Jaja«, sagte er nur und nickte.
Ich ließ nicht locker. »Puschkin ist auch einer geworden?«
»Puschkin auch. Stör mich bitte nicht.«
Das ließ sich aber nun gar nicht mehr vermeiden. »Und du, bist du denn auch ein Osiris?«
Mein Vater stutzte und legte die Feder aus der Hand. »Ich? Nein, wieso, ich bin doch noch am Leben«, sagte er lächelnd.
»Aber wenn du stirbst …?«
Da lachte er laut auf – um im nächsten Moment in tückischem Ton zu wispern: »Wo ist eigentlich die Zeitung von gestern?«
Das war das Signal für die glücklichsten Minuten des Tages. Wir falteten die Zeitung zu Fliegenklatschen zusammen und machten Jagd aufeinander, tobten durch die Zimmer.
Wasser war das Einzige, was er trank, die Karaffe stand immer auf dem Esstisch.
»Der Mensch besteht zu achtzig Prozent aus Wasser, wie man weiß«, pflegte er zu sagen. »Nicht etwa aus Tee mit Zitrone oder Kaffee mit Sahne.«
Ein Curriculum vitae wollte ich schreiben, und jetzt ist ein Karl Iwanitsch draus geworden.
Ein Mädchen kommt zu mir in die Sprechstunde. Tritt zaghaft ein, mit der Schulter voran, verschreckt und verheult, die Nase rot geschwollen. »Treten Sie näher! Nur keine Bange, kommen Sie, setzen Sie sich!«
Sie setzt sich auf die Stuhlkante.
Ich werfe einen Blick auf die Visitenkarte. »Sie sind also … Pawel Petrowitsch Lunin, Mademoiselle?«
Der Scherz bringt sie noch mehr aus der Fassung, sie springt gleich wieder auf. »Das ist mein Vater, wir treten gemeinsam auf. Aber das ist alles ein Missverständnis, Papa trägt keinerlei Schuld, da muss ein Fehler vorliegen!«
Ich drücke sie zurück auf den Stuhl. »So beruhigen Sie sich doch, um Himmels willen!«
Sie schnäuzt sich und schnieft, scheint gleich wieder losheulen zu wollen. »Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das alles ist!«
»Ich kann Ihnen versichern, meine Liebe«, erwidere ich, »dass ich mir alles Mögliche vorstellen kann und auch dieses. Erzählen Sie, und wir werden sehen, wie Ihnen am besten zu helfen ist.«
»Mein Vater … Er ist … Man hat …«
Na bitte, schon wieder Schluchzen.
Sie verbirgt das Gesicht im Taschentuch, die schmalen Schultern beben, die Ohren lohen.
»Jetzt ist es aber mal gut. Wie heißen Sie? Trinken Sie einen Schluck Wasser!«
»Anja.« Sie haucht es kaum vernehmlich.
»Sehen Sie, meine Tochter heißt auch so, Anja, Anetschka. Halb so groß wie Sie und heult längst nicht so viel!«
Erst lehnt sie zu trinken ab, dann leert sie das ganze Glas.
Ich sehe ihr zu, wie sie trinkt, mit einer Geste der Entschuldigung wieder aufsteht, um zum Spiegel zu gehen, die Nase frisch zu pudern, sie tut es wie eine Erwachsene; ihr Kleid liegt so eng an, dass das Gummi des Strumpfhalters sich darunter abzeichnet. Und ich weiß im Voraus, was sie mir jetzt gleich erzählen wird. Ich flehe Sie an, wird sie sagen, retten Sie meinen Vater, der an allem unschuldig ist, auch wenn er vorgestern unter ungeklärten Umständen, gerade als der Kurierzug in der Ferne tutete, einen nicht identifizierten Leichnam, vielleicht haben Sie in der Zeitung davon gelesen, es stand ja überall. Natürlich habe ich das. Vorgestern im Mittagszug, unterwegs zur Datscha, die Septembersonne schlug quer durch den Wagen, und längs des Damms eine Kette Pappeln, weshalb mein Wolgabote rhythmisch aufleuchtete und wieder erlosch, das reinste Seeleuchtfeuer: Punkt- Strich, Punkt-Strich, die Augen taten einem weh davon.
»Soweit mir bekannt ist, verehrte Anna Pawlowna, hat die ermittelnde Behörde keinerlei stichhaltige Indizien gegen Ihren Vater in der Hand. Alles höchst unklar und verworren. Weder weiß man, wer das Opfer war, noch kennt man die Motive des Verbrechens. Auf Mutmaßungen lässt sich keine vernünftige Anklage gründen, deshalb ist Herr Lunin bislang auch nur vorbeugend beauflagt worden, die Stadt nicht zu verlassen.«
»Er ist ein so wunderbarer Mensch, verstehen Sie, er wäre zu so etwas einfach nicht fähig!«
»Oh, meine Liebe, wenn Sie wüssten, wozu diese wunderbaren Menschen alles fähig sind! Aber nein, entschuldigen Sie – von der Unschuld Ihres Vaters bin ich felsenfest überzeugt. Selbstredend handelt es sich um ein betrübliches Missverständnis. Gewiss werden sich die Umstände dieser leidigen Angelegenheit in allernächster Zeit aufklären lassen, und die Polizei wird allen Grund haben, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Und sollte die Sache wider Erwarten doch zu einem Prozess führen, so danke ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Der Sieg ist uns sicher. Ich werde alles tun, um einen Freispruch für Ihren Herrn Vater zu erlangen. Warum ist er eigentlich nicht selbst gekommen?«
Gerade schien das Mädchen sich ein wenig gefasst zu haben, ihr zartes Köpfchen hatte freudig genickt, doch bei dieser Frage schrak sie auf, ihre Miene verdüsterte sich.
»Es geht ihm nicht gut«, stammelte sie erschrocken, »er ist krank. Hat Fieber.«
»Verstehe. In diesem Fall richten Sie ihm meine besten Wünsche für baldige Genesung aus.«
Und wieder war sie aufgesprungen, flammende Röte schoss ihr ins Gesicht.
»Was ist denn noch, mein Kind?«
Sie hielt mir ein Kuvert entgegen.
»Was ist das?«
»Da sind fünfzig Rubel drin. Mehr haben wir nicht.«
»Stecken Sie das weg!«
Sie legte es auf meinen Tisch, schob es unter die Papiere.
»Was fällt Ihnen ein! Augenblicklich nehmen Sie dieses Geld zurück!«
Ich ergriff das Kuvert, schob es in ihre Handtasche.
»Dann nehmen Sie wenigstens hier die Freikarten!«, sprach sie bebend. »Wir geben eine Vorstellung im Simin-Theater. Es wird Ihnen sehr gefallen. Bringen Sie Ihr Töchterchen mit!«
»Das ist ja nett. Für wann denn?«
»Zum Beispiel heute Abend.«
»Ach. Eben sagten Sie noch, Ihr Vater sei krank, mit Verlaub.«
»Sie wissen nicht, was es bedeutet, Künstler zu sein. Er muss auftreten, wenn die Vorstellung angekündigt ist!«
Ach Anja, Schniefnäschen, du denkst anscheinend, der Mann, der da vor dir saß, wäre edel, hilfreich und gut und vor allem mächtig. Dass das Publikum in Scharen geströmt käme zu seinen Reden, Eintritt bezahlte. Eine lokale Berühmtheit, die man um Hilfe bitten kann, wenn die Familie vom Leid betroffen ist. Die letzte Hoffnung … Dabei ist er das Schwarze unter deinem Fingernagel nicht wert.
Morgen:
Zum Zahnarzt
Photographieren lassen
Bei Tolbejew Bücher nach Kat. bestellen
Pfandbriefe im Fall E. einsehen
Abends – Simin-Theater (?)
Nirgends kann man hingehen, ohne Bekannte zu treffen. Heute im Theater schon an der Garderobe. Ein Geschiebe und Gedränge, nasse Schirme und Mäntel, tropfende Hüte. Theatergerüche aus klaffenden Handtaschen, staubigen Plüschsofas, klatschnassem Gymnasiastinnenhaar. Vom Büfett her duftete es nach geröstetem Kaffee.
Alles schaute auf meine Kleine. Stolz führte ich sie an der Hand umher. »Komm, Anetschka, gleich fängt die Vorstellung an.«
Da stand auf einmal K. K. vor mir. »Ah, Alexander Wassiljewitsch leibhaftig. Und die Kleine ist ja groß geworden! Das Engelchen! Schon fast eine kleine Husarin!«
Und er quasselt etwas mit vielen Ausrufezeichen in seinen bekrümelten Bart. Die Krawatte fleckig, da ist ihm wohl Suppe draufgetropft. Das wird seiner Seligen peinlich sein, wenn sie von irgendwo droben herabschaut. Wie sieht er wieder aus, wird sie denken. Kaum dass ich nicht mehr da bin, lässt er sich gehen.
»Was täte meine Werteste sich freuen, wenn sie noch unter uns weilte, Euch zu sehen, Alexander Wassiljewitsch! Sie hatte einen Narren an Euch gefressen. Aber seht nur, wie viele Leute gekommen sind! Es heißt, anfangs wären sie vor leerem Saal aufgetreten, jetzt ist es rappelvoll. Man kennt ja das hiesige Publikum. Alle wollen sie einen Unhold begaffen. Ein ehrbarer Mann lockt keinen hinterm Ofen hervor. Ihr kommt doch zur Gedenkfeier am vierzigsten Tag? Tut ihr den Gefallen …«
Ich versprach es ihm, was soll man machen.
Wir hatten uns verabschiedet und waren schon in der Tür zum Saal, da winkte der Alte immer noch Anetschka hinterher, sie blies vor Vergnügen Spuckeblasen – und plötzlich eilte er noch einmal heran, drückte mir innig die Hand und raunte in mein Ohr: »Ihr seid ein Heiliger. Ich danke Euch.«
Ach, K. K., du guter alter Esel … Keine Ahnung, warum sie alle denken, ich müsste darunter leiden, mich mit meinem kleinen Goldschatz an der Hand in der Öffentlichkeit zu zeigen. Und darüber aufzuklären lohnt nicht – fängst du erst damit an, schütteln sie nur den Kopf und bedauern dich noch mehr. Von mir aus. Sollen sie!
Der stickige kleine Saal des Simin war tatsächlich voll besetzt. Ich setzte mir Anetschka auf die Knie. »Pass mal auf, gleich kommt der Zauberer und führt uns Kunststücke vor!«
Das Publikum begann ungeduldig zu applaudieren, mein Sonnenschein klatschte mit gespreizten Fingern eifrig mit.
Der Vorhang bauschte sich von einem Luftzug. Ich hatte zu tun, meiner Prinzessin die Spucke vom Mund zu wischen. Endlich ging der Vorhang auf. Und kein Hindu mit Turban trat an die Rampe, auch kein Mephisto im Feuermantel – beides hätte mich nicht gewundert –, sondern mein alter Schönschreiblehrer Gromow: so quadratschädelig, gravitätisch und maulwurfsblind wie in alten Zeiten. Immer noch dasselbe gepflegte Kinnbärtchen, dasselbe ironische Lächeln im Mundwinkel, die langen rosa Fingernägel. Dass es mir kalt über den Rücken lief, wäre noch untertrieben. Augenblicklich fühlte ich mich wieder wie das am Boden zerstörte Schulkind von einst, dem der Professor, zwangsversetzt von der Universität an unsere Schule nach irgendeinem Vorfall, verächtlich das Heft auf die Bank warf mit den Worten: »Das da, mein Verehrtester, stammt nicht aus dem russischen Tintenfass.«
Wenn es keine Seelenwanderung war, so doch ein verblüffender Fall von Doppelgängerei. Auch die Stimme hatte sich weiterverpflanzt. Ebenso die Marotte, das Gesagte mehrfach zu wiederholen, damit auch noch die Dussel in den letzten Bänken es schnallten. Sogar seine alte Schultafel hatte mein verhinderter Professor dabei.
Lunin begann mit Rechenkunststücken. Eine gleichfalls neugeborene Scheherazade in grünen Pumphosen, mit nacktem Bauch und einem hauchzarten Schleier darüber, assistierte ihm. In dem anmutigen Wesen, das da mit klingelnden Glöckchen an der Hüfte über die Bühne trippelte, meine verheulte Mandantin wiederzuerkennen war nicht so einfach.
Jetzt malte sie mit Kreide eine Reihe fünfstelliger Zahlen an die Tafel, wie Freiwillige aus dem Publikum sie ihr aufs Geratewohl zugerufen hatten. Lunin wusste sie mit Leichtigkeit zu multiplizieren, zu dividieren oder ins Quadrat zu nehmen.
»Das ist nichts Besonderes, glauben Sie mir«, sagte er lächelnd, als der erste Applaus verklungen war, »gar nichts Besonderes. Ein jeder von uns bringt seine speziellen Fähigkeiten zur Anwendung, spielend sozusagen. Um ein starker Mann zu werden, muss man bloß seine Muskeln trainieren, Muskeln trainieren ist das Allerwichtigste.«
Man ging zu Sechsstellern über. Lunin legte die Hände flach an die Schläfen, konzentrierte sich einen Moment lang und warf dann lässig die Antwort hin. Einmal irrte er für einen Moment, korrigierte sich jedoch umgehend selbst.
In meinem pausbäckigen, asthmatischen Hintermann fand sich der ungläubige Thomas, der mit einer vorbereiteten Liste die Bühne erklomm. Argwöhnisch begutachtete er zunächst die Kreide, drehte plötzlich mit Schwung die Tafel so herum, dass nur die Zuschauer sie sehen konnten, und übertrug zwei Zahlenkolonnen von seinem Blatt, die der Vortragende zu multiplizieren hatte.
»Sie brauchen sie mir nicht zu zeigen«, sagte Lunin, »es genügt, wenn sie sie mir vorlesen.«
Den Blick zur Decke gerichtet, hörte er sich die Zahlen an, rieb nur die Fäuste leicht gegeneinander und verkündete geruhsam das Ergebnis; es handelte sich um eine Unendliche.
Verdutzt blickte der Thomas auf seine Liste, und ein Strahlen ging ihm übers Gesicht, er hob die Hände, als wie: nicht zu fassen! Das Jackett voller Kreidestaub, kehrte er an seinen Platz zurück.
Lunin behielt lange Ziffernkolonnen, die ihm nur für einen kurzen Moment offeriert wurden, memorierte sie von links nach rechts und von rechts nach links, vollführte noch einige weitere arithmetische Glanzleistungen, doch war all dies nur Aufwärmung, Präludium.
Endlich verkündete Lunin, er habe die einzigartige Gabe, Texte mit den Fingern zu lesen, sei mithin bereit und in der Lage, den Inhalt eines verschlossenen Briefes wiederzugeben, ohne dafür das Kuvert öffnen zu müssen. Währenddessen eilte die Odaliske durch die Reihen und verteilte Umschläge und Briefbögen an die, die sich beteiligen wollten. Auch bei uns kam sie vorbei, lächelte unter ihrem Gazeschleier hervor: »Greifen Sie zu!« – und war im nächsten Moment wieder davongegaukelt. Der Geruch von kindlichem Schweiß, übertüncht mit Parfüm, blieb in der Luft hängen.
»Ich bitte Sie, meine Herren, nicht in Druckbuchstaben zu schreiben«, mahnte Lunin. »Wir wollen das Experiment nicht unnötig simplifizieren!«
Ich prüfte das Kuvert – es schien kein Trick dahinter zu sein –, zückte den Füllfederhalter, wölbte die Hand gegen das Blatt, damit keiner der Umsitzenden Einsicht nehmen konnte, und malte in Großbuchstaben: Telegramm. Darunter in kleinerer Schrift, so wie ich gewöhnlich zu schreiben pflege: »Totschlag ist nicht als Verbrechen zu ahnden, wenn ihm die zulässige, auf den Schutz des eigenen oder eines anderen Lebens oder der Ehre und Keuschheit einer Frau abzielende Notwehr vorausging.«
Ich speichelte die Klebefläche ordentlich ein und verschloss das Kuvert, hielt es prüfend gegen das Licht und fuhr mit der Hand darüber, bevor ich es der herbeieilenden Anja anvertraute.
Die eingesammelten Briefe wurden auf ein Tablett vor Lunin hindrapiert. Stille trat ein.
Er hob die Hände, schlenkerte sie ein wenig durch die Luft, als wollte er sie lockern und entspannen. Dann ergriff er den ersten Umschlag und legte ihn vor sich ab. Fuhr, die Stirn gefurcht, mit den Fingern darüber hin. Man sah die Anspannung in seinem Gesicht, sah die Venen an seinen Schläfen hervortreten. Eine längere Pause entstand. Schließlich sprach er: »Ein Augenblick ist mein gewesen … Wer hat das geschrieben?«, fragte er, in den Saal schauend. »Bitte sich zu erheben!«
Eine Jungfer in der dritten Reihe, uns gerade gegenüber, sichtlich außer Fassung, stand errötend auf und applaudierte. Lunin riss das Kuvert auf und wies dem Publikum das Blatt mit dem berühmten Puschkinvers vor. Beifall brandete auf, den er mit einem kurzen Wink zu stoppen wusste. Schon griff er nach dem nächsten Kuvert. Darin fand sich ein Liebesschwur, der erneut fehlerlos gelesen wurde. Im dritten eine lateinische Schulweisheit.
»Aber Sie haben das falsch geschrieben«, kommentierte Lunin mit abschätziger Miene, bevor er das Kuvert erbrach, »ad calendas graecas, muss es heißen, Sie vergaßen in der Eile das a.«
Schon langte Lunin nach dem nächsten Kuvert. Schloss die Augen, konzentrierte sich, während die Finger über das Papier strichen. »Na, das ist ja einfach: Telegramm! Wer hat das geschrieben? Zeigen Sie sich!«
Ich war verlegen. Der ertappte Schuljunge von einst erhob sich, auch mein Dummerchen schoss neben mir erschrocken in die Höhe. Der ganze Saal wandte sich nach uns um.
»Ich hatte doch gebeten, nicht in Druckbuchstaben zu schreiben«, mäkelte Lunin.
Ich wählte die Vorwärtsverteidigung. »Lesen Sie weiter! Einfach weiterlesen!«, rief ich.
Seine Finger wanderten ein paarmal über das Kuvert. Er drehte es um und wiederholte die Lektüre. Erneutes Umwenden. Währenddessen war das selbstzufriedene Lächeln aus seinem Gesicht verschwunden. Mir schien gar, als würde er blass.
Schließlich las er Wort für Wort vor, was ich geschrieben hatte. »Korrekt?«
Und wieder schaute der ganze Saal auf uns.
Mir trat der Schweiß auf die Stirn.
»Gewiss, gewiss. Vollkommen korrekt«, stammelte ich und ließ mich in den Sessel fallen.
Der Saal fing wieder stürmisch an zu klatschen. Ängstlich schmiegte sich Anetschka an meinen Arm. Ich strich ihr über den Kopf. »Alles ist gut, mein Engelchen. Alles prima!«
Die Pause wurde verkündet. Wir gingen hinaus ins Foyer. Mein Krümelchen spürte wohl, dass mit mir etwas nicht stimmte, und fing zu quengeln an. In diesem Zustand, so wusste ich, würde sie kaum noch zu beruhigen sein. Also ging ich mit ihr zur Garderobe. Wir waren dabei, uns anzuziehen, da hörte ich es in meinem Rücken rufen: »Da sind Sie ja! Ich suche Sie schon die ganze Zeit!«
Ich drehte mich um: Es war Anja, mit falschen Wimpern, Rouge auf den Wangen, in ihres Vaters viel zu großen Kittel gehüllt.
»Kommen Sie, ich mache Sie mit Papa bekannt!«
Wir gingen hinter die Kulissen. Dort war es finster, der Weg verstellt mit staubigem Gerümpel, es roch nach Getriebeöl. Vorbei an einer Reihe verschlissener Türen, vor der letzten blieben wir stehen. Anja klopfte.
»Was ist denn nun schon wieder?«, ertönte eine missmutige Stimme.
Anja lugte durch den Türspalt hinein. »Wir sind es nur!«
Mein wiederauferstandener Schönschreiblehrer saß, die Augen geschlossen, vor dem Spiegel und rieb sich eine Flüssigkeit in die Schläfen. Es roch streng nach Apotheke. Alte, welke Plakate an den Wänden.
»Erlauben Sie, meine Begeisterung kundzutun«, hob ich an. »Ich hatte nicht geglaubt, dass heutzutage noch Wunder geschehen. Um Mademoiselle Lenormand vollends in den Schatten zu stellen, müssten Sie mir nur noch mein Sterbedatum offerieren, vielleicht noch Ort und Zeit meiner Wiedergeburt, und außerdem das Geheimnis verraten, wie Sie es anstellten, das Äußere von Herrn Gromow, meinem seligen Pauker, anzunehmen.«
Lunin klappte die müden gelben Augen auf. Sein Gesicht war im spärlichen Licht der staubbeflockten Lampe aschgrau. »Was wollen Sie von mir?«
»Papa, untersteh dich!«, schluchzte Anja auf. »Das ist doch Alexander Wassiljewitsch!«
Lunin ließ die Augendeckel wieder fallen.
Anja setzte ein gequältes Lächeln auf, mit dem sie die Unhöflichkeit ihres Vaters wettzumachen suchte.
»Dann gehen wir wohl lieber!«, sagte ich. »Der Herr Zauberer scheint nicht in Stimmung zu sein.«
Da knallte Lunin unversehens die Faust auf den Tisch. Das Fläschchen mit der Tinktur hüpfte in die Höhe, fiel zu Boden und zerbrach, Splitter flogen nach allen Seiten, rasch schirmte ich Anjas Gesicht mit der Hand, damit sie nichts abbekam. Vor Schreck plärrte sie los.
Lunin sprang auf. Ohne mich anzusehen, mit einer Stimme, die so beherrscht klang, dass es sich schon wieder bedrohlich ausnahm, presste er durch die Zähne hervor: »Ich brauche keinen Verteidiger. Und hören Sie zu, was ich Ihnen sage. Sie verlassen jetzt diesen Raum. Augenblicklich! Ich bin es leid, noch irgendwem irgendwelche Erklärungen abzugeben. Und Ihrem hochnotpeinlichen Staatsanwalt Herrn Istomin können Sie ausrichten: Wenn er, dieser Milchbart, es noch einmal wagt, sich mit seinen sogenannten Beweisen in mein Hotel einzuschleichen, schmeiße ich ihn die Treppe hinab!«
Entgeistert starrte Anja ihren Vater an.
Ich zuckte die Schultern, nahm meinen plärrenden Sonnenschein auf den Arm, tätschelte ihm den Scheitel.
»Ich darf Ihnen versichern«, sagte ich im Hinausgehen, »dass keiner je in diesem Ton mit mir zu sprechen sich erkühnt hat. Zwar bin ich durchaus geneigt, auf Ihre Verfassung Rücksicht zu nehmen, fürchte nur, Sie unterschätzen den Ernst Ihrer Situation. Leben Sie wohl.«
»Ich pfeif auf Sie und Ihre Si-tu-a-tion!«, rief er uns hinterher. »Ich trage keine Schuld und sehe keinen Grund, mich zu rechtfertigen. Wüsste nicht, wofür!«
Als die Glocke zum zweiten Teil der Vorstellung schellte, waren wir schon auf der Straße.
Bloß gut, dass du bei mir warst, mein Spätzelchen. Welch ein Glück, dass ich dich habe! So kann ich an deinem Bett sitzen, dir aus deinem Lieblingsbuch mit den extragroßen Bildern vorlesen, dein schlafendes Fäustchen küssen, und die Geschichte kommt mir bereits wieder amüsant vor.
Du schnaufst im Schlaf. Was gäbe ich dafür, mich in deinen Traum zu stehlen. Was mag darin vorgehen? Wo bist du, bei wem? Da ich gerade an dich denke, du mein Heil, werde ich wohl auch in deinem Traum vorkommen, es kann nicht anders sein.
Alle Welt tut so, als bedauerte sie dich. In Wirklichkeit haben sie Angst vor dir. Oder sie bedauern mich und haben Angst vor sich selbst.
Über dich gebeugt, um dir einen Gutenachtkuss zu geben, sehe ich, dass die Pupillen unter deinen Lidern flattern. Dein Atem geht schwer und schnell – als liefest du vor jemandem weg. Vor wem und wohin? Hab keine Angst, mein Herzchen, ich bin bei dir. Lauf her zu mir! Wir sind zu zweit, und keiner kann uns was.
Gedenkfeier für Maria Lwowna zum vierzigsten Tag.
Ich hatte schon befürchtet, als Einziger zu erscheinen, dabei ist so ziemlich das ganze Gericht versammelt. Erst recht das Anwaltskollegium, vollständig vertreten. Der alte K. K. ist eine Seele von Mensch, man muss ihn einfach mögen. Nur hinter vorgehaltener Hand, beim Anstoßen, wird so allerlei geraunt.
»Die Selige, mit Verlaub, war doch ein ziemlicher Drachen. Wie hat ers nur die dreißig Jahre mit ihr ausgehalten?«
Im Chor aber so: »Ihr ewiges Angedenken in Ehren! Und Ihr, lieber K. K., gehabt Euch wacker, sie ist ja doch nicht ganz gestorben. Den Tod, den gibt es bekanntlich nicht! Irgendwo da oben ist sie jetzt, Eure bessere Hälfte, und schaut auf Euch hernieder, kopfschüttelnd, aber doch froh, dass wir ihrer gedenken, anstoßen auf ihre streitbare Seele und eingelegte Pilze dazu schmausen. Denn so ist es doch, verehrtester K. K.: der liebste Mensch auf Erden nicht mehr da, aber seine berühmten Pilze knackig wie eh und je! Und wer weiß, offen gesagt, fällts Euch ja womöglich noch ein, wieder zu heiraten, das Herz zu wärmen an einem drallen Leib, das wäre doch was!«
Darauf K. K.: »Ach ja, so ists, meine Lieben, den Gedanken hatte ich auch schon, dass mit ihrem Tod was nicht stimmt! Wie sie da so im Sarg lag, dachte ich mir: eine Fremde! Ein Blick, und ich wusste, das kann mein Maschalein nicht sein, das ist wer anders. Nachts lieg ich wach und meine sie nebenan zu hören, wie sie Wäsche sortiert. Stehe auf und schaue nach – da ist keiner. Öffne den Schrank – und rieche sie. Ihr Geruch steckt dort drinnen, versteht ihr? … Wo sollte sie auch hin sein so schnell. Wir reden miteinander die ganze Zeit. Das heißt, ich frag sie was, erzähl von mir, sie schweigt. Na, soll sie. Wird wieder schmollen, denk ich mir. Früher wars ja auch nicht viel anders: tagelang einander angegiftet, bis sie einschnappte. Bestimmt ist sie noch in der Nähe, hat mir irgendwas krummgenommen und versteckt sich, denkt nicht dran rauszukommen … Alexander Wassiljewitsch, was hieltet Ihr davon, wenn ich Euch einmal meine Schätze zeige!«





























