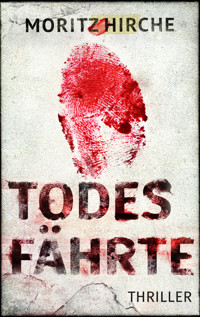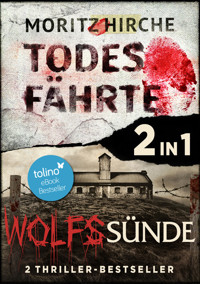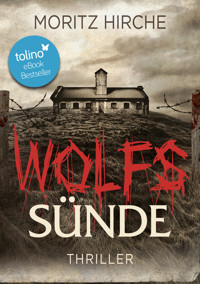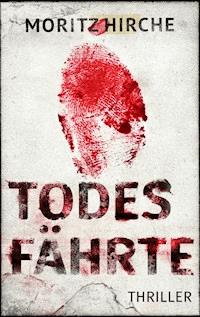4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Berlin, 1923: Zwei rätselhafte Verbrechen lassen die Kripo ratlos zurück. Zwischen einem Mord im Rotlicht-Milieu und dem Raub des kostbarsten Diamanten der Stadt scheint es zunächst keine Verbindung zu geben. Doch am Tatort bleibt eine mysteriöse Botschaft zurück… Fräulein Jette Adler, soeben gegen alle Widerstände als erste Frau in den Dienst der Berliner Kripo getreten, ermittelt verdeckt zwischen Glanz und Elend der brodelnden Hauptstadt. Gemeinsam mit dem undurchsichtigen Kommissar Rosen stößt sie auf einen unglaublichen Verdacht. Er führt bis in ihre eigene Familie. Um das tödliche Geheimnis zu lüften, muss die junge Ermittlerin einer Liebe vertrauen, die sie in höchste Gefahr bringt... Atemberaubender History-Thriller um die erste Kriminalpolizistin im schillernden Berlin der Zwanziger Jahre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Moritz Hirche
DIE ERSTE KOMMISSARIN
Thriller
I Die Auserwählte
Berlin, Kurfürstendamm, Kranzler-Eck
Spätherbst 1920
„Was soll das heißen, Frau Abgeordnete?“, empörte sich die junge Frau. Eine Welle roter Farbe spülte ihre Wangen. „Sie haben es mir versprochen.“
Die kleine, kugelige Dame auf der anderen Seite des runden Cafétisches flocht unangenehm berührt ihre Hände ineinander. Sie hieß Martha Sunneberg und war eine resolute Frau in den frühen Fünfzigern, gestählt von jenem Sumpf, den man politisches Geschäft nannte. Ihr gemütliches Äußeres passte nicht dazu. Es glich eher einer nützlichen Mimikry, die ihr Gegenüber in trügerischer Sicherheit wiegte. Sie erkannte Gefahren schon von Weitem. Sie wusste, wie man Ränkespiele parierte und Intrigen inszenierte. Ihre nur am Ansatz angegrauten, ansonsten brünetten Haare verschwanden zum größten Teil unter einem roten Glockenhut, den sie auch im Café nicht abgenommen hatte. Als wolle sie sich darunter verstecken, inkognito bleiben oder sei nur auf dem Sprung. Ihr kompakter Oberkörper steckte in einem edlen Jackett aus Astrachanfell, das an Kragen und Ärmeln mit Zobel besetzt war. Aus ihrer Körpersprache ließ sich jetzt dagegen fast so etwas wie Verlegenheit lesen. Eine Emotion, die nicht zu ihr passte.
„Verzeihen Sie, Fräulein Adler. Ich war damals ein wenig voreilig. Ich habe gewisse Tatsachen übersehen. Die Dinge haben sich geändert. Sie wissen, das kommt vor im Leben.“
„Geändert?“
„Ja, leider. Dieses Projekt liegt in den Händen des Innenausschusses und der Polizeiführung. Dort gibt es gewisse Einwände gegen Ihre Person.“
Die jüngere Frau, wenig älter als Mitte zwanzig, versuchte, ihre Verärgerung im Zaum zu halten.
„Wenn es an den Zeugnissen der Mädchenschule liegt…“
Die Abgeordnete unterbrach sie mit einer wegwischenden Handbewegung.
„Nein nein, mit Ihren Zeugnissen ist alles in Ordnung. Sogar mehr als das. Es ist…“, sie druckste kurz herum, „…mehr eine familiäre Frage.“
„Was passt Ihnen an meiner Familie nicht?“, erkundigte sich Henriette Adler in einem Ton, den eine Abgeordnete des Reichstags eher selten gewohnt war.
„Junges Fräulein, ich glaube, ich muss Ihnen etwas erklären. Es geht hier nicht um Sie oder mich, sondern um ein wesentlich größeres Ziel. Erst zwei Jahre ist es her, dass Frauen in diesem Land das Wahlrecht erhielten. Wenn unser Weg weiterhin erfolgreich sein soll, dürfen wir uns jetzt keine Fehler erlauben. In der Politik gilt das Prinzip des Machbaren.“
Sie ließ eine bedeutungsschwangere Pause und seufzte dann wie eine erfolglose Nachhilfelehrerin.
„Bitte verstehen Sie doch, Fräulein. Die Angelegenheit ist kompliziert.“
Dann ist sie wahrscheinlich sehr einfach, dachte Henriette Adler, die sonst nur Jette genannt wurde. Sie überlegte fieberhaft, was sie die Chance gekostet haben könnte, in weniger als einem Monat die Ausbildung für Anwärter an der Preußischen Kriminalakademie in Charlottenburg zu beginnen. Zunächst fiel ihr gar nichts ein. Dann verdichtete sich ein Gedanke zur Vermutung. Ihre Mutter. Ging es um ihre Mutter?
„Sie sind sicher ein ehrgeiziges, talentiertes Fräulein“, redete ihre Gesprächspartnerin derweil weiter um den heißen Brei herum, als wisse sie nicht so recht, wie sie es sagen sollte. Schließlich erhob sie beschwichtigend beide Hände, als wolle sie Jette segnen.
„Glauben Sie mir, es ist nichts Persönliches. Doch hier geht es darum, wie ich der Polizeiführung und meinen altmodischen Kollegen im Reichstag die Notwendigkeit verkaufe, in naher Zukunft eine weibliche Kriminalbeamtin zu akzeptieren. Dazu braucht es eine Bewerberin, die über alle Zweifel erhaben ist.“
„Könnten Sie bitte zur Sache kommen?“
Endlich fasste sich die streitbare Frauenrechtlerin ein Herz. Ihre Stimme klang, als brüte sie über einer Akte.
„Sie sind Halbwaise. Ihre Mutter, Friederike Adler, starb vor etwa zwei Jahren, nach dem Großen Krieg. Ihr Vater, damals gerade von der Front aus Flandern heimgekehrt, erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Vor allem gegen die Kriminalpolizei. Er war der Meinung, die Behörden hätten im Fall seiner Ehefrau nicht korrekt ermittelt, ja sogar Beweise unterschlagen. Namentlich richtete er seine Beschwerden gegen den damaligen Herrn Polizeipräsidenten. Und das auch noch in der Presse.“
Jette lachte bitter auf.
„Jetzt verstehe ich, Frau Abgeordnete. Mein Vater legte sich damals mit den falschen Leuten an. Diese Herrschaften sind nachtragend und haben kein Interesse daran, der Tochter des Querulanten den Weg zu ebnen. Sie wissen schon, man nährt keine Schlange an seinem Busen. Übrigens sind Ihre Informationen nicht ganz richtig. Meine Mutter starb nicht vor zwei Jahren. Sie verschwand spurlos aus unserem Haus. Unter ungeklärten Umständen, die möglicherweise auf ein Verbrechen hindeuteten. Später wurde sie dann für tot erklärt, obwohl der Fall nie gelöst werden konnte.“
Die Politikerin wirkte jetzt, als drohe sie, die Nerven zu verlieren.
„Genau da liegt das Problem. Einige Beteiligte äußerten die Befürchtung, Ihnen gehe es bei Ihrer Bewerbung gar nicht um die Rechte der Frauen oder die Arbeit der Kriminalpolizei.“
Jette sah sie unverwandt an.
„Sondern?“
„Um eine persönliche Vendetta“, erwiderte die Abgeordnete frei heraus. „Vielleicht wollen Sie der Polizei nur ihre Unfähigkeit vor Augen führen. Oder kommen gar auf die Idee, das Verschwinden Ihrer Mutter gleich selbst aufzuklären. Zumindest befürchten dies einige. So abwegig erscheint es mir nicht. Die erste Beamtin der Kriminalpolizei wird von allen beobachtet werden. Sie wird bewundert und gehasst werden. Sie wird härter beurteilt werden als ihre männlichen Kollegen. Ihre Motive werden ebenso hinterfragt werden wie ihre Fähigkeiten. Welches Fräulein wir auch immer auf die Akademie nach Charlottenburg schicken, es wird wahrhaftig kein Zuckerschlecken werden. Auch ohne persönliche Konflikte.“
„Und wenn ich Ihnen versichere, dass diese Befürchtungen unzutreffend sind?“
Sunneberg sah Jette bedauernd an. Fast schien es, als denke sie tatsächlich darüber nach, die Entscheidung zu revidieren. Allerdings nur fast. Nach einer endlos scheinenden Weile schüttelte sie den Kopf.
„Es tut mir leid, Fräulein Adler. Selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht mehr ändern. Die Beteiligten haben sich bereits auf eine andere Bewerberin geeinigt.“
Unschlüssig blickte sich Jette um.
„Warum haben Sie mich dann ins Kranzler bestellt, wenn die Angelegenheit bereits entschieden ist?“
„Weil ich möchte, dass Sie Fräulein Kleinschmidt kennenlernen.“
„Bitten Sie mich um meinen Segen für Ihr neues Protegé? Ist das nicht etwas viel verlangt?“
„Es ist mir wichtig, dass Sie sich kennenlernen. Marie Kleinschmidt ist zweiundzwanzig Jahre alt. Sie entstammt einer Arbeiterfamilie aus dem Wedding und hat die Volksschule mit guten Noten verlassen. In der deutschen Sprache, im Mathematikunterricht, aber auch in Leibesertüchtigung und Turnen sind ihre Leistungen überdurchschnittlich. Aus anderer Herkunft hätte sie das Gymnasium sicher längst als Oberprimanerin abgeschlossen.“
Jette dachte über die Worte nach. Dieses Mädchen war fast fünf Jahre jünger als sie. Sie kam aus einem Arbeiterbezirk und hatte die Chance verdient, sich zu beweisen. Sollte sie Erfolg haben und es tatsächlich zur Kriminalbeamtin bringen, konnte sie eine Bresche für alle nachfolgenden Bewerberinnen schlagen. Sie war die Richtige. Für Jette war es dagegen Zeit, den Weg frei zu machen, so schmerzlich es sich auch anfühlte. In den nächsten Tagen würde sie darüber nachdenken, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wollte. Immerhin konnte sie wieder im Krankenhaus arbeiten. Oder sie überlegte es sich noch einmal und begann eine Anstellung in der Firma ihres Vaters. Auch wenn es nicht das war, was sie sich erhofft hatte. Sie nickte Sunneberg zu. Erst zögerlich, dann überzeugter.
Die Abgeordnete nahm ihre Hand, was sich ein wenig zu vertraulich anfühlte.
„Weiß Fräulein Kleinschmidt schon, dass sie die Auserwählte ist?“, erkundigte sich Jette.
„Im Prinzip schon. Wir benötigen lediglich noch die Zustimmung ihres Vaters, bevor sie als alleinstehendes Fräulein eine Ausbildung beginnen darf. Ein Anachronismus, aber so will es das Gesetz und wir dürfen uns keine formellen Fehler erlauben.“ Die Abgeordnete wedelte hoffnungsfroh mit der Hand. „Aber das ist nur eine Formsache. Sie hat mir zugesagt, das unterschriebene Formular heute mitzubringen. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist etwas zum Anstoßen.“
Die Politikerin warf einen Blick auf die Armbanduhr. Gleich elf Uhr vormittags. Sie winkte nach dem Kellner.
„Herr Ober, bringen Sie uns drei Gläser Sekt. Von der besten Sorte des Hauses.“
Eine junge Frau mit mittellangen, kastanienbraunen Haaren betrat das Kranzler und blickte suchend umher.
Zeitgleich mit dem Kellner traf sie am Tisch ein. Sie trug ein sackartiges, unmodisches Kleid, unter dem eine sportliche, fast knabenhafte Erscheinung zu erahnen war. Jette spürte bereits, dass etwas nicht stimmte, bevor sie in ihr Gesicht blickte. Sunneberg schien es ähnlich zu gehen.
„Fräulein Kleinschmidt, geht es Ihnen gut?“, wagte sie einen behutsamen Vorstoß.
Die junge Frau, die noch eher wie ein Mädchen wirkte, hob langsam den Kopf und strich ihre Haare zur Seite. Es war zu sehen, dass sie geweint hatte. Außerdem war neben dem linken Auge eine violette Verfärbung zu erkennen.
„Was ist geschehen?“, bohrte die Abgeordnete weiter, jetzt ernsthaft besorgt.
Die Bewerberin schüttelte nur langsam und schweigend den Kopf.
In diesem Augenblick platzierte der Kellner in schwungvoll-fröhlicher Routine ein Tablett mit drei Sektkelchen auf dem Tisch.
„Sehr zum Wohl, die Damen!“
Bevor Marie Kleinschmidt sich auf den dritten Stuhl fallen ließ, griff sie nach einem der Gläser und stürzte den perlenden Inhalt auf einmal hinunter. Sunneberg blickte irritiert umher. Die Angelegenheit entwickelte sich offenbar ganz und gar nicht wie geplant.
„Weiber bei de Polente, det fehlt uns ooch noch“, stieß Kleinschmidt plötzlich hervor. Die groben Worte schienen aus einem anderen Mund zu kommen. Die Reichstagsabgeordnete wirkte darüber so verdattert wie ein Priester, dem ein blasphemischer Witz erzählt wurde.
„Was sagen Sie da, Fräulein Kleinschmidt?“
„Das hab nicht ich gesagt, sondern mein Vater, als ich ihn um die Unterschrift gebeten habe.“
Trotz und Verbitterung überzogen das Gesicht der jungen Frau.
Sunneberg sah plötzlich aus, als würge sie an einem ungenießbaren Brocken. Höchstwahrscheinlich dachte sie daran, wie sie die Nachricht all denen verkaufen würde, die sich mühsam auf Marie Kleinschmidt als erste preußische Kriminalanwärterin geeinigt hatten.
„Aber Ihr Vater hatte doch schon zugesagt“, erinnerte sich Sunneberg verständnislos.
Fräulein Kleinschmidt erhob trotzig die Augen.
„Schon, aber da war er ja auch nicht besoffen. Hat es sich wohl unterwegs anders überlegt. Vielleicht hat jemand Druck gemacht. Ist ne andere Welt bei uns, da mag keiner die Schutzleute. Mit denen will man nichts zu tun haben. Erst recht nicht in der Nachbarschaft.“
Sunneberg zeigte auf die leichte Verfärbung neben dem linken Auge. „Hat er…?“
„Ist kein Paradies bei uns im Wedding“, antwortete Kleinschmidt ausweichend.
Die Politikerin schnaufte und blickte sich erneut nach dem Kellner um.
„Bringen Sie mir zwei doppelte Cognac.“
Auf die fragenden Blicke der beiden Frauen stellte sie klar: „Sind beide für mich.“
Eine einsame Träne rann über die Wange von Marie Kleinschmidt. In ihr reifte die Gewissheit, dass ihr Leben im Wedding nicht nur begonnen hatte, sondern höchstwahrscheinlich auch dort enden würde. Daran konnten auch ihre Schulnoten nichts ändern. Das Einzige, worauf sie noch hoffen konnte, war es, einen Ehemann zu finden, der sie gut behandelte und vor der Fabrikarbeit bewahrte.
„Sie müssen doch etwas dagegen tun können“, sagte Jette zu der Reichstagsabgeordneten, die bereits verdrossen am zweiten Cognac nippte. Doch die schüttelte den Kopf.
„Ohne Zustimmung des Vaters darf kein alleinstehendes Fräulein eine Beschäftigung aufnehmen. So steht es im Gesetz.“
Kleinschmidt erhob sich. Ihr Gesicht bemühte sich um Tapferkeit.
„Tja, gespielt und verloren. Auf Wiedersehen, Frau Abgeordnete. Es sollte eben nicht sein.“
Die Politikerin reichte ihr die Hand, die die junge Frau zögerlich ergriff.
„Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann.“
Marie Kleinschmidt war noch jung. Doch mit Phrasen und Ausflüchten war man im Wedding noch nie weit gekommen. Ihre Augen sprachen aus, was ihr Mund für sich behielt.
Nachdem sie das Kranzler verlassen hatte, erhob sich Jette ebenfalls.
„Scheint, als hätten Sie noch einen langen Weg vor sich, Frau Abgeordnete.“
In den Augen der Politikerin stand mit einem Mal etwas Gehetztes. Als kämpfe sie um den letzten Listenplatz auf einem Parteitag.
„Warten Sie, nun warten Sie doch“, bat sie und rang nervös die Hände.
„Fröhliche Jagd, Frau Sunneberg. Sie werden schon eine passende Bewerberin finden.“
„Sie wissen genau, dass es nicht sehr viele in Frage kommende Fräulein gibt. Im Übrigen haben wir keine Zeit mehr für ein neues Auswahlverfahren. Der Lehrgang für Kriminalanwärter in Charlottenburg beginnt in weniger als einem Monat. Wenn wir jetzt einen Rückzieher machen, tun die Großkopferten in der Polizeiführung oder dem Innenministerium das womöglich auch. Die warten erst einmal die nächste Wahl ab, um das Vorhaben, wenn möglich, klammheimlich zu beerdigen.“
„Klingt, als steckten Sie in einem gehörigen Dilemma, Frau Abgeordnete.“
Kurz überzog eine wütende Falte Sunnebergs Stirn, bevor sie zu einem verbindlichen Lächeln zurückkehrte. Sie schob das verbliebene Sektglas Jette zu und erhob den Rest ihres Cognacs.
„Herzlichen Glückwunsch, Fräulein Adler. Vielleicht erhalten Sie doch noch Ihre Chance. Sofern ich die hohen Herren davon überzeugen kann, dass Sie ein überschaubares Risiko darstellen.“
Ihre Mimik verfinsterte sich.
„Doch ich will Ihnen nichts vormachen. Man wird es Ihnen nicht leichtmachen. Ich werfe Sie in eine Schlangengrube. Und noch etwas: Ich schicke Sie nicht zur Kripo, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Sondern weil ich den lebenden Beweis brauche, dass es funktioniert.“
Jette lehnte sich vor und hielt ihrem Blick stand.
„Damit habe ich gerechnet. Eine muss ja den Anfang machen, nicht wahr?“
Die Augen der stellvertretenden Vorsitzenden des Innenausschusses umwölkten sich. Jette erkannte einen Anflug von Weisheit, aber auch jene Erbarmungslosigkeit darin, durch die es diese Frau weit gebracht hatte. Für die Reichstagsabgeordnete Sunneberg war sie von jetzt an nicht mehr und nicht weniger als eine Figur auf einem großen, glatten Schachbrett.
„Soso, damit haben Sie gerechnet, mein Kind. Dann lassen Sie es mich anderes ausdrücken. Dort, wo ich Sie hinschicke, hat keiner auf Sie gewartet und niemand will Sie dort haben. Von jetzt an kämpfen Sie allein gegen alle.“
II Zerbrochene Puppe
Berlin-Mitte, Vergnügungsviertel
Februar 1923
Die Temperaturen in der Hauptstadt bewegten sich seit Wochen um den Gefrierpunkt. Eine feuchte, unangenehme Kälte, die kein richtiger Winter war. Nischt halbet und nischt janzet. Wenn es schneite, wurde auf der Straße daraus unverzüglich stinkender, graubrauner Matsch. Dolores hielt den Blick gesenkt. Dolores war nicht ihr richtiger Name. Natürlich nicht. Doch was machte das schon für einen Unterschied. Mechanisch setzte sie einen Fuß vor den anderen, bis sie die Ecke Friedrichstraße erreichte. Sehnsüchtig und frierend wanderten ihre Augen an den glitzernden Verheißungen der Schaufenster und Reklametafeln der Einkaufsmeile entlang. Dann kehrte sie um, die Oranienburger Straße in entgegengesetzter Richtung zurück. Die vereinzelten Passanten bliesen ihren Atem in dichten Dampfwolken vor sich her, als seien sie Lokomotiven. Niemand nahm Notiz von ihr. Aus einer Bar drangen gedämpfte Swingklänge auf die Straße. Im wilden Takt des Charleston schwangen dazu einige junge Nachtschwärmer hinter den beschlagenen Fenstern das Tanzbein. Ansonsten war auf der Amüsiermeile trotz der späten Stunde nicht viel los. Ihre Kolleginnen mochte das stören. Dolores nicht. Sie tat ohnehin nur, als halte sie Ausschau nach Freiern. Denn eigentlich wartete sie nur auf einen einzigen. Seit einer Woche kam er jeden Abend. Die ersten Nächte hatte er gut bezahlt. Für Liebe und Gesellschaft. Am vierten Tag hatte er sie in ein Speiselokal ausgeführt. Keines von der billigen Sorte. Dort hatte er ihr ein Angebot gemacht. Zuerst war sie misstrauisch gewesen. Das war ratsam, wenn man in ihrem Gewerbe und in dieser Gegend überleben wollte. Doch warum sollte sie nicht auch einmal Glück haben? Er sei häufig geschäftlich in der Stadt und schlage ihr ein langfristiges Arrangement vor. Sie müsse sich zukünftig nicht mehr auf der Oranienburger anbieten, sondern könne ihm exklusiv zur Verfügung stehen, wenn er in Berlin sei. Er wolle ihr sogar eine kleine Wohnung anmieten. Das klang nicht schlecht. Nie wieder in diesem widerlichen, verschimmelten Mietskasernen-Zimmer in der Torstraße schlafen, für das Toni, der Lude, ihr auch noch ein Drittel ihres hart erarbeiteten Geldes abknöpfte. Sogar eine Reise hatte er ihr versprochen. Mit dem Schiff über das Mittelmeer, auf die griechischen Inseln. Es klang wie ein Traum, den sie bislang vergeblich geträumt hatte. Falls Toni sie nicht freiwillig gehen ließ, wollte sich William auch darum kümmern. Ja, der gute Geist hatte tatsächlich gesagt, sein Name sei William. Klang irgendwie merkwürdig und war vielleicht genauso ausgedacht wie Dolores. Doch damit konnte sie leben. Sie hatte Willi daraus gemacht. Wie ein Geschäftsmann wirkte William eigentlich nicht mit seinem dunklen Bart. Eher wie ein Matrose. Auch schien er nicht von hier zu kommen. Dafür sprach schon sein Akzent. Aber das Wichtigste war, er musste Geld haben, auch wenn man ihm das nicht gleich ansah. Immerhin logierte er im Adlon. Das sagte doch alles. Vielleicht war er unerwartet zu Wohlstand gekommen. Eine reiche Erbtante womöglich. Der Gedanke entlockte Dolores ein albernes Kichern. Eine Bordsteinschwalbe, die diesen Fisch vom Haken ließ, war selbst schuld. Erzählt hatte er kaum etwas von sich und sie wollte ihn nicht drängen. Stattdessen hatte er sie nach ihrer Familie gefragt. Nach Freunden. Wo sie wohne. Nun, diese Geschichte war schnell erzählt. Keine Familie, kaum Freunde und die winzige Bude in der Torstraße. Kein Wunder, auch sie kam nicht von hier. Was sie vor Jahren von der pommerschen Küste in die Hauptstadt gespült hatte, wusste sie selbst nicht mehr so genau. Wahrscheinlich waren es die Armut, ihr vergnügungssüchtiger Vater und irgendwelche naiven Träume gewesen. Seitdem war das meiste schiefgelaufen, was sie angepackt hatte. Die Zeiten waren nicht rosig. Einige Monate Aushilfe in einer Wäscherei, dann noch schlechtere Anstellungen und schließlich unvermeidlich der Strich. Doch jetzt sah sie einen Silberstreif am Horizont. Dolores würde diese Gelegenheit ergreifen, das hatte sie sich geschworen. Schlimmer konnte es ohnehin nicht mehr kommen, wenn sie an die Männer dachte, mit denen sie es sonst häufig zu tun hatte. Eine einzige Bande von versoffenen, gewalttätigen, schmutzigen Flegeln. Der Sex mit William mochte auch keine Erfüllung sein, doch er tat ihr immerhin nicht weh und zahlte mehr als sie verlangte. Wenn sie es richtig anstellte, konnte dieser merkwürdige Typ ihre Eintrittskarte in ein neues, besseres Leben sein. Warum er ausgerechnet sie ausgesucht hatte, war eines jener Rätsel, das sie sich entschlossen hatte, nicht zu hinterfragen. Sicher, sie war nicht hässlich. Nein, das konnte man nicht behaupten. Auch wenn die letzten, harten Jahre nicht ganz spurlos an ihr vorbeigegangen waren, umrahmten die blauschwarzen Locken noch immer ein Gesicht, das auf eine wilde Weise anziehend wirkte, da stets eine Andeutung von Hochmut darin stand. Ihre dunklen, feurigen Augen passten dazu, täuschten jedoch ein Temperament vor, das sie eigentlich gar nicht besaß, ihr dafür aber den Namen Dolores eingebracht hatte. Klang irgendwie heißblütig, fand Toni, der Lude, und nannte sie seitdem so. Sie hatte nicht protestiert, das wäre nicht ratsam gewesen. Man sollte stets seinen Marktwert kennen. Mit ihren zweiunddreißig Jahren galt sie hier fast schon als alt und wenn sie ehrlich war, gab es tatsächlich einige jüngere und hübschere Bordsteinschwalben an der Oranienburger. Umso dankbarer war sie Gott, dem Schicksal, oder wem auch immer für Williams großzügiges Angebot.
Dolores blieb vor der Sindbad-Bar an der Ecke Auguststraße stehen. Der Eingang bestand aus zwei beleuchteten Krummsäbeln, deren Spitzen sich kreuzten. Alberne Idee, fand sie, genauso wie die Kellner mit Fes und Pluderhosen, aber kitschige Exotik stand gerade hoch im Kurs. Sie blies den dampfenden Atem zwischen ihre Handflächen. Die Nacht wirkte kälter, als es die Temperaturen vermuten ließen. In der Ferne ertönte eine Kirchturmuhr. Elf Schläge. Eine bange Vorahnung stieg in ihr auf. Was wurde aus ihr, wenn er einfach wegblieb und nie wiederkam? Ihr Traum vom neuen Leben würde sich auflösen wie eine Seifenblase. Unschlüssig trat sie von einem Fuß auf den anderen. Am liebsten hätte sie sich in einer der vielen Bars aufgewärmt. Doch wenn Toni seine späte Runde machte und sie nicht auf ihrem Abschnitt vorfand, gab es Ärger. Schlimmstenfalls eine Tracht Prügel. Wenn Sie mit William verschwand, war das etwas anderes. Er war schließlich ein Freier und damit bares Geld für Toni. Wo blieb er nur? Beunruhigt folgte ihr Blick dem vor Nässe glänzenden Pflaster der Oranienburger Straße bis zum alten kaiserlichen Postfuhramt an der Kreuzung Artilleriestraße. Nichts. Nicht einmal ein paar Betrunkene. Nur eine weitere gelangweilte Bordsteinschwalbe schräg gegenüber, die genauso fror wie sie. Dolores wartete eine Weile und ging dann weiter, schon damit ihre Beine unter den dünnen Strumpfhosen nicht noch kälter wurden. Bevor sie die langgestreckte Fassade des Postfuhramtes erreichte, tat sich eine Gasse zwischen den Häusern auf. Unbeleuchtet und so schmal, dass kein Automobil hindurch passte. Sie trat ein paar Meter in die Dunkelheit und steckte sich eine Zigarette an. Toni mochte es aus unerfindlichen Gründen nicht, wenn seine Mädchen während der Arbeitszeit qualmten. Als würde das die Freier abschrecken. In ein paar Tagen konnte der Dreckskerl bleiben, wo der Pfeffer wächst. Zumindest, wenn alles klappte. Hektisch zog Dolores an der Kippe und blies Rauchschwaden in die Gasse. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung durch den Tabaksqualm wahr. Sie erkannte die Umrisse einer Person, dann einen dunklen Mantel. Etwa Toni, der Lude? Ein letzter Zug, dann warf sie den Stummel fort. Funken wirbelten über das Pflaster. Sie beeilte sich, zurück auf die Oranienburger Straße zu kommen. Zuerst tat sie, als bemerke sie den Mann nicht, der neben ihr aus dem Dunkel der Gasse trat. Erst jetzt erkannte sie den Bart und die schütteren Haare unter der Hutkrempe, deren dunkles Rot an den Schläfen in Grau überging.
„Willi?“
„N’Abend, Dolores.“ Eine unauffällige Stimme. Weder hoch noch tief.
Er war es tatsächlich. Den schwarzen Mantel sah sie zum ersten Mal an ihm. Darunter trug er Hemd und einen dunklen Strickpullover, wie er zu Seeleuten passte. Oder zu Menschen, die nachts nicht gesehen werden wollten.
„Hast mich erschreckt. Bist spät dran heute.“
Sie bemühte sich, nicht vorwurfsvoll zu klingen.
„Aber nicht doch, das wollte ich nicht“, entgegnete er entschuldigend. Wieder einmal nahm sie seinen leichten Akzent wahr. Englisch? Niederländisch? Friesisch? Sie wusste es nicht. Doch da war noch etwas anderes. Auf eine Weise, die sie nicht erklären konnte, wirkte er heute anders als sonst.
„Willst du ins Hotel gehen? Oder etwas essen?“, versuchte sie, alles nach Normalität klingen zu lassen.
„Heute nicht, Dolores. Heute gehen wir woanders hin.“
Seine Stimme gab sich Mühe, vielversprechend zu klingen. Doch für einen Moment glaubte sie, dahinter den Hauch eines Missklangs herauszuhören. Sie verbat sich weitere Gedanken darüber. Wenn sie zu zögerlich erschien, stand es ihm frei, sein Angebot jederzeit einer der anderen Frauen zu unterbreiten. Vielleicht einer der jüngeren. Das durfte nicht passieren. Sie hakte sich bei ihm unter, als seien sie schon lange ein Paar.
„Wohin du willst, Willi.“
Er grinste zufrieden. Doch wieder wirkte es ein wenig angespannt. Hatte er einen anstrengenden Tag gehabt? Ihr würde sicher etwas einfallen, was Abhilfe schaffte.
„Warum kommst du heute von dort?“, fragte sie und zeigte in die dunkle Gasse.
„Mein Wagen steht hinten in der Johannisstraße. Komm schon.“
Sie folgte ihm, fort von den Straßenlaternen und den gedämpften Jazzrhythmen, die aus den Bars auf die Oranienburger dröhnten.
„Wohin gehts denn?“, drängelte sie wie ein kleines Mädchen. „Hauptsache nicht draußen in der Kälte.“ Sie grinste schelmisch. „Da wird es bei dir auch nicht klappen.“
Wieder dieses starre Lächeln. Als müsse er sich dazu zwingen.
„Keine Angst. Wirst nicht frieren.“
Sie folgten der Gasse bis zu seinem unauffälligen Automobil, das er unweit der Spree an der Kalkscheune, einem alten Fabrikgebäude, geparkt hatte. Dolores kannte sich mit Automobilmarken nicht aus, doch immerhin hatte er einen Wagen. Durch eine Lücke zwischen den Häusern glitzerte die Wasseroberfläche unfreundlich. William schloss auf und sie stiegen ein.
„Nun mach es nicht so spannend. Wo können wir denn um die Zeit schon hingehen?“, bohrte sie weiter.
Er ließ den Wagen an.
„Was besonderes. Soll ja nicht langweilig werden, oder?“
Sie gab sich vorerst damit zufrieden und lehnte sich zurück.
Der Wagen überquerte die Spree über die Weidendammer Brücke, bevor er die Stadtmitte auf der Wilhelmstraße in Richtung Kreuzberg verließ. Eigentlich egal wohin, dachte Dolores. Wenn er unbedingt wollte, konnten sie ihretwegen auch ein Schäferstündchen auf dem neuen Funkturm am Messegelände verbringen. Verklemmt durfte sie in ihrem Gewerbe nicht sein. Hauptsache, es blieb bei seinem Angebot. Ihre Gedanken wanderten bereits zu einer eigenen, kleinen Wohnung. Ohne Schimmel, ohne Bettwanzen, die immer neue Wege durch die Ritzen fanden und ohne die Geräusche der Ratten, die ihr in der Nacht den Schlaf raubten. Dafür würde sie alles tun, was er verlangte. Nun, zumindest fast alles. Doch bisher hatte er nicht einmal die üblichen Sonderwünsche geäußert.
William bog schweigend in die Anhalter Straße, kurz darauf in die Königgrätzer Straße ein. Keine aufregende Gegend, eher ein großbürgerliches Wohnviertel für Offiziere und Ministerialbeamte. Er parkte den Wagen in einer Seitenstraße und öffnete die Beifahrertür.
„Nur noch ein kurzes Stück zu Fuß.“
Danach stand Dolores nicht unbedingt der Sinn, während der kurzen Fahrt war die Wagenheizung nicht auf Touren gekommen und sie fror erbärmlich. Dennoch folgte sie ihm bereitwillig über den breiten Bürgersteig der Königgrätzer Straße, bis ihr Begleiter an der Ecke Prinz-Albrecht-Straße plötzlich stehenblieb. Der kalte, unnahbare Mond beschien einen repräsentativen, wilhelminischen Prachtbau. Hinter keinem einzigen der großen Bogenfenster war ein Lichtschein erkennbar.
„Wo sind wir hier?“ Sie klang eher verhalten als begeistert.
„Hast du nicht mal gesagt, du magst es an verrückten Orten?“, frohlockte er. „Hier sind wir ganz allein.“
Dolores’ Blick fiel auf die Messingtafel neben der geschwungenen Doppeltür:
Königliches Völkerkundemuseum
Sie verstand nicht, was das Ganze sollte. Sicher, sie hatte es mit Freiern schon an unüblichen Stellen getan. In einer Umkleidekabine. Im Wald. Im Automobil. Etwas in dieser Art. Ein nächtliches Museum gehörte bisher nicht dazu. William ignorierte ihre Verwunderung, schritt voran und drückte wie selbstverständlich die Klinke der schweren Eingangstür. Passend dazu klangen zwölf Glockenschläge von der Sankt-Hedwigs-Kirche hinüber. Zu Dolores Erstaunen schwang die Tür auf. Kopfschüttelnd folgte sie ihm in das dunkle Museum.
„Willi, was tun wir hier?“ Dumpf hallte ihre Frage durch die Eingangshalle. Sie bemerkte, dass zwischen den zugezogenen Gardinen der Pförtnerloge ein schwacher Lichtschein hervortrat. Sie erschrak, griff nach seinem Arm.
„Da ist jemand“, stieß sie flüsternd hervor, doch ihr Begleiter lächelte nur. Er ging geradewegs auf die kleine Tür zu, klopfte, verschwand kurz darin und trat sofort wieder hinaus. In seiner Hand baumelte eine Blendlaterne.
„Mach dir keine Sorgen, das ist alles geklärt.“ Er legte eine Hand um ihre Hüfte. „Niemand wird uns stören.“
Dolores behielt für sich, dass die Umgebung sie keineswegs in die richtige Stimmung für Liebesspiele versetzte.
„Leg deinen Mantel ab“, forderte William sie auf. Sie legte das Kleidungsstück auf den verwaisten Tresen der Garderobe. Immerhin fror sie nicht mehr, das Museum war gut geheizt.
Er zeigte auf eine breite Marmortreppe am Ende des Vestibüls.
„Ich will dir etwas zeigen.“
Dolores folgte ihm mit einem unsicheren Lächeln von dem sie hoffte, dass es einigermaßen echt wirkte. Sie passierten Türen zu dunklen Ausstellungssälen. Im Schein der Petroleumflamme stiegen sie die Stufen ins erste Stockwerk empor. Um sie herrschte eine Schwärze, die auf Dolores seltsam bedrohlich wirkte. Als könne sich alles und nichts darin verbergen. Nur hin und wieder warfen Scheinwerfer vorbeifahrender Automobile scharf umrissene Lichtinseln auf die Wände.
Das ist nur ein Museum, erinnerte sie sich. Wenn William diesen Nervenkitzel braucht, soll er ihn haben. Sie erreichten einen Treppenabsatz, von dem ein Flur und eine Vielzahl von Türen abzweigten. Ihr Begleiter schien genau zu wissen, wohin er wollte. Zielstrebig steuerte er eine breite Doppeltür an, deren Flügel weit offenstanden. Sie folgte ergeben. Die Blendlaterne erhellte einen Saal, der noch größer war, als Dolores erwartet hatte. Auf den ersten Blick erkannte sie Palmenzweige, eine Bambushütte auf Pfählen, eine Feuerstelle. Sie traten ein. Der Weg durch die Halle war einem Dschungelpfad nachempfunden. An seinem Rand waren verschiedene Szenen tropischer Natur, der Jagd und Fischerei nachgestellt.
„Wo sind wir hier?“, erkundigte sich Dolores und konnte ein gewisses Interesse nicht leugnen. Der Lichtschein fiel auf einen Einbaum, dahinter täuschte ein riesiges Plakat das Panorama einer Palmeninsel vor. Davor war weißer Sand aufgeschüttet. Kokosnüsse lagen wie zufällig herum.
„In der Südsee“, erklärte William und schwenkte die Lampe halbkreisförmig über den kleinen Strand. „Komm mit.“
Einfallsreicher, als ich ihm zugetraut hätte, dachte Dolores und überquerte eine kleine Holzbrücke. Sie spürte, wie ihre Anspannung ein wenig nachließ. Zumindest, bis ihr Blick auf eine Glasvitrine fiel, aus der sie einige Schrumpfköpfe traurig anstarrten. Sie unterdrückte einen Schrei.
William legte einen Finger auf die Lippen. „Pssst. Die tun dir nichts, sind vollkommen harmlos. Komm weiter.“
Sie erreichten eine Absperrung aus Bambuspfählen. Er hielt die Liane hoch, die dazwischen gespannt war. Dolores trat darunter hindurch. Feiner, weißer Sand knirschte unter ihren Schuhen. Eine Palme senkte ihre trockenen Blätter über den künstlichen Strand.
Keine schlechte Idee, die Südsee, musste Dolores zugeben, als sie an den Schneematsch und die feuchte Kälte dort draußen dachte. Sie sah sich um. Erst jetzt fiel ihr auf, welchem Zweck die Umgebung diente. Vor der Palme war eine brusthohe Skulptur aufgestellt. Im spärlichen Licht der Laterne erkannte sie einen geschnitzten Körper aus dunklem Ebenholz. Der Kopf leuchtete dagegen, als sei er aus Elfenbein. Die übergroßen Augen und der breite Mund starrten sie mit einem seltsamen Ausdruck der Entrücktheit an. Als könne die Figur in sie hineinsehen. Die rechte Hand umklammerte einen Stab oder Speer wie einen Königszepter. Auch dieser war fast weiß und wurde von etwas gekrönt, das sie für einen großen Edelstein hielt. Er reflektierte die Petroleumflamme wie Kristallglas. Alles an der Figur war fein und kunstvoll herausgearbeitet. Auf Dolores wirkte sie faszinierend und abschreckend zugleich. Erst jetzt erkannte sie, dass ein quaderförmiger Glaskasten die Statue umgab.
„Merkwürdiges Ding, nicht wahr?“, riss William sie aus ihrer Betrachtung.
Sie erschrak. Die fremdartige Skulptur hatte sie derart in ihren Bann gezogen, dass sie William, der neben sie getreten war, gar nicht bemerkt hatte. In seinen Händen hielt er zwei gefüllte Sektkelche. Wo hatte er die nur plötzlich her? Sie hatte nicht einmal das Ploppen des Korkens gehört. Auf dem Sand hatte er eine Decke ausgebreitet. Offenbar war er gut vorbereitet.
„Du bist verrückt“, sagte sie, halb begeistert, halb mit der Situation überfordert. Dabei stellte sie wiederum fest, dass sie diesen Mann falsch eingeschätzt hatte. William reichte ihr eines der Gläser und erhob das andere. Sie trank, ohne zu zögern. Vielleicht half es ihr dabei, sich ein wenig zu entspannen. Der Sekt schmeckte nicht übel, nur der metallische Nachgeschmack störte ein wenig. Doch sie war eine Dirne, Champagner konnte sie nicht erwarten. William zeigte auf die Decke auf dem Sand.
„Wie wärs, wenn wir es uns ein wenig bequemer machen?“
Sie nickte, auch wenn sie sich nicht unbedingt auf das freute, was jetzt bevorstand. Dieses Gefühl war ihr geläufig. Berufsroutine. Doch da war noch mehr. Ein Gefühl, als beobachte sie jemand oder etwas aus der Dunkelheit. Etwas, das sich in dem künstlichen Dschungel verbarg. Sie blickte zu der Skulptur der Eingeborenen, deren unbewegte Augen sie zu fixieren schienen. Am liebsten hätte sie William gebeten, den Glaskasten mit einem Tuch zu verhängen. Wenigstens, bis sie fertig waren. Doch das wäre albern gewesen. Was sollte er von ihr denken? Schlimmstenfalls würde er sie für überspannt halten und ihr den Laufpass geben. Reiß dich zusammen!
Ihr Begleiter hatte sich inzwischen auf der Decke niedergelassen. Vielleicht täuschte sie sich, doch wirkte nicht auch er ein wenig nervös? Dolores schob alle Gedanken von sich und legte sich neben ihn. Tatsächlich fühlte es sich danach an, als seien sie an einem dunklen, einsamen Strand. Sie begann, mit mechanischer Routine ihre Bluse aufzuknöpfen. Ihr war überhaupt nicht mehr kalt. Eigentlich fühlte sie sogar eine ungewohnte Hitze in ihrem Körper aufsteigen, gepaart mit einer leichten Benommenheit. Nach einem einzigen Glas Sekt?, wunderte sie sich. Sie spürte die Hand ihres Begleiters, die über ihre Schulter, dann über ihre Brüste strich. Selbst durch den Stoff fühlte sich die Berührung kalt und abwesend an. Hatte er sie etwa schon satt? Oh nein, das durfte nicht passieren. Nicht jetzt. Sie gab sich besonders viel Mühe beim Vorspiel, tat Dinge, für die sie andere Freier hätte doppelt und dreifach bezahlen lassen. Dennoch blieb es ein kurzer, nahezu mechanischer Vorgang, dem jede Wollust und Leidenschaft fehlte. Dolores blickte zu William. Er wirkte immer angespannter. Wenn er nicht in Stimmung war, warum hatte er sie dann an diesen seltsamen Ort gebracht? Sein Gesicht sah aus, als sei er sich dessen ebenfalls nicht mehr sicher. Die Bewegungen ihres Beckens erlahmten zusehends. Noch während sie auf ihm saß, erfasste sie betäubender Schwindel. Als hätte sie zwei Flaschen lieblichen Likörs getrunken. Oder eine gewaltige Dosis Laudanum intus. Ja, erinnerte sie sich mühsam. Wie Laudanum fühlte es sich an. Allerdings wohl nur, wenn man viel zu viel davon nahm.
„Willi“, stotterte sie. „Mir ist so… Ich bin so…“ Sie suchte nach den richtigen Worten. „So müde.“
„Es ist nichts“, beschwichtigte er und schob sie von sich. „Versuche einfach, dich zu entspannen. Es ist besser so für dich, es wird leichter werden.“
Dolores starrte durch die dunkle Halle, zwischen Palmenwedeln, Sand und Glasvitrinen umher, die im Laternenschein nur zu erahnen waren. Dabei kämpfte sie gegen lähmende Schläfrigkeit an.
Plötzlich traten zwei Augenpaare, die schon die ganze Zeit da gewesen waren, aus der Dunkelheit. Oder bildete sie sich das nur ein?
Sie brabbelte einige unverständliche Worte in Williams Richtung. Doch ihr Begleiter war aufgesprungen und zog sich hektisch an. Anscheinend waren die Augen keine Einbildung gewesen. Er hatte sie auch gesehen.
„Was machen Sie jetzt schon hier?“ fragte er in die Richtung, aus der Dolores nur schemenhafte Silhouetten wahrnahm. „Ich dachte, Sie kämen später.“
„Deswegen kommen wir früher“, schnarrte eine Stimme, die selbst durch Dolores’ tauben Körper ein Frösteln trieb.
Eines der Augenpaare trat näher an sie heran, musterte sie wie ein anatomisches Präparat.
„Ist sie das?“
„Ja“, entgegnete William zögerlich, als plage ihn mit einem Mal ein Anflug schlechten Gewissens. „Was werden Sie mit ihr…?“
Die Silhouette nickte zufrieden. „Sie wird sich sehr nützlich machen. Es wird nicht umsonst sein. Gehen Sie jetzt.“
Währenddessen versuchte Dolores, sich aufzurichten. Sie verstand nichts von dem, was um sie geschah. Nur eine Erkenntnis durchdrang den Nebel, der sich immer weiter in ihr ausbreitete: Etwas war in ihrem Sekt gewesen. Warum hatte William sie betäubt?
„Das Glas“, lallte sie verstört. „Was hast du…“
Er blickte mit ehrlichem Bedauern auf sie herab. „Eine Menge hochkonzentriertes Laudanum und etwas Sekt.“
„Was, wieso… Ich…“
„Es tut mir leid. Aber du wirst dankbar sein, dass du es getrunken hast.“
In ihrem Gesicht stand Unverständnis. Trotz des Betäubungsmittels in ihrem Körper keimte Panik in ihr auf. Ihre Stimme klang schwerfällig und dissonant. Die Zunge fühlte sich riesig und aufgequollen an. Als läge ein Stück totes Fleisch in ihrem Mund.
„Was hast du, warum… Wer sind diese…“
„Sie werden sich dir selbst vorstellen. Sie wollen dich kennenlernen.“
„Nein… nein… ich will nicht… Sowas mache ich nicht mehr…“
William lächelte traurig.
„Keine Sorge, an so etwas haben diese Herren bestimmt kein Interesse.“
Ängstlich blickte er dorthin, wo im Dunklen die Umrisse zweier Gestalten zu erahnen waren.
„Sie haben gesagt, Sie würden ihr nichts tun“, rief er zaghaft und spürte seine trockene Kehle.
Ein freudloses Schnauben, in dem die Frage lag, ob er wirklich so dumm war. „Nein nein, natürlich nicht. Und jetzt gehen Sie, solange Sie noch können.“
William wandte sich ab. Nicht schnell genug, um die große, blitzende Klinge zu übersehen, auf der sich das trübe Licht der Petroleumflamme spiegelte.
„Was… William… was werden die mit mir…?“, rief Dolores so eindringlich, wie sie dazu noch in der Lage war. Die Todesangst brachte eine vorübergehende, verstörende Klarheit in ihr Bewusstsein.
„Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen“, gestand er und klang dabei erschreckend ehrlich. „Aber ich hatte keine Wahl. Ich bin schwach. Vergib mir.“
Dolores versuchte, etwas zu sagen, doch die Übermacht des Betäubungsmittels hatte ihr bereits das Sprachvermögen genommen.
„Hab keine Angst. Wir haben dich erwählt. Du bist dazu bestimmt“, sagte die kalte Stimme, die jetzt hinter ihr war. So nah, dass sie den scharfen Atem spürte.
„Nimm dir das Schloss an der Vitrine vor“, wies der Unbekannte einen anderen an. „Aber pass auf den Diamanten auf.“
Aus dem Augenwinkel sah William noch, wie sich eine Gestalt am Glaskasten zu schaffen machte, unter dem die exotische Skulptur stand. Dann eilte er den Dschungelpfad entlang, nur fort. Aus der Halle. Aus dem Museum.
Fort von dem Ort, an dem er Dolores einem Schicksal überließ, das er ebenso wenig verstand wie sie selbst. Als er die breite Treppe ins Erdgeschoss erreichte, hörte er hinter sich einen gedämpften Laut, schauerlich klagend wie das einsame Nebelhorn eines Kohlenschleppers auf dem nahen Landwehrkanal. Er ging in etwas unter, das ihn an das flüssige Blubbern einer undichten Ölpumpe auf einem Schiff denken ließ. Zumindest versuchte er, daran zu denken. Denn er ahnte, die Wahrheit war eine andere, unfassbare.
Dann kehrte wieder Stille ein.
Eine Stille, die ihm dämmern ließ, dass er etwas Furchtbares getan hatte.
Berlin-Kreuzberg, Königgrätzer Straße, Königliches Museum für Völkerkunde
In derselben Nacht
Egon Lubolds müder Blick wanderte zur Wanduhr. Auf dem elfenbeinfarbenen Ziffernblatt schien sich der Zeiger ebenso müde über die fünf zu quälen. Er legte die Abendzeitung nebst ein paar halb ausgefüllten Wettscheinen vor sich auf den Tisch und gähnte hemmungslos. Während der letzten Stunden musste er vorübergehend darüber eingenickt sein, auch wenn es gegen die Vorschriften war. Doch etwas hatte ihn zwischendurch aus dem pflichtwidrigen Schlaf gerissen.
Noch sieben Minuten, bis seine letzte Runde fällig war. Er trank einen Schluck aus der Blechtasse. Der Inhalt war nur noch lauwarm. Angeblich handelte es sich um schwarzen Tee, doch der Geschmack erinnerte eher an aufgegossenen Kaninchenkot. Die Wahrheit lag wohl irgendwo dazwischen. Kaffee wäre ihm ohnehin lieber gewesen, war aber rar und teuer, zumal in diesen Zeiten. Zu teuer für einen Nachtwächter. Doch man konnte das Ganze auch positiv sehen. Er saß nicht bettelnd auf der Straße wie viele andere und er litt auch nicht unter den scheußlichen Zitteranfällen, die viele seiner ehemaligen Kameraden plagten. Kein Wunder, hatte er doch den gesamten Krieg in einer Schreibstube in der Etappe überdauert wie eine Larve in einem schützenden Gehäuse. Liebevoll betrachtete er sein linkes Bein, das er seit der Kindheit leicht nachzog. Es hatte ihn vor den Maschinengewehrsalven und dem Granatenhagel der Westfront bewahrt.
Er zündete sich eine Zigarette an. Bald hingen Rauchschwaden schwer wie gelber Nebel im Licht der Gaslampe, die vor ihm auf dem Tisch stand. Zwar war das gesamte Gebäude mit modernen AEG-Glühfadenlampen ausgestattet, doch während der Nacht wurde der Strom abgeschaltet. Für die Rundgänge benutzte er daher eine der Petroleum-Blendlaternen. Und das alles für einen mickrigen Zuschlag von fünfzig Pfennig pro Schicht.
Lubold drückte die Zigarette aus, griff nach der Laterne und erhob sich schwerfällig. Sein Magen knurrte vernehmlich. Er warf einen sehnsüchtigen Blick auf die zerbeulte Metalldose, in der zwei Brotscheiben lagen, die seine Frau mit einer dünnen Schicht grober Leberwurst bestrichen hatte. Doch diesen Leckerbissen gab es erst nach seiner Runde.
Er verließ die Pförtnerloge in Richtung der nächtlich verwaisten Flure und Hallen. Zunächst verschloss er die Tür am Haupteingang, die er in dieser Nacht ausnahmsweise offengelassen hatte. Hundert Mark hatte ihm der Kerl in die Hand gedrückt. Nur, damit er mit seinem Mädchen nachts in die Südsee-Halle durfte. Sie bräuchte den Nervenkitzel, um in Stimmung zu kommen, hatte er gesagt und dabei dreckig gegrinst. „Bitteschön, wenn ihnen das den Hunderter wert ist“, hatte Lubold geantwortet und eingeschlagen. „Hauptsache, Sie sind rechtzeitig am nächsten Morgen verschwunden und machen nichts kaputt da oben.“ Eigentlich konnte man da ohnehin nicht viel kaputtmachen und die Ausstellungsstücke von Wert wurden in Glasvitrinen aus nahezu unzerstörbarem Sicherheitsglas aufbewahrt. Der Kerl hatte geantwortet, so lange bräuchten sie gar nicht. Dann hatte er den Schein herausgerückt und gezwinkert. Der kleine, warme Regen kam zur richtigen Zeit. Die Wettschulden drückten Lubold nicht nur aufs Gemüt, auch der Buchmacher wurde langsam ungeduldig. Diese verdammten Klepper auf der Trabrennbahn Karlshorst hatten es in letzter Zeit nicht gut mit ihm gemeint. Nicht mehr lange und ein paar unangenehme Typen hätten ihm nach seiner Schicht vor dem Museum aufgelauert. Diese Sorge war er dank des Fremden vorläufig los. Eigentlich ein Grund zu guter Laune, doch die wollte sich partout nicht einstellen. Irgendetwas fühlte sich merkwürdig an. Lag es an diesem Typen mit seiner Braut?
Der Nachtwächter begann seine Runde. Der größte Teil des Königlichen Museums gliederte sich geografisch. Lubold begann wie immer in der Halle der chinesischen Dynastien und arbeitete sich dann weiter ins Reich der Khmer nach Kambodscha vor. Im Licht der Petroleumflamme starrten geisterhafte Apsara-Figuren aus der Tempelanlage von Angkor Wat einschüchternd auf den Nachtwächter herab. Es folgten Exponate aus Java und Sulawesi in Niederländisch-Indien. Schließlich die Japan-Ausstellung, der ein eigener Saal gewidmet war, bewacht von zwei erstarrten Samuraikriegern in prächtigen Harnischen, die ihre Katanas drohend über die Besucher erhoben.
Durch die hohen Fenster drang trübes Licht der Straßenlaternen von der Königgrätzer Straße hinein. Eine repräsentative Treppe führte den Nachtwächter ins erste Stockwerk, wo in der Amerika-Ausstellung indianische Totempfähle und Tipi-Zelte zu besichtigen waren. Alles ruhig. Wie immer. Lubold betrat die Ozeanien-Halle. Ein großer Teil der Exponate entstammte den ehemaligen kaiserlichen Schutzgebieten auf Samoa und Neuguinea, die mitsamt dem Großen Krieg verloren gegangen waren. Das öffentliche Interesse an den fernen Eilanden war jedoch ungebrochen. Lubold hingegen hatte noch nie verstehen können, was an Inseln voller Kannibalen, Krankheiten und giftiger Tiere sonderlich reizvoll sein sollte. Er selbst konnte darauf verzichten. Genauso gut hätte man ihm eine Lagerhalle voller Eisenbahnschwellen anvertrauen können. Das bläuliche Licht der Petroleumlampe fiel auf einige polynesische Masken, die zwischen getrockneten Palmwedeln an einer Wand drapiert waren.
Hexenkram, dachte er und lenkte seine Schritte weiter durch die verlassene Halle. Er spürte eine gewisse Nervosität. Hoffentlich hatte der bärtige Kerl mit seinem Mädchen nichts durcheinandergebracht. Natürlich war es Lubold als Nachtwächter nicht erlaubt, zwei Fremde des Nachts ins Museum zu lassen. Erst recht nicht, um in der Südsee-Ausstellung Unzucht zu treiben. Doch wem schadete es schon? In diesen Zeiten musste jeder sehen, wo er blieb. Hoffentlich waren die beiden nach ihrem Schäferstündchen nicht am künstlichen Strand eingeschlafen. Doch das schien unwahrscheinlich, denn Lubold hatte ungefähr um zwei Uhr mit einem Ohr gehört, wie jemand das Museum durch den Haupteingang verlassen hatte. Leichter würde er sich hundert Mark nie wieder verdienen können.
Er erreichte die Absperrung aus Bambuspfählen und Lianen, hinter der diese seltsame samoanische Skulptur stand. Sie umgab, wie einige andere wertvolle Exponate, ein verschlossener Kasten aus einbruchsicherem Glas. Besonders war nur, dass sie während der Öffnungszeiten zusätzlich von einem extra dazu abgestellten Museumswärter bewacht wurde. Sand knirschte unter seinen Schuhen. Der Kerl und seine Begleitung schienen längst verschwunden, wie erwartet. Wie bei jedem Rundgang schwenkte Lubold die Lampe in alle Richtungen. Zuletzt dorthin, wo die Figur unter Glas stand.
Sein Blick streifte den Bambuszaun, den aufgeschütteten Sand des kleinen Südseestrandes. Die Glasvitrine. Plötzlich hielt er inne. Die Petroleumlampe in seiner Hand begann zu zittern. Erst leicht, dann stärker. Als traue er seinen Augen nicht. Dann verlor Lubold die Kontrolle über seinen Körper.
Der Anblick, den der Lichtschein zum Vorschein brachte, war mehr, als er ertragen konnte. Scheppernd fiel die Laterne zu Boden, während sein Herz für mehrere Schläge aussetzte. Petroleum verteilte sich in einer brennenden Lache vor ihm auf den Bodenfliesen. Das ungleichmäßige Flackern brannte Bruchstücke des Unfassbaren in seine Netzhaut.
Egon Lubold war kein Mann, der sich je viele Fragen gestellt hatte. Auch war er nicht abergläubisch und einigermaßen gottesfürchtig. Doch jetzt durchzuckte ihn eine letzte Offenbarung, bevor er ohnmächtig zusammenbrach:
Wenn es einen Gott gab, gab es auch einen Teufel. Niemand anderes konnte angerichtet haben, was hier geschehen war.
Er selbst hatte ihm die Pforte geöffnet, ohne es zu wissen.
III Zeitenwende
Polizeipräsidium am Alexanderplatz, Februar 1923
Am folgenden Tag
Jette folgte dem in jeder Hinsicht gewichtigen Mittsechziger durch einen Flur, der kein Ende zu nehmen schien. Das traf auch auf den Rundgang durch das Hauptquartier der Preußischen Polizei zu. Gleich nach dem Stadtschloss galt es als zweitgrößtes Gebäude Berlins. Pünktlich zur Jahrhundertwende fertiggestellt, brauchte es zumindest äußerlich den Vergleich mit dem Scotland Yard in London oder dem Dienstsitz der Sûreté von Paris nicht zu scheuen. Die vier Türme mit Kuppeldächern hatten alsbald für den passenden Spitznamen des gewaltigen Backsteinbaus gesorgt: Rote Burg.
Kriminaldirektor Wilhelm Eickhoff schritt forsch voran wie ein Kriegselefant, den Stolz des Hausherrn auf dem verwitterten Gesicht. Soeben hatte er Jette die Zentrale der modernen Rohrpostanlage im Erdgeschoss gezeigt, die sowohl die Abteilungen des Hauses als auch das Präsidium mit wichtigen Behörden der Hauptstadt verband. Anschließend hatte der Paternoster sie in die erste Etage befördert. An den Wänden der Flure hingen Gemälde von Männern in Uniform, die Jette anstarrten, als hielten sie sich für etwas Besseres. Nachdem sie mehrere Abzweigungen passiert hatten, bog Eickhoff nach links ab.
„Passen Sie auf, Fräulein, dass Sie sich nicht verlaufen. Die Büros der Kriminalpolizei befinden sich im Westflügel.“
„Und wohin geht es dort, Herr Kriminaldirektor?“, erkundigte sich Jette und zeigte geradeaus in den düsteren Flur.
„In den Nordflügel. Aber dort sitzt momentan nur die Verkehrspolizei, äh, ich meine die Sitte.“
Die Stimme des Kripo-Chefs klang leicht abfällig. Als versuche er die Nähe zum Sittendezernat zu ignorieren, wie man es mit dem üblen Geruch der Gosse tat.
Kurz darauf erreichten sie den Westflügel. Als Chef der Preußischen Kriminalpolizei residierte Wilhelm Eickhoff hinter einer gepolsterten Tür im geräumigen Turmzimmer. Die Vorzimmerdame, eine abweisende Jungfer von gut vierzig Jahren, musterte Jette hinter ihrer Schreibmaschine wie eine Hyäne. Ihr Gesicht schien hauptsächlich aus Ecken und Kanten zu bestehen und ließ jede Rundung vermissen. Erst als Eickhoff zweimal Kaffee orderte, ging eine liebenswürdige Veränderung mit ihrem Gesicht vor, die jedoch nur Sekunden anhielt.
In seinem Büro angelangt, nahm der Kriminaldirektor hinter einem mächtigen, polierten Eichenschreibtisch Platz. An der Wand stand eine dazu passende Kommode. Durch ein Fenster fiel das Licht kalter Vormittagssonne auf zwei Fotografien eines ausgesprochen hässlichen Kindes.
„Mein einziger Enkel“, erklärte er, als er Jettes Blick bemerkte.
„Ein reizender Knabe“, versicherte sie.
Eickhoff nahm ihr die Schwindelei ab und wies auf einen Besuchersessel von edler, aber unbequemer Ausführung. Er schien hauptsächlich dafür gemacht, Gäste einzuschüchtern oder dazu anzuhalten, nicht länger als nötig darauf zu verharren. Während Jette im Leder versank, kramte Eickhoff eine Lesebrille aus Hirschhorn hervor und schlug eine bereitliegende Akte von einem Stapel auf. Er hatte es jedoch nicht eilig, daraus vorzulesen, sondern steckte sich zunächst ein dunkles Zigarillo an. Erst nach dem dritten Rauchring erhob er seine Bassstimme. Argwöhnisch überflog er den Akteninhalt.
„Henriette Viktoria Adler, geboren 1894 in Berlin-Grunewald, wohnhaft ebenda. Einmal verlobt, bisher unverheiratet. Einen Meter neunundsechzig groß. Haare schwarz, mittellang, leicht gelockt. Augenfarbe grün. Und so weiter und so fort, das sehe ich ja alles selbst.“
Er schob den Umschlag fort. Erst jetzt fiel Jette eine alte Narbe auf, die sich seitlich über Eickhoffs Hals zog, wie ein kleiner, grauer Wurm. Wenn sie von einem Streifschuss herrührte, musste er einen fähigen Schutzengel haben.
„Also, was tun Sie hier, Fräulein?“
„Bitte, Herr Kriminaldirektor?“
Jette versuchte, eine aufrechte Position einzunehmen, was der Besuchersessel jedoch zu verhindern wusste. Eickhoff griff derweil nach einer weiteren Akte vom Stapel und begann, ohne Eile darin zu lesen.
„Ihre Noten an der Akademie sind nicht schlecht“, gestand er nach einer Weile zu und vertiefte sich aufs Neue.
„Charakterliche Beurteilung, mal sehen… hm… interessant… aha… feinfühlig, einfallsreich… harte Schale, weicher Kern, was?“
Er schob auch diese Akte missbilligend zur Seite, als enthielte sie nicht, was er suchte und förderte eine weitere zutage.
„Vorher haben Sie als Krankenschwester am Klinikum gearbeitet, an der Charité genau genommen. Er blätterte in der Personalakte. Gute Beurteilungen, mit ein paar Ausnahmen. Eine Rüge des Chefarztes wegen respektlosen Verhaltens. Eine weitere der leitenden Oberschwester, soso. Dennoch hielt Ihr vorgesetzter Stationsarzt Sie für eine hervorragende Krankenschwester und traute Ihnen sogar ein medizinisches Studium zu.“
Jette spürte, wie ihr Puls anstieg. Sie wies auf die Krankenhausakte.
„Woher haben sie die, Herr Kriminaldirektor?“
„Nun, wir sind die Kripo, Fräulein. Aber bleiben wir bei der Sache. Warum haben Sie nicht Medizin studiert oder es wenigstens versucht? Mit einer Empfehlung der Charité wäre das doch sicher nicht unmöglich gewesen? Heutzutage scheint ja vieles vorstellbar.“
Jette warf einen Blick auf die verbliebenen Aktenstücke auf dem Schreibtisch und fragte sich, ob der Kripo-Chef tatsächlich auf eine Antwort aus war oder nur ihre Reaktion beobachten wollte.
„Die Dinge entwickelten sich anders“, erwiderte sie etwas wortkarg.
Der Kriminaldirektor begann in seinen Papieren zu wühlen, als nehme er die Herausforderung an.
„Liegt es nicht vielleicht daran, dass Sie schon einmal studiert haben? Dies und das, könnte man sagen. Literatur und Geschichte an der Friedrich-Wilhelms-Universität, allerdings ohne Abschluss.“
Seine streng erhobenen Augenbrauen nötigten ihr eine Bestätigung ab.
„Das ist korrekt, Herr Kriminaldirektor.“
„Nicht, dass ich unbedingt diese Ansicht vertrete, aber es klingt wie eine Bestätigung derer, die die akademische Bildung junger Fräulein für vertane Zeit halten. Dabei hätten Ihre Noten einem Magister doch nicht im Wege gestanden?“
Seine Provokation sollte sie offenbar aus der Reserve locken.
„Nein, meine Noten nicht“, sagte Jette endlich. „Aber der Große Krieg.“
Eickhoff lachte freudlos auf.
„Sind wir schon so weit, junge Fräulein an die Front zu schicken?“
„Nein, aber der Dekan gab mir damals unmissverständlich zu verstehen, dass junge Fräulein jetzt woanders gebraucht würden als im Hörsaal.“
„Ich verstehe.“ Eickhoffs Stimme hatte ihren auftrumpfenden Impetus abgelegt.
„Daher begann ich, als Hilfsschwester im Lazarett der Charité zu arbeiten.“
„Ich verstehe“, wiederholte sich der Kriminaldirektor. Er hatte sich vorgebeugt, als lausche er einer spannenden Geschichte. „Und dann?“
„Nun ja, nach dem Krieg hatte ich keinen Studienplatz mehr und war fast fünf Jahre älter. Dafür hatte ich viele andere Dinge gelernt. Da mir die Zeit im Lazarett angerechnet wurde, lag es nahe, die Ausbildung als Krankenschwester abzuschließen.“
„Dann ist Ihnen der Anblick schlimmer Verletzungen ja vertraut.“
„Nicht so vertraut, wie Sie denken. Ich war keine OP-Schwester“, entgegnete Jette und fragte sich, was der Einwurf zu bedeuten hatte.
„Haben Sie nie eine Anstellung im Unternehmen Ihres Vaters erwogen?“, grub Eickhoff sich weiter durch ihre Lebensgeschichte.
„Erwogen, doch schon, aber ich gehe lieber meinen eigenen Weg“, versuchte sie, das Thema zu umgehen.
Eickhoff legte die Aktenbestandteile zurück auf den Stapel und schob ihn akkurat zurecht, als wolle er sich damit Zeit zum Nachdenken verschaffen.
„Ihren eigenen Weg… Ja, das sehe ich. Sie sind ganz schön herumgekommen. Haben Sie ihrer akademischen Karriere niemals nachgetrauert?“
„Manchmal“, gestand Jette. „Es klingt womöglich abgedroschen, aber im Hörsaal oder in der Bibliothek hätte ich niemandem helfen können, im Hospital schon.“
„Jetzt sagen Sie mir bloß noch, Sie sind deshalb zu uns gekommen?“ Der Kripo-Chef hatte sein abgeklärtes, unfrohes Schmunzeln wiedergefunden. „Eine einzige Stelle wurde damals ausgeschrieben. Ein Fräulein unter dreißig Jahren für eine zweijährige Ausbildung an der Kriminalakademie in Charlottenburg. Bei Bestehen probeweise Übernahme in den Dienst der Preußischen Polizei. Das Ergebnis waren zig hunderte Bewerbungen, zahllose Gespräche und ebenso viele Absagen. Nur eine kam durch.“
„Ich war nicht die erste Wahl“, wiegelte Jette ab.
„Und doch sitzen Sie nun hier, mit einem bestandenen Abschluss in der Tasche. Als erste Absolventin der Akademie.“
„Jawohl, Herr Kriminaldirektor.“
„Sie sind ein intelligentes, hungriges Fräulein. Aber mit Verlaub, für mich klingt das nach einem großen Kuddelmuddel. Als hätten Sie nicht so recht gewusst, was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen.“
„Die Hauptsache scheint mir, dass ich jetzt am richtigen Platz bin, Herr Kriminaldirektor.“
Er betrachtete sie eine Weile zweifelnd, als sei er sich dessen keineswegs sicher. Schließlich zog er zielsicher eine Zeugniskopie aus den aufgeschichteten Dokumenten.
„Zumindest nach den Ergebnissen Ihrer schriftlichen Prüfung sieht es so aus. Theorie ist wichtig.“
„Aber, Herr Kriminaldirektor?“
„Drei Viertel von dem, was Sie dort gelernt haben, können Sie getrost gleich wieder vergessen.“
Jette behielt die Frage für sich, welches Viertel sie behalten sollte. Eickhoff blies eine letzte Rauchschwade zur Decke, bevor er das Zigarillo im Ascher beerdigte.
„Die Schule ist vorbei. In der nächsten Zeit werden Sie verschiedene Abteilungen der Kriminalpolizei durchlaufen, vor allem aber einem erfahrenen Ermittler assistieren. Am Ende werden Ihre Leistungen bewertet und es folgt eine praktische Prüfung. Es ist nicht vorbei, Fräulein Adler. Genau genommen fängt es jetzt erst richtig an. Verstanden?“
Sie nickte.
„Sehr gut, dann können wir zum förmlichen Teil kommen. Hiermit ernenne ich Sie vorläufig zur Kriminalassistentin auf Probe. Klingt vielleicht nicht sehr beeindruckend, aber auf zahlreiche Beförderungen brauchen Sie bei der Kripo ohnehin nicht zu schielen. Schon deshalb, weil wir nur sechs Dienstgrade haben. Assistent, Sekretär, Inspektor, Kommissar, Kriminalrat und einen Kriminaldirektor, also mich.“
Er grinste selbstzufrieden.
„Ach ja, falls Ihnen das noch niemand gesagt hat: Die Besoldung ist kümmerlich, zumindest am unteren Ende. Aber dafür bekommen Sie das hier.“
Er öffnete eine Schublade und schob eine Messingplakette über den Tisch. Darauf prangte ein Adler. Unter seinen Krallen war der Schriftzug Kriminalpolizei eingraviert. Mehr nicht. Jette bedankte sich artig und nahm die Dienstmarke entgegen.
„Sie hatten auf der Akademie den Wunsch geäußert, dem Morddezernat zugewiesen zu werden“, fuhr ihr Vorgesetzter fort und ließ offen, was er davon hielt.
Das Morddezernat bildete das Herzstück der Kripo. Wer es ernst damit meinte, es als Ermittler zu etwas zu bringen, versuchte über kurz oder lang, dort Dienst zu tun.
Nachdem Eickhoff ihre Ungewissheit lange genug genossen hatte, ließ er durchblicken: „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, Ihrem Wunsch nachzukommen.“
Der Drehsessel quietschte erleichtert, als Wilhelm Eickhoff seinen massigen Körper daraus erhob. Er wies die frisch gebackene Kriminalbeamtin an, ihm zu folgen. Die Unterredung war beendet. Jette fragte sich erneut, ob ihr Zweck gewesen war, sie einzuschüchtern oder zu analysieren. Nur einen Teil ihres Lebens hatte er dabei ausgespart: Ihre Familiengeschichte. War dies Zufall, Absicht oder eine Botschaft?
Der Kriminaldirektor passierte viele Türen, bis er am Ende des Flurs vor einer stehenblieb. Er klopfte geschäftsmäßig und trat ein, ohne abzuwarten. Es gelang Jette gerade noch, das Schild auf Augenhöhe wahrzunehmen: Rosen, Kriminalkommissar.
Die Silhouette des Chefs der Preußischen Kriminalpolizei schob sich aus der schummrigen Flurbeleuchtung in den Türrahmen, als verdunkele ein Berg die Sonne. Im spartanisch möblierten Dienstzimmer dahinter erhob sich der Kommissar um einige Grad zackiger als üblich. Nicht allzu groß und äußerlich eher unauffällig, wirkte er wie das Gegenteil seines Vorgesetzten. Eher wendig als wuchtig. Nachdem er die Uniform eines Hauptfeldwebels der kaiserlichen Infanterie abgelegt hatte, war er zunächst zur Schutzpolizei gekommen, wie ein Fisch zur Quelle. Der Weg zum Sittendezernat war von dort nicht weit gewesen, der zur Kriminalpolizei schon eher. Doch Edmund Rosen war ehrgeizig und intelligent. Er hatte die Mordkommission mit aufgebaut, ohne je eine kriminalistische Ausbildung genossen zu haben. Doch wer hatte die schon gehabt, in der Anfangszeit.
„Guten Tag, Herr Kriminaldirektor.“
„Tag, Rosen“, erwiderte Eickhoff knapp. Er blieb im Türrahmen stehen, wohl um zu demonstrieren, dass er nicht viel Zeit hatte – oder haben wollte. Denn er gehörte nicht unbedingt zu Edmund Rosens engen Freunden, wenn es die überhaupt gab. Eigentlich hatte er den Kommissar nie besonders gemocht und Rosen seinerseits mochte niemanden. Höchstens seine Frau, aber sicher war das nicht. Er wurde als gewissenhafter Ermittler in der Burg allgemein respektiert, doch beliebt hatte ihn das nicht gemacht. Er war und blieb ein Eigenbrötler.
„Es gibt Arbeit“, brummte der Kriminaldirektor.
„Es ist ja nicht so, dass ich bisher arbeitslos war“, gab Rosen etwas respektlos zurück und schob pikiert einige Akten auf der Tischplatte umher. Als Kripo-Mann erwarb man über die Jahre einen intuitiven Instinkt, ob man wollte oder nicht. Daher war Rosen sicher, dass der Alte mehr als eine Katze im Sack hatte. Worum es dabei ging, konnte er nicht erahnen. Er war zwar Kriminalbeamter, aber kein Hellseher. Vorsichtshalber hielt er es wie ein Priester vor der Beichte und machte sich vorsorglich auf alles gefasst.
Eickhoff wischte derweil die Stapel aus Polizeiakten, Vernehmungsprotokollen und Tatortberichten symbolisch mit seiner Löwenpranke vom Tisch. Ganz so, als seien die Kapitalverbrechen darin nur unwichtiges Geplänkel.
„Ihre übrigen Ermittlungen können vorerst warten. Müssen warten.“
„Worum geht es?“
„Eine unappetitliche Sache, wirklich unappetitlich. Und merkwürdig dazu. Geradezu gespenstisch, das Ganze. Schon der Anblick ist verdammt schwer verdaulich.“
Dachte der Alte etwa schon wieder ans Essen? Warum kam er damit gerade zu ihm? Es gab zweifellos Kollegen im Dezernat, die momentan nicht, wie er, unter einer Aktenlawine verschüttet zu werden drohten. Sein Chef stierte mit seinen Reptilienaugen auf den Kommissar und bewies dann, dass es kein leeres Gerücht war, dass er Gedanken lesen konnte.
„Sie fragen sich, warum ich damit ausgerechnet zu Ihnen komme? Nun, Sie stammen vom Verkehrsdezernat und sind Mordermittler der ersten Stunde. Aus diesem Grund sind Sie meine Wahl.“ Im internen Dienstgebrauch sprach niemand von der Sitte, sondern nur von der Verkehrspolizei.
„Wieder mal ne tote Bordsteinschwalbe?“, schloss Rosen messerscharf, bevor er seinen flapsigen Tonfall korrigierte: „Ähem, ich meine ein Tötungsverbrechen im horizontalen Gewerbe?“
„Ja und nein. Eigentlich wissen wir nur, dass es heute Nacht geschah.“
Der Kriminalkommissar verkniff sich seinen Unmut. Wie war es nur möglich, auf diese Frage keine klare Antwort geben zu können?
„Sie fahren sofort da raus, zum Tatort“, befahl Eickhoff.
„Jawohl“, Rosen überlegte. „Stadtmitte oder Schöneberg?“
Wenn eine Prostituierte das Zeitliche segnete, tat sie dies, nach seiner Erfahrung, zumeist in der Nähe ihres angestammten Reviers.
„Weder noch.“
„Ach, am Spittelmarkt?“
Der Chef der Kripo schüttelte seinen gewaltigen Schädel. Irgendwie erinnerte die gesamte Physis des Kriminaldirektors den Kommissar an etwas, das seit Urzeiten ausgestorben war. Oder es zumindest sein sollte.
„Königgrätzer Straße, Ecke Prinz-Albrecht.“
Rosen kratzte sich dort, wo ihm die Haare fast ausgegangen waren. Rundherum war ein Haarkranz verblieben, der ihm ein annähernd mönchisches Aussehen verlieh. Allerdings passte die Frisur nicht zu seinem Gottvertrauen, das nicht mehr sonderlich ausgeprägt war. Überhaupt war es in seinem Beruf nicht leicht, sich so etwas wie Glauben zu bewahren. Was er zunächst im Krieg und dann in den Berliner Gossen und Hinterhöfen gesehen hatte, machte es einem gewissenhaften Kirchgänger nicht unbedingt leicht.
„Kreuzberg?“, wunderte er sich. „Hat sich die Kleine verirrt?“
„Genau das sollen Sie ja für mich herausfinden“, knurrte Eickhoff.
„Woher wissen wir überhaupt, dass es sich um eine Dame aus dem Gewerbe handelt?“, erkundigte sich Rosen.
„Reiner Zufall. Der Schupo, der als erster am Tatort eintraf, kannte sie von der Straße. Geht sonst Streife auf der Oranienburger. Das spätere Opfer soll da häufig gestanden haben.“
„Kannte er ihren Namen?“
„Nein.“
Rosen warf einen Blick durch das kleine Fenster, das tatsächlich eher wie die Schießscharte einer Burg anmutete. Dicke Flocken sanken langsam davor herab wie ein zerfleddertes Laken.
„Sind die sterblichen Überreste schon unten im Tempel?“ Er meinte das Rechtsmedizinische Institut, das im Untergeschoss des Präsidiums residierte.
Erneutes Kopfschütteln.
„Ich möchte, dass Sie sich die Leiche am Fundort ansehen und mir sagen, was das Ganze zu bedeuten hat.“
Rosen seufzte unwillig.
„Unter einem Meter Schnee? Seit der Nacht schneit es unablässig. Wahrscheinlich muss ich die Dame vom Boden abkratzen.“
„Nichts dergleichen. Sie liegt warm und trocken.“
„Ach, sie starb in einer Wohnung? Wohl ein Freier durchgedreht“, vermutete Rosen aus Gewohnheit.
Eickhoff konnte ein freudloses Grinsen nicht unterdrücken.
„Nach allem, was mir zugetragen wurde, halte ich das für unwahrscheinlich.“
„Königgrätzer Straße, Ecke Prinz-Albrecht“, überlegte der Kommissar laut. „Da ist doch dieses Museum?“
Sein Vorgesetzter nickte bedächtig. Eines musste er Rosen lassen: Er kannte sich im Labyrinth der Berliner Straßen so gut aus wie ein alter Droschkenkutscher.
„Das Königliche Museum für Völkerkunde, so ist es“, bestätigte er. „Genau dort wurde das Opfer gefunden. Aber in allen weiteren Fragen konsultieren Sie Herrn Professor Rienstein.“
Ein Name, den man besser genau ausspricht, dachte Rosen. Ansonsten klingt es wie Rinnstein.
Es schien alles gesagt. Trotzdem machte Eickhoff keine Anstalten, die Tür freizugeben. Eine Alarmsirene begann in Rosens Kopf zu schrillen.
„Da ist noch etwas anderes. Hat aber nichts mit dem Fall zu tun.“
Auch das noch, dachte der Ermittler auf der anderen Seite des Tisches. Solange es um Mord und Totschlag ging, war ja alles in Ordnung. Doch jetzt spürte er, dass etwas wirklich Unangenehmes bevorstand. Eickhoff trat zur Seite. Hinter ihm erhob sich eine Frau in Trenchcoat, Tweedhose und Schnürschuhen von der harten Besucherbank. Rosen schätzte sie mit professionellem Blick auf Ende zwanzig. Eigentlich noch jünger, wären da nicht ihre dunkelgrünen Augen gewesen, deren Tiefe und Ausdruck nicht zum verschwommenen Blick eines Mädchens passten. Auch nicht zu einer Schreibkraft, befand der Kommissar beunruhigt. Womöglich eher zu einem Greifvogel.
„Ja, bitte?“, entfuhr es ihm.
„Darf ich vorstellen“, begann Eickhoff. „Kriminalassistentin Fräulein Henriette Adler, das ist Kriminalkommissar Edmund Rosen.“
Da keiner etwas sagte, fuhr der Kripo-Chef fort.