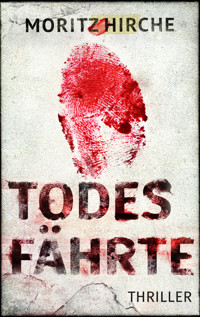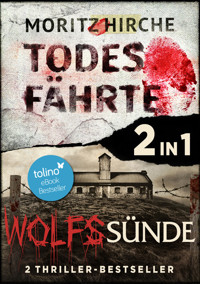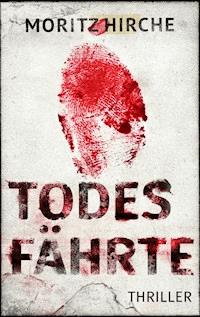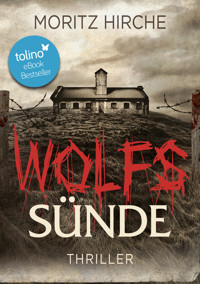
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein schrecklicher Fund, eine tödliche Botschaft, ein gefährliches Geheimnis... BKA-Zielfahnder Robert Hartmann auf der Jagd nach der Wahrheit: Südlich von Berlin, in Brandenburg… Im Nebel einer Herbstnacht versucht eine junge Försterin, ein neu angesiedeltes Wolfsrudel zu beobachten. Dabei trifft sie tief im Wald auf eine verwirrte Frau, die sie zu einem grausigen Fund führt: Die schrecklich zugerichteten Leichen dreier Menschen, die offenbar von den Raubtieren getötet wurden. Die Forstbeamtin steht vor einem Rätsel. Die örtliche Polizei scheint ratlos. Das Bundeskriminalamt wird gebeten, Licht ins Dunkel der Ereignisse zu bringen. Denn die Toten hinterließen eine seltsame Botschaft, die niemand zu deuten vermag… Robert Hartmann, der als Zielfahnder mit einer heiklen internationalen Ermittlung befasst ist, wird nach Deutschland zurückbeordert, um die mysteriösen Todesfälle zu untersuchen. Schnell entwickelt sich der Fall zu einer gefährlichen Jagd, die Hartmanns eigene Sünden ebenso an die Oberfläche bringt wie die finstere Vergangenheit des Waldes. Die Bedrohung kommt näher und sie ist persönlicher, als Hartmann ahnt. Doch niemand außer den Wölfen scheint ihm dabei helfen zu wollen, das tödliche Geheimnis zu lüften…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Titel
I - Im finsteren Wald
II - Die Kreuzigung
III - Das Haar in der Suppe
IV - Die Falle
V - Flashback
VI - Verbotene Stadt
VII - Kiefernruh
VIII - Fette Beute
IX - Wolfsfieber
X - Alte Wunden
XI - Schnell rein, schnell raus
XII - Die Pforte zur Hölle
XIII - Das Wurmloch
XIV - Das zweite Gesicht
XV - Der letzte Vorhang
Der Autor
Bücher
Wolfssünde
Hartmanns zweiter Fall
Schlicht und einfach die Wahrheit?
Die Wahrheit ist selten schlicht und niemals einfach
(Oscar Wilde)
Hinweis:
Es existieren keine Parallelen zu lebenden oder verstorbenen Personen. Etwa auftretende Ähnlichkeiten sind Zufall und nicht beabsichtigt. Die baulichen und landschaftlichen Hintergründe der Handlungsorte des Romans entsprechen überwiegend den realen Gegebenheiten, erheben jedoch keinen Anspruch auf Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse.
I
Im finsteren Wald
morituri non cognant
(lat.:die Todgeweihten sind ahnungslos)
Landstraße 74, zwischen Wünsdorf und Töpchin
Das knurrige Motorengeräusch verebbte. Wie immer ließ sie den betagten, grünen Mercedes-Geländewagen vor der alten Schranke stehen. Vor Jahrzehnten musste sie einmal rot-weiß gestreift gewesen sein. Jetzt bedeckte Grünspan die Reste der Farbe, die noch nicht abgeblättert war. Der Schlagbaum versperrte den Zugang zu einem der verwilderten Forstwege, die das riesige Areal durchzogen wie blutleere Adern einen toten Körper.
Das Blechschild, das sich an den rostigen Schlagbaum klammerte, wirkte hingegen noch recht neu:
Naturschutzgebiet
(ehemaliges militärisches Übungsgelände)
Von dieser Fläche gehen erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit aus.
Darunter stand noch irgendetwas Unheilvolles von alter Munition, Explosionsstoffen, Chemikalien, einsturzgefährdeten Bauwerken und unterirdischen Anlagen.
Hinter der Schranke begann hügeliger, lichter Kiefernwald, gelegentlich durchsetzt von Eichen, Birken und Erlen. Letzte Sonnenstrahlen fielen durch die Stämme auf den bemoosten Boden.
Julia Singer öffnete die Heckklappe, hinter der Cheetah geduldig wartete. Die große Hündin sprang heraus, schnupperte halbherzig, entfernte sich aber nicht vom Auto. Singer schulterte den kleinen Rucksack, der außer einer digitalen Nikon-Kamera eine Wasserflasche und einige nützliche Utensilien enthielt. Dann band sie in einer uneitlen Bewegung die brünetten Haare zum Pferdeschwanz. Zuletzt steckte sie den Revolver in das Holster am Gürtel. Nur für alle Fälle. Ein gut gepflegter 38er von Smith & Wesson. Beileibe kein High-Tech, aber zuverlässig. Für eine Försterin erfüllte er seinen Zweck. Ein Gewehr nahm sie, wie meistens, nicht mit. Ohnehin war das einzige, das sie zu schießen gedachte, Fotos.
Der Weg, der sie tiefer in den Wald führte, war bald kaum noch als solcher zu erkennen. Eine Wildnis, mitten in Brandenburg. Über dreihundert Hektar Sumpf, Sand, Wiese und Wald. Nein, es war mehr als eine Wildnis. Ein vergessener, ein verbotener Ort. Seit 1994 die letzten sowjetischen Streitkräfte abgezogen waren, hatte man das riesige Areal sich selbst überlassen. Gebäude verfielen, Bunker wurden allmählich überwuchert. Erst ein paar Jahre später war halbherzig damit begonnen worden, zumindest die gefährlichsten Altlasten zu beseitigen. Offen herumliegende Granaten oder Ähnliches waren seitdem nicht mehr zu befürchten. Anschließend wurde das Sperrgebiet offiziell zum Naturschutzgebiet erklärt.
Doch alle Dinge, vor denen das Schild warnte, waren noch da.
Dort, wo niemand hinsah.
Als zuständige Forstbeamtin war Julia Singer für den erfreulichen Teil dieser Entwicklung zuständig. Die Natur hatte das Terrain zurückerobert, soweit es ihr nicht schon vorher gehörte. Eine reichhaltige Flora und Fauna gedieh allerorten. Seltene Arten hatten hier ein ungestörtes Refugium gefunden. Darunter auch eine große, räuberische Spezies, deren Auftauchen nicht bei allen Begeisterung hervorrief.
Cheetah trottete ohne Leine neben Singer her, ließ sich auch von einer Eidechse nicht ablenken, die neben ihr durch trockenes Laub raschelte. Nach etwa drei Kilometern verjüngte sich der Weg zu einem schmalen Pfad. Er führte einen Hügel hinauf. Ein Schutthaufen zwischen den Kiefern war von Gras und Flechten überwuchert. Unweit davon wuchsen wilde Heidelbeeren.
Wenige Minuten später passierte die Försterin ein kleines Gebäude. Auf dem Dach fehlten die meisten Ziegel. Es war verlassen. Wie alles andere hier. Warum hatte man es einstgebaut? An einer Mauer waren die Reste einer kyrillischen Aufschrift zu erahnen.
Von hier aus war ihr Ziel nicht mehr weit. In einer Senke lichtete sich der Wald. Sie nahm Cheetah an die Leine. Ab jetzt durften sie keine Geräusche mehr verursachen und keine Spuren hinterlassen. Allmählich begann die Dämmerung.Jagdzeit. Der kleine Hochstand am Waldrand, den sie kürzlich mit zwei Forstarbeitern errichtet hatte, bot gerade soviel Platz, dass sie es mit dem Hund ein paar Stunden darauf aushalten konnte. Singer legte Fernglas und Fotoapparat neben sich. Sie schraubte das Objektiv für Nachtaufnahmen auf und machte einige Probeaufnahmen von der Stelle auf dem Hügel, an der sie die Köder ausgelegt hatte. Cheetah saß neben ihr auf einer kleinen Decke. Wieder einmal hatte Singer festgestellt, dass es kein einfaches Unterfangen war, einen ausgewachsenen Rhodesian-Ridgeback auf einen Hochstand zu hieven. Es musste lächerlich ausgesehen haben. Aber wen interessierte das schon? In einem Umkreis von mindestens fünfzehn Kilometern um sie war kein Mensch. Davon war zumindest auszugehen. Verzichten wollte sie weder auf Cheetahs scharfe Sinne noch auf ihre Gesellschaft. Unten bleiben konnte sie auch nicht. Es war zu gefährlich. Denn die, auf die Singer wartete, würden die Hündin töten, falls sie sie witterten. Man hätte es ihnen nicht vorwerfen können. Sie waren es gewohnt, um das Überleben ihres Rudels zu kämpfen. In ihrer Welt gab es keinen Napf mit frischem Fleisch am Morgen und keine warme Decke am Abend.
Canis Lupus war zurück. Ja, es gab wieder Wölfe in Brandenburg.
Hundertzweiundfünfzig Jahre, nachdem ein Gutsherr stolz verkündet hatte, das letzte Exemplar in dieser Gegend erschossen zu haben. Die Menschen registrierten es mit einer Mischung aus Entsetzen und Faszination. Von Begeisterung bis Abscheu war alles darunter. Wie so oft lagen Liebe und Hass dicht beieinander. Die Aussicht, dass es in den Wäldern wieder ein großes Raubtier gab, polarisierte besonders die Bevölkerung in den angrenzenden Dörfern.
Als Försterin sah Julia Singer es als ihre Aufgabe an, für den Wolf zu werben. Zur friedlichen Koexistenz zwischen Mensch und Tier beizutragen. Es handelte sich aus ihrer Sicht dabei eher um ein emotionales Problem. Der Wolf wollte im Normalfall mit Menschen nichts zu tun haben und nahm rechtzeitig Reißaus. Zumindest, solange man ihn nicht in die Enge trieb. Es würde alles kein Problem sein, wenn man dem Ärger aus dem Weg ging.
Dass sie an diesem Abend bewusst die Nähe der Raubtiere suchte, war Teil dieser Mission. Ziel war es, möglichst viele Fotos des Rudels aufzunehmen. Wer war der Leitwolf, wie viele weibliche Tiere gab es? Waren womöglich schon Welpen geboren worden? Abgesehen vom wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn konnten gelungene Aufnahmen eineMenge zum positiven Image des Wolfs beitragen. Vielleicht gelang es ihr sogar, ein Muttertier mit ihren Welpen zu fotografieren. Ein Anblick, der kaum weniger anrührte, als ein tapsigerWurf junger Hunde.
Soviel zur Theorie, dachte Singer. Sie mochte Tiere. Eigentlich sogar lieber als Menschen. Dennoch beschlich sie ein mulmiges Gefühl, während sie zusah, wie die Dämmerung in Dunkelheit überging. Wer sich im Wald nicht auskannte, wurde regelrecht von der Nachtüberrascht. Cheetahs dunkle Augen starrten wachsam umher, die Ohren waren aufgerichtet.
Singer trank einen Schluck Wasser, hielt dann jedoch inne. Der Drang, zur Toilette zu müssen, wäre jetzt denkbar unpassend. Sie hob das schwere Fernglas an. Es war kein Nachtsichtgerät, doch die Linsen waren für schlechtes Licht optimiert. Schemenhaft erkannte sie die Fleischköder im Moos. Dort, wo sie die Abdrücke der Tatzen gefunden und Cheetah die Losung der Wolfsrüden gewittert hatte. Die Fleischbrocken wirkten allesamt noch unberührt. Sie wartete. Und wartete. Eine Ewigkeit, so kam es ihr vor. Es wurde kühl. Singer fröstelte und zog den Reißverschluss ihres Parkas höher. Cheetahs Wachsamkeit hatte merklich abgenommen. Die Hündin schien stattdessen mit dem Gedanken zu spielen, sich trotz des beengten Raumes auf der Decke zusammenzurollen.
Das Rudel würde an diesen Platz zurückkehren, das lag in der Natur der Tiere, versicherte sich Singer fast trotzig. Gleichzeitig war sie sich bewusst, dass es mit jeder Minuteunwahrscheinlicher wurde, dass sie in dieser Nacht einen Wolf zu Gesicht bekam. Der Biorhythmus der Tiere sprach ganz einfach dagegen. Die Armbanduhr war der Meinung, dass es bereits auf dreiundzwanzig Uhr dreißig zuging. Sie seufzte enttäuscht. Warum ignorierte das Rudel die Köder? Warum mieden die Wölfe ihren alten Lagerplatz, obwohl dort eine mühelose Mahlzeit wartete?
War sie zu nah? Oder hatten die Tiere sie doch gewittert?
Es gab viele mögliche Gründe. Erstmals gönnte sie sich ein langgestrecktes Gähnen. Die Anspannung ließ merklich nach. Während sie ihre Augen zusammenpresste, drang ein Geräusch an ihre Ohren. Ein Knacken. Wie ein Zweig unter einem Schuh. Die Tiere des Waldes erlaubten sich solche Unachtsamkeit nicht. Auch Cheetah war aufgeschreckt. Ihr kräftiger Körper straffte sich.
Offenbar keine Täuschung.
Singer kramte im Rucksack nach der Taschenlampe. Ob sie damit Tiere verscheuchte, spielte jetzt keine Rolle mehr. Es waren keine in der Nähe. Zumindest nicht die, wegen denen sie sich hier die Nacht um die Ohren schlug. Sie ließ den Lichtstrahl ziellos durch die Stämme wandern, die in der Dunkelheit wie ein unfreundliches Labyrinth wirkten.
Nichts. Vielleicht doch nur ein Wildschwein.
Das Geräusch wiederholte sich nicht. Sie wartete noch, wusste aber selbst nicht mehr, worauf. Ein zweiter Blick zur Uhr. Irgendetwas deutlich nach Eins. Die Geisterstunde war lange vorüber. Zeit zu gehen. Sie trank etwas Wasser, verstaute ihre Sachen und bereitete Cheetah darauf vor, dass der Rückweg keineswegs angenehmer sein würde. Die Holzsprossen ächzten, während sie mit dem Hund in die Dunkelheit hinabstieg. Eine Dauerlösung war das nicht. Unten angekommen, schaltete sie die Stablampe ein und entschied, Cheetah vorsichtshalber anzuleinen. Doch die Hündin wirkte mit einem Mal unruhig. Als habe sie etwas gesehen, gerochen oder gehört, was den untauglichen Sinnesorganen eines Menschen zwangsläufig entgehen musste.
Im spärlichen Licht lenkte Singer ihre Schritte über den Hügel, hinter dem der Pfad begann, der sie zurück zur Landstraße führte. Der dicke Moosteppich verschluckte die Schritte ihrer Stiefel.
Singer kannte sich hier aus, soweit das überhaupt möglich war. Dennoch war sie erleichtert, als sie endlich den Forstweg erreichte. Noch drei oder vier Kilometer bis zum Wagen. Sie kam schnell voran. Der Lichtkegel wanderte über das hohe Gras, das auf der einstigen Fahrspur von Panzerketten wuchs. Sie fühlte Müdigkeit in sich aufsteigen. Ein erneutes tiefes Gähnen lenkte ihren Blick für Sekunden vom Weg ab.
Plötzlich zog der Hund so ruckartig an der Leine, dass ihr das Ende mit der Schlaufe aus der Hand rutschte. „Hierher, Cheetah“, rief sie ärgerlich. Der Lichtstrahl folgte dem Hund. Sie setzte an, das Kommando in gesteigerter Lautstärke zu wiederholen. Doch der Ton blieb ihr im Hals stecken.
Eine Frau stand vor ihr. Mitten auf dem Weg.
Die schlanke, ja dünne Gestalt erstarrte in der Bewegung. Als sei sie bei etwas ertappt worden. Das Gesicht unbewegt, die ausdruckslosen Augen ängstlich aufgerissen. Wie ein Reh im lähmenden Scheinwerferlicht eines heran rasenden Autos. Ein Schauer jagte über Singers Nacken. Das Licht tanzte im erschrockenen Rhythmus ihrer Hand über die Fremde. Singerräusperte sich heiser.
„Hallo?“
Keine Reaktion.
„Warten Sie.“
Doch die Frau machte überhaupt keine Anstalten fortzulaufen. Die dunklen Pupilleninmitten des schmutzigen Gesichts starrten sie unverwandt an. Auch wenn es nicht verbotenwar, nachts im ehemaligen Sperrgebiet herumzulaufen, war es doch mehr als ungewöhnlich. Singer ging mit festen Schritten auf sie zu. Verwundert stellte sie fest, dass Cheetah sich auf halber Strecke sträubte, weiterzugehen. Als habe sie der Mut verlassen. Eine bemerkenswerte Reaktion für einen Hund, dessen Vorfahren für die Löwenjagd gezüchtet worden waren.
Je näher Singer kam, desto mehr Details brachte ihre Taschenlampe zum Vorschein. Das blasse Gesicht und die Hände der Unbekannten waren voller bräunlich-roter Flecken, als habe sie in der Erde gewühlt. Die Kleidung war dunkel und unauffällig. Jeans und Pullover unter einem halblangen Mantel. Je näher sie ihr kam, desto mehr glaubte sie die Verwirrung zu spüren, die die Frau umgab.Oder war es ihre eigene?
Die Fremde umgab eine Aura, an der nichts zueinander zu passen schien. Cheetah hob nervös witternd den Kopf. Etwas gefiel ihr ganz und gar nicht.
Singer hielt ein paar Schritte Abstand, der Hund blieb dicht neben ihr.
„Was tun Sie denn hier?“ Sie zögerte. „Ich meine, um diese Zeit?“
Die Frau schwieg, blickte mit leeren Augen umher, als habe sie Singer nicht bemerkt. Sie schien damit beschäftigt, aus einer tiefen Höhle zurückzukehren. Singer wagte einen neuen Anlauf. Nebenbei tätschelte sie Cheetah, die ihren Mut wiedergefunden hatte und ein leises, misstrauisches Knurren absonderte.
„Ich bin die… die zuständige Beamtin des Landkreises. Forstoberinspektorin Singer. Wie heißen Sie?“
Es klang dämlich, nach Wichtigtuerei. Singer ärgerte sich über ihre eigenen Worte. Seit wann stellte sie sich als Forstoberinspektorin vor? Es war, als rechtfertige sie sich vor der Unbekannten für ihre Anwesenheit, obwohl es umgekehrt sein sollte.
Ihre Blicke trafen sich. Das Schweigen wurde Singer unerträglich. Zeit, die Fronten zu klären, die Reste ihrer Autorität zusammenzuklauben.
„Sofern Sie Angaben zu ihrer Person verweigern, müssen Sie mich zum Wagen begleiten. Dort klären wir alles Weitere.“
Es klang sehr amtlich. Dennoch gab es wieder keine Reaktion. Singer wünschte sich, die Person niemals getroffen zu haben. Doch ein Zurück gab es jetzt nicht mehr. Mit einem Mal fiel der Blick der Fremden auf den großen Hund. Ihre Gesichtszüge veränderten sich in der Art einer Explosion in Zeitlupe. Wie die Sprengung eines Abrisshauses. Ein spitzer, hysterischer Schrei schallte durch die Nacht. Irgendwo im Wald brach er sich an einem Hindernis. Dann rannte die Fremde in einer Schnelligkeit los, die Singer ihr nicht zugetraut hätte. Zunächst blieb sie auf dem Weg, änderte dann plötzlich die Richtung und verschwand zwischen den Kiefern. Wie ein Hase, der Haken schlägt. Singer gab Cheetah das Kommando, die Verfolgung aufzunehmen. Die Beute zu stellen, ohne sie anzugreifen. Die Hündin schoss los. Ihre Besitzerin folgte, so schnell es ihr möglich war. Trotz der Lampe stolperte sie fluchend über Äste und Gestrüpp. Wie konnte sich die Frau in der Dunkelheit zurechtfinden, ohne zu stürzen? In einiger Entfernung hörte sie ein Bellen und hielt darauf zu. Die Fremde stand mit dem Rücken an einen Stamm gepresst und blickte panisch auf den Hund vor ihr. Sie hyperventilierte vor Anstrengung.
„Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie tut Ihnen nichts“, keuchte Singer. „Warum laufen Sie vor mir weg? Ich will Ihnen doch nichts Böses.“
Singer bemerkte, dass ihr Parka über das Pistolenhalfter gerutscht war. Im spärlichen Licht traten die Konturen der 38er hervor. Die Fremde hatte die Waffe gesehen. Singer beschloss, keine weiteren Nerven in das Spiel des Schweigens investieren zu wollen. Dieses Spiel hatte die Unbekannte ohnehin bereits gewonnen.
„Na schön. Kommen Sie.“
Die Frau bewegte sich kein Stück.
„Hören Sie, ich habe jetzt genug davon. Sie begleiten mich zur Polizeiwache nach Zossen. Zur Überprüfung ihrer Personalien. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie anschließend nach Hause gehen.“
Wo immer das auch sein mag, setzte Singer in Gedanken hinzu.
Sie untermalte es mit einer auffordernden Handbewegung in Richtung des Weges, der sich irgendwo hinter einer schwarzen Wand aus Bäumen verbarg. Ihr fiel auf, dass sich etwasan der Frau verändert hatte. Die ängstliche Seite schien die Oberhand zu gewinnen. Die fast schwarzen Haare umrahmten ein Gemälde der Furcht. Singer wurde nicht schlau daraus.
„Ich hab das nicht gemacht“ stieß die Fremde plötzlich hervor. Singer hatte nicht mehr damit gerechnet, irgendetwas von ihr zu erfahren. Sie erschrak über den Klang. Die Stimme schien aus der gleichen Höhle gekrochen zu kommen wie der Rest der Frau. Ängstlich, erdig, kalt.
„Glauben Sie mir“, beteuerte sie.
„Wovon sprechen Sie? Was haben Sie nicht getan?“
Singer begann sich allmählich ernsthaft zu fragen, ob es sich bei dem Ganzen um einen Scherz handelte. Erschien gleich irgendjemand, um sich herzhaft über sie zu amüsieren?Versteckte Kamera oder etwas in dieser Art? Schadenfreude genossen die Menschen immerhin fast wie Vorfreude.
Sie sah die verwirrte Frau unverwandt an und hoffte dabei inständig, nicht einmal genauso zu enden. Mit einem Mal sah sie, dass sie zitterte. Singer fühlte etwas, das einem schlechten Gewissen sehr nahe kam. Womöglich war die Unbekannte gar nicht verwirrt, sondern stand unter Schock. Vielleicht hatte sie einen Unfall gehabt. Oder war Opfer eines Verbrechens geworden. Und sie hatte die Anzeichen nicht bemerkt.
„Ist Ihnen kalt? Möchten Sie eine Decke?“
Ihr Gegenüber ignorierte das Angebot. Dafür stand für eine Sekunde etwas in ihrem blassen Gesicht, das einem irren Grinsen ähnelte, bevor es wieder verschwand.
„Warten Sie auf die Wölfe?“ Die Unbekannte ließ eine bedeutungsschwere Pause. Ihr entrückter Blick schwenkte Richtung Wald. Die Stimme wurde versonnen.
„Sie werden nicht kommen.“
Das alles ergab für Singer keinen Sinn. Doch es reichte, um eine Gänsehaut zu erzeugen, die sich ein durchziehender Schneesturm über ihren Rücken bewegte. Sie rang sich eine weitere Frage ab.
„Warum werden die Wölfe nicht kommen?“ Sie entließ die Fremde nicht aus ihrem Blick.
„Die Wölfe“, erwiderte sie nur. „Ich hab es gesehen.“
Singer seufzte. Sie war todmüde und wollte nach Hause. Doch was sollte sie mit der Frau anfangen? Was konnte sie tun, wenn die Fremde nicht mit ihr sprach? Therapeuten, die mit ihren Fragen an eine Mauer gerieten, ließen ihre Patienten die Antwort oft zeichnen. Zumindest war es bei ihr selbst so gewesen. Das würde hier nicht funktionieren. Doch ihr kam eine ähnliche Idee.
„Können Sie mir zeigen, was Sie gesehen haben? Ist es weit weg?“
Die Antwort bestand aus einem skeptischen Blick auf den Hund. Dann bewegte sich die Frau so behände durch den Wald, dass Singer sich erneut anstrengen musste, nicht zurückzufallen. Ungern wollte sie wieder Cheetah hinter ihr herschicken. Schnell erreichten sie den Pfad. Im Licht von Singers Taschenlampe eilte die Frau weiter. Sie schlug die Richtung ein, aus der sie gekommen waren: tiefer in den Wald. Sie entfernten sich weiter vom Auto und der L74 nach Wünsdorf, der einzigen Landstraße weit und breit.
„Scheiße“, fluchte Singer leise, als ihr Fuß unter einer Wurzel hängenblieb, die sich quer über den Weg spannte. In der Dunkelheit sah alles anders aus und andererseits alles gleich. Offenbar ließ die Kondition der Fremden allmählich nach. Die Schritte wurden langsamer. Singer hörte ihren Atem. Schnell und von einem leichten Pfeifen begleitet. Cheetah war die einzige, die der nächtliche Marsch nicht nennenswert anstrengte.
Mit einem Mal spürte Singer harten Grund unter den Stiefeln. Sie erreichten eine alteMilitärstraße. In diesem Bereich war Sie bisher kaum gewesen. Die verlassene Piste bestand aus zusammengefügten Betonplatten, die hie und da aus dem Sand ragten. Tannennadeln und Kienäpfel bedeckten den Rest. An vielen Stellen war der Beton während strenger Winter aufgebrochen. Kiefernsprösslinge nutzen die Löcher. Sobald ihr Stamm stark genug war, sprengten sie den Beton weiter auseinander und schafften Platz für neue Sprösslinge, die es ihnen wiederum gleich täten. Währenddessen nagten Zeit und Wetter weiter am Beton. In drei oder vier Dekaden würde von der alten Militärstraße nichts übrig sein, als einige Betonklumpen, die als letzte Zeugen einer unheimlichen Vergangenheit allmählich im märkischen Boden versanken. Jene Vergangenheit war hier spürbar konserviert. Mit etwas Phantasie waren Befehle zu hören, die in einer fremden Sprache durch den Wald schallten. Überlagert von Schüssen und dem mahlenden Geräusch der Panzerketten. Die Übung für eine große Kraftprobe zwischen Ost und West, die es nie gegeben hatte.
Nach etwa einhundert Metern passierten sie ein gemauertes Wachhäuschen mit eingeschlagenen Scheiben. Nach weiteren zweihundert Metern erhoben sich geduckte Hallen mit schweren, rostigen Rolltoren neben der Straße.
Die Fremde verringerte ihr Tempo weiter. Sie blickte nervös umher, als müsse sie sichorientieren. Durch die Bäume war der abnehmende Mond zu erkennen. Fahles, weißliches Licht, das weder Wärme noch Trost spendete. Hier war Singer noch niemals zuvor gewesen. Dort, wo die Straße endete, fiel der Lichtkegel auf ein Backsteingebäude, das zunächst klein aussah. In ihr keimte die Frage auf, ob es wirklich ein durchdachter Einfall war, der Unbekannten zu folgen.
Hohe Bäume umgaben das Gebäude, was dafür sprach, dass es schon sehr lange hier stand. Die Russen hatten es nur übernommen. Wahrscheinlich auch erweitert.
Je näher sie kamen, desto mehr schälten sich die alten Mauern aus der Nacht. Was Singer zunächst für ein kleines Gebäude gehalten hatte, war in Wahrheit nur der Eingang zu einem Komplex, der eher die Größe einer Fabrik besaß. Ein Teil der dreistöckigen Anlage verbarg sich hinter Bäumen und Büschen. Aus einigen Mauern waren Stücke herausgebrochen, an anderen führten verrostete Rohre entlang. Auch neben der Straße lagen Rohre im Gras, die ins Nirgendwo führten. Singer erinnerte sich dunkel, dass ihr Vorgänger, der alte Radditz, ihr von einem Ort wie diesem erzählt hatte. Er musste es wissen. Oder tat zumindest so. Während der DDR-Zeit war er als Förster der einzige gewesen, der das Sperrgebiet außer den Sowjets betreten durfte. Doch einige Bereiche waren auch für ihn streng tabu gewesen. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, Unheimliches darüber zu berichten. Dinge, die er mehr ahnte als wusste. Schon vor den Russen seien hier chemische oder biologische Waffen erforscht worden. Nachdem der Komplex den Sowjets in die Hände gefallen war, hätten sie die Arbeit daran angeblich wieder aufgenommen. Zumindest bis in die sechziger Jahre. Vielleicht auch länger. So genau könne er das nicht sagen.
Sie hatte ihm kein Wort geglaubt. Geschichten wurden immer besser, je häufiger sie erzählt wurden und je mehr Zeit verstrich. Jetzt war sie sich damit nicht mehr so sicher. Aber wahrscheinlich lag es nur an ihren Nerven.
Singer hielt inne. Ein Kienapfel knackte unter ihrer Sohle.
„Bleiben Sie stehen“, sagte sie scharf. Die Unbekannte gehorchte.
Egal, was diese merkwürdige Person vorhatte. Sie würde dieses Gemäuer nicht betreten. Schon jetzt fühlte es sich an, als hätte sie sich etwas aufzwängen lassen, was keine gute Entscheidung war.
„Wie weit ist es noch?“
„Wir sind da“, sagte die Fremde mit erstaunlicher Klarheit. Singer leuchtete direkt in ihr Gesicht. Die Augen inmitten der schmutzigen Haut wirkten jetzt weniger verwirrt. Sie ließ das Licht im Halbkreis wandern.
„Haben Sie hier die Wölfe gesehen?“
Auf einmal ein Stammeln: „Ich bin weggelaufen. Hab nichts damit zu tun. Schrecklich.“
„Zeigen Sie mir endlich, wovon Sie sprechen“, entgegnete Singer gereizt. „Sofort“
Die Frau hob eine Hand in Richtung des alten Fabrikgebäudes. Ihr Arm ähnelte einem verwitterten Wegweiser. Singer nickte frustriert.
„Das habe ich mir gedacht. Was haben Sie da drinnen gesehen, einen Geist?“
Ihr Gegenüber überhörte den Sarkasmus. Singer überlegte. Sicher, sie konnte einfach wieder gehen. Doch dann war sie sinnlos mitten in der Nacht durch den Wald gestolpert. Wahrscheinlich hatte die Frau gar nichts gesehen, weder drinnen noch draußen. Ihr Geisteszustand war, gelinde gesagt, unklar. Kurz entschlossen traf Singer eine Entscheidung. Sie würde nachsehen und dann wieder gehen. Mehr nicht.
Sie hatte keine Angst. Nein, Angst würde sie sich nie wieder erlauben.
Der abgenutzte Holzgriff des Revolvers drückte mitsamt dem Holster auf ihre Hüfte. Doch in diesem Augenblick verströmte diese Druckstelle ein beruhigendes Gefühl. Ebenso wie das kleine, scharfe Messer, das sie an der linken Wade trug. Sie legte es nur selten ab. Eigentlich nie. Seit damals.
„Sie warten hier“, sagte sie. Es klang wie ein Befehl, nicht wie eine Bitte und war auch so gemeint.
„Hinter der Tür“ antwortete die Frau. „Sie werden schon sehen.“
Singer überlegte, Cheetah zurückzulassen, entschied sich aber dagegen. Vielleicht würde sie ihre Nase oder ihr Gehör brauchen. Sie hielt die Hündin kurz an der Leine und strebte dem tunnelartigen Eingang zu. Die rostige Tür stand weit offen.
Lange nicht bewegt worden, stellte sie mit einem Blick auf die Zargen fest. Dahinterbaumelten verwitterte Streifen aus Gummi von der Decke. Fetzen eines Vorhangs, wie er in Krankenhäusern und Labors verwendet wurde. Dichtungsstreifen an Boden und Decke. Die Überreste einer Luftschleuse. Die Wände mussten einmal weiß gewesen sein. Jetzt zog sich grünlicher Belag darüber. Moos und Algen, die in Feuchtigkeit und Finsternis gediehen.
Der kurze Gang endete in einer geräumigen Halle, die oben mit großen Fenstern und unten mit Stützpfeilern versehen war. Auch hier ragten rostige Rohrleitungen aus denWänden. Sie leuchtete die Ecken aus und kämpfte gegen das mulmige Gefühl an. Eine hartnäckige Warnung ihrer Magengrube, die sie ignorierte. Vorsichtig setzte sie Schritt vor Schritt. Ein gute Entscheidung, wie sich herausstellte. In der Mitte der Halle tat sich ein rechteckiges Becken im Boden auf, das entfernt an ein kleines Schwimmbad erinnerte. Am Rand waren die Reste irgendeiner Vorrichtung zu erkennen. Trübe Flüssigkeit stand darin. Ein morsches Brett schwamm an der Oberfläche. Daneben etwas, das wie eine alte Schüssel aussah. Singer machte einen gehörigen Bogen darum. Sie konnte nicht abschätzen, wie tief es war. Doch allein der Gedanke hineinzufallen, ließ ihren Puls in die Höhe schnellen. Es interessierte sie auch nicht, wozu das alles einmal gedient hatte. Zumindest nicht in dieser Nacht. Alles an diesem Ort war beunruhigend. Doch was hatte der Frau dort draußen einen solchen Schock versetzt, dass sie außerstande war, davon zu erzählen? Singer näherte sich dem hinteren Teil der Halle. Dort schloss sich ein breiter Gang mit niedriger Decke an. Wieder Rohre. Weiter hinten lag Gerümpel im Weg und begrenzte den Blick. Mehrere Türen gingen an beiden Seiten ab. Sie schüttelte den Kopf. Es war unmöglich, all das zu durchsuchen. Zumal nachts. Genau genommen war es auch nicht ihre Aufgabe, den Aussagen einer Verwirrten nachzugehen. Sollten sich die Kollegen der Polizei darum kümmern. Was die davon hielten und ob sie sich damit lächerlich machte, war ihr mittlerweile gleichgültig.
„Komm Cheetah“, sagte sie verdrossen, „Wir haben uns genug an der Nase herumführen lassen.“
Wider Erwarten folgte ihr das Tier nicht. Die Hündin sträubte sich, die Augen in denleeren Gang gerichtet. Anspannung ging von ihr aus. Aus dem Maul drang ein leises, aber unheilvolles Knurren, dann ein deutliches Grollen, schließlich ein lautes Bellen, dass sich an den Wänden brach. Singer zuckte zusammen.
„Was ist los? Was hast du?“
Eine Frage, die Cheetah nur mit weiterem Zerren an der Leine beantwortete. Singer hielt dagegen. Nein, sie würde sie nicht in die Finsternis laufen lassen. Wenn überhaupt, gingen sie zusammen. Sie kniff die Augenlider zusammen und leuchtete in den Tunnel, der sich wie ein schwarzer Schlund vor ihr auftat. Sie tat einige Schritte. Ein alter Stuhl säumte den Weg. Weiter hinten moderte ein Haufen Lumpen vor sich hin. Alte Kleidung oder Ähnliches. Einzelheiten waren im spärlichen Licht auf diese Entfernung nicht auszumachen. Julia Singer wollte nur noch eines. Raus hier und schnellstens zurück zur Straße, an der das Auto stand. Cheetah zog weiter in die entgegengesetzte Richtung. Doch hatte sie die Hündin nicht mitgenommen, um sich auf ihren Spürsinn zu verlassen? Irgendetwas war dort hinten. Eine flüchtige Warnung zuckte durch ihr Gehirn wie eine rote Leuchtrakete: Die Lage gerät außer Kontrolle. Sie ging weiter, als sie gehen sollte. Im wahrsten Sinne. Sie passierte schimmligeTapetenreste, von denen ammoniakartiger Geruch aufstieg. Cheetah schnüffelte an einigen Holzbrettern. Singer folgte ihr. Alarmiert, aber ratlos. Aus einem der Rohre tropfte Brackwasser auf ihre Schulter. Das hoffte sie zumindest. Im Rhythmus ihrer Schritte sprang der Lichtkegel umher. Neben ihr fehlte ein zwei Meter breites Stück der Außenmauer. Weißliches Mondlicht fiel in den Gang. Aus dem Wald wehte der Duft von Erde und feuchten Tannennadeln herein. Brusthohe Büsche wucherten vor der geborstenen Mauer. Mit der Dunkelheit kehrte der muffige Gestank zurück, der dem ganzen Gebäude innewohnte wie ein Pilz. Singer verharrte. Irgendwo plätscherte Wasser. In weiter Entfernung schrie ein Vogel, am ehesten ein Waldkauz, wie die Försterin in ihr feststellte. Im gleichen Augenblick stieg ihr jene metallische Würze in die Nase, die Cheetah schon lange witterte. Süßlich, aber stumpf wie abgestandener Lambrusco.
Der Geruch, der das Ende einer Jagd begleitet: Blut.
Bevor sie einen klaren Gedanken zu fassen vermochte, fiel ihr Blick auf das, was sie für einen Haufen alter Kleidung gehalten hatte. Ein Anblick, der sie traf wie ein Schuss in den Rücken. Für den es keine Vorbereitung gab. Ein entsetzter Schrei löste sich aus ihrer Kehle. Es fühlte sich an, als habe ein anderer geschrien. Die unheimliche Frau dort draußen hatte die Wahrheit gesagt.
Das Rudel war hier gewesen.
Singer wandte den Blick ab, als sie glaubte, sich übergeben zu müssen. Mit der Säure stieg ein ungläubiges Gefühl ihren Hals empor. Die unentrinnbare, beißende Wahrheit, mit der ein Priester vom Glauben abfällt.
Die Wölfe…Unmöglich. Das darf nicht sein!
Sie musste erneut hinsehen.
Fleisch. Blut. Knochen. Mehr Blut. Zerfetzte Haut, die im Licht glänzte wie Alabaster. Alles was sie sah, war Weiß oder Rot. Überreste von mehreren Menschen, die sie nur als zerfetzt bezeichnen konnte. Drei, wenn sie nicht irrte.
Raubtiere fressen zuerst die Innereien, erst danach das Fleisch.
Ausgeweidete Körper. Beute. Nicht mehr, nicht weniger. Sie hatte schon tote Menschen gesehen. In ihrem früheren Leben. Doch es gab nichts, was diesem Anblick auch nur entfernt nahekam. All das war zu viel für ihren Körper. Ihre Knie wurden weich, knickten ein. Schwindel erfasste sie. Sie erbrach sich gegen die abblätternde Gipsfarbe der Tunnelwand. Cheetah registrierte es mit einem Blick, der Unverständnis ausdrückte. Mitleid und Ekel waren zutiefst menschliche Regungen.
Singer erhob sich mühsam. Ihre Schläfen pochten.
Noch einmal schwenkte sie die Lampe auf das Unfassbare, zwang sich zu einem letzten Blick.
Nein, sie irrte sich nicht. Der Arm einer der Leichen schien auf etwas zu zeigen. Dieblutverkrustete Hand eines Mannes lag ausgestreckt auf dem Beton. Davor Konturen im Staub. Vielleicht Buchstaben. Oder nur eine Täuschung.
Vorsichtig tat sie einige Schritte darauf zu. Sie versuchte, das schreckliche Geschehenauszublenden, ihre Sinne nur auf die Spuren am Boden zu konzentrieren. Wie sie es früher getan hatte. Es waren Zeichen, die sehr wahrscheinlich ein Mensch hinterlassen hatte. Die Hinterlassenschaft eines Toten.
Buchstaben, zweifellos. In den Boden gekratzt. Vielleicht mit einem spitzen Stein. ZumEnde waren sie nur noch in den Staub gewischt. Als hätte bereits die Kraft gefehlt.
Es begann mit einem W. Dann I, D, E, R.
Die Ziffern wurden undeutlicher. Ein O. Nein, eher ein G. Wieder ein E. Ein B, oder eine 8. Dann ein gut lesbares U. Ein halb verwischtes R und ein zu erahnendes T. Dahinter verlief die Schrift im Sand. Als habe er weiterschreiben wollen, sei aber nicht mehr dazu gekommen.
W-I-D-E-R-G-E-B-U-R-T las sie langsam.
Falls es stimmte, fehlte ein E. Aber wer achtete in seinen letzten Sekunden schon aufRechtschreibung? Vielleicht hatte er es auch nicht besser gewusst. Während sie stumm vor den Buchstaben verharrte, nahm sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahr. Cheetah drehte ruckartig den Kopf. In die Richtung, aus der sie gekommen waren. Ehe der Lichtstrahl denAugen des Hundes folgte, war Singer klar, dass dort jemand stand. Bewegungslos und abwartend. Eine Hand fuhr leicht zitternd zum Revolver, die andere zur Taschenlampe. Der Lichtstrahl erfasste die Silhouette. Sie ahnte bereits, wer sich dahinter verbarg.
„Wiedergeburt“, wiederholte sie abwesend das Vermächtnis des Toten.
Ihre Augen richteten sich auf die Gestalt, die sie geduldig beobachtete.
II
Die Kreuzigung
Grafschaft Fermanagh, Nordirland
Der Nieselregen gönnte sich eine kurze Unterbrechung. Als müsse der graue Himmel Luft holen. Es war nicht abzusehen, wann er damit fertig war, doch die Regenpause konnte jederzeit enden. Genau wie der Frieden in dem Land, auf das er hinabfiel. Der nordirische Frühherbst wirkte so einladend wie die Mienen der beiden Beamten, hinter denen Robert Hartmann im Wagen saß. Der urige Polizei-Landrover rumpelte hart über die Piste.
Police Service of Northern Ireland stand gut sichtbar auf den Türen. Bis vor einiger Zeit hatte dort RUC gestanden, Royal Ulster Constabulary. Nicht nur die alten Buchstaben schimmerten noch durch. Neuer Name, alte Truppe. Seit gut einer halben Stunde hatte der Fahrer, ein Detective Inspector aus Belfast, keinen Ton von sich gegeben. Der Beifahrer, ein junger Constable, schwieg ebenfalls. Auf der Rückbank begann Robert Hartmann, sich zu fragen, ob er der Grund dafür war. Möglicherweise waren es die ersten Auswirkungen des bevorstehenden Brexit. Einem Kollegen vom Kontinent war einfach nicht zu trauen. Vielleicht lag es aber auch nur an ihrer Nervosität. Der Land Rover durchquerte eine dünn besiedelte Gegend ohne Industrie oder größere Ortschaften. Wer hier lebte, war mit hoher Wahrscheinlichkeit Katholik und brachte Polizeibeamten weder Respekt noch Freundlichkeit entgegen, unerheblich davon, was auf der Autotür stand. Auf vertrauensbildende Maßnahmen irgendwelcher Politiker und Bürokraten aus Belfast oder gar London gab man hier das, was die Kühe und Schafe in rauen Mengen ausschieden.
Über dem platten Wasser des Lower Lough Erne dräuten die nächsten dunklen Wolken. Da niemand Interesse an einer Unterhaltung zeigte, blieb Hartmann genug Zeit, die Landschaft in sich aufzunehmen. Zumindest das, was die Dämmerung davon übrig ließ. Eigentlich ein recht idyllisches Fleckchen Erde. Grüne Hügel wie aus der Butterwerbung und freundlicher Galeriewald an den Ufern des riesigen Sees. In einiger Entfernung schnatterten ein paar Enten. Auf dem Lough zog ein unförmiges Hausboot mit einer Laterne am Bug vorbei.
Er blickte zum Handgelenk. 19.46 Uhr. Zwei Stunden, seit sie Belfast verlassen hatten. Die Fahrt war an ihm vorübergeschlichen wie ein streunender Hund. Aber eilig schien man es hier ohnehin selten zu haben. Die sympathische Eigenschaft eines Landes, in dem sich ansonsten viel Misstrauen und Bitterkeit angesammelt hatte. Der Hass schwelte weiterhin unter der Oberfläche. Als habe man in bester Absicht etwas Sand und Wasser in ein Erdloch voller Glut gegossen und gehofft, der Rest möge sich von selbst erledigen. Doch das Loch war tief. Man hatte es vor langer Zeit eigenhändig ausgehoben. Das Ergebnis waren dreißig Jahre Bürgerkrieg. Und auch wenn diese Zeit vorerst vorbei war, verband die Einwohner des nördlichen Zipfels der Grünen Insel doch kaum mehr, als eine notorische Todfeindschaft. Einwohner, das waren Katholiken und Protestanten. Irische Nationalisten und pro-britische Unionisten. Anders gesagt: Nichts, was einen Beamten des deutschen Bundeskriminalamtes auch nur entfernt etwas anging. Denn etwas Verbindendes gab es doch: Egal welcher Gruppe man angehörte. Einmischung von Außen war allen ein Gräuel. Hier regelte man seine Angelegenheiten selbst. Das war immer so gewesen.
Hartmann gähnte. Das monotone Gerumpel ließ ihn träge werden, aller Aufregung zum Trotz. DI McCulloch überprüfte mit geübten Bewegungen seine Glock 17-Pistole. Hartmann sah ihm über den Innenspiegel in die taubengrauen Augen. Der Beamte verstand den Wink.Er öffnete das Handschuhfach und zauberte einen zierlichen Taschenrevolver daraus hervor.
„Was ist denn das?“, fragte Hartmann auf Englisch. „Zirpende Grille?“
„So in etwa. Macht mehr Lärm, als man glaubt.“
Entgeistert blickte der Ermittler auf die kleine Waffe, die in der riesigen Pranke des Iren wie ein Spielzeug wirkte.
„Richten Sie Ihrer Frau meinen Dank aus.“
„Aha, unser deutscher Freund ist ein Komiker. Ist ne 38er. Hat nur fünf Schuss. Aber benutzen sollen sie ihn ja ohnehin nicht.“
Der Inspector fuchtelte damit vor Hartmann herum. Gleichzeitig begann er sehr unerwartet, Deutsch zu sprechen.
„Nun nehmen Sie das Ding schon. Etwas anderes kriegen Sie nicht. Nur, damit ich mich nicht schuldig fühle, wenn etwas schiefgeht. Sie schießen auf niemanden, ist das klar? Sie sind überhaupt nur dabei, weil dieser verdammte Terrorist O’Ferghail ausgerechnet mit Ihnen sprechen will. Warum auch immer.“
McCulloch sprach tatsächlich ein gutes, weiches Deutsch und genoss Hartmanns Überraschung.
„Paderborn, 1978-84. Ich hatte eine gute Zeit da.“ Er verdrehte grübelnd die Augen. „Eigentlich sogar die beste in meinem Leben.“
„Britische Armee?“, forschte Hartmann.
Er erhielt ein stilles, professionelles Lächeln als Antwort. Es schien Netter Versuch, Kleiner zu sagen. Dem deutschen Gast war längst klargeworden, dass es sich bei McCulloch nicht um einen einfachen Kriminalpolizisten der CID, der Criminal Investigation Divisionhandelte. Wahrscheinlich gehörte er eher zu Special Branch, der Geheimdienst-Abteilung der Polizei, wenn nicht gar zum MI-5, dem britischen Inlandsgeheimdienst.
Angesichts des Einsatzes, der sie erwartete, wäre es keine Überraschung gewesen. Der geheimnisumwitterte Anführer der Real-IRA, einer der letzten wirklich gefährlichen Splittergruppen der alten IRA, gab sich die Ehre. Dieser Mann, dessen Identität bisher ein streng gehütetes Geheimnis war, hatte sich überraschend aus der Deckung gewagt. SeineEinladung richtete sich ausgerechnet an Robert Hartmann, Zielfahnder des Bundeskriminalamtes und seit drei Tagen ungeliebter Gast der Nordirischen Polizei.
Patrick O’Ferghail, der mit seiner Truppe aus alten und neuen Fanatikern alle Friedensverträge boykottierte, bat ausgerechnet den deutschen Ermittler um ein Treffen. Allein. Keine Nordirische Polizei, keine Briten. Abschließend hatte er durchblicken lassen, was geschah, wenn Hartmann sich nicht an diese Bedingungen hielt:
Alle sterben und Sie erfahren gar nichts.
Nun gut, es konnte sich um alles Mögliche handeln. Eine Falle war dabei nicht die unwahrscheinlichste Möglichkeit. Hartmann hatte der merkwürdigen Einladung überhaupt nur aus einem einzigen Grund zugestimmt: Es war die vielversprechendste Chance, seine eigenen Ermittlungen voranzutreiben. Die Hintergründe eines Uran-Schmuggels aufzuklären, den er eigenhändig in der Nähe von Koblenz vereitelt hatte. Gewisse Indizien legten dabei eine mögliche Verbindung nach Nordirland nahe. Das sah zumindest Hartmanns Vorgesetzter in Wiesbaden, der Leitende Kriminaldirektor Arthur Quenting, so. Deswegen hatte er Hartmann ermuntert, dem Treffen zuzustimmen. Kein Wunder, er riskierte ja nicht seine eigene Haut. Wenn es einen Uran-Deal gab, wusste O’Ferghail davon. Der sogenannte Stabschef der Real-IRA war ein Fanatiker der alten Schule. Für Polizei und MI-5 einer der größten Fische im Teich.
Hartmann hatte sich entschlossen, das Risiko einzugehen. Die Möglichkeit war einfach zu verlockend. Und wenn er ehrlich war, hatte er ansonsten bisher nicht viel herausgefunden.
„Anhalten!“ befahl McCulloch dem Constable. „Wir müssen den Deutschen noch verkabeln.“
Hartmann glaubte, sich verhört zu haben.
„Auf keinen Fall!“, protestierte er. „Keine Wanzen. Wenn O’Ferghail davon Wind bekommt, ist er weg und ich bin tot.“
„Wir haben unsere Befehle direkt aus Belfast“, mischte der Constable sich ein. „Was dieser Vogel singt, möchten alle hören.“
Sein Versuch, dabei sardonisch zu grinsen, wirkte komisch. Dazu war er noch zu grün hinter den Ohren. Sein Aussehen entsprach dem eines Sonntagsschülers. Zumindest die wichtigste Lektion hatte er aber offenbar schon gelernt: Bei Problemen oder Widerspruch immer auf irgendeine höhere Dienststelle zu verweisen. Doch Hartmann hatte sich vorgenommen, in diesem Punkt nicht zu verhandeln. Er wechselte ins Englische.
„Ist mir egal, Constable. Es geht ja nicht um ihren A…“
„Also gut“, unterbrach der DI. „Aber seien Sie sich bewusst, was Alleinsein heißt. Keine Unterstützung, keine Rückendeckung. Mit uns können Sie nicht rechnen. Wir kommen erst, wenn alles vorbei ist, um die Reste einzusammeln.“
„Das ist doch Ihr Job“, ätzte Hartmann.
Der Constable ließ den Defender am Rand eines kleinen Wäldchens ausrollen. Dahinter schlossen sich jene sumpfigen Weiden an, in deren Mitte sich laut Karte der Treffpunkt befand. Ein verlassener Bauernhof. Keine schlechte Wahl, dachte Hartmann. O’Ferghail wusste, was er tat.
Allmählich ging die Dämmerung in Dunkelheit über. Erneut setzte leichter Nieselregen ein. Violette Wolken zogen vom Lough über die Grafschaft Fermanagh. Vielleicht würde es später ein kurzes Gewitter geben. Vielleicht auch nicht.
Hartmann spürte, dass er schwitzte. Er zog das Jacket aus und krempelte die Hemdsärmel hoch. Da McCulloch darauf bestand, zwängte er sich außerdem in eine Kevlar-Weste. So nah, wie er O’Ferghail kommen würde, bot sie allerdings kaum Schutz. Und sollten die Terroristen ihn bereits aus großer Entfernung ausschalten wollen, verfügten sie sicher über Munition, denen eine schusssichere Weste nicht standhielt. Schlechte Bewaffnung war nie das Problem der IRA gewesen. Ihre Kaliber .50 Vollmantel-Projektile, liebevoll Copkiller genannt, gingen durch die Kevlarschichten wie ein Küchenmesser durch warmen Obstkuchen. Hartmann war nicht lebensmüde, jedenfalls nicht grundsätzlich. Doch so lange er auch darüber nachdachte, fiel ihm einfach kein plausibler Grund ein, warum sein Tod für O’Ferghail erstrebenswert sein sollte. Hier war er ein Niemand. Nur irgendein Kraut, der morgen wieder abreiste. Er stellte keine Gefahr dar. Jedenfalls würde die Real-IRA das annehmen. Hartmann spürte, wie seine Aufregung anwuchs wie die eines Jagdhundes auf einer frischen Fährte.
Was wollte dieser Mann ihm mitteilen?
Ein Blick zur Armbanduhr. Der gefühlt hundertste in der letzten Viertelstunde.
20.10 Uhr Ortszeit.
„Ich gehe jetzt los.“
„Braver kleiner Deutscher“, sagte der Detective Inspector und hielt ihm ein kompaktes Funkgerät hin.
„Nur für den Notfall.“
Hartmann schüttelte entschieden den Kopf. Er hätte die Fürsorglichkeit des Kollegen zu schätzen gewusst, doch es war keine. Was McCulloch interessierte, war lediglich, was der IRA-Stabschef von sich gab. Hartmann konnte es ihm nicht verübeln, zumal seine Vorgesetzten an ihren polierten Schreibtischen in Belfast oder London-Whitehall sicher ordentlich Druck machten.
Außer dem Revolver, den er hinten im Hosenbund trug, nahm er nur eine starke Taschenlampe mit sich. Er ließ den Land Rover hinter sich, folgte ein kurzes Stück dem Feldweg und schlug sich dann in die Büsche. Zweige von Heideginster und Tannen schlugen ihm ins Gesicht. Zwischen den Bäumen herrschte bereits jene Finsternis, die sich sehr bald auch auf die Felder und Wiesen legen würde. Er überlegte kurz und schaltete die Lampe ein. Sofern O’Ferghails Leute die Gegend beobachteten, sollten sie ihn ruhig beizeiten sehen. Keine Überraschung, keine Bedrohung.
Hinter einem schmalen Gürtel aus Laubbäumen begann das Weideland. Mehr Morast als Wiese. Hin und wieder begrenzten hüfthohe Wälle aus aufgeschichteten Feldsteinen die Äcker. Seit dem Frühmittelalter hatte sich diese Art, seinen Besitz zu umfrieden, hier nicht geändert. Tagsüber musste all das einen leidlich idyllischen Anblick bieten. Falls sich gelegentlich Touristen hierher verirrten, fühlten sie sich vielleicht an Stonehenge erinnert. Für Hartmann waren es nicht mehr als unfreundliche Steinhaufen, die ihm den Weg versperrten. Er kam langsam voran, versank bei jedem Schritt im aufgeweichten Boden. Der kleine Lichtkegel der Taschenlampe glitt über die tiefen Abdrücke schwerer Pferde. Daneben gab esSpuren von Kühen und Schafen - und gelegentlich solche vom Profil grober Stiefel. Es stand kein Wasser darin, was nahelegte, dass sie relativ frisch waren. Nach einhundert Metern spürte Hartmann, wie die Feuchtigkeit allmählich durch seine Lederschuhe drang. Nach dreihundert Metern waren seine Füße nass und kalt. Selbst schuld, dachte er ergeben und erblickte in der Ferne eine Erhebung. Das Gehöft. Er beschleunigte die Schritte. Sein Herzschlag tat es ihm gleich. Was erwartete ihn dort? Nach und nach verdichteten sich die Umrisse zu Gebäuden. Das große, alte Cottage aus Feldsteinen wurde von zwei Stallungen umrahmt, deren Wände lustlos mit grauem Mörtel verputzt waren. Die Mitte bildete eingepflasterter Hof. Was ihn beunruhigte, war die Dunkelheit im Inneren der Kate. Warum war keines der Fenster erleuchtet? Eine Sicherheitsvorkehrung?
Ganz schön paranoid, dieser O’Ferghail, dachte Hartmann. Doch wahrscheinlich war der Terrorchef genau aus diesem Grund noch am Leben. Es hatte Zeiten gegeben, in denen der britische Special Air Service unter IRA-Mitgliedern eher selten Gefangene gemacht hatte. Und wenn doch, waren die anschließenden Verhöre meist sehr unschön verlaufen. Lieber also etwas vorsichtig, als etwas tot.
Der Ermittler blieb stehen, hielt den Atem an und sah sich um. Einsamer konnte ein Ortkaum sein. Selbst in Irland. Wurde er bereits beobachtet? Wenn ja, machten die ihre Sache nicht schlecht. Was erwartete ihn in diesem Haus? Einer der Instinkte, die er nicht hinter einem Schreibtisch erworben hatte, warnte ihn, wusste aber noch nicht wovor.
Er ging weiter darauf zu. Auch aus der Nähe wirkte alles verlassen. Hartmann umkreiste das heruntergekommene Cottage vorsichtig in einiger Entfernung. Nichts. Niemand. Nur Finsternis und neuer Nieselregen. Natürlich konnte er jederzeit unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ebenso sicher machte er sich damit zum Gespött der ganzen nordirischen Polizei. Nun gut, damit konnte er leben. Viel wichtiger war es, zu erfahren, warum der Typ ausgerechnet nach ihm verlangte. Im besten Fall bot er ihm Informationen über die Hintermänner des Uranschmuggels. Schon diese Aussicht genügte, um zu bleiben.
Der lehmige Boden, der seine Schuhe inzwischen wie eine frische Brotkruste umschloss, reichte bis an den gepflasterten Hof. Zwischen den Steinen wuchs Gras, hie und da bis auf Kniehöhe. Er leuchtete in die schwarzen, fensterlosen Öffnungen der Ställe, in denen vermutlich einmal Kühe oder Schweine gehalten worden waren. Vor der Eingangstür zum Wohnhaus blieb er stehen. Er bemerkte Schuhabdrücke, die genau dorthin führten. Im Lichtkegel erkannte er zwei unterschiedliche Sohlen. Neben dem groben Profil von den Feldern hatte hier eine weitere Person ihre Spuren hinterlassen. Natürlich konnten sie auch älter sein. Der Regen verwischte sie im Lehm nur langsam. Dafür brauchte es schon einen veritablen Wolkenbruch, der hier momentan jedoch selten vorkam. Wichtig war nur eines. Irgendwer hatte irgendwann ein Haus betreten, das ansonsten unbewohnt war, und war dabei nicht allein gewesen. Hartmann entschloss sich, höflich zu klopfen. Bloß nicht in den Verdacht geraten, sich anzuschleichen wie der Späher einer Spezialeinheit.
„Mister O’Ferghail? It’s me, Robert Hartmann.“ Er sprach es halblaut gegen die Holztür und kam sich dämlich dabei vor. Es fühlte sich ein wenig an, als stehe er in der Wüste und erzähle einem Kaktus seine Lebensgeschichte: Es war nutzlos und sich weiter zu nähern, war nicht ratsam.
Zum ersten Mal zog er in Erwägung, dass in diesem Haus überhaupt niemand auf ihn wartete. Zumindest nicht mit ehrlichen Absichten. Er drückte zögerlich die Klinke, fast sicher, die Tür verschlossen vorzufinden. Doch sie schwang auf. Wie die schmutzig grinsende Einladung eines Fremden, von der man sich später wünschte, sie ausgeschlagen zu haben. Hinter dem Eingang lag ein kratziger Teppich aus Hanffasern, dessen einzige Daseinsberechtigung darin bestand, pflegeleicht zu sein. Daneben fiel der Lichtstrahl auf eine dunkle Kommode, der ihr Alter weder zu Wert noch antiken Reizen verhalf. Darüber waren Garderobenhaken angebracht. An einem hing eine graue Jacke, ein nichtssagender, billiger Blouson. Hartmann befühlte ihn. Der Stoff war trocken. Doch diese Art von Gewebe trocknete sehr schnell. Das Ding konnte dort seit einer Stunde oder einem Monat hängen. Kaum Rückschlüsse möglich.
Er fand einen Lichtschalter, den er betätigte. Nichts geschah. Er ging weiter bis in einen großen Raum, den Mittelpunkt des Hauses. Eine Art Wohnzimmer. Abgewetzte Sofas, Tisch und Stühle. An der Wand eine Vitrine mit Flaschen und Gläsern. Von der Decke hing etwas, das verzweifelt versuchte, einen Kronleuchter zu imitieren. Wie eine Hure, die gerne eine Prinzessin wäre. Er fand einen zweiten Lichtschalter. Doch auch der Lüster blieb dunkel. Es gab eine ganze Anzahl von Erklärungen dafür. Eine einzige davon ließ ihn nervös werden:Jemand hatte die Stromleitungen gekappt.
Er begutachtete oberflächlich die übrigen Räume. Überall der gleiche schäbige Chic. Möbel aus den Sechzigern, hässliche Teppiche und Leere. Ein kitschiges Wandbild mit röhrenden Hirschen auf einer Wiese. Mehr Klischee als Kunst. Hartmann öffnete die Tür zum letzten Zimmer. Regale mit zerfledderten Büchern. Immerhin. Zwei Sessel, dazwischen ein niedriger Beistelltisch. Darauf ein Flaschemit bernsteinfarbenem Inhalt. Ein knappes Drittel des Inhalts fehlte. Zwei Gläser standen daneben. Das eine gut gefüllt, als habe sich soeben jemand nachgeschenkt. Das zweite war leer. Er roch daran, ohne es zu berühren. Unbenutzt. Geruch von irischem Whiskey hing in der Luft. Daneben etwas Unbestimmtes. Mehr eine beklemmende Ahnung als ein Indiz. Möglicherweise Schweiß. Doch es war eine Ausdünstung, die nicht auf körperliche Anstrengung zurückzuführen war. Hartmann wusste, wie Angst roch. Er war damit vertraut. Eine zarte Note von kaltem Rauch gesellte sich hinzu. Nicht, als sei in diesem Raum geraucht worden. Eher, als sei mit einem Raucher unbeabsichtigt ein Hauch seines Lasters hereingeweht. Starker, dunkler Tabak. Er roch am gefüllten Glas, genau dort, wo kräftige, ja wulstige Lippen einen leichten Abdruck hinterlassen hatten. Keine Spur von Rauch. Nur die milde Würze des Whiskeys. Ein weiterer Blick durch den Raum. Der Läufer war verrutscht. In der Mitte schlug der Teppich eine Falte. Etwa so, als sei jemand mit dem Fuß daran hängengeblieben. Jemand, der es sehr eilig hatte oder den Blick grundsätzlich lieber in die Luft als auf den Boden richtete.
Hartmann erinnerte sich daran, nicht als Forensiker hier zu sein, sondern um eine Verbindungsperson zu treffen. Für Schlussfolgerungen war es ohnehin zu früh. Ein Ermittler lief stets Gefahr, sich eine Theorie zusammenzuzimmern, nur um die Indizien unterzubringen. Das alte Gemäuer posaunte seine Geheimnisse, wenn es sie gab, nicht gerade hinaus. Vielmehr raunte es ihm auf zarte Weise den Beginn einer Geschichte zu, die ihn in Versuchung führte, sich auszumalen, was in diesem Raum geschehen war:
Ein Mann hatte an dem kleinen Tisch gesessen, wahrscheinlich der Stabschef selbst. Er erwartete einen Gast, vielleicht Hartmann. Deswegen ein zweites Glas. Er wollte nicht warten und hatte sich bereits ein oder zwei Whiskey eingeschenkt. Entweder weil er ihn mochte, oder um seine Nerven zu beruhigen. Da es sich offenbar um keinen feierlichen Tropfen handelte, war letzteres nicht unwahrscheinlich, selbst bei einem abgebrühten Terroristen. Das alles sprach dafür, dass die Nachricht, die er Hartmann mitzuteilen gedachte, es in sich hatte.
Jetzt gehe ich zu weit, bremste sich Hartmann. Nichts als Spekulationen.
Sicher war nur eines: Etwas Unerwartetes war geschehen. Oder etwas, dass O’Ferghail schon vorher befürchtet hatte, ohne es letztendlich verhindern zu können.
Blieb die Frage: Wo war er geblieben?
Wäre ein Auto oder Motorrad gestartet worden, hätte man es gehört. Nicht auszuschließen war natürlich, dass O’Ferghail den Hof zu Fuß verlassen und über die dunklen Felder gelaufen war. Obwohl Hartmann den Hof mehrfach umrundet hatte, war es fraglos möglich.
Wiederum erwog Hartmann, zum Land Rover zurückzukehren, um McCulloch und seinem hungrigen jungen Kollegen die Angelegenheit zu übergeben. Der Detektive Inspector würde ohne Zweifel einen amtlichen Blick aufsetzen, anschließend irgendeinen entbehrlichen Spruch von sich geben und dann einen kurzen, unergiebigen Einsatzbericht zu den Akten legen. Schon als Beleg für die Überstunden. Viel mehr konnte er auch nicht tun, denn der IRA-Mann würde nicht mit ihm sprechen.
Gleichzeitig wurde Hartmann immer mehr bewusst, dass er in Gefahr schwebte. Worumes hier auch ging. Er selbst hatte dafür gesorgt, dass seine Anwesenheit nicht unbemerkt geblieben sein konnte, sofern jemand in der Nähe war. Wiederum spürte er den warnenden Impuls, das alte Haus sofort zu verlassen. Diesmal entschloss er sich, ihm zu folgen. Die nassen Bindfäden, die der Himmel auf die Grafschaft herabhängen ließ, waren noch dünner und mutloser geworden. Winzige Tropfen schienen in Zeitlupe zu fallen. Sie durchnässten alles sehr langsam, dafür aber gründlich. Im Licht der Taschenlampe widmete sich Hartmann noch einmal den Fußabdrücken. Nur ein Paar der Sohlen setzte sich im Haus fort. Die Stiefel, falls sie das Haus je betreten hatten, waren dagegen zuvor gesäubert worden. Dafür sprachen auch die Reste von Morast auf dem Abtreter. Das Licht der Taschenlampe wurde schwächer. Die Batterien mussten schon älter oder halb leer gewesen sein. Hartmann stieß einen Fluch aus, der auf McCulloch gemünzt war. Wie lange würden sie noch halten? Konzentration, mahnte er sich. Er musste die verbleibende Zeit nutzen.
Die Spuren führten nicht nur ins Haus, wie ihm auffiel, sondern auch wieder hinaus. In unregelmäßiger Schrittfolge. Jedoch nicht in Richtung der Weiden. Stattdessen verloren sie sich in der Nähe der Stallungen. Genau genommen vor dem Eingang.
Was sollte er tun? Unschlüssig stand er in der Dunkelheit. Nicht einmal der Mond durchbrach die Nacht, unter der die Grafschaft Fermanagh verschwand. Ohne Licht würde er über die Felder stolpern wie ein Blinder. Wenn er jetzt aufbrach, hielt die Lampe vielleicht durch, bis er den Land Rover erreichte. Doch er hatte nichts erfahren. Im Gegenteil. Er kehrte mit neuen Fragen zurück.
Die Alternative war es, alle vernünftige Vorsicht über Bord zu werfen.
Kurz entschlossen lenkte er seine Schritte zu den Ställen. Das große Doppeltor, durch das man das Vieh hinein- und hinaustreiben konnte, hing in rostigen Scharnieren, die aussahen, als würden sie kaum benutzt. Er zog daran. Verschlossen. Einige Meter entfernt gab es eine weitere Tür, die wahrscheinlich für das morgendliche Melken und Füttern gedacht war. Auch an ihr nagte der Rost. An den Scharnieren gab es jedoch blanke Stellen. Dieser Eingang wurde zumindest sporadisch geöffnet. Sie war unverschlossen und quietschte. Die schwarze Öffnung gähnte Hartmann an. Alte Gerüche von Heu, Urin und dem Kot der Pflanzenfresser hatten sich in den Mauern eingenistet. Und etwas anderes, das er schon zuvor wahrgenommenhatte: Die schwache Note von kaltem Rauch. So zart, dass es auch eine Täuschung sein konnte. Ein letzter Blick in den Regen, bevor Hartmann eintrat. Er ließ das unbestimmte Gefühl zurück, dort draußen nicht alleine zu sein. Nach wenigen Metern befand er sich im Mittelgang zwischen zwei Futterrinnen. Der Lichtkegel tanzte über die Wände, an denen schwere Eisenringe befestigt waren. An einigen hingen noch rostige Kettenglieder.
Man könnte es glatt für einen Folterkeller halten, versuchte sich Hartmann mit einem Anflug von Ironie zu beruhigen. Die Umgebung erinnerte ihn an seinen letzten Fall, der ihn erst an diesen Ort geführt hatte. Damals wäre sein Leben beinahe in einem Erdloch geendet.
Unter seinen Schuhen knisterten trockene Halme. Reste von Stroh. Darauf nach Abdrücken zu suchen, war sinnlos, zumal im Licht der schwachen Taschenlampe. Nach etwa zehn Metern lösten Verschläge für Pferde die offenen Stehplätze ab. Zehn auf jeder Seite.Seufzend öffnete er die Tür zur ersten Box. Das Heu und ältere Pferdeäpfel wiesen darauf hin, dass dieser Teil des Stalls gelegentlich noch genutzt wurde. Der Harngeruch war hier stechender. Er öffnete die zweite Box. Das gleiche Bild, der gleiche Geruch. Nur deutlich mehr Pferdeäpfel. Unvermittelt erklang ein leises Rascheln aus dem gegenüberliegenden Verschlag. In der Stille schreckte Hartmann auf. Noch einmal das gleiche Geräusch. Das war keine Ratte. Der Ermittler verharrte in der Bewegung. Sein Herz pochte schneller und stärker. Er zog den kleinen Revolver aus dem Hosenbund und spannte ihn. Er näherte sich der Box seitlich, hielt den Atem an. Ruckartig leuchtete er in die Öffnung. Das Licht fiel auf dunkleAugen. Ein Gesicht wie eine schwarze Maske. Es erstarrte - und wirkte ebenso überrascht wie Hartmann.
Ein Waschbär. Verflucht. Oder Gott sei Dank.
Hartmann stieß Luft aus. Zufällig erhob der kleine Bär seine Pfoten ein wenig. Es sah aus, als wolle er sich ergeben, was aber eher unwahrscheinlich war. Hartmann grinste, vollführteeine halbherzige Husch-husch-Geste und steckte die 38er weg.
„Los, raus hier, du Vagabund.“
Widerwillig trollte sich der Waschbär. Sehr kurz fiel Hartmanns Blick auf die rechte Pfote. Die spitzen Krallen hielten etwas fest, an dem das Tier genagt hatte. Bis es gestört worden war. Etwas, das es in dieser Box gefunden hatte. Nur kurz streifte das Licht darüber. Zu kurz, um ganz sicher sein zu können. Dennoch traf es Hartmann wie ein Schock. Sein Wissen über Waschbären war spärlich: Allesfresser. Kräftiges Gebiss. Nahrung hauptsächlich Pflanzen, Nüsse, frisches Fleisch, altes Fleisch, Knochen…
Er schauderte. Knochen
Was er gesehen hatte, war allem Anschein nach ein menschlicher Finger gewesen. Sein Herz sprang in schnelles Stakkato. Sinnloserweise zog er erneut die Waffe hervor und leuchtete durch das Heu. Nichts.
Ich muss weg von hier.
Nein, halt, da ist noch etwas. Mit dem Fuß schob er trockene Halme zu Seite. AufKniehöhe war etwas in die Bretterwand geritzt. Er kniete sich davor. Es waren Buchstaben, keine Frage. Vermutlich mit einem Kugelschreiber mehr eingeritzt als geschrieben. Die Schrift war eckig und fahrig. Hektik und Angst sprachen aus jedem Strich.
Nur Großbuchstaben.
WIEDERGEBURT, las er langsam ab.
Dahinter folgte ein Strich, möglicherweise ein Bindestrich.
In welchen Irrsinn war er hineingeraten? Warum stand dieses Wort in deutscher Sprachein einem verlassenen Stall in der nordirischen Provinz?
Es dauerte einige Sekunden, bis er sich besonnen hatte. Er traf eine Entscheidung. Und er traf sie schnell. Was immer hier geschehen war. Ein Verbrechen, ein Unfall oder sonst etwas. Es war Sache des CID aus Belfast, nicht seine. Er würde McCulloch haarklein berichten, was er gesehen hatte. Der konnte dann bei Tag mit seinen Forensikern anrücken und untersuchen, ob es etwas zu untersuchen gab. Auch wenn sich der Waschbär kaum als Zeuge zur Verfügung stellen würde.
Ja, genau das würde er tun. Hoffentlich hielt die verdammte Lampe noch bis zum Wagen durch. Er wandte sich zum Gehen. Es war feucht im Stall. Tropfen fielen auf seinen Kopf. War die Decke etwa undicht? Egal, nur weg hier. Es war von Anfang an eine sehr dumme, sehr unnötige Idee gewesen, der Nachricht eines IRA-Chefs, eines notorischen Terroristen, in einen verlassenen Bauernhof zu folgen.
Wieder fielen Tropfen auf seine Haare. Beiläufig wischte er mit der Hand darüber. Etwas zu klebrig für Regenwasser, fand er und hielt seine Hand vor die Lampe. Das Licht war beunruhigend schwach geworden.
Mein Gott. War das etwa… Blut?
Sofort richtete er die Lampe über sich, in Richtung Dach. Der dürftige Schein kroch über alte Holzbalken. Dort, wo er innehielt, begann er zu springen wie ein Dämon. Hartmanns Hand zitterte. Es war beileibe nicht der erste Tote, den er zu Gesicht bekam. Dennoch hätte er um ein Haar aufgeschrien.
Er hatte O’Ferghail gefunden.
Gekreuzigt! Sie haben ihn gekreuzigt.
Der Kopf des stämmigen Mannes hing mitsamt der grauen Haare kraftlos zwischen den ausgestreckten Armen herab. Blut tropfte von seinen Lippen. Sofort war Hartmann klar, um wen es sich handelte. Es musste der IRA-Chef sein. Alter und Statur passten.
Dicke Zimmermannsnägel waren durch Hände, Arme und Füße in die Balken des Dachstuhls getrieben worden. Sie hielten die Leiche in einer Position, die unweigerlich an ein Kruzifix erinnerte.
Während Hartmanns Blick die Nägel streifte, fiel ihm ein weiteres schreckliches Detail auf. Die Daumen fehlten. Sauber abgetrennt, soweit er erkennen konnte. Es gab nur wenige Formen von Gewalt, die Hartmann bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Eine Kreuzigunggehörte dazu.
Ein Mord, so skurril, grausam und frevelhaft, dass die Botschaft darin fast die Tat überlagerte. Aus den Wunden, in denen die Nägel steckten, lösten sich zähe Blutstropfen. Die Tötung, oder zumindest die Kreuzigung, konnte noch nicht allzu lange her sein. War die Leiche post mortem an diesen Ort gebracht worden, oder war der Ire dort oben langsam gestorben? Hartmann stoppte seine Gedanken, mit denen er instinktiv bereits eine Ermittlung eröffnete. Doch dies hier war noch immer nicht seine Aufgabe, war es nie gewesen. Er hatte es nur zu spät bemerkt.
Jetzt gab es nur noch eines: Raus hier! Nichts wie weg.
Von irgendwoher näherte sich das leise schmatzende Geräusch von Schritten auf nassem Grund. Nicht im Stall, aber in der Nähe.
Wenn ich schnell laufe, kann ich in gut zehn Minuten am Wagen sein. Oder ist es das, worauf die da draußen warten? Renne ich in mein Verderben?
Wieder Schritte. Leiser, tastender. Jetzt noch näher. Wer konnte das sein?
Nur einer schied aus. Der Waschbär. Robert Hartmann saß in der Falle. Sein Blick wanderte noch einmal hinauf zum Giebel. Zur gekreuzigten Leiche. Unter anderen Umständen hätte er sich vielleicht die Frage gestellt, wer zu so etwas fähig war. Doch der Überlebensinstinkt war ein eifersüchtiger Begleiter. Jetzt ging es nur darum, lebendig hier herauszukommen. Denn eines war sicher. Wer auch immer O’Ferghail das angetan hatte, würde ihn nicht verschonen, weil er mit alledem eigentlich nichts zu tun hatte.
Es hatte Situationen in Hartmanns Leben gegeben, in denen er dem Tod sehr nahe gewesen war. Ein paar Mal hatte er sich in ruhigen Minuten die Frage gestellt, unter welchen Umständen sein Leben wohl enden würde. In diesem Augenblick lautete seine Antwort:
Nicht hier. Nicht in einer verregneten Nacht in der nordirischen Grafschaft Fermanagh. Über alles andere konnte man reden, wenn es soweit war.
Er schaltete die schwächelnde Lampe aus und schlüpfte in den Mantel der Dunkelheit. Falls es jemand auf ihn abgesehen hatte, musste er es ihm nicht leichter machen, als nötig. Die kleine 38er im Anschlag, tastete er sich aus der Pferdebox. Sicherung nach allen Seiten. Er nutzte jede Deckung, während er sich lautlos zum Ausgang vorarbeitete. Die Seitentür war nicht unbedingt ein raffinierter Schachzug, doch einen anderen Ausgang schien es nicht zu geben. Er blieb daneben stehen und legte das Ohr an die Mauer. Sie war kalt und feucht. Entferntes Pfeifen von Wind, angereichert mit Sprühregen. Was hatte er erwartet?
Er konnte noch stundenlang so ausharren. Oder es riskieren.
Vorsichtig drückte er die Klinke und schob die Tür einen Spalt breit auf. Dann immer weiter. Frische, irische Luft und feine Tropfen schlugen ihm entgegen. Die Dunkelheit wirkte nicht so undurchdringlich, wie er erwartet hatte. Der Vollmond nutzte jeden Spalt zwischen den Wolken. Der Ermittler spähte über die Felder. Nichts. Er wartete. Zweieinhalb Minuten später schob sich eine der Regenwolken vor den weißlichen Himmelskörper. Eine bessere Gelegenheit würde sich kaum bieten. Hartmann trat ins Freie. Er roch den Nebel, der aus den Feldern aufstieg. Eine angenehme Mixtur aus Wasser, Lehm und Stein, die an eine Töpferwerkstatt erinnerte.
Unweit vom Stall begann der Pfad über das Weideland, der ihn zum Land Rover führte. Eine verlockende Aussicht. Unter den Schuhen gab der aufgeweichte Boden nach. Als liefe er über den weichen Unterleib eines riesigen Ungeheuers, das man besser nicht weckte. Er passierte das Cottage, in dem vor Kurzem vermutlich ein Mann seinen letzten Whisky getrunken hatte. Inzwischen hing er in einem Nebengebäude an sechs stabilen Nägeln. Die Erinnerung ließ ihn erneut schaudern. Hartmann erreichte den Pfad. Er bestand aus dem gleichen Morast, wie die Umgebung, war aber im Laufe der Zeit festgestampft worden.
Sein Puls begann sich zu normalisieren. Er warf einen letzten Blick auf die verfluchte Farm, die bei Tagesanbruch zu einem abgesperrten Tatort werden würde. In diesem Moment schob sich eine der Wolken am Mond vorbei. Das plötzliche Licht wurde von etwas reflektiert. Direkt neben dem Haus. Metall, das sich bewegte. Weniger als fünfundzwanzig Meter von ihm entfernt. In derselben Sekunde begriff Hartmann, dass er sich zu früh gefreut hatte. Schlimmer noch. Er stand ungeschützt auf freiem Feld. Was er sah, war die Mündung einer Waffe. Höchstwahrscheinlich ein Gewehr, schlimmstenfalls mit nachttauglichem Zielfernrohr.