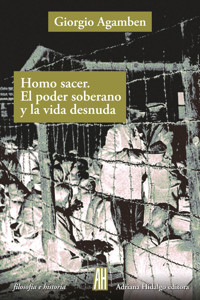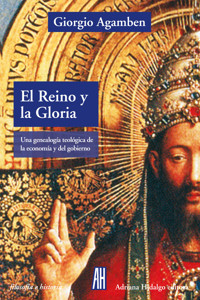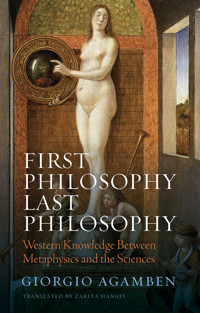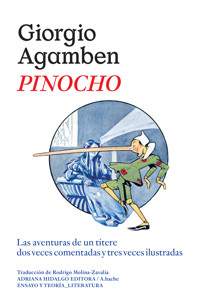12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Was ist das Geheimnis der Literatur? Mit ›Die Erzählung und das Feuer‹ legt der weltbekannte Philosoph Giorgio Agamben eine Sammlung seiner neuesten Essays vor. Was steht in der Literatur auf dem Spiel? Was hat es mit dem »Feuer« auf sich, das die »Erzählung« verloren hat und um jeden Preis wiederzufinden versucht? Was widersteht bei jedem Schöpfungsakt der Schöpfung hartnäckig und verleiht so dem Werk Intensität und Anmut? Und warum ist das Gleichnis das heimliche Muster jeden Erzählens? Wie in ›Nacktheiten‹ kommen in den zehn Essays die dringlichsten Themen der gegenwärtigen Forschung Giorgio Agambens zur Sprache. Und wie in allen seinen Texten geht es auch hier um die unnachgiebige Befragung des »Geheimnisses« der Literatur, die auch vor deren materiellen Aspekten (wie die Ablösung des Buchs durch den Bildschirm) nicht haltmacht. Inhalt: ›Das Feuer und die Erzählung‹ / ›Mysterium burocraticum‹ / ›Gleichnis und Reich‹ / ›Was ist der Schöpfungsakt?‹ / ›Strudel‹ / ›In wessen Namen?‹ / ›Ostern in Ägypten‹ / ›Über die Schwierigkeit des Lesens‹ / ›Vom Buch zum Bildschirm. Vor und nach dem Buch‹ / ›Opus alchymicum‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Ähnliche
Giorgio Agamben
Die Erzählung und das Feuer
Aus dem Italienischen von Andreas Hiepko
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Erzählung und das Feuer
Scholem beschließt sein Buch über die jüdische Mystik[1] mit einer Geschichte, die ihm Josef Agnon erzählt hat:
Wenn der Baal-schem etwas Schwieriges zu erledigen hatte, […] so ging er an eine bestimmte Stelle im Wald, zündete ein Feuer an und sprach […] Gebete – und alles geschah, wie er es sich vorgenommen hatte. Wenn eine Generation später der Maggid von Meseritz dasselbe zu tun hatte, ging er an jene Stelle im Wald und sagte: »Das Feuer können wir nicht mehr machen, aber die Gebete können wir sprechen« – und alles ging nach seinem Willen. Wieder eine Generation später sollte Rabbi Mosche Leib aus Sassow jene Tat vollbringen. Auch er ging in den Wald und sagte: »Wir können kein Feuer mehr anzünden, und wir kennen auch die geheimen Meditationen nicht mehr, die das Gebet beleben; aber wir kennen den Ort im Walde […], und das muß genügen.« – Und es genügte. Als aber wieder eine Generation später Rabbi Israel von Rischin jene Tat zu vollbringen hatte, da setzte er sich in seinem Schloß auf seinen goldenen Stuhl und sagte: »Wir können kein Feuer machen, wir können keine Gebete sprechen, wir kennen auch den Ort nicht mehr, aber wir können die Geschichte davon erzählen.« Und – so fügt der Erzähler hinzu – seine Erzählung allein hatte dieselbe Wirkung wie die Taten der drei anderen.
Man kann diese Anekdote als Allegorie der Literatur lesen. Im Laufe ihrer Geschichte entfernt sich die Menschheit immer weiter von den Quellen des Mysteriums, nach und nach vergisst sie, was die Tradition über das Feuer, den Ort und die Formel lehrt – doch von all dem können sich die Menschen noch die Geschichte erzählen. Was vom Mysterium übrig bleibt, ist die Literatur, »das« – wie der lächelnde Rabbi ergänzt – »muß genügen«. Was mit diesem »Genugsein« gemeint ist, versteht sich nicht von selbst, und doch hängt das Schicksal der Literatur davon ab, wie wir es verstehen. Denn betrachtete man den Verlust des Feuers, des Orts und der Formel als Fortschritt, und sieht im Ergebnis dieses Fortschritts – der Säkularisierung – die Befreiung der Erzählung von ihren mythischen Ursprüngen und die Schaffung einer – autonom und mündig gewordenen – Literatur in der abgetrennten Sphäre der Kultur, entbehrte das »Genugsein« jeden Sinns. Es genügt – doch wofür? Kann uns eine Erzählung befriedigen, die jeden Bezug zum Feuer verloren hat?
Im Übrigen behauptet der Rabbi das genaue Gegenteil. Wenn er sagt, dass »wir die Geschichte davon erzählen können«, steht das Pronominaladverb »davon« für das Verlorene, das dem Vergessen Anheimgefallene: Erzählt wird die Geschichte des Verlorengehens des Feuers, des Orts und des Gebets. Jede Erzählung, die gesamte Literatur ist Gedenken an den Verlust des Feuers.
Dass der Roman seinen Ursprung im Mysterium hat, ist in der Literaturgeschichte mittlerweile unumstritten. Wie Kerényi und in seinem Gefolge Reinhold Merkelbach zeigen konnten, besteht ein genetischer Zusammenhang zwischen den heidnischen Mysterien und dem antiken Roman, dessen unübertroffenes Muster die Metamorphosen des Apuleius sind (deren in einen Esel verwandelter Protagonist schließlich durch eine mystische Initiation erlöst wird). Denn wie die Mysterien führt uns der Roman ein individuelles Leben vor, das sich mit einem göttlichen, jedenfalls übermenschlichen Element verbindet, so dass die Wechselfälle, Episoden und Abwege dieses Menschenlebens eine Bedeutung erhalten, die es übersteigt und zum Mysterium werden lässt. Wie der Initiand, der im eleusinischen Dämmerlicht der pantomimischen oder getanzten Heraufbeschwörung der Entführung Kores in den Hades und ihrer alljährlichen Wiederkehr im Frühling beiwohnte, in das Mysterium einging und aus ihm Hoffnung auf Rettung seines Lebens schöpfte, so nimmt der Leser, der der Verwicklung der Lebensumstände und Geschehnisse folgt, in die der Roman seine Figuren wohlwollend oder schonungslos verstrickt, Anteil an deren Los, ja er selbst tritt in die Sphäre des Mysteriums ein.
Allerdings ist es ein von jedem mythischen Gehalt und jeder religiösen Gestimmtheit freies und deshalb nicht selten tristes Mysterium – man denke nur an Isabel Archer in James’ Roman oder an Anna Karenina; es kann sich sogar, wie im Fall Emma Bovarys, um ein Leben handeln, das jedes Geheimnis verloren hat. Wie dem auch sei, ohne Initiation, und mag sie noch so armselig sein und nur ins Leben und seine Verschwendung einweihen, gibt es keinen Roman. Zu dessen Wesen gehört es, zugleich Verlust und Gedenken des Geheimnisses, Vergessen und Wiederheraufbeschwören der Formel und des Ortes zu sein. Wenn er jedoch, wie es heute immer öfter der Fall zu sein scheint, von seiner ambivalenten Beziehung zum Mysterium nichts mehr wissen will, wenn er jede Erinnerung an die prekäre, ungewisse eleusinische Erlösung tilgt, weil er meint, auch ohne die Formel auskommen zu können oder, schlimmer noch, das Mysterium in der Anhäufung von Vertraulichkeiten zu finden glaubt, ginge mit der Erinnerung an das Feuer auch die Romanform verloren.
Das Element, in dem sich das Mysterium auflöst und verliert, ist die Geschichte. Dass ein und dasselbe Wort sowohl die chronologische Abfolge der Wechselfälle der Menschheit als auch das, was die Literatur erzählt, sowohl die Geste des Historikers und des Forschers als auch die des Erzählers bezeichnet, ist eine Tatsache, die uns stets aufs Neue zu denken gibt. Zum Mysterium gelangen wir nur durch eine Geschichte, und doch (oder vielleicht müsste man sagen, ebendeshalb) ist es die Geschichte, in der die Feuer des Mysteriums erloschen sind oder verborgen wurden.
Ausgehend von seiner persönlichen Erfahrung als Kab- balaforscher denkt Scholem in einem Brief von 1937 darüber nach, welche Schlüsse aus der Verbindung zweier scheinbar sich widersprechender Elemente wie der mystischen Wahrheit und der historischen Forschung zu ziehen sind. Er hatte die Absicht, »nicht die Historie, sondern die Metaphysik der Kabbala zu schreiben«; ihm wurde jedoch sehr schnell klar, dass man zum mystischen Kern der Überlieferung (Kabbala bedeutet »Überlieferung«) nicht vordringen kann, ohne die »Wand der Historie« zu durchschreiten.
Der Berg [wie Scholem die mystische Wahrheit nennt] bedarf gar keines Schlüssels; nur die Nebelwand der Historie, die um ihn hängt, muß durchschritten werden. Sie zu durchschreiten – daran habe ich mich gemacht. Ob ich im Nebel steckenbleibe, sozusagen den »Tod in der Professur« erleiden werde? Aber die Notwendigkeit der historischen Kritik und kritischen Historie kann, auch wo sie Opfer verlangt, durch nichts anderes abgegolten werden. Gewiß, Geschichte mag im Grunde ein Schein sein, aber ein Schein, ohne den in der Zeit keine Einsicht in das Wesen möglich ist. Im wunderlichen Hohlspiegel der philologischen Kritik kann für heutige Menschen zuerst und auf die reinlichste Weise, in den legitimen Ordnungen des Kommentars, jene mystische Totalität des Systems gesichtet werden, dessen Existenz doch gerade in der Projektion auf die historische Zeit verschwindet. In diesem Paradox, aus solcher Hoffnung auf das richtige Angesprochenwerden aus dem Berge, auf jene unscheinbarste, kleinste Verschiebung der Historie, die aus dem Schein der »Entwicklung« Wahrheit hervorbrechen läßt, lebt meine Arbeit, heute wie am ersten Tag.[2]
Die von Scholem als paradox bezeichnete Aufgabe besteht, um es mit seinem Freund und Lehrer Walter Benjamin zu sagen, darin, aus der Philologie eine mystische Disziplin zu machen. Voraussetzung dafür ist, wie bei jeder mystischen Erfahrung, mit Leib und Seele in den undurchdringlichen Nebel philologischer Forschung mit ihren traurigen Archiven und trostlosen Regesten, ihren unlesbaren Manuskripten und wirren Glossen einzutauchen. Die Gefahr, sich in der philologischen Tätigkeit zu verirren, das mystische Element, dessen man habhaft werden wollte, infolge der coniunctivitis professoria, die eine solche Tätigkeit mit sich bringt, aus den Augen zu verlieren, ist zweifelsohne sehr groß. Doch wie der Graal in der Geschichte verlorenging, muss sich auch der Forscher in seiner philologischen quête verlieren, weil nur ein solches Sichverlieren die Seriosität einer Methode verbürgt, die zugleich mystische Erfahrung ist.
Wenn die Geschichte erforschen und eine Geschichte erzählen in Wahrheit ein und dieselbe Geste sind, ist auch der Schriftsteller vor eine paradoxe Aufgabe gestellt. Er soll ausschließlich und unbeirrbar an die Literatur – das heißt an den Verlust des Feuers – glauben, soll sich in der Geschichte, die er um seine Figuren webt, verlieren und nichtsdestoweniger, wenn auch nur um diesen Preis, am Grund des Vergessens die Splitter schwarzen Lichts erkennen, die das verlorene Geheimnis aussendet.
»Prekär« heißt, was durch Bitten erlangt wird (prex, mündliche Frage, im Unterschied zu quaestio, Frage, die sich aller, auch gewaltsamer Mittel bedient), und ist deshalb fragil und riskant. Riskant und prekär ist auch die Literatur, wenn sie im rechten Verhältnis zum Mysterium stehen will. Wie der Initiand in Eleusis schreitet der Schriftsteller im Dunkel oder Halbdunkel voran, auf einem Pfad, der zwischen niederen und höheren Gottheiten, zwischen Vergessen und Erinnerung gespannt ist. Es gibt jedoch eine Art Sonde, ein ins Geheimnis gesenktes Lot, das es ihm erlaubt, seinen Abstand zum Feuer zu bestimmen. Diese Sonde ist die Sprache, der sich die Abstände und Brüche, die die Erzählung vom Feuer trennen, als Wunden einschreiben. Die literarischen Gattungen sind die Wunden, die das Vergessen des Mysteriums der Sprache schlägt: Trauerspiel und Elegie, Hymne und Lustspiel sind lediglich die Modi, in denen die Sprache ihre verlorene Verbindung zum Feuer beklagt. Heutzutage scheinen die Schriftsteller diese Wunden nicht mehr zu bemerken. Sie wanken wie Blinde und Taube am Abgrund der Sprache und hören die Klage nicht, die zu ihnen hinaufdringt, sie glauben, die Sprache als neutrales Werkzeug zu verwenden und vernehmen das gekränkte Gestammel nicht, das die Formel und den Ort einfordert und nach Abrechnung und Rache verlangt. Schreiben heißt Kontemplation der Sprache, und wer seine Sprache nicht liebt, nicht sieht, wer weder die zarte Elegie zu buchstabieren noch die verhaltene Hymne wahrzunehmen versteht, ist kein Schriftsteller.
Das Feuer und die Erzählung, das Geheimnis und die Geschichte sind die beiden unverzichtbaren Elemente der Literatur. Doch wie kann ein Element, dessen Anwesenheit der unwiderlegbare Beweis für den Verlust des anderen ist, dessen Abwesenheit bezeugen, dessen Schatten und Andenken beschwören? Wo es Erzählung gibt, ist das Feuer erloschen, wo ein Geheimnis weht, kann es keine Geschichte geben.
Die missliche Lage des vor diese unmögliche Aufgabe gestellten Künstlers fasst Dante einmal so zusammen: »l’artista / ch’a l’abito de l’arte ha man che trema [dem Künstler, der die Kunst beherrscht, zittert die Hand]« (Par. XIII, 77–78). Die Sprache des Schriftstellers ist – nicht anders als die Geste des Künstlers – ein Spannungsfeld, dessen Pole der Stil und die Manier sind. Stil ist »der Habitus der Kunst«, die vollkommene Beherrschung der Mittel: Er besiegelt die Abwesenheit des Feuers, da alles im Kunstwerk enthalten ist und ihm folglich nichts fehlen kann. Es gibt kein, gab nie ein Mysterium, da es hier und jetzt und immerdar gut sichtbar ausgestellt ist. Doch durch diese herrische Geste geht zuweilen ein Zittern, etwas wie eine tiefsitzende Unsicherheit, die auf einen Schlag den Stil entweichen, die Farben verblassen, die Worte stocken, das Material aufschwemmen und gerinnen lässt. Dieses Erzittern ist die Manier, die, indem sie den Habitus ablegt, den Mangel und das Übermaß des Feuers bezeugt. Bei jedem wahren Schriftsteller, bei jedem Künstler findet man eine Manier, die sich vom Stil absetzt, und einen Stil, der sich als Manier entäußert. Auf diese Weise löst und zerreißt das Mysterium den Faden der Erzählung, und das Feuer lässt die Seiten der Geschichte in knisternde Flammen aufgehen.
Henry James hat einmal beschrieben, wie seine Romane entstehen. Anfangs gebe es nur etwas, das er image en disponibilité nennt, das isolierte Bild einer Frau oder eines Mannes, noch frei von jeder näheren Bestimmung. Sie sind »disponibel«, können vom Autor nach Belieben eingewoben werden in ein Geflecht aus verhängnisvollen Konstellationen, Beziehungen, Begegnungen und Episoden, die »sie deutlicher hervortreten lassen«, um sie schließlich zu dem zu machen, was sie sind, die »Komplikationen, die sie sehr wahrscheinlich verursachen und erleiden«, kurz: Charaktere.
Die Geschichte, die sie so, Seite um Seite, während sie von ihren Erfolgen und ihrem Scheitern, ihrem Heil oder ihrer Verdammnis erzählt, zeigt und offenbart, spinnt zugleich den Faden, der sie an ein Schicksal bindet, ihr Leben zu einem mysterion werden lässt. »Hervortreten« lässt sie sie nur, um sie in eine Geschichte einschließen zu können. Am Ende ist das Bild nicht mehr »disponibel«, es hat sein Geheimnis verloren und muss vergehen.
Im Leben der Menschen geschieht etwas ganz Ähnliches. Die Existenz, die am Anfang so disponibel, so reich an Möglichkeiten gewesen zu sein schien, verliert in ihrem unerbittlichen Verlauf nach und nach ihr Geheimnis, eins nach dem anderen verlöschen ihre Feuer. Am Ende ist sie nur noch eine Geschichte, unbedeutend und entzaubert wie jede Geschichte. So lange bis sie eines – vielleicht nicht letzten, sondern vorletzten – Tages ihren Zauber für einen Augenblick wiedererlangt, mit einem Schlag ihre Enttäuschung einbüßt. Das, was sein Geheimnis verloren hatte, ist jetzt unauflößbar geheimnisvoll und absolut unverfügbar. Das Feuer, von dem nur erzählt werden konnte, das Mysterium, das restlos in einer Geschichte aufgegangen war, entzieht uns jetzt das Wort, verschließt sich für immer in ein Bild.
Mysterium burocraticum
Vielleicht wird das enge, uneingestehbare Verhältnis, in dem das Mysterium der Schuld und das Mysterium der Strafe stehen, nirgends greifbarer als in den Filmaufnahmen des Jerusalemer Eichmann-Prozesses. Da ist zum einen der im Glaskasten sitzende Angeklagte, der nur dann gefasst und ganz bei sich zu sein scheint, wenn er die Kürzel der von ihm geleiteten Dienststellen gewissenhaft aufzählen und die Zahlen oder Akronyme betreffenden Ungenauigkeiten der Anklage berichtigen kann, da ist zum anderen der resolute Auftritt des Oberstaatsanwalts, der den Angeklagten ebenso rechthaberisch mit den bürokratischen Signaturen seines scheinbar unerschöpflichen Aktenstapels einzuschüchtern versucht.
Tatsächlich gibt es – jenseits der Groteske, die den tragischen Dialog der Protagonisten einrahmt – ein Arkanum: Die Dienststelle IV B4, die Eichmann in Berlin leitete, und Beth Hamishpath, das Haus der Gerechtigkeit in Jerusalem, in dem ihm nun der Prozess gemacht wird, entsprechen einander genau, sind gleichsam ein und derselbe Ort, so wie Hausner, der die Anklage führende Staatsanwalt, Eichmanns exakter, auf der anderen Seite des sie aneinanderkettenden Mysteriums stehende Doppelgänger ist. Und beide scheinen sich dessen bewusst gewesen zu sein. Wenn der Prozess, wie einmal behauptet wurde, ein »Mysterium« ist, dann besteht es darin, in einem dichten Netz aus Gesten, Handlungen und Worten Schuld und Strafe unerbittlich zusammenzuzwingen.
Allerdings hat man es weder – wie bei den heidnischen Mysterien – mit dem Mysterium eines wenn auch prekären Heils zu tun noch – wie bei der christlichen Messe, in der laut Honorius von Autun »die Sache zwischen Gott und seinem Volk verhandelt wird« – mit einem Mysterium der Sühne. Das mysterion, das im Haus der Gerechtigkeit abgehalten wird, kennt weder Heil noch Entsühnung, weil der Prozess, gleich wie er ausgeht, selbst die Strafe ist, die das Urteil lediglich verlängert und bestätigt und auch durch einen Freispruch nicht entkräftet werden kann, da dieser lediglich die Anerkenntnis eines non liquet, einer Unzulänglichkeit des Urteils ist. Eichmann, sein unsäglicher Verteidiger Servatius, der finstere Hausner und die Richter in ihren düsteren Roben sind die spitzfindigen Offizianten des letzten Mysteriums, das dem modernen Menschen noch zugänglich ist: kein Mysterium des Bösen in seiner Banalität oder Abgründigkeit (denn es gibt kein Geheimnis des Bösen, sondern nur dessen Schein), sondern eines der Schuld und der Strafe, oder besser ihrer unauflösbaren Verbindung, die wir Urteil nennen.
Dass Eichmann ein Durchschnittsmensch war, bezweifelt mittlerweile niemand mehr. Insofern überrascht es nicht, dass der Polizeibeamte, den die Anklage um jeden Preis als skrupellosen Mörder darzustellen versuchte, ein vorbildlicher Vater und wohlmeinender Bürger war. Doch heute ist es gerade die Geistesverfassung des Durchschnittsmenschen, die der Ethik das größte Rätsel aufgibt. Als Dostojewski und Nietzsche klarwurde, dass Gott tot ist, glaubten sie, daraus folgern zu müssen, dass der Mensch nun zu einem schändlichen Ungeheuer werde, das von nichts und niemandem davon abgehalten werden könne, die abscheulichsten Verbrechen zu begehen. Ihre Prophezeiung hat sich als völlig haltlos erwiesen – und trifft doch in gewisser Weise zu. Denn unzweifelhaft gibt es immer wieder scheinbar gute Jungen, die in Colorado ihre Mitschüler erschießen, und in den Vorstädten der Metropolen kleine Ganoven und große Mörder. Sie bilden jedoch wie zu allen Zeiten und heute in vielleicht noch größerem Maße die Ausnahme, nicht die Regel. Der Durchschnittsmensch hat Gott überlebt, ohne dass es ihm allzu große Schwierigkeiten bereitet hätte, ja er bringt den Gesetzen und gesellschaftlichen Konventionen wider Erwarten größten Respekt entgegen, ist instinktiv geneigt, sie zu befolgen und, zumindest wenn es andere betrifft, schnell dabei, ihre Durchsetzung zu fordern. Mit ihm erfüllt sich die Prophezeiung, der zufolge »alles möglich sei, wenn Gott tot ist«, jedenfalls nicht: Auch ohne den Trost der Religion lebt er vorbildlich weiter, erträgt resigniert ein seines metaphysischen Sinns beraubtes Leben, über das er sich im Übrigen keinerlei Illusionen zu machen scheint.
Insofern gibt es einen Heroismus des Durchschnittsmenschen, eine Art Alltagsmystik: Wie der Mystiker beim Eintritt in die »dunkle Nacht« die Vermögen der Sinne (Nacht des Hörens, Sehens, Fühlens …) und der Seele (Nacht des Erinnerns, des Denkens und des Wollens) eins nach dem anderen eintrübt und abstreift, so entledigt sich auch der moderne Bürger gemeinsam mit diesen und beinahe gedankenlos aller Eigenschaften und Attribute, die das menschliche Dasein definieren und lebbar machen. Deshalb ist ihm das pathos fremd, das Dostojewskis und Nietzsches Figuren des Humanen nach dem Tod Gottes – den Keller- und den Übermenschen – auszeichnete. Und bei allem Respekt für die beiden Propheten scheint ihm nichts selbstverständlicher, als ein Leben zu führen, etsi Deus non daretur