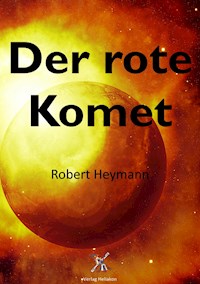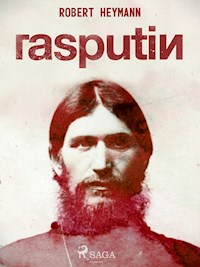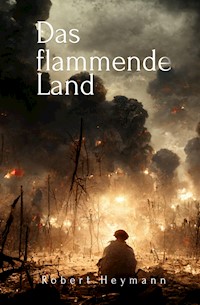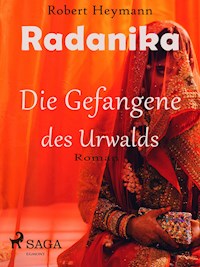Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nach dem Abitur kommt Fritz zurück – das verspricht er Hedwig, Tochter von Pastor Hinrichsen, der ihn in den Ferien auf die Schule vorbereitet hat. Fritz musste das Gymnasium nach dem Tod seines Vaters verlassen und hat jetzt die Möglichkeit, das Abitur nachzuholen. Die Erinnerung an die Nachhilfestunden und die Eroberung von Hedwig beflügeln Fritz: Er wird ein hervorragender Schüler, der das Glück hat, auf einen ganz außergewöhnlichen Pädagogen zu treffen. Professor Glauckner, genannt die Eule, glaubt im Gegensatz zu den strengen Statuten seiner Schule mehr an das Verständnis für Schüler als an Disziplin. Er liebt " seine" Primaner über alles, besonders Fritz. Doch plötzlich verändert sich Fritz, wird frech und aggressiv. Hedwig hat seine Briefe zurückgeschickt, sie wird jemand anderen heiraten. Die letzten zwei Ferienwochen hat ihr schon deutlich älterer Bräutigam als Gast im Pastorenhaushalt verbracht und seitdem um sie geworben. Bisher vergeblich, doch ihr Vater verliert die Pastorenstelle und jetzt muss Hedwig der Vernunft folgen. Bald findet der verzweifelte Fritz heraus, wer der Zukünftige ist: es ist sein geliebter Lehrer – die Eule.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Heymann
Die Eule
Ein Gymnasiasten-Roman
Saga
Die Eule
© 1912 Robert Heymann
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711503508
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1. Kapitel.
Es war schon Abend, als Fritz Rowaldt an seinem Bestimmungsort anlangte, einem kleinen, idyllisch zwischen Bergen gelegenen Dörfchen, wo Pastor Hinrichsen seit mehr als zwanzig Jahren seines Amtes als Seelsorger einer Gemeinde waltete, die ihm mit grösster Liebe anhing. Fritz Rowaldt hatte an den Pastor einen Empfehlungsbrief; er wollte hier in der Stille eine Reihe von Wochen verbringen, um sich für seinen Eintritt in die Oberprima des Gymnasiums vorzubereiten.
Eine kampfesreiche, schwere Zeit lag hinter ihm. Sein Vater war Arzt in einem kleinen, norddeutschen Landstädtchen gewesen, hatte sich für seinen Beruf geopfert und war schliesslich fast ebenso arm gestorben, als er die Praxis begonnen.
Für seine Witwe, die immer noch eine jugendlich schöne Frau war, blieb kaum das Nötigste zurück. Das war eine düstere Zeit damals, als Fritz aus dem Gymnasium nach Hause kam und ahnungslos in das Sterbezimmer seines Vaters geführt wurde. Noch drückender aber wurde das Leid um den Toten, als Frau Rowaldt mit ihrem Sohn die gänzlich veränderten Verhältnisse besprach.
Fritz Rowaldt hatte damals schon vor Jahresfrist das Reifezeugnis zum Einjährigen erlangt gehabt. Ein paar Jahre noch — und die Pforten des Gymnasiums hätten sich hinter ihm geschlossen. Er wollte ja Arzt werden wie sein Vater, dessen rührendes und in seinen Ehrbegriffen fast spartanisches Vorbild eine unauslöschliche Begeisterung gerade für diesen Beruf in ihm wachgerufen.
Da, in dieser traurigen Stimmung eines nebeligen Novembertages, zerrann dieser Traum in nichts, da trat zum erstenmal die unbarmherzige Wirklichkeit in den Kreis der Vorstellungen dieses Jünglings, der bisher vor jeder Enttäuschung bewahrt geblieben war.
Die rasche Art des Entschlusses hatte er von dem Vater geerbt. Er sah ein, dass er unmöglich noch zwei Jahre hindurch seiner Mutter die Last finanzieller Opfer für ihn aufbürden konnte. Im Gegenteil! Sollte nicht die graue Sorge den Lebenskreis dieser Frau verdüstern, die er nicht nur als Mutter zärtlich liebte, der er fast eine scheue Verehrung entgegenbrachte, so musste etwas geschehen, um eine Katastrophe zu verhindern.
Nächte hindurch war damals Fritz Rowaldt, in Nachdenken versunken, wach auf seinem Lager gelegen, bis er sich endlich den schweren Entschluss abgerungen hatte: das Gymnasium zu verlassen, mit allen Kräften zu versuchen, eine Lebensstellung zu erringen, die, mochte sie vorläufig auch noch so gering sein, ihn wenigstens selbständig machte, so dass das Wenige, was die Mutter besass, sie für sich allein aufwenden konnte.
Sie hatte zwar anfangs leidenschaftlichen Widerstand geleistet, aber die Verhältnisse waren stärker — alsbald, nachdem Dr. Rowaldt der Erde gegeben war, verliess sein Sohn das Gymnasium und trat bei einem angesehenen Kaufmann in Darmstadt, wohin Frau Dr. Rowaldt übersiedelte, in die Lehre.
Der Kaufherr Johannes Göbel erfuhr alsbald, wie sich eben in einer kleinen Stadt Ungewöhnliches schnell herumspricht, von dem Schicksal seines Lehrlings, dem er eine besondere Sympathie entgegenbrachte. Einmal in seinem neuen Wirkungskreis, bot Fritz Rowaldt alles auf, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen, und erwarb sich so neben der Achtung auch das besondere Vertrauen seines Chefs, so dass er schon nach Ablauf eines Jahres in der Lage war, seiner Mutter kleine Beträge zu senden.
Er schien sich mit seinem neuen Schicksal ausgesöhnt zu haben; in Wirklichkeit aber hatte er die Veränderung keineswegs überwunden. Er sah voll Bitternis der Zeit entgegen, wo seine ehemaligen Kameraden das Gymnasium verlassen und in ein neues, an Ehren und Würden reiches Leben eintreten würden, dessen Pforten ihm nun verschlossen waren. Der nüchterne Kaufmannsstand sagte ihm nicht zu; seine Ideale liessen sich nimmer zügeln, und obgleich Johannes Göbel alles tat sein Interesse für Zahlen und Geschäfte zu heben, hing Fritz Rowaldts Sehnsucht nach wie vor an dem Verlorenen.
Da trat, nachdem er fast seit zwei Jahren schon das Gymnasium verlassen, eine unerwartete Wendung ein. Ein entfernter Verwandter Frau Dr Rowaldts war in Amerika ohne Nachkommen gestorben, und da sich weitere Anverwandte nicht nachweisen liessen, so fiel das beträchtliche Vermögen der Witwe des Arztes zu.
Fritz Rowaldt war immer von neuem heimlich zu seinen Büchern zurückgekehrt; die plötzliche Veränderung rief wieder den flammenden Wunsch in ihm wach, nachzuholen, was er versäumt, zurückzukehren aufs Gymnasium und, wenn auch etwas später als seine früheren Kameraden, das Maturum zu machen.
Johannes Göbel bedauerte tief, ihn ziehen lassen zu müssen. Doch war er gerecht genug, Rowaldts Entschluss zu billigen. Das grosse Geschäft in Darmstadt war nur eine Zweigniederlage des Hamburger Exporthauses, dem Göbels Bruder vorstand. Der Einfluss der Millionärsfamilie reichte weit; der Fürsprache und der Verwendung seines früheren Chefs hatte Fritz Rowaldt es zu danken, dass er schneller, als er hoffen durfte, wieder im Gymnasium Aufnahme sand, nachdem er sich einige Monate in rastloser Tätigkeit für die Unterprima vorbereitet hatte.
Er zählte nun allerdings nicht mehr zu den Jungen, war ein grosser, schon stattlicher junger Mann von fast zwanzig Jahren, dem überdies die zweijährige Selbständigkeit ein sicheres, unabhängiges Auftreten verliehen.
Er errang sich ein günstiges Abgangszeugnis aus der Unterprima. Nun zeigten sich aber doch die Folgen der Überanstrengung; er bedurste dringend der Erholung, umsomehr, als er sich ja auch gleichzeitig von neuem für die Oberprima vorbereiten musste, sollte sein sehnsüchtiger Wunsch, ohne weiteren Zeitverlust das Maturum zu bestehen, in Erfüllung gehen.
Johannes Göbel, der Kaufherr, war ihm wieder behilflich. Er hatte sich eines alten Freundes aus der Zeit, da er selbst das Gymnasium besucht, erinnert, des Pastors Hinrichsen in F., mit dem er stets in Verbindung geblieben war. Mit diesem hatte er wegen Fritz Rowaldt mehrere Briefe getauscht. Der Pastor erklärte sich mit Vergnügen bereit, die Vorbereitung des jungen Mannes für die Oberprima zu übernehmen, und da die Gegend in ihrer Stille und Schönheit vollauf Gelegenheit zur Erholung und Zurückgezogenheit bot, so war Fritz Rowaldt mit seiner Mutter und dem Kaufherrn übereingekommen, die Ferien dort zu verbringen.
Gegen Abend langte er an seinem Bestimmungsort an. Das Städtchen, in dem Johannes Göbel bereits Zimmer für ihn gemietet, lag etwa eine Wegstunde von Pastor Hinrichsens Behausung entfernt. Fritz verschob seinen ersten Besuch auf den folgenden Morgen. Er stand am offenen Fenster, durch welches die Abendluft den Duft des nahen Waldes trug, reckte die Arme hoch und sah mit brennenden Augen in dieses Meer von Grün. Unter ihm standen glutrote Rosen in vollerblühter Pracht. Schwertlilien, sattfarbige Kinder der Iris, schwellten neben der Germanica-Hybride, die sich mit Farben geschmückt, die an die sinnverwirrenden Orchideen gemahnten. Violett und weiss standen sie zwischen Kränzen sibirischen Mohns, dessen rote Blüten wie Feuerzungen aus der Erde trieben, und über alle Wege hingen schwer und reich, als habe sich das Sonnenlicht in Blüten gefangen, bienenumschwärmte Goldruten. Das Leben lockte um ihn mit reifen Farben wie das hohe Lied der Verheissung. Er liebte die Natur über alles. Da erwachte seine Sehnsucht und flog weit über die Alltäglichkeit hinaus in ein anderes Leben, das ihm schon so nahe stand, in ein Leben der Wunder, ungezählter Erwartungen, stolzer Träume.
Noch ein letztes Hindernis — dann trat er durch das Tor der Verheissung.
Ein strahlender Morgen folgte dem in Schönheit gestorbenen Tage. Da machte sich Fritz auf den Weg zu Pastor Hinrichsen. Als er in das schlicht eingerichtete Studier- und Wohnzimmer des alten Mannes trat, der stets einen langen Bratenrock mit ganz unmöglichen Schössen trug, erblickte er vorerst nichts als einen urväterlichen Schrank mit Büchern und eine lange Pfeife.
Der Pastor ging seinem Besucher entgegen und empfing ihn voll Wärme und Freundlichkeit.
„Ich habe von Ihrem Schicksal gehört, Herr Rowaldt,“ begann er, den Jüngling ohne viel Umschweife auf einen der altmodischen, gepolsterten Sessel nötigend. „Wahrlich, Ihr Geschick hat meine volle Teilnahme gefunden! Wenn Sie sich mir anvertrauen wollen ...“
„Aber, Herr Pfarrer,“ unterbrach ihn Rowaldt lächelnd, „ich muss Ihnen doch mit grösster Dankbarkeit entgegenkommen, wenn Sie sich solche Mühe mit mir machen wollen!“
Der Pastor musterte ihn wohlwollend, sah eine Weile prüfend in das scharf geschnittene, offene Antlitz des Jünglings, lächelte dann vor sich hin und meinte:
„Es gehört ein ungewöhnliches Mass von Energie zu dem Entschluss, den Sie gefasst haben! Und noch mehr: wahre, aufrichtige Liebe zu den Wissenschaften.“
„Die hege ich,“ entgegnete der Jüngling einfach. Der Pastor nahm eine Prise aus der alten, mit Elfenbein verzierten Dose und sah nach der grossen Wanduhr:
„Es ist bereits halb neun, ich muss jetzt meine Kinderchen unterrichten. Wenn Sie um elf Uhr wiederkommen wollten, Herr Rowaldt, könnten wir gleich heute mit dein Studium beginnen.“
„Gut, Herr Pastor, ich bin völlig einverstanden.“
„Also — dann auf Wiedersehen. Übrigens ..“ Hinrichsen hielt den Jüngling, der schon an der Tür stand, fest, „haben Sie meine Tochter schon gesehen?“
„Nein, Herr Pastor.“
„Aber da muss ich gleich — nein, so eine Vergesslichkeit! — Hedi! Hedi!“ rief er in den Gang hinaus.
„Väterchen?“ klang es zurück.
„Komm einmal herein, mein Herzchen, binde aber Deine weisse Schürze um und stecke Dein Haar auf!“
Man hörte im Nebenzimmer ein paar Tassen klappern, dann einen leichten graziösen Schritt, und unter dem Türrahmen erschien Hedwig.
„Hier stelle ich Dir unseren neuen Hausfreund vor ... meinen Herrn Studiosus Fritz Rowaldt,“ sagte der Alte lächelnd und deutete auf den Gymnasiasten, der sich leicht verneigte. „Dies hier, Herr Rowaldt, ist Hedwig, die Tochter meiner verstorbenen Frau, die mein Hauswesen führt und mich auf meine alten Tage mit Leckereien traktiert.“
„Aber Vater!“ verwies sie ihn lächelnd, den Fremden mit einem flüchtigen Seitenblick streifend. Dann trat sie auf ihn zu, reichte ihm die schmale Hand und sagte leise:
„Seien Sie willkommen!“
„Ich danke, gnädiges Fräulein!“
Er wollte einige Worte hinzufügen, aber sie hatte ihm schon ihre Hand entzogen und war im Nebenzimmer verschwunden.
Mit einem Blick hatte er ihre Schönheit umfasst: schlanke Glieder, rehbraune Augen, die wohl etwas dunkler erschienen, als sie waren, und schweres, blondes Haar, beinahe brennend. Der pikante, helle Ton ihres Gesichtes, dem zartes Rot auf beiden Wangen gesunde Frische verlieh, ward durch die Spitzenkrause noch gehoben, während die grosse, weisse Schürze ihre Gestalt appetitlich und reizend umrahmte.
Als er die Tür öffnete, um ins Freie zu gelangen, steckte Hedwig ihr Köpfchen durch den Türspalt.
„Speist der Herr bei uns?“ fragte sie, während ihre vollen, kirschroten Lippen sich leicht öffneten.
„Natürlich, mein Herzchen,“ warf der Pastor ein, der sich eben den gefährlich aussehenden Zylinder aufs Haupt stülpte.
„Also, dann auf Wiedersehen,“ lächelte sie schalkhaft und verschwand.
Fritz ging die Landstrasse entlang. Die Höhen hatten sich in einen leichten Dunst gehüllt, der feiner als ein Brautschleier war und Weinberge und Burgruinen in bläulichen Nebel sinken liess. Er ging wie im Traume und dachte immerfort an das liebliche Mädchen.
Wieder tauchte vor ihm ihre schlanke Figur auf; er sah die wunderbaren, brennenden Flechten, die sie über dem Nacken zu einem schlanken Knoten geflochten hatte. Er musste an den schmalen, blendend weissen Hals und die feine, leidenschaftliche Linie um ihre Mundwinkel denken.
„Seltsam,“ dachte er und blieb tief aufatmend stehen. „Ist es nicht wie ein Wunder, diese keusche Mädchenblüte in dieser weltverlorenen Einsamkeit?“
Er hatte bisher keine Zeit gefunden, sich mit Frauen zu beschäftigen. Als er das Gymnasium verlassen, war er zu jung gewesen, um ähnlichen Gedanken nachzuhängen. In der Folgezeit hatte ihn der Ernst des Lebens ganz beansprucht.
Er lächelte mit leisem Spott über sich selbst, als er daran dachte, dass er doch bloss ein Gymnasiast war ... mit zwanzig Jahren allerdings, einer, der dem Milieu schon entwachsen war!
Um elf Uhr fand er sich wieder bei Pastor Hinrichsen ein. Der Alte sass bereits am Tisch.
„Ich denke, wir nehmen gleich Sophokles vor,“ begann er, ganz geschäftig, dabei gemütlich über die Brillengläser schielend.
Fritz vertiefte sich sogleich in den Unterricht. Aber jeden Moment ertappte er sich selbst, wie er das Auge nach der gegenüberliegenden Tür richtete, doch nur in der Hoffnung, Hedwig zu sehen.
Aber er hörte nur die Tassen klappern und ein leises Singen wie Vogelgezwitscher.
Indes verbreitete sich Pfarrer Hinrichsen über Inhalt und Bedeutung der Dramen, über Sophokles als Tragödiendichter überhaupt, über die Harmonie seiner Charaktere....
Pastor Hinrichsen hatte nichts von dem Schwung, den die Begeisterung verleiht. Er lehrte in einem schwerfälligen, dogmatischen Ton. Der Jüngling aber dachte an seinen Ordinarius, Professor Glaukner, dem sie alle, die Wissensdurstigen wie die Gleichgültigen, in derselben Liebe anhingen. Wie ganz anders wusste der über Sophokles zu reden!
Im Geiste des Primaners erstand das Bildnis des Sohnes des Sophillus, wie er, ein schöner, wohlgestalteter Jüngling, ausgezeichnet durch seltene Anmut der Bewegungen, durch klassische Mienen und ein stolzes, schönheitsfrohes Auge, durch die Strassen Athens schritt, zum Opfer ging oder die attischen Fluren auf schnaubendem Rosse durchstreifte.
Wie er bei Salamis unter den vordersten Schiffen gegen die persischen Räuberscharen gekämpft, wie er, als der Jubel des Sieges ganz Attika berauschte, den Reigentanz der Jünglinge angeführt. Wie er ein Meister in allen Künsten des Leibes war, ebenso wie ein begnadeter Jünger der Pallas Athene.
So hatte Professor Glaukner seinen Schülern Sophokles nahe gebracht, ehe er die Werke des Dichters heranzog, um die Kenntnisse der griechischen Sprachformen ihnen zu stählen.
Nicht jeder, ach, wenige besassen die Kunst, die Jugend und ihren Durst nach Schönheit, ihre Auffassungsgabe so zu verstehen, wie Ewald Glaukner, den seine Schüler ohne schlimme Absicht kurzweg „Die Eule“ nannten. Einmal, weil das Sinnbild Athens, glaux, die Eule, sie durch Anklingung des Namens Glaukner dazu verführte, dann aber, weil der Professor selbst an dieses Symbol der Gelehrsamkeit in jeder Weise erinnerte. Auf breiten Schultern sass ihm ein mächtiger Kopf mit scharf geschnittener Nase, schmalen Lippen und tief in ihre Höhlen zurückgefallenen Augen.
Über der hohen Stirn trug er das Haar wie Federn zurückgelegt, und so erinnerte sein Antlitz tatsächlich an das Sinnbild Athenes. Wenn aber seine Augen in Begeisterung glänzten, dann war es wiederum, als sähe man in einer Eule wechselnde Pupillen, die bald hell aufblickten in der Finsternis, bald dunkel und schwarz wurden vor dem störenden Licht des Tages.
Solcherlei Gedanken durchzuckten Fritz Rowaldt. Kein Wunder, dass er auf die Frage seines Lehrers zerstreute Antworten gab und seine Geduld auf eine harte Probe stellte. Pastor Hinrichsen verfügte eben nur über schematische Gelehrsamkeit. Fritz Rowaldt aber sah das Altertum mit anderen Augen, wollte es nur mit anderen Augen sehen, lebte ein Stück eigenes Leben in der Antike, von der Professor Glaukner einmal sagte:
„In keiner Epoche der Weltgeschichte hat der Mensch die Schönheit des Lebens in so unbegrenzter Liebe genossen als in diesem Zeitalter. Denn es war im wahren Sinne eine Kultur der Liebe.“
Wie Flammen lebten die Worte in der Brust des Gymnasiasten. Eben darum machte er die gewaltigsten Anstrengungen, die Schwierigkeiten der griechischen Sprache völlig zu überwinden, um der Schönheit ihrer Zeit teilhaftig zu werden.
„Na, Herr Rowaldt, ich meine bald, Sie träumen?“ fragte Pastor Hinrichsen und sah seinem Schüler verblüfft ins Gesicht.
Der fuhr aus seinem Sinnen auf. Aber die Uhr schlug eben ächzend zwölf und enthob ihn so der Antwort.
Hedwig steckte den Kopf durch die Tür:
„Darf ich decken?“
Pastor Hinrichsen blieb in seinem Vortrag stecken, sah sich um und beeilte sich, zu sagen:
„Gewiss, mein Täubchen!“
Fritz Rowaldt sass noch am Tisch und sah zu ihr auf, wie sie ein grosses Tischtuch, Teller und Bestecke in die Stube trug.
Aber sie warf nur einen forschenden Seitenblick nach ihm, während sie geschickt und voll reizender Bewegungen den Tisch deckte. Sie war wohl etwas jünger als Fritz Rowaldt; sie mochte achtzehn Jahre zählen, war aber aufgeschossen und kräftig und konnte wohl für älter gelten. Während der Mahlzeit sass sie schweigsam. Der Pastor plauderte über die alten Griechen und ihre Lehrer; Fritz Rowaldt aber war ein unaufmerksamer Zuhörer. Entweder hielt er den Blick auf seinen Teller gebannt oder er sah zu Hedwig hinüber. Sie sass am liebsten das Gesicht dem Fenster zugewandt, wo sich ihr Blick über die prangenden Wiesen hinweg weit in der Ferne verlor.
Aus einigen Worten, die sie in das Gespräch hineinwarf, merkte Fritz Rowaldt, dass ihr das Gebiet des Altertums nicht fremd war. Sie hatte die klassischen Dichter ohne Ausnahme gelesen, ja, sie verriet ein ganz ungewöhnliches Verständnis für die Kultur der Antike, dass Rowaldt sie mehr als einmal erstaunt anblickte.
Nach Tisch hielt Hinrichsen sein gewohntes Schläfchen, Hedwig verschwand und der Gymnasiast ging in den Garten.
Seltsam, dachte er. Alle jungen Mädchen sind sonst ausgelassen und lachen viel. Er hatte Hedwig noch nicht lachen hören. Er sah sie auch die folgenden Tage nicht lachen. Sie blieb immer ernst und gemessen, war auch viel sicherer in ihrem Benehmen als Fritz. Der war plötzlich von einer namenlosen Unruhe ergriffen worden. Umsonst nahm er früh morgens die Bücher vor, stützte den Kopf zwischen die Fäuste und versuchte, zu arbeiten.
Es ging nicht, es wollte nicht gelingen! Die Gedanken flatterten nach allen Seiten auseinander, bis er schliesslich die Scharteken in eine Ecke warf und das Haus verliess, die Höhen hinaufstieg, der Sehnsucht nach, die immer in ihm lebte, die ihn nicht mehr verliess, seitdem er hierher gekommen war, eine grosse, gewaltige, unfassbare Sehnsucht, deren dunkle Stimme er noch nicht völlig begriff.
Einige Tage lang kam er gar nicht mehr zu Pastor Hinrichsen. Dieser war sehr beschäftigt und hatte für ihn keine Zeit. Hedwig aber allein aufzusuchen, hielt Rowaldt nicht für schicklich und wagte es auch nicht.
Hinrichsen hatte Besuch aus Berlin bekommen. In einem leichten Wägelchen war spät abends ein beleibter Herr vorgefahren, der sofort das grösste Interesse der Bewohner des Dorfes erregte, nicht allein, weil er als Gast des Pastors in dessen Hause wohnte, sondern weil er direkt aus Berlin gekommen war und zweifellos unter die Millionäre gezählt werden musste. Auf der weissen Weste hing eine schwere goldene Kette, an den Fingern blitzten Brillanten. Sein Gesicht war breit, die Stirn niedrig, das dunkle Haar in der Mitte gescheitelt und kurz geschnitten. Die unruhigen, kleinen Augen verschwanden fast hinter dem Fett, das dick aufgetragen, seinem Gesicht etwas Verschwommenes gab, das die Charakterisierung erschwerte.
Pastor Hinrichsen schien ebenso erfreut wie erschrocken zu sein, als der Fremde anlangte. Hedwig konnte nicht schnell genug für einen Imbiss sorgen, und bald schloss sich Hinrichsen mit Romeo Markwald er ein.
„Sie haben mich ordentlich überrascht — es ist doch nichts Schlimmes vorgefallen?“
„Im Gegenteil, lieber Pastor, im Gegenteil! Mon dieu — da sagt man, wir Grossstadtmenschen hätten schlechte Nerven! Mut! Mut und Ruhe, alter Freund!“
Der Pastor kniff ein wenig die Lippen zusammen bei dieser vertraulichen Anrede. Er räusperte sich:
„Hm! Also kein Kurssturz? Kein Papier zurückgegangen?“
„Nee! Einhundertvierzig!“
„Um neunzig haben Sie gekauft?“
„Um neunzig. Aber ich sage Ihnen, sie steigen noch auf zweihundert ...“
„Vielleicht sollte man doch jetzt verkaufen, Herr Markwalder! Der Betrag ist gross genug!“
„Verkaufen? Pastor, sind Sie von Sinnen? Wenn die Papiere zweihundertzwanzig stehen, verkaufen wir, keinen Tag früher!“
Pastor Hinrichsen wischte mit dem Taschentuch über die Brille. Zweihundertzwanzig!
Und so schnell es ihm bei seiner Schwerfälligkeit möglich wurde, berechnete er den Gewinn. Zehntausend Mark betrug sein Vermögen. Das war ein eisernes Kapital, das für Hedwig reserviert war, wovon er nichts verlieren wollte. Es war auch nicht nötig, dass sie mehr bekam — aber was darüber ging, das gehörte seiner Gemeinde. Seit sieben Jahren wurde gesammelt und gespart — eine Lotterie zugunsten des neuen Kirchenbaues hatte ein kleines Stammkapital ergeben — um an Stelle der schon hundertfünfzig Jahre alten Kirche eine neue zu errichten.
Schon als Pastor Hinrichsen sein Amt angetreten, hatte ihm sein Vorgänger sozusagen als heiliges Vermächtnis den Plan einer neuen Kirche hinterlassen. Der junge Pastor hatte die Idee mit Feuereifer aufgenommen, war aber über zehn Jahre nicht in der Lage gewesen, Tatkräftiges dafür zu tun.
Seit sieben Jahren nun sollte die Kirche begonnen werden, aber die Gemeinde war arm, Missernten, Schädlinge in den Weingeländen hatten ihr mehrere Jahre nacheinander grossen Schaden zugefügt. Und doch musste ein neues Gotteshaus gebaut werden!
Hinrichsen träumte davon Jahr um Jahr. Er besass einiges Talent zum Zeichnen — in früher Jugend war er zum Architekten bestimmt gewesen — und hatte in seinen Mussestunden daher schon die Pläne entworfen. Er sah den Turm vor sich, den neuen Turm mit der alten Glocke, deren Klänge seiner Gemeinde vertraut waren seit Generationen. Er sah die weissen Wände der Kirche mit den grossen, langen Fenstern, den neuen Altar, den Chor und die neue Orgel — denn eine neue Orgel war nötig, das stand fest. Pastor Hinrichsen war, wie gesagt, im allgemeinen ein wenig schwerfällig und kein rasch zugreifender Mensch. Woran er aber einmal festhielt, davon brachte ihn niemand mehr ab. Er war auch zurückhaltend; doch für zweierlei scheute er keinen Gang, keine Anstrengung, selbst dann und wann eine kleine Demütigung nicht: wenn es seinen Armen oder seiner Kirche galt.
Vor zwei Jahren hatte Romeo Markwalder in dem nahe gelegenen Flecken mit seiner Familie den Sommer verbracht, und bei dieser Gelegenheit hatte Pastor Hinrichsen den Berliner Bankier, der fast täglich mit dem Automobil durch das Dorf gerast war, kennen gelernt. Da hatte er sich einmal ein Herz gefasst und ihm von dem Projekt der neuen Kirche gesprochen. Romeo Markwalder hatte zweitausend Mark gespendet und dann dem dankbar aufhorchenden Pfarrer gesagt:
„So kommen Sie Ihr Lebtag nicht ans Ziel, Herr Pastor! Sie mühen sich ab und mühen sich ab, die Gemeinde ist arm, die Zuschüsse reichen nicht — Sie müssen das Geld für den guten Zweck arbeiten lassen!“
„Wie das, Herr Bankier?“
„Legen Sie das Kapital, das bis jetzt für die Kirche gesammelt wurde und das Sie verwalten, in meinem Bankhause an, lassen Sie das Geld zu sieben Prozent — was sage ich! Sie können es auf zehn, fünfzehn, zwanzig Prozent bringen — in meinem Hause arbeiten, und Sie sollen sehen — in fünf Jahren können Sie mit dem Kirchenbau beginnen!“
Pastor Hinrichsen verstand von Geldgeschäften und Spekulationen ungefähr ebenso viel wie Bankier Markwalder von dem Beruf des Pastors.
Ein Unterschied war da freilich: Bankier Markwalder war sich über die Pflichten Hinrichsens wohl klar, aber auch über einen Fehler, den er besass: er wollte nie die schlechten Seiten der Menschen sehen. Erkannte er sie, so täuschte er sich geflissentlich darüber, und so kam er auch gar nicht auf den Gedanken, der Berliner Bankier könnte mit seinen Vorschlägen persönliche Vorteile verfolgen.
Seit zwanzig Jahren war Hinrichsen kaum über die Gemarkung seiner Gemeinde hinausgekommen. Die Zeitungen, die er las, brachten wenig oder nichts von dem gewaltigen Wettkampf, der dort draussen im Reich, in dem grossen Berlin unter ungeheurer Anstrengung aller Kräfte tobte. Er wusste nichts von dem Spekulantentum und Gründerwesen. Er sah nur die Erfüllung seines zwanzigjährigen Traumes: die neue Kirche!
Er sagte damals:
„Herr Markwalder, über das Geld, das meine Gemeinde mir anvertraut hat, darf ich, so gut und schön der Zweck auch ist, nicht nach Belieben verfügen. Aber ich selbst besitze zehntausend Mark. Das Geld ist teils ererbt, teils haben ich und meine selige Frau es in mancherlei Entbehrungen für unsere Tochter Hedwig erspart. Diese zehntausend Mark müssen dem Kinde erhalten bleiben. Was Sie aber damit verdienen können — wenn Sie wirklich so schön an unserer Gemeinde handeln wollen — das möchte ich zu dem Kapital legen, das für den Kirchbau bestimmt ist.“
Romeo Markwalder hatte die Unterlippen vorgeschoben und den Kopf gewiegt. Dann hatte er mit seinen kleinen, forschenden Augen, die die Menschen zu durchdringen schienen, den Pfarrer angesehen und schliesslich gesagt:
„Gut, Herr Pastor! Wir sprechen später noch darüber!“
Das war vor zwei Jahren gewesen. Romeo Markwalder hatte mit diesem Gelde, wie mit allen Einlagen seiner Kunden, waghalsig spekuliert. Mit Glück spekuliert, denn er zahlte fünfzehn, manchmal siebzehn Prozent, ja, er stellte mehr in Aussicht. Dass er nebenbei verlor, dass manche seiner Unternehmungen missglückten und dass die Kapitalien, aus denen er teilweise diese hohen Zinsen bezahlte, langsam verschwanden, darum wusste natürlich niemand.
Pastor Hinrichsen hatte nicht einmal die Zinsen genommen. Er begnügte sich mit den Abrechnungen und schrieb jedes Jahr nach Berlin:
„Legen Sie das Eine zum Anderen.“
In ein paar Jahren würde sich das Geld verdoppelt haben. Dann konnte Markwalder schon mit Zwanzigtausend operieren. In Pastor Hinrichsens Phantasie wuchsen die Zahlen schneller noch, als der gewagteste Zinsfuss sie vermehren konnte, und immer näher rückte die Erfüllung seines heissen Wunsches: die neue Kirche. Da kam nun Romeo Markwalder plötzlich ganz unangemeldet angereist. Gott sei Dank, es war also nichts zu befürchten. Denn heimlich fürchtete Pastor Hinrichsen manchmal doch, es könnte mit den Abrechnungen Romeo Markwalders nicht ganz seine Richtigkeit haben. Nicht, dass er auf den Gedanken gekommen wäre, der Bankier könnte ihn absichtlich betrügen.
Aber er konnte sich doch täuschen! Es konnten Ereignisse eintreten, die stärker waren als er.
Romeo Markwalder aber war bester Laune. Er goss sich schon von der zweiten Flasche Wein ein.
Sein Gesicht war gerötet. Dass seine unruhigen Augen noch ruheloser geworden waren, entging Hinrichsen.
„Wissen Sie, Pastor, dass wir nun über Nacht reich werden können?“
Seine Augen hatten einen fieberhaften Glanz. Der Pfarrer lächelte.
„Wirklich?“
„Wirklich — das sagen Sie, Pastor Hinrichsen, als ob es sich rein um nichts handelte!“
„Was hätte ich davon, wenn ich reich wäre, Herr Markwalder? Meine Gemeinde würde mir dann eher misstrauen, als nach wie vor ihre Zuneigung bewahren. Ich vertrete Gott und bin bemüht, den göttlichen Gedanken meiner Gemeinde zu übermitteln, ihn wach zu halten Jahr um Jahr. Was sollte mir dabei der Reichtum?“
Romeo Markwalder blinzelte listig:
„Aber die Kirche, Herr Pastor!“
„Ja, die Kirche!“
Pastor Hinrichsen legte die Hände ineinander, schloss ein wenig die Augen und lehnte sich in seinem Sessel zurück.
Die neue Kirche!
Romeo Markwalder fuhr rasch fort: