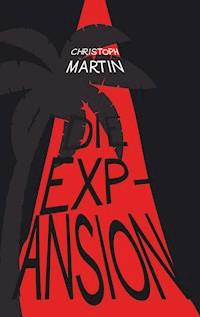
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der Politik und in der Wirtschaft ist die Wahrheit eine Ermessensfrage. Für Max Burns ist ein Traum wahr geworden: Als Chefingenieur ist er für das Konzept und die Überwachung eines der größten Bauprojekte des 21. Jahrhunderts zuständig, die Erweiterung des Panamakanals. Ihre Tarnidentität am Smithsonian Tropical Research Institute erlaubt es Agentin Karis Deen das Bauprojekt rund um den Panamakanal im Blick zu behalten. Denn in der Welt des internationalen Handels und der Diplomatie sind die Einsätze hoch und es wird nicht immer fair gespielt. Bald gerät Max in ein Netz aus Intrigen und Verrat, das weit über die idyllischen Ufer Mittelamerikas hinausreicht. Seine einzige Verbündete scheint Karis zu sein, aber kann er ihr trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das für dieses Buch eingesetzte Papier ist ein Produkt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
»Sei umsichtig bis zur Formlosigkeit.
Sei geheimnisvoll bis zur Geräuschlosigkeit.
Nur so kannst du das Schicksal
deines Gegners bestimmen.«
Sunzi, Die Kunst des Krieges
Inhaltsverzeichnis
Prolog I
Prolog II
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil II
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Teil III
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Teil IV
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Teil V
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
PROLOG I
Landsitz der Burns, Surrey, England, Januar 1993
Sie war schon immer eine Schönheit gewesen. Schon als junge Frau, schon vor den Diamanten und Designerhandtaschen. Schon bevor sie das eng anliegende Polyester von der Stange ablegte und sich von ihm langsam und liebevoll in Seide kleiden ließ.
Als er sich an diesem Winterabend zu ihr durchkämpfte, durch das Gedränge von Champagnergläsern und Anzügen, bemerkte er in den Augen seiner Frau die gleiche, starke Zuwendung, die ihn - und so viele andere – vor all den Jahren zu ihr hingezogen hatte. Denn Helen Burns sah die Menschen – sie sah sie wirklich. So wie sie ihn gesehen hatte. Und sein Vermögen.
Ihre beeindruckende Fähigkeit, Gelegenheiten wahrzunehmen, war der Grund dafür, dass aus seinem bereits eindrucksvollen Vermögen Reichtum geworden war, und zwar für ihn und alle vom Schicksal bestimmten Personen, die sich in ihre Umlaufbahn verirrt hatten.
»Liebling, du wirst nicht glauben, wen ich gestern Abend getroffen habe. Das war wohl Schicksal ...«, pflegte sie zu sagen.
Edward Burns spürte einen schmerzenden Stich in der Brust, als er vor ihr stand.
»Ed, was ist? Stimmt etwas nicht?« Sie musste ihn gesehen haben, denn jetzt stand sie neben ihm.
»Wir müssen hier raus!« Er packte sie am Arm.
Sie zog ihn zurück. »Wieso?«
»Helen, wenn wir jetzt nicht gehen ...«
»Wovon redest du? Wir können doch nicht einfach während unserer eigenen Party gehen ...«
»Garcia wurde verhaftet!«
»Rupert Garcia ...?« Sie erstarrte. Ihr Blick wanderte über die gläsern glitzernde Weihnachtsbeleuchtung und das wirbelnde Durcheinander von Gelächter und Gesichtern, so als ob sie alles zum ersten Mal sähe. Dann sah sie ihn wieder an. »Verdammt!«
Er bemerkte, wie sich ihre Kiefermuskeln anspannten.
»Wir müssen das klären, Ed«, zischte sie. »Sofort!«
Sie winkte die Hausangestellten heran, gab Anweisungen und im nächsten Augenblick liefen sie bereits durch das Marmorfoyer ihres Hauses hinaus auf die Kieseinfahrt, vorbei an Misteln und Efeu, der die Steinsäulen hinaufkletterte, auf das mit Frost überzogene Gelände des imposanten Burns-Anwesens.
Als sich die Kufen ihres Robinson-R44-Hubschraubers in den Nachthimmel erhoben, hatte sie bereits ihren Anwalt angerufen.
»Wir sind unterwegs nach London«, hatte sie gesagt, während sie sich anschnallte. Die Rotorblätter des Helikopters dröhnten und schaufelten sich durch die eisige Luft. Schnell gewannen sie an Höhe.
Gekonnt steuerte Ed den Helikopter über die Baumwipfel. »Ich habe Vorkehrungen für Max getroffen.« Er sprach in das Mikrofon seines Headsets.
»Was für Vorkehrungen?« Helens Stimme erklang in seinem Kopfhörer.
»Er kommt nächste Woche nach England zurück, um bei Alan zu wohnen ...«
»Bei Alan?! Bist du wahnsinnig? Ich lasse meinen Sohn doch nicht in einem Wohnblock leben! Du weißt ja, wie es dort ist...«
»Es reicht, Helen! Du hörst mir nicht zu! Es ist vorbei! Wir haben keine Wahl mehr. Gegen uns liegt ein Haftbefehl vor.« Er sah auf die durchdringende Dunkelheit unter ihnen – die Wälder von Surrey, wie er wusste –, und ihm wurde übel. Es gab keinen Ausweg mehr.
»Aber wir sind es doch, Ed, du und ich. Wir werden es schaffen, so wie immer.«
»Nur dieses Mal geht es nicht um uns, richtig? Es geht um all die anderen, die du überzeugt hast, in Ruperts blödes Vorhaben zu investieren! Alle unsere Freunde, Helen!«
»Ich konnte doch nicht wissen ...«
»Nein!« Er schnitt ihr das Wort ab. »Du wusstest genau, was du tust.« Er sah sie an. Leere machte sich in ihm breit. »Alles, was ich getan habe, habe ich für dich getan. Ich habe dich immer so sehr geliebt. Und ich liebe dich noch.«
Sie sagte nichts.
»Aber alles, was wir haben ... Das war nicht genug für dich. Nie war es genug.«
Noch immer schwieg Helen.
Sie hatten eine Flughöhe von dreitausend Fuß erreicht. Dann fanden seine Finger, was sie suchten: die glatte Kunststoffkappe, die die Leerlaufabschaltung des Motors verdeckte. Es würde schnell gehen.
Benommen wandte er sich zu seiner Frau. Sie hielt die Hand vor den Mund und er hörte sie schluchzen. In der Dunkelheit hatten die Diamanten um ihren Hals ihr Feuer verloren. »Es ist das Beste. Ich kann nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken«, sagte er. »Max wird neu anfangen können. Ich hoffe, er wird mir eines Tages verzeihen ...«
»Nein!«, kreischte sie und warf sich verzweifelt in ihrem Sitz hin und her. Mit einer Hand hielt sie sich an der Fensterscheibe fest und schaute hinunter auf die Lichtpunkte ihres immer kleiner werdenden Zuhauses.
Mit letzter Kraft griff Edward Burns nach seiner Frau. Er zog sie an sich und umarmte sie fest. Dann öffnete er das Ventil. Als der Motor ausging, kämpfte sie in seiner Umklammerung. Aber es dauerte nur einen Moment, bis das Verdeck abriss, von den kreischenden Rotorblättern abgetrennt, und der Sog sie umfasste und sie taumelnd in Richtung Boden zog.
Helen und Edward Burns spürten nichts, als der Hubschrauber auf den Boden krachte.
PROLOG II
Zuoz, Engadin, Schweiz
Der sechzehnjährige Max Burns schleifte seinen Koffer über das vereiste Kopfsteinpflaster und trottete zu dem steinernen Wassertrog oben auf der Anhöhe. Der alte Brunnen war bereits vor Monaten eingefroren, aber Max kannte niemanden, der ihn vor dem späten Frühjahr brauchen würde, wenn es im Tal taute.
Sein Klassenkamerad, Godfredo Roco, hatte seinen Koffer in einer Schneewehe in der Nähe liegen gelassen und sich auf den Rand des Steinbeckens gesetzt. Trotz eines beeindruckenden Veilchens, das sein linkes Auge zierte, sah Godfredo auf klassische Weise gut aus. Er hielt eine dicke, teure Zigarre zwischen den behandschuhten Fingern. Diese und einige andere hatte er sich aus der Sammlung seines Vaters genommen, um sie bis zu seinem Geburtstag aufzuheben. Doch bereits nach ein paar Schlucken aus der mitgeschmuggelten Schnapsflasche während der vierstündige Zugfahrt von Zürich nach Zuoz war er ausgestiegen und hatte verkündet: »Scheiß drauf. Jetzt passt es genauso gut wie irgendwann sonst«, und sich genüsslich eine angesteckt.
Max ließ sich neben seinen Freund sinken und zog seine Strickmütze vom Kopf. Mit einer Hand fuhr er sich durch die blonden, ständig zerzausten Haare und blickte auf das schmucke Dorf unter ihnen. Dessen enge, gepflasterte Straßen waren Hunderte von Jahren vor dem ersten Röhren eines Automotors entstanden, und auf den adretten Dächern, die wie aus einem Märchenbuch entsprungen aussahen, türmte sich der Schnee. Die funkelnde Weihnachtsbeleuchtung markierte Regenrinnen und Schornsteine, und die Rauchfahnen der Holzöfen hingen tief über dem Tal.
Max zeigte hinauf zu dem höchsten Berggipfel, der sich im Mondschein klar erkennen ließ. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er an seinem Arm entlang. »Ich glaube, letzte Woche bin ich mit dem Helikopter so hoch geflogen«, lallte er. Seine Worte kamen langsam und bedächtig wegen des Alkohols und der eisigen Luft an seinen Lippen. »Du hättest das Gesicht meines Vaters sehen sollen, Fredo!«, fuhr er fort. Er ließ seinen Arm in seinen Schoß sinken und wandte sich seinem Freund zu. »Er hatte wirklich Schiss, weil ich zum ersten Mal allein dort oben im Heli war ... Aber gleichzeitig war er verdammt stolz.« Seufzend legte er einen Arm über Godfredos Schulter. »Ich mag das, verdammt noch mal, weißt du? Ich mag ihn, verdammt noch mal.« Er hickste. »Er bringt mich immer dazu, an meine Grenzen zu gehen.« Er hickste wieder, seine Worte waren leicht gelallt. Schließlich lachte er. »'tschuldigung.«
Er bekam keine Antwort und vernahm nur das pulsierende, orangefarbene Leuchten, als Godfredo zum wiederholten Male an der Zigarre zog.
Max ließ seinen Freund los und boxte ihn spielerisch in den Oberarm. »Du hättest deinen Vater fragen sollen, ob er dir ein paar Flugstunden erlaubt«, sagte er und dachte an den Adrenalinschub, als sich sein englischer Landsitz unter ihm immer weiter entfernt hatte. »Im Ernst, Fredo, du wärst begeistert. Mit einer Hand hältst du den Blattverstellhebel ...« Er schloss die Augen. »Dann ziehst du am Steuerknüppel ...«
Godfredo unterbrach ihn. »Halt die Klappe, Mann! Meinst du wirklich, mein Vater würde mir an einem ruhigen Sonntagnachmittag dabei zusehen, wie ich einen verdammten Helikopter fliege?«
Es klang nicht bitter, aber als sich sein Freund zu ihm wandte, sah Max sein gezwungenes Lächeln. Er stellte sich Godfredos strengen Vater, Paco Roco, dabei vor, wie er seine Freizeit mit ihm verbrachte. Mit den unzähligen leicht bekleideten heißen Frauen auf irgendwelchen Jachten. Oder während er sich bei einem internationalen Pferderennen die Lunge aus dem Leib brüllte. »Okay, vielleicht nicht ...«
»Das siehst du verdammt richtig!« Godfredos Lachen war spröde. Er hielt Max die Zigarre hin. »Hier, Hermano.« Er nannte seinen Freund oft so, und in seine Stimme schlich sich dann ein leichter Singsang, ein Rest seiner argentinisch-spanischen Muttersprache, obwohl er schon seit fast zehn Jahren mit seinem Vater in England lebte.
Max nahm die Zigarre entgegen und inspizierte das Etikett. »Weißt du, Fredo, wenn ich nicht so scheißbetrunken wäre, würde ich deinen Vater anrufen.«
»Ja?« Godfredo ließ seinen Blick über das Tal schweifen.
»Ja. Würd' ich, verdammt noch mal. Und ich würd' ihm sagen, er soll aufhören, dich zu schlagen.«
Sofort wanderte Godfredos Blick zurück zu Max. »Er meint es nicht so.«
Max schüttelte den Kopf. »Alter, ehrlich. Dein Vater ist ein komplettes Arschloch.« Er sah Godfredos Faust erst in dem Moment kommen, als sie in seinen Magen stieß. Augenblicklich krümmte er sich vor Schmerzen. Er hatte die Zigarre fallen lassen, deren Glut nun davonstob wie Sternschnuppen.
Inzwischen war Godfredo aufgestanden und zeigte mit einem Finger auf Max. »Ich darf sagen, dass er ein Arschloch ist. Du nicht.«
Eine Sekunde später kämpften die beiden Jungen mit allem, was dazugehörte: rechter Haken, Schwitzkasten ... Sie wanden sich, ihre Gliedmaßen verhedderten sich und sie landeten hart auf dem eisigen Schnee.
Godfredo entkam Max' Griff und stürzte zu seinem Koffer.
Langsam hob Max den Kopf. Er sah, wie Godfredo wegging, sich dann blitzschnell umdrehte, zu ihm zurückkam und schließlich auf Armlänge mit zusammengepressten Lippen vor ihm stehen blieb. »Weißt du, manchmal hasse ich verdammt noch mal meinen Vater. Mehr als mein eigenes Leben.« Er hielt inne. »Aber er ist der Einzige, ich habe nur den einen. Verstehst du das?«
Bevor Max sich entschuldigen konnte, war Godfredo allein losgegangen und stieg das letzte, steile Stück Straße zu ihrem Internat in den Alpen hinauf.
Als Max sich den lachsfarben verputzten Schulgebäuden näherte, die zu dem exklusiven Schulgelände gehörten, blickte er hinauf. Die wie immer zuverlässige Uhr auf dem gedrungenen Glockenturm sagte ihm, dass es bald Mitternacht war. Er stapfte durch den frisch gefallenen Schnee und folgte Godfredos Spur vorbei an dem einsamen Tannenbaum, der mitten auf dem Schulhof stand. Seine Zweige waren mit silbernen Christbaumkugeln geschmückt.
Er schleifte seinen Koffer in das Gebäude. Die Eingangshalle war warm und hell erleuchtet, und es roch noch nach Abendessen. Es hatte gebratenes Fleisch mit Gemüse gegeben – für alle, die rechtzeitig zurück in der Schule gewesen waren.
Mit gesenktem Blick stampfte er auf, um seine Stiefel vom Schnee zu befreien, wobei er hoffte, dass es ihm gelingen würde, unbemerkt zu verschwinden, während die Schulleiterin mit Godfredo beschäftigt war. Sein Freund konnte seinen Rausch, der so gar nicht zu der Null-Toleranz-Politik der Schule passte, immer meisterhaft verbergen. »Tut mir leid, bin etwas spät dran«, murmelte er und sah kurz hoch. Dann hielt er inne.
Godfredo starrte ihn an. Die Schulleiterin starrte ihn an. Und die Tür zum Empfangszimmer stand offen.
»Was ist los?«
Ein großer Mann erschien in der Tür. Er trug einen fadenscheinigen Regenmantel, der nicht für den alpinen Winter geeignet war, ebenso wie seine riesigen abgetragenen Turnschuhe aus Nylon.
Endlich erkannte Max den Mann. »Onkel Alan?« Sein Blick wanderte zwischen seinem Onkel und der Schuldirektorin hin und her. »Was ist los?«
Alan machte einen Schritt nach vorn, während er einen rot-weißen Fußball-Fanschal in seinen riesigen Fäusten knetete. »Tut mir leid, aber ich habe schlechte Neuigkeiten von zu Hause. Es geht um deine Eltern.«
Max spürte, wie sich sein Hals zuschnürte.
»Es gab einen Unfall mit dem Helikopter«, fuhr Alan fort. »Sie haben den Absturz nicht überlebt. Sie sind von uns gegangen.« Betroffen legte er seine schwere Hand auf Max' Schulter.
»Sie ... Was?«
»Sie sind gestorben, Kumpel.« Alans tiefe Stimme war sanft. »Er tut mir wirklich leid. Wir haben versucht, dich zu erreichen, aber ...«
»Nein«, unterbrach ihn Max. Er schüttelte den Kopf. »Das muss ein Irrtum sein. Ich habe sie doch noch ... erst vor ein paar Tagen ...« Er zog seine Jacke aus und sah zu Godfredo. Dabei versuchte er sich daran zu erinnern, wie viel Zeit sie in dessen Ferienwohnung in der Bahnhofstraße in Zürich verbracht hatten.
»Wann war das denn, Fredo? Vor zwei Tagen?« Er wartete auf eine Antwort, aber sein Freund konnte ihn nur betroffen ansehen.
»Lass deinen Mantel an, Max«, sagte die Schulleiterin. »Am besten fahrt ihr gleich los. Dein Onkel bringt dich nach Zürich.«
»Aber von dort sind wir doch eben gekommen.«
»Ja, ja, natürlich«, bestätigte sie. Etwas leiser wandte sie sich an Alan. »Der Pass ist offen, man kann ihn nachts befahren, aber ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, sofort zu fahren, wenn Sie einen frühen Flug erwischen wollen. Wann war noch mal das Begräbnis?«
Max blickte zu Godfredo, während die Übelkeit in ihm hochstieg.
Godfredo eilte zu ihm. »Du schaffst das, Hermano«, sagte er, »Du wirst das schaffen.«
Max nickte benommen.
»In ein paar Tagen komme ich vorbei«, fuhr Godfredo fort, »Ich bin immer für dich da. Das verspreche ich dir.« Er drückte seinen Freund fest an sich.
Als sie in die Nacht hinaustraten, fühlte Max sich leer.
TEIL I
KAPITEL 1
London, England, November 2008
Max Burns konnte in der Dunkelheit und durch den Schneeregen die roten Schlusslichter des Land Rovers sehen, der in der Kurve wartete. Er rannte, wobei er Fußgängern und Pfützen auswich, bis er die Beifahrertür erreicht hatte. Eilig öffnete er sie und warf sich auf den Sitz.
»Tut mir leid, ich bin spät dran«, sagte er. »Ich habe Professor Moyle getroffen, als ich aus dem Hörsaal kam.«
Sarah lächelte und beugte sich zu ihm, um ihn auf die Wange zu küssen. »Bäh! Du bist ganz nass!«, sagte sie. Sie trug einen Schal von Burburry und sie roch gut.
Max stellte seine Tasche in den Fußraum und zog sich seine durchnässte Jacke aus. »Ja, und es ist saukalt hier!«
Sarah schlug das Lenkrad ein und steuerte den Wagen in den dahingleitenden Verkehr fort vom Campus. »Und? Wie fühlt sich das an, Dr Burns? War es unsagbar traurig, eben die letzte Vorlesung deiner Unikarriere zu halten?« Sie strahlte ihn an.
Max lachte trocken. »Nicht wirklich. ›Best practice für Großprojekte‹ und ›Vertrauensbasierte Zusammenarbeit‹? Kannst du dir vorstellen, wie schnell all meine Zuhörer glasige Augen bekommen haben? Unterrichten, das ist ...« Er musste nochmals lachen und schüttelte den Kopf. »Lass es mich so sagen: Ich tue meinen Studenten einen Gefallen, wenn ich jetzt in die Privatwirtschaft wechsle.«
Während sie das Unigelände verließen, blickte Max zurück auf die immer kleiner werdenden Gebäude, die in den vergangenen fünf Jahren sein berufliches Zuhause gewesen waren. Dann wandte er sich Sarah zu. »Wir sind heute Abend zum Essen eingeladen.«
»Heute?«
»Ja, Professor Moyle hat eine Art Abschiedsparty für mich organisiert.«
»Nett von ihm. Aber doch sehr kurzfristig.«
Max nickte, wobei er den missbilligenden Unterton in ihrer Stimme ignorierte. Er hatte über die Jahre hinweg gelernt, dass Sarah – so wie übrigens die gesamte Familie Beauvoir – bei Einladungen mindestens zwei Wochen Vorlauf brauchte. Keiner von ihnen mochte kurzfristige Überraschungen.
Vielleicht weil Max so schweigsam war, fragte Sarah: »Alles in Ordnung?«
»Klar«, antwortete er.
»Warum dann der düstere Blick?«
Max fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Der Panamakanal wird erweitert.«
»Und?« Sarah warf einen Blick in den Rückspiegel.
»Moyle möchte ein Team zusammenstellen und ein Angebot einreichen.«
»Für die Erweiterung? Wow. Wie ambitioniert!« Sie hielt an einer Ampel, setzte den Blinker und sah Max an.
»Ja«, sagte er und nickte, »das ist es.« Max musste an seine langjährige Kollegin Alexandra Wong denken und fragte sich, ob Moyle ihr davon erzählt hatte. Es war schon eine Weile her, dass sie beide an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet hatten, und dieses Projekt wäre sicher genau nach ihrem Geschmack.
Über Sarahs Gesicht huschte ein Ausdruck von Besorgnis. »Moment mal. Denkst du etwa ...?«
Den Rest ihres Satzes hörte er nicht mehr, weil sie sich wegdrehte. Sie presste einige Finger an ihre Stirn, so als hätte sie Migräne. Als sie ihn wieder anblickte, wirkte sie entschlossen. »Du hast den Vertrag mit meinem Vater bereits unterschrieben, und Moyle versucht trotzdem noch, dich zu ködern?« Hinter ihnen hupte es, also fuhr Sarah schwungvoll wieder los. »Aber eigentlich«, sagte sie nach einer Pause, während der Wagen vorwärtskroch, »überrascht mich das nicht. Das ist ja wohl kein Zufall, dass die Erweiterung des Panamakanals bekannt gegeben wird, und dann, ganz plötzlich, beschließt der gute Professor Moyle, für dich eine Abschiedsparty zu schmeißen ...«
»Sarah, bitte!« Max seufzte. »Verdammt noch mal, ich bin Ingenieur für den Bereich Geomatik. Es ist nur logisch und absolut nachvollziehbar, dass er, wenn sich eine so unglaubliche Möglichkeit auftut, an mich denkt.«
Sie antwortete ihm nicht. Der Takt der Scheibenwischer nahm zu, um den Regenguss zu bewältigen. Wenig später waren sie zu Hause angekommen und Sarah lenkte den Wagen auf den Parkplatz vor ihrem Reihenhaus.
»Ich weiß, dass dich das ärgert«, sagte Max, als Sarah ihre Handtasche vom Rücksitz angelte. »Dennoch würde ich mich wirklich freuen, wenn du mich heute Abend begleitest.«
Sie hielt mit ihrer Tasche in der Hand inne, dann zog sie ihren Regenschirm hervor. »Lieber nicht«, sagte sie. »Ich habe keine Lust, gegen Moyle antreten zu müssen.« Entschlossen schlug sie die Wagentür hinter sich zu.
Max seufzte, griff nach seiner Jacke und sah zu, wie Sarah in Richtung des Hauses davonlief.
KAPITEL 2
London, England
»Halllooo!« Eine Frauenstimme übertönte das barocke Streichkonzert, das aus Professor Moyles kleiner Wohnung zu hören war.
Aus dem Augenwinkel sah Max den ihm vertrauten roten Trenchcoat, als der Professor Alexandra Wong, von den meisten »Alex« genannt, hereinbat. Der Mantel schmiegte sich an ihre schmale Silhouette. Ihre sonst glänzenden schwarzen Locken waren verwuschelt und tropfnass.
»Großartig! Rosmarin!«, rief Alex begeistert, als sie dem Professor voran in das Zimmer trat. »Das riecht nach einem wahren Festmahl!« Sie schloss die Augen und sog mit einem Lächeln auf den Lippen den Duft tief ein. »Wunderbar!«
Max stand mit einem Weinglas in der Hand neben der riesigen Kochinsel, die die Küche vom Wohnzimmer trennte. »Guten Abend«, sagte er lachend.
Moyles Apartment war ein Neubau und jeder Zentimeter Wand war mit Buchregalen bedeckt. Bis auf die Küche, in der, wie Max erst vor Kurzem entdeckt hatte, Moyles Weigerung, Bücher zu entsorgen, zu einer etwas merkwürdigen Zweckentfremdung geführt hatte. Eine Palette gebundener Bücher, die aussahen, als stammten sie aus dem letzten Jahrhundert, bildete säuberlich gestapelt und mit langen Metallbändern fixiert die Basis einer Küchentheke mit einer Holzablage. Ein ähnlicher Bücherstapel diente als Sockel für den Beistelltisch mit Glasplatte mitten im Wohnzimmer.
»Hat er es dir erzählt?«, fragte Alex. Sie hatte sich zu Max gesellt und machte eine Bewegung mit dem Kopf in Richtung des Professors, der wieder hinter der Kücheninsel stand und Karotten mit nahezu roboterhafter Präzision klein schnitt.
»Habe ich«, warf Moyle stolz ein. »Bitte zieh deine nassen Sachen aus, Alexandra.«
Folgsam zog sie ihren Mantel aus und hängte ihn über die Lehne eines der Esszimmerstühle.
Moyle lege das Messer auf die Ablage. »Wäre die Garderobe bei der Eingangstür nicht eine besser Wahl?«, fragte er schmunzelnd.
Während Alex ihren Mantel an die Garderobe hängte, goss ihr Max ein Glas Wein aus einem angeschlagenen und mit Fingerabdrücken übersäten Dekanter ein.
»Also dann bist du dabei?«, fragte Alex, als sie zurückkam und nach ihrem Glas griff.
»Dabei?« Max blickte hinüber zum Professor, der sich in sein Kochbuch vertiefte. Langsam sickerte in ihm die Erkenntnis durch, dass Sarah wohl doch recht gehabt hatte: Das hier war keine Abschiedsparty.
»Die Regierung von Panama veröffentlicht am Montag die Ausschreibung«, drang Alex' Stimme in seine Gedanken ein. Sie strahlte ihn an.
»Schon?«
»Ich weiß, ist das nicht großartig?« Ihre Finger formten sich zu einer Faust, während sie ihn lebhaft musterte. »Wir müssen ein Team zusammenstellen, um uns für die Ausschreibung zu bewerben, dann haben wir sechs Monate Zeit, unser Angebot fertigzustellen, und dann müssen wir ...«
»Langsam, langsam«, unterbrach sie Moyle. »Nichts überstürzen. Wir warten jetzt erst einmal auf Gian.«
»Gian kommt heute Abend auch ...?«
»Ja klar!«, sagte Alex. »Max, wir können unser Angebot nicht ohne einen Software-Zauberer im Team zusammenstellen.«
»Unser Angebot ...?« Max hielt inne. Dann begann er zu lachen, wobei er den Kopf schüttelte. »Das scheint mir weniger eine Abschiedsparty als vielmehr eine Willkommensparty zu sein, oder?«
Moyle grinste. »Wäre das so schlimm?«
»Sie wissen, dass ich den Vertrag bei der Beauvoir Gruppe schon unterschrieben habe. Vor zwei Monaten. Ich kann das nicht einfach sausen lassen.«
»Verdammt, Max!«, rief Alex aus. »Verstehst du das nicht?! Es geht um den Panamakanal!«
Max hob seine Hand mit einer Bewegung, die, wie er hoffte, ablehnend war. »Es tut mir leid. Ich wäre gerne dabei, aber ...«
»Max.« Moyle legte sein Messer wieder auf die Ablage. »Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber Sie kennen ja die Geschichte des Kanals.« Er neigte sein Kinn etwas nach unten und blickte Max über sein Weinglas hinweg an. »Sie wissen, was es für eine Herausforderung war, ihn zu bauen, und was für eine großartige und einmalige Chance es wäre, beim bevorstehenden Ausbau federführend zu sein!«
Max zog die Augenbrauen zusammen, so als wollte er sagen: »Bitte beleidigen Sie mich nicht.« Er hatte seine Doktorarbeit über den Suezkanal geschrieben und in diesem Zusammenhang auch intensiv über den Panamakanal recherchiert, diesen Moloch, den die Franzosen begonnen hatten und der schließlich das triumphale Debüt der Amerikaner in Sachen Ingenieurskunst geworden war.
Moyle fuhr nüchtern fort: »Auch wenn wir die Ausschreibung nicht gewinnen würden, so wäre es trotzdem eine tolle Möglichkeit, sich Gedanken zu einer der größten Ingenieursleistungen der Welt zu machen.« Es sah erst Alex, dann Max an. »Und ihr beide ...« Kurz hielt er inne und sog seine Lippen zwischen seine Zähne. »Also, ich bin viel zu alt und zu müde, um mir ein derartiges Großprojekt zumuten zu wollen, doch ihr beide zusammen hättet echte Chancen.« Er schwieg kurz. »Aber ihr könntet es nicht allein durchziehen. Wir müssten ein Weltklasseteam zusammenstellen, auch mit Leuten vor Ort in Panama ...«
Die Türklingel ertönte. Moyle entschuldigte sich und ging zur Eingangstür.
»Na toll«, zischte Alex Max sarkastisch zu. »Du verziehst dich ... und verbaust mir so die Möglichkeit, an etwas wirklich Großem mitzuarbeiten.«
Max sah sie an. »Alex, du kannst dir jeden Partner ins Boot holen, den du nur willst. Du bist die Leiterin des Fachbereichs. Und du weißt, dass dich Moyle immer unterstützen wird.«
»Nein, Max. Das wird ohne dich nicht funktionieren.« Sie zeigte auf den Professor, der Gian Tarocco aus dem Mantel half. Über ihr Gesicht huschte ein Ausdruck von Bitterkeit. »Er wird mich allein nicht unterstützen. Das hat er schon öfter deutlich gemacht. Denn«, sie deutete mit den Fingern Anführungszeichen an, ›»Ihre Arbeit ist viel besser, wenn Sie mit Dr Burns zusammenarbeiten.‹«
»Alex, du müsstest doch von allen am besten wissen, wie sehr mich diese Neuigkeit begeistert«, sagte Max. »Das ist der Traum eines jeden Ingenieurs. Die Chance, auf die wir alle gewartet haben. Aber ich muss auf Sarah Rücksicht nehmen.«
»Burns!« Mit einem breiten Lächeln gesellte sich Gian Tarocco zu den beiden. »Du bist also dabei!« Er hielt bereits ein kühles Bier in der Hand.
KAPITEL 3
Wolverhampton, England
»Francisco Roco! Bist du immer noch von Madrid bis Mallorca hinter allen hübschen Frauen her?«
»Wer spricht da?« Paco Roco legte seinen Stift hin und lehnte sich in seinem Ledersessel zurück. Ihn sprach nur selten jemand mit seinem vollen Namen an, aber der Anrufer schien ihn gut zu kennen. Er legte seine Füße auf den großen Eichenschreibtisch.
»Jemand, der dich jederzeit im Blackjack fertigmacht!«
Paco sprang auf, was den kleinen Hund unter dem Schreibtisch, ein schwarz-weißer Boston Terrier, erschreckte. »Verdammt noch mal! Wenn das nicht der verloren geglaubte Prinz von Panama höchstpersönlich ist!«, sagte er. »Wie geht es dir, alter Freund?« Er ging mit einem breiten Lächeln zur Balkontür und trat hinaus in den grauen, englischen Tag. Der Hund folgte ihm.
»In der Politik gibt es keinen Adel, Paco. Wir ziehen die Boxhandschuhe jeweils aus, bevor wir in den Ring steigen.«
Paco lachte dröhnend. »Boxhandschuhe? Hast du sowieso noch nie getragen. Immerhin machst du dir gerne mal die Hände schmutzig!« Die Stimme seines alten Freundes erinnerte ihn an die schwüle Hitze und den Trubel in Madrid, wo sie sich kennengelernt hatten und eine Zeit lang während des Aufschwungs und vor der Immobilienblase in Südeuropa zusammengearbeitet hatten. Ihre Zusammenarbeit hatte sich dann noch intensiviert, als sie gemeinsam nach Südamerika expandiert hatten.
Am anderen Ende der Leitung wurde gelacht. »Das war damals so! Aber ich kann mich nicht beklagen. Mir geht es hier in Panama sehr gut.«
»Aha?«
»Sogar meine Rennpferde liegen jedes Mal vorne.«
»Du gewinnst also immer noch?«
»Natürlich! Ich habe einen großartigen Trainer.« Für einen kurzen Moment herrschte Schweigen. »Sag mal, Paco, möchtest du vorbeikommen und ihn treffen?«
Sofort spürte Paco, wie sein Adrenalinspiegel stieg. »Erzähl mir mehr«, sagte er, ganz der Geschäftsmann. Er hatte den Subtext wahrgenommen. »Was brauchst du? Du willst ja nicht wirklich über Pferde sprechen.« Er schob den Hund mit dem Fuß beiseite und lehnte sich nach vorne, um sich mit einem Ellbogen auf der steinernen Balustrade abzustützen.
»Ich habe einen – nennen wir es mal Plan – für die Altersvorsorge.«
»Heilige Mutter Gottes! Du sprichst über den verdammten Panamakanal, richtig? Ich habe es in den Nachrichten gesehen.«
Sein Freund lachte.
»Du durchtriebener Bastard! Du wirst also höchstpersönlich den ganzen Auswahlprozess überwachen?«
»Ja. Darum rufe ich an. Also, bist du interessiert?«
»Kumpel, ich arbeite im Baugewebe. Wenn du ›Beton‹ rufst, frage ich: ›Wie viel?‹« Paco war hellwach. So gut hatte er sich schon ewig nicht mehr gefühlt. Aber er war lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es nicht so einfach werden würde. »Wo ist der Haken?«, fragte er.
»Wir machen es auf meine Art.«
Paco schürzte die Lippen. Das Arschloch denkt wirklich, er kann mich herumkommandieren, dachte er. Ohne mich wäre er nicht da, wo er jetzt ist. »Denkst du daran, dich aus der Politik zurückzuziehen?«, fragte er unschuldig. »Ist alles in Ordnung? Wie geht es Rosa?«
Sein Gesprächspartner schwieg. Paco wusste, dass er den wunden Punkt getroffen hatte.
»Es geht ihr gut. Wenn man diesen Krebs-Perücken-Look mag.«
Paco zuckte zusammen, als ungewollt das Bild seiner eigenen, sterbenden Mutter in ihm hochstieg. Ihre graue und schlaffe Haut. Ihre vertrockneten Hände mit Venen wie Spinnweben, die nicht mehr auf eine Berührung reagieren konnten. Trotzdem. Das hier war seine Lebensversicherung. Niemand wusste, wie viel Zeit Rosa noch auf dieser Erde bleiben würde, und ein bisschen Extrageld würde ihr den Übergang ins Jenseits auf jeden Fall erleichtern.
»Das tut mir leid«, sagte Paco gut gelaunt. »Lass uns das alles persönlich besprechen. Ich kann bis Mitte der Woche in Panama sein. Und Godfredo schicke ich dir sofort, er kann morgen fliegen. Du und ich, wir besprechen die Details, sobald ich da bin.«
»Perfekt. Ich sage Fuentes, er soll ihn am Flughafen abholen.«
Paco legte auf und warf den Hörer auf den Schreibtisch vor sich. Seine Hände ruhten auf seiner Brust, er holte tief Luft. Dann bückte er sich und nahm den Hund hoch. »Hast du gehört? Das wird unser großer Deal«, sagte er zu dem kleinen Vierbeiner. »Das wird Paco Rocos Arsch retten.«
Er stellte den Boston Terrier auf seinen Schreibtisch zwischen zwei gerahmte Fotografien von Starlight Starbright und Running Hot, beides noch Jährlinge, aber auf dem Weg, seine besten Rennpferde zu werden.
»Was mache ich bloß mit meinen Pferden, wenn ich nach Panama gehe, hm?« Er legte seinen Kopf auf die Seite. Der Hund machte es ihm nach und wedelte mit dem Schwanz. »Und was wird Godfredo ohne sein Schoßhündchen machen?«
Der Hund zuckte vor lauter unverbrauchter Energie.
»Godfredo!«, brüllte Paco und der Hund sprang vom Tisch. »Pack deine Sachen! Und such deinem verdammten Köter ein neues Zuhause!«
KAPITEL 4
Obarrio, Panama-Stadt, Panama
Ein spektakulärer Sonnenuntergang setzte den Himmel in Flammen, während Godfredo Roco Papiere in seine Aktentasche stopfte. Der Fahrer, Fuentes, nahm die Kurven sehr eng, während sie durch den frühen Feierabendverkehr fuhren.
»Uff!« Godfredo lachte. »Sie haben Ihren Führerschein wohl bei einem Stuntman gemacht.«
Fuentes grinste und brachte den Wagen unverhofft, aber gekonnt zum Stehen, womit er trotz Vorfahrt einen Zusammenstoß mit den ungebremst heranbrausenden Autos ganz knapp verhindern konnte.
Nicht zum ersten Mal an diesem Tag war Godfredo froh, einen erfahrenen Fahrer zu haben. Auf Panamas Straßen herrschte Krieg. Jede Kreuzung war Gefahrengebiet, und laut und lang zu hupen war die allgemeine Lingua franca. Godfredo fuhr normalerweise lieber selbst und hielt sich auch für einen talentierten Fahrer – ihm gehörten in England zwei Bugattis und eine niedliche alte Corvette. Aber seit er den Zustand der Straßen in Panama gesehen hatte – die großen, nicht zusammenpassenden Betonplatten und das Durcheinander von Autos –, war er froh, dass er unter diesen Bedingungen nicht in einem seiner üblichen tief liegenden Wagen das Steuer selbst übernommen hatte. Sowohl für seine Gesundheit als auch für seinen Hintern.
Er warf einen Blick auf seine Uhr und raffte seine Aktentasche und seine Jacke zusammen.
Dem Marriott Hotel und dem angeschlossenen Casino gehörte ein Großteil der Immobilien in dieser Straße. Direkt gegenüber stand jedoch eine Reihe heruntergekommener Gebäude. Dort befand sich, von der Hauptstraße aus etwas nach hinten versetzt, ein kleines Lokal, dessen kahle Kletterpflanzen an der Fassade und grün flackernde Neonröhren seinem eleganten Nachbarn unpassend ins Auge stachen.
Als er aus dem Wagen ausstieg, warf Godfredo einen kurzen Blick in Richtung des Lokals. Fast erwartete er, zwischen den spärlich bekleideten Kellnerinnen und Prostituierten seinen Vater zu sehen, wie er vielleicht einen Drink hinunterkippte. Aber die Bar mit ihren verspiegelten Rückwänden war leer, nur ein paar Frauen in High Heels saßen mit aufgestützten Ellbogen auf den Bänken.
Godfredo konzentrierte sich auf das anstehende Treffen, während er in die großzügige Lobby des Hotels trat und in Richtung Lounge ging. Auf einem tiefen schwarzen Ledersofa sah er an einem der gläsernen Beistelltischchen Paco sitzen. Dessen Blick ruhte auf Papieren, die er in der Hand hielt.
»Seit wann trägst du eine Brille!«, fragte Godfredo gut gelaunt. Sein Vater musste blind wie eine Fledermaus sein, wenn er sich dazu herabgelassen hatte, sich eine Brille zu besorgen.
»Und du bist wieder zu spät.« Paco sah nicht hoch, als Godfredo ihm gegenüber Platz nahm. Stattdessen zeigte er auf die Bierflasche, die unberührt auf der anderen Seite des Tisches stand.
Godfredo bediente sich und goss sich die kühle Flüssigkeit in ein hohes Glas.
»Wir haben eine verdammte Riesenaufgabe vor uns«, fuhr Paco fort.
Godfredo lächelte. »Ach ja? Meinst du?«, fragte er scherzhaft. »Sogar mein Fahrer Fuentes hat schon stolz erwähnt, dass die Erweiterung des Panamakanals das größte Unterfangen sei, welches ein Land in den letzten hundert Jahren in Angriff genommen hätte.« Er schwieg kurz. »Für wen arbeitet dieser Fuentes eigentlich genau? Er weiß unglaublich viel über den Kanal.«
Endlich blickte Paco auf und nahm die Brille ab. Er ignorierte Godfredos Frage und stellte stattdessen selbst eine: »Hast du dir die Unterlagen angesehen?«
Godfredo zog das Bündel aus seinem Aktenkoffer. »Ja. Da steht, dass neunzig Prozent des Trinkwassers von Panama aus dem Rio Chagres kommen ...«
»Ich habe die Unterlagen gelesen«, unterbrach ihn Paco. »Ich will verdammt noch mal wissen, ob du sie gelesen hast.«
Erstaunt fuhr Godfredo fort: »Ja, und man muss kein Genie sein, um zu verstehen, dass der Knackpunkt des Projekts das Wassermanagement sein wird. »Er atmete aus, als er durch die Papiere blätterte. »Brücken und städtische Wasserwege sind eine Sache, aber hier geht es um ein komplettes verdammtes Feuchtgebiete-Ökosystem.«
»Hast du schon ein paar Kontakte für mich? Fachleute, Ingenieure, Hydrografen?«
»Nein.« Godfredo schüttelte den Kopf. »Noch nicht.«
»Godfredo, denkst du verdammt noch mal, dass wir hier Urlaub machen?«
»Paps, entspann dich. Ich habe all die Entwürfe bekommen und unsere Interessenbekundung termingerecht eingereicht. Bis jetzt steckte ich bis zum Hals in diesen verdammten Flora-und-Fauna-Unterlagen und hatte noch keine Zeit, nach geeignetem Personal zu suchen.«
Paco gab ein unwilliges Geräusch von sich. Er lehnte sich zurück. »In Ordnung. Ich habe einige Ideen und werde mal ein bisschen herumtelefonieren. Ich kenne da ein paar Holländer.« Er schwieg kurz. »Was ist mit dem Jungen, mit dem du in der Schweiz auf der Schule warst?«
Godfredo sah ihn fragend an. Er schüttelte den Kopf.
»Der, dessen Vater von Rupert Garcia beschissen wurde und sich und seine Frau dann umgebracht hat. Was ist aus ihm geworden?«
»Max Burns? Er ist von der Schule gegangen.«
»Das weiß ich. Ich wollte wissen, was er studiert hat. War das nicht irgendwas mit Ingenieurswesen für große Infrastrukturen? Irgendwas mit Ägypten?«
»Stimmt.« Godfredo beugte sich nach vorne und klopfte auf das Tischchen, während er sein Gedächtnis durchwühlte. »Ich erinnere mich daran, dass er seine Doktorarbeit über den Suezkanal geschrieben hat. Und er hat in London studiert. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich glaube, er unterrichtet jetzt. Er könnte jemanden kennen.«
»Worauf wartest du noch? Ruf ihn an!«
Godfredo notierte sich Max Burns als Erinnerung auf die Vorderseite seiner Aktenmappe. Er warf die Dokumente auf den Tisch, lehnte sich in seinem Sessel zurück und nahm einen großen Schluck Bier. Dann zeigte er auf die Unterlagen, die vor Paco auf dem Tisch lagen, und sagte: »Nur damit du es weißt: Ich will die Hälfte vom Gewinn.«
Paco erstarrte mit seinem Bier in der Hand und sah Godfredo an. »Die Hälfte?« Er lachte laut.
Godfredo, der dieses Lachen kannte, ahnte, dass er gleich in Stücke gerissen würde. Zu seiner Überraschung aber nickte sein Vater bedächtig und er konnte Zustimmung in seinem Gesicht ablesen.
»Die Hälfte«, wiederholte Paco und nickte. »Jetzt denkst du endlich wie ein Roco.« Abermals brach er in Gelächter aus. Dann wischte er sich mit seinem Handrücken über den Mund. »Nein!«, bestimmte er. Entschlossen stand er auf und zeigte auf Godfredo. »Du erzählst mir nicht, wie das hier läuft.« Er richtete sein Sakko. »Wie viel du bekommst, sage ich dir, wenn wir hiermit fertig sind.«
Als er sein Apartment im obersten Stockwerk des Hotels betrat, öffnete Godfredo die ersten Knöpfe seines Hemds. »So ein Arschloch!«, stieß er hervor. »Noch eine verdammte Karotte«, er zerrte an seiner Krawatte, »die er mit vor die Nase hält.«
Er entledigte sich der Krawatte, knüllte sie zusammen und warf sie zielgerichtet zum Fenster. Mitten im Flug entfaltete sie sich und landete auf einem Arrangement aus tropischen Blättern und leuchtend orangefarbenen Blüten. Der Raum war blitzblank gesäubert worden. Nur Sophias String lag sorgfältig gefaltet auf der Nackenstütze eines der Sessel, als wäre er ein – wenn auch absurder – Sesselschoner.
Godfredo warf einen Blick auf seine Uhr. Vermutlich hatte er Zeit, sie heute Abend zu treffen. Er blickte aus dem bodentiefen Fenster: Die Wellen des Atlantiks zogen sich vom Ufer zurück und hinterließen eine große schlammige Fläche, während der Horizont wegen des Dunstes eines herannahenden Sturms auf See nicht auszumachen war.
Auf der anderen Seite der Bucht, jenseits der spanischen Kuppeln und Fassaden von Panamas schöner Altstadt, dem Casco Viejo, ankerten etwa fünfzehn riesige Cargoschiffe und warteten darauf, den Kanal passieren zu dürfen. Während Godfredo hinüberblickte, nahm das erste Schiff seinen Weg zur Flussmündung auf, wo es schließlich in Richtung Norden fahren und die ersten zwei Schleusen passieren würde. Jede Durchfahrt brachte um die zweihunderttausend Dollar ein, und es wurde nur Vorauszahlung oder Bargeld akzeptiert, keine Kreditkarten und Schecks. Das waren um die zwei Milliarden Dollar im Jahr, die dringend benötigt wurden, um die Kanalbehörden und die Wirtschaft des gesamten Landes am Laufen zu halten.
Der Gedanke an diese Summe reichte aus, um Godfredos Puls zu beschleunigen. Sie würden mehr Bagger, mehr Basaltsteine, mehr Raupen und Kräne benötigen, als er jemals bei einem anderen Projekt gezählt hatte. Zudem würden zehntausend Arbeiter oder mehr über Jahre beschäftigt sein.
Rasch ging er zum Kühlschrank, nahm eine Flasche Bier heraus und drehte den Schraubverschluss auf. Was, wenn er tatsächlich den Gewinnerentwurf einreichte? Was, wenn er es war, dem dieses verdammte Projekt zufiel?
Ja. Godfredo nickte und spannte seine Kiefermuskulatur an. Er konnte das Geld förmlich riechen. Und er würde die Möglichkeit haben, mit Paco auf Augenhöhe an einem richtig großen Projekt zu arbeiten. Solange er nur das passende Team zusammenstellte.
Max Burns. Godfredo lachte. Ausgerechnet er tauchte nach all den Jahren wieder auf der Bildfläche auf! Max Burns war der Einzige seiner Schulfreunde gewesen, der an den seltenen Wochenenden, wenn sie den Schulregeln entwischt waren, bei jedem Trinkwettbewerb mit ihm hatte mithalten können. Häufig hatten sie den Zug genommen, um zu Pacos Junggesellenwohnung in der Bahnhofstraße in Zürich zu gelangen. Dort hatten sie sich auch Blackjack beigebracht. Max war zudem der einzige Freund gewesen, der den Mut gehabt hatte oder dem es vielleicht einfach wichtig genug gewesen war, ihn eines Abends nach den blauen Flecken zu fragen, mit denen er aus den Ferien zurückgekommen war.
Godfredos Lächeln wich aus seinem Gesicht, als er an diese Nacht dachte, an seine überschäumende Wut auf Max und an die eigene Faust, die den Kiefer seines besten Freundes getroffen hatte, und wie sie beide sich danach geschlagen hatten. Wie sie hart auf dem vereisten Boden gelandet waren und anschließend mit ihren Koffern die verschneite Straße zu ihrem Internat in den Alpen hatten hochlaufen müssen. Wie sein Blut vorne auf seine Jacke getropft war.
Es war die Nacht gewesen, in der Max' seltsamer Onkel Alan gekommen war und sie in seinem dünnen Gummiregenmantel in der Eingangshalle des Internats erwartet hatte, seinen Schal fest umklammert. Die Nacht, in der Max erfahren hatte, dass seine Eltern einen tödlichen Helikopterunfall erlitten hatten. Wie schnell sich das Leben ändern konnte.
Godfredo verbannte das Bild von Max' betroffenem Gesicht aus seinen Gedanken, ging hinüber zum Schreibtisch und öffnete den Deckel seines Laptops. »Okay, Dr Burns«, sagte er, während er dessen Namen in eine Suchmaschine eingab. »Wo zum Teufel bist du?«
KAPITEL 5
Pferderennbahn, Panama-Stadt, Panama
Es war noch lange nicht Mittag und viel zu früh für Alkohol, aber Godfredo war ausgedörrt, nachdem er wegen eines »eiligen« Treffens mit seinem Vater länger als zwei Stunden in der Hitze auf ihn gewartet hatte.
Im Fernseher über der Bar waren Luftaufnahmen von Miraflores zu sehen, den südlichsten Schleusen des Panamakanals, dann kamen die Mulis ins Bild, die Zahnradlokomotiven, die gerade ein mit Hunderten von Containern beladenes chinesisches Schiff den Kanal entlangzogen.
»Der Kanal gehörte bis in die 1970er Jahre den USA, nicht wahr?«, hörte er die Stimme eines Reporters, als zu einem Interview mit einem Journalisten in Panama zurückgeschaltet wurde.
Godfredos Finger trommelten ungeduldig auf den Tresen und er sah der Kellnerin zu, wie sie akkurat zwei Cocktailschirmchen öffnete. Sie hatte eine gute Figur unter der weißen Bluse. Aber das hatten diese Kolumbianerinnen alle.
»Er gehörte ihnen nicht wirklich«, vernahm er die Antwort des Interviewten. Godfredo blickte zum Bildschirm. »Die USA verwalteten den Kanal bis 1999, bis zum sogenannten Jahrtausendwechsel. Dann wurde er an Panama übergeben unter der Voraussetzung – und hier zitiere ich Wikipedia –, dass die USA das Recht behalten, den Kanal vor jeder Bedrohung zu schützen, die seine politisch neutrale Nutzung durch Schiffe aller Nationen gefährden könnte.«
»Die Torrijos-Carter-Verträge, richtig?«
»Genau. Sie wurden 1977 zwischen Präsident Jimmy Carter und General Omar Torrijos vereinbart. Obwohl also die USA die Kontrolle über den Panamakanal abgegeben hatten, behielten sie dennoch vertraglich das Recht, militärisch einzugreifen, falls nötig. Dies wäre auch heute noch denkbar und möglich.«
»Nun zum geplanten Ausbau des Kanals. Gibt es hier in Panama großen Widerstand gegen das Projekt?«
Die Kellnerin stellte die mit den Papierschirmchen dekorierten Drinks auf den Tresen. Während Godfredo seine Brieftasche herauszog, ließ er den Fernseher nicht aus den Augen.
»Es gibt hier erstaunlich wenig Widerstand dagegen. Die Regierung von Panama war sehr offen, was ihre Pläne angeht, und bereit, das Projekt gemeinsam mit Panamas Umweltbehörden zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Weiterhin soll es mit internationalen Standards wie den Equator Principles konform gehen, die im Wesentlichen die Kriterien für nachhaltige Entwicklung festlegen.«
»Und was ist mit dem Smithsonian Tropical Research Institute, das doch hier in der Region sehr aktiv ist?«
»Das ist ein amerikanisches Institut ... Was sollten sie dazu zu sagen haben?«
»Ja, seine Forscher sind seit der Jahrtausendwende im Gebiet des Panamakanals tätig, und die Zusammenarbeit mit der Kanalbehörde und der Regierung von Panama war immer sehr gut. Es spricht nichts dagegen, dass dies auch bei der Erweiterung des Kanals so sein wird.«
Godfredo hielt inne, den Geldschein in der Hand.
»Spannend ist, dass der meiste Widerstand anscheinend aus dem US-Kongress kommt. Dort war man schon immer dagegen, bereits als die Torrijos-Carter-Verträge zum ersten Mal vorgestellt wurden. Viele Amerikaner verstehen bis heute nicht, warum ihre Regierung den Kanal mit seiner enormen internationalen strategischen Bedeutung weggegeben hat. Zahlreiche Gegner vertreten seit der Unterzeichnung der Verträge den Standpunkt, dass es sich hier um ein Übersetzungsproblem handelt, denn der Inhalt der spanischen Version würde von der englischen abweichen, und dieser Unterschied wiederum würde die Verträge ›ungültig‹ werden lassen ... Aber das größere Problem scheint einfach die Tatsache zu sein, dass sie sich immer noch nicht mit dem Gedanken abfinden konnten, dass sie den Kanal quasi kostenlos an Panama zurückgegeben haben. Schließlich ist er, wie gesagt, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt.«
»Also können wir davon ausgehen, dass auch die Amerikaner ein Angebot für die Expansion des Kanals einreichen werden?«
»Auf jeden Fall. Sie werden sich diese Chance nicht entgehen lassen. Und wir wissen auch, dass es von der Siegel-Gruppe aus Pittsburgh kommen wird. Ich habe heute Morgen mit dem amerikanischen Botschafter in Panama, Larry Roebuck, gesprochen.«





























