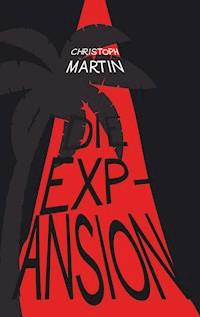0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Ähnliche
Original-Bucheinband
Wieland Geschichte des Prinzen Biribinker
Kulturhistorische Liebhaberbibliothek Band 11
Geschichte des Prinzen Biribinker
von
Wieland
Herausgegeben und eingeleitet von
Dr. Carl Schüddekopf
Dritte Auflage.
Berlin und Leipzig Magazin-Verlag Jacques Hegner 1904
Alle Rechte vom Verleger vorbehalten
Roßberg’sche Buchdruckerei, Leipzig
Einleitung.
„Wieland als Konvertit“ ist eins der merkwürdigsten Probleme unsrer vorklassischen Literatur, die an intimen persönlichen Bekenntnissen nicht eben reich ist. Wie sich der junge, weltfremde Gelehrte aus einem schwärmerischen Heiligen zum frivolen Spötter wandelt, wie er am Schluß seines Schweizer Aufenthalts aus den seraphischen Sphären Bodmers zur Erde herabsteigt und in Biberach Freunde wie Feinde durch die radikalsten Zeugnisse seiner Umkehr in Staunen setzt, ist sicherlich eins der interessantesten Kapitel in der noch zu schreibenden Biographie des Dichters. Derselbe Wieland, der noch am 27. August 1758 in einem ausführlichen ungedruckten Briefe an den Braunschweiger Professor Ebert schrieb: „Ein bel-Esprit ist allemal auch ein Glied der menschlichen Gesellschaft; und ich schätze ihn nur alsdann, wenn er als bel-Esprit der Gesellschaft nützlich ist. Der Mißbrauch des Genie und der Künste hat mich schon lange äußerst gekränkt, und es war ein creve-cœur für mich, Deutschland mit tändelnden Poesien und läppischen Nachahmungen des Anakreon, und dergleichen überhäuft zu sehen. – Ich konnte nicht kaltsinnig von Leuten sprechen, die ich als Verführer der Jugend und Verderber des ächten Geschmaks einer gantzen Nation ansehen mußte“ – derselbe unduldsame Gegner der Anakreontik hatte, als er diesen Brief schrieb, auf den meisten Punkten bereits den Rückzug angetreten. Schon damals spielte er gern mit seinen Meinungen, wie Goethe später von ihm sagte; denn um dieselbe Zeit bedauert er seine übertriebenen Angriffe auf Uz und Genossen, empfiehlt als kräftiges Gegenmittel gegen die platonische Schwärmerei den Plutarch und Don Quixote und entwirft den Plan zu einem satirischen Roman nach Lucian. Das wichtigste literarische Dokument für diesen psychologischen Prozeß in Wieland ist aber das Feenmärchen, das wir der in jüngster Zeit sich wieder mehrenden Zahl von Freunden des Dichters hier in einem Neudruck vorlegen.
Die „Geschichte des Prinzen Biribinker“ ist ursprünglich nicht separat erschienen, sondern sie ist eine freilich nur lose eingefügte Innenerzählung des ersten großen Wielandschen Romans, der unter dem Titel „Der Sieg der Natur über die Schwärmerey, oder die Abentheuer des Don Sylvio von Roselva, Eine Geschichte, worinn alles Wunderbare natürlich zugeht“, im Jahre 1764 zu Ulm erschien. Daß dieser Don Sylvio eine direkte Nachahmung des Don Quixote ist, hat der Dichter selbst später bestätigt; wie Cervantes seinen Helden durch die Ritterromane, so läßt Wieland den Don Sylvio auf dem einsamen Schloß seiner Tante, der Donna Mencia, durch die Lektüre der Feenmärchen den Sinn für die Wirklichkeit verlieren und mit seinem Diener Pedrillo, dem Pendant zum Sancho Pansa, eine Reihe erträumter Abenteuer bestehen, bis er durch die Liebe zu Donna Felicia und die Bemühungen seines Freundes Don Gabriel von seiner Schwärmerei geheilt wird. Ein Radikalmittel des letzteren ist die Geschichte des Prinzen Biribinker, die er an einem schönen Sommerabend in der Laube des Gartens von Schloß Lirias der Gesellschaft, die bereits auf das abenteuerlichste vorbereitet ist, erzählt, um dadurch eine Probe zu machen, „wie weit das Vorurtheil und die Einbildung bei unserm Helden gehe“. Es gelingt ihm in der Tat, den Don Sylvio zunächst unter Berufung auf seine Quelle, den glaubwürdigen Geschichtsschreiber Paläphatus, zu täuschen und später durch die Enthüllung, daß die ganze Geschichte von seiner eignen Erfindung sei, zu beschämen und von seinem Glauben an das Übernatürliche zu heilen.
Ein literarisches Symbol für die menschliche Selbstbefreiung, die der Dichter in den letzten Jahren selbst durchgemacht hatte! Wie Don Sylvio von seiner Schwärmerei für das Wunderbare durch Don Gabriel und Donna Felicia geheilt wird, so befreite sich Wieland in Biberach durch den Verkehr mit dem Grafen Stadion und Sophie la Roche von seiner platonischen Schwärmerei; auch bei ihm siegte die Natur!
Um den Don Sylvio zu kurieren, wählt Don Gabriel das wirksamste Mittel: er sucht den ganzen Feenspuk durch Verspottung ad absurdum zu führen. Diese Karrikatur ist bis zum Schluß folgerichtig durchgeführt, und ich kann Scherers Ansicht, daß Wieland die Feenmärchen verspotte, „um selbst den Eingang in ihre Zaubergärten zu erlangen“ – ein Vorgang also, wie wir ihn etwa bei Hauffs Satire gegen Clauren beobachten – wenigstens für diese Zeit nicht teilen. Wielands spätere romantische Dichtungen beruhen auf ganz anderen literarischen Voraussetzungen, wie der Don Sylvio.
Aus dieser Tendenz des Romans und der kleinen Innenerzählung ergibt sich schon mit Notwendigkeit, daß der Dichter die zu parodierenden Feenmärchen selbst heranziehen und benutzen mußte. Denn darin besteht der Hauptreiz jeder Karrikatur, daß sie die vorhandene Vorlage übertrumpft und überbietet. In der Tat ist denn auch die Geschichte des Prinzen Biribinker ein Meisterstück der Entlehnungskunst, die bei Wieland überhaupt so virtuos ausgebildet ist. Durch mehrere Untersuchungen von Mayer (Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 5, 374), Tropsch (Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, Neue Folge, 12, 454 und Euphorion, Ergänzungsheft 4, 32), Martens (Untersuchungen über Wielands Don Sylvio, Halle 1901) und Steinberger (Lucians Einfluß auf Wieland, Göttingen 1902) ist in den letzten Jahren die Quellenfrage geklärt und der Einfluß, den neben Cervantes die französischen Feenmärchen und Lucian auf den Don Sylvio im allgemeinen und speziell auf den Biribinker ausgeübt haben, zur Genüge nachgewiesen. Die meisten Namen (wie Padmanaba, Caramussal, Caraculiamborix) und eine Fülle von Motiven und Situationen lassen sich auf die genannten Vorbilder zurückführen. Das literarhistorische Interesse an diesen Entlehnungen würde allein genügen, um der kleinen Erzählung dauernden Wert zu verleihen.
Aber auch was Wieland Eigenes hinzugefügt hat, ist wichtig. Ich meine nicht sowohl die Führung der Erzählung, die witzige Verspottung der unsinnigen Abenteuer des Helden, die in der Tragik seines Namens „Biribinker“ und in dessen Umwandlung in „Cacamiello“ gipfelt, sondern die virtuose Art, mit der die Moral gleicherweise auf den Kopf gestellt wird wie die physischen Gesetze. Eine so beißende und doch graziöse Unterhaltung über die weibliche Tugend, wie sie die schöne Mirabella mit dem Helden unsrer Erzählung führt, war in der deutschen Literatur etwas bis dahin Unerhörtes; und es ist kein Wunder, daß Wielands Freundin Julie v. Bondeli sie ihm verdachte. Seinen Zweck,«de turlupiner certaines femmes, qui osent prétendre au sentiment et ne sont au font que des espèces méprisables», wie er am 16. Juli 1764 an sie schreibt, hat er zweifelsohne ebenso erreicht, wie Hogarth mit seinen Zeichnungen, auf die er sich beruft.
Die „Geschichte des Prinzen Biribinker“ ist endlich deswegen von besonderem Interesse, weil sie Reste eines älteren Planes zu einem verlorenen Roman Wielands herübernimmt, der eine Nachahmung von Lucians Ảλεθὴς Ἱστορία werden sollte. Wieland schreibt darüber am 20. März 1759 an J. G. Zimmermann (Ausgewählte Briefe I, 345): „So bald Sie verlangen, so will ich Ihnen das erste Buch von Lucian des Jüngern wahrhafter Geschichte zusenden. Es ist ein Manuscript, dessen Verfasser der Welt ein Geheimniß bleiben muß. Il y va presque de la tête.“ Am 27. März heißt es vom ersten Buch dieser Geschichte: «il n’est pas encore assez poli, et le second livre n’est pas achevé». Näheres geht aus Wielands Brief an Zimmermann vom 6. April 1759 (Ausgewählte Briefe I, 352) hervor, worin er schreibt: «Si mon plan devoit être exécuté, j’en donnerois III tomes, chacun composé de plusieurs livres et chapitres. Le premier tome seroit le plus extravagant. Le second livre de I. tome, qui fait celui que je vous ai envoyé, contient la description de deux Républiques, le troisième celle d’un Etat d’Abeilles intelligentes, le quatrième celle d’une nation, nommée Pagodes,dont le gouvernement, les mœurs et la religion sont tout ce qu’il y a de plus détestable. Le cinquième contiendra un voyage très-singulier dans le ventre d’une Baleine, avec les aventures merveilleuses et intéressantes, qui arrivent à l’auteur dans cette étrange région.» Wieland bittet Zimmermann um sein Urteil, indem er zugleich das erste Kapitel des Buchs übersendet; obwohl es günstig ausfiel und die Fortsetzung folgte (Ausgewählte Briefe I, 361), hat Wieland doch später das Manuskript vernichtet, infolge einer abfälligen Kritik, die seine Freundin Julie v. Bondeli über derartige Satiren fällte. Nur einiges davon ist später in die Geschichte des Prinzen Biribinker übergegangen, so der Bienenstaat (Seite 14 unseres Neudruckes) und die Begebenheiten im Walfischbauch (Seite 93 ff.).
All diese Gründe rechtfertigen wohl zur Genüge einen Neudruck der witzigen kleinen Satire; es kommt hinzu, daß sie als ein abgeschlossenes Ganzes sich leicht aus dem Rahmen des umfangreichen „Don Sylvio“ herauslösen läßt, wie schon der Umstand beweist, daß bereits der erste Verleger des Wielandschen Romans fünf Jahre nach seinem Erscheinen eine besondere Ausgabe davon veranstaltete. Diesem ersten seltenen Einzeldruck sind wir in der äußeren Einkleidung, bis auf Wiedergabe der Kopf- und Schlußleisten gefolgt und haben dementsprechend die Zwischenreden der handelnden Personen des Romans fortfallen lassen; daß dagegen dem Text selbst die erste Ausgabe von 1764 zugrunde zu legen sei, konnte nicht zweifelhaft sein. Schon der Einzeldruck von 1769 zeigt einige wichtige Abweichungen (z. B. „nicht einmal“ für „nur nicht“ 14,5. 23,16, „weiß“ für „weißt“ 4,4. 70,16. 83,16. 136,22), denen die späteren Ausgaben von 1772 und 1794 so viele sprachliche und stilistische Veränderungen hinzufügen, daß neben ihnen die erste Fassung stets ihre Geltung behaupten wird. Weiter prätendirt unser Neudruck nichts. Sache der großen historisch-kritischen Ausgabe, die von der Berliner Akademie der Wissenschaften unter Bernhard Seufferts Leitung ins Leben gerufen wird, muß es sein, die Veränderungen, die der Dichter während seiner langen schriftstellerischen Tätigkeit an seinen Werken vornahm, zu verzeichnen, damit endlich ein über hundert Jahre alter Wunsch erfüllt werde, den Goethe 1795 in seiner Streitschrift: „Litterarischer Sansculottismus“ aussprach: aufmerksame Bibliothekare möchten eine Sammlung aller Ausgaben von Wielands Werken veranstalten, damit ein verständiger fleißiger Literator aus den stufenweisen Korrekturen dieses unermüdet zum Bessern arbeitenden Schriftstellers die ganze Lehre des Geschmacks entwickeln könne.
Weimar, im Februar 1904.
Dr. Carl Schüddekopf.
Geschichte des Prinzen Biribinker.
In einem Lande, dessen weder Strabo noch Martiniere Erwähnung thun, lebte einst ein König, der den Geschichtschreibern so wenig zu verdienen gab, daß sie aus Rachbegierde mit einander einig wurden, so gar seine Existenz bey der Nachwelt zweiffelhaft zu machen. Allein alle ihre boßhaften Bemühungen haben nicht verhindern können, daß sich nicht einige glaubwürdige Urkunden erhalten hätten, in denen man alles findet, was sich ungefehr von ihm sagen ließ. Diesen Urkunden zufolge war er eine gute Art von einem Könige, machte des Tages seine vier Mahlzeiten, hatte einen guten Schlaf, und liebte Ruhe und Frieden so sehr, daß es bey hoher Strafe verboten war, die blossen Namen Degen, Flinte, Canone und dergleichen in seiner Gegenwart zu nennen. Das merkwürdigste an seiner Person, (sagen die bemeldten Urkunden) war ein Wanst von einer so majestätischen Peripherie, daß ihm die grösten Monarchen seiner Zeit hierinn den Vorzug lassen mußten. Ob ihm der Beyname des Grossen, den er bey seinen Lebzeiten geführt haben soll, um dieses nehmlichen Wanstes oder einer andern geheimen Ursache willen gegeben worden, davon läßt sich nichts gewisses sagen; so viel aber ist ausgemacht, daß in dem ganzen Umfange seines Reichs niemand war, den dieser Beyname einen einzigen Tropfen Bluts gekostet hätte. Wie es darum zu thun war, daß seine Majestät aus Liebe zu dero Völkern und zu Erhaltung der Thron-Folge in dero Familie, sich vermählen sollte, so hatte die Academie der Wissenschaften nicht wenig zu thun, vermittelst der gegebenen Grösse des königlichen Wanstes und einiger anderer Verhältnisse die Figur derjenigen Princeßin zu bestimmen, welche man würdig halten konnte, die Hofnungen der Nation zu erfüllen. Nach einer langen Reyhe von academischen Sitzungen wurde endlich die verlangte Figur, und durch eine grosse Menge von Gesandtschaften, die an alle Höfe von Asien geschickt wurden, die Princeßin ausfindig gemacht, die mit dem gegebenen Modell übereinstimmte. Die Freude über ihre Ankunft war ausserordentlich, und das Beylager wurde mit so grosser Pracht vollzogen, daß sich wenigstens fünfzig tausend Paare von den königlichen Unterthanen entschliessen mußten ledig zu bleiben, um seiner Majestät die Unkosten von dero Hochzeit bestreiten zu helfen. Der Präsident der Academie, der, ungeachtet er der schlechteste Geometer seiner Zeit war, sich alle Ehre der obgedachten Erfindung beyzulegen gewußt hatte, glaubte mit gutem Grunde, daß nunmehr sein ganzes Ansehen von der Fruchtbarkeit der Königin abhange, und weil er in der Experimental-Physik ungleich stärker war, als in der Geometrie, so fand er, man weißt nicht was für ein Mittel, die Berechnungen der Academie zu verificiren. Kurz, die Königin gebahr zu gehöriger Zeit den schönsten Prinzen, der jemals gesehen worden ist, und der König hatte eine so grosse Freude darüber, daß er den Präsidenten auf der Stelle zu seinem ersten Vezier ernannte.
Sobald der Prinz gebohren war, versammelte man zwanzig tausend junge Mädchen von ungemeiner Schönheit, die man zum voraus aus allen Enden des Reichs zusammen berufen hatte, um eine Säugamme für ihn auszuwählen. Man muß gestehen, daß unter allen diesen jungen Mädchen nicht eine einzige Jungfer war; allein man glaubte, sie würden sich nur desto besser zu dem ehrenvollen Amte schicken, wozu man sie nöthig hatte, und wozu sich jede die meiste Hofnung machte, weil der erste Leibartzt ausdrücklich verordnet hatte, daß die Wahl auf die schönste fallen sollte. Aus zwanzig tausend schönen die schönste auszuwählen, ist keine so leichte Commißion, als man denken möchte; auch hatte der Leibartzt, ungeachtet er eine gute Brille auf der Nase sitzen hatte, so viel Mühe, einen zureichenden Grund zu finden, warum er einer vor der andern den Vorzug geben sollte, daß bereits der dritte Tag sich zum Ende neigte, ehe er es nur so weit gebracht hatte, die Kandidatinnen von zwanzig tausend auf vier und zwanzig zu bringen. Allein, da doch endlich eine Wahl getroffen werden mußte, so war er eben im Begriff unter den vier und zwanzig einer grossen Brunette den Vorzug zu geben, weil sie unter allen den kleinsten Mund und die schönste Brust hatte, Eigenschaften, die, wie er versicherte, Galenus und Avicenna schlechterdings von einer guten Amme fordern; als man unvermuthet eine gewaltig grosse Biene nebst einer schwarzen Ziege ankommen sah, welche vor die Königin gelassen zu werden begehrten.
Frau Königin, sprach die Biene, ich höre, sie brauchen eine Amme für ihren schönen Prinzen. Wenn sie das Vertrauen zu mir haben wollten, mir vor diesen zweybeinigten Creaturen den Vorzug zu geben, so sollte es sie gewiß nicht gereuen. Ich will den Prinzen mit lauter Honig von Pomeranzen-Blüthen säugen, und sie sollen ihre Lust daran sehen, wie groß und fett er dabey werden soll. Sein Athem soll so lieblich riechen wie Jasmin, sein Speichel soll süsser seyn als Canarien-Sect, und seine Windeln ––
Gestrenge Frau Königin, fiel ihr die Ziege ins Wort, nehmen sie sich vor dieser Biene in Acht, das will ich ihnen als eine gute Freundin gerathen haben. Es ist wahr, wenn ihnen sehr viel daran gelegen ist, daß ihr junges Herrchen süß werde, so taugt sie dazu besser als irgend eine andere; aber es laurt, wie das Sprüchwort sagt, eine Schlange unter den Blumen. Sie wird ihn mit einem Stachel begaben, der ihm unendlich viel Unglück zuziehen wird. Ich bin nur eine schlechte Ziege; aber ich schwöre eurer Majestät bey meinem Bart, meine Milch wird ihm weit besser zuschlagen als ihr Honig; und wenn er schon weder Nectar noch Ambrosia machen wird, so versprech ich ihnen hingegen, daß er der tapferste, der weiseste und der glücklichste unter allen Prinzen seyn soll, die jemals Ziegenmilch getrunken haben.
Jedermann verwunderte sich, da man die Ziege und die dicke Biene so reden hörte. Allein die Königin merkte gleich, daß es zwo Feen seyn müßten, und dieses machte sie eine ziemliche Weile unschlüßig, was sie thun sollte. Endlich erklärte sie sich für die Biene; denn weil sie ein wenig geitzig war, so dachte sie: Wenn die Biene ihr Wort hält, so wird der Prinz allenthalben so viel Süßigkeiten von sich geben, daß man das Confect für die Tafel wird ersparen können. Die Ziege schien es sehr übel zu nehmen, daß sie abgewiesen wurde: sie meckerte dreymal etwas unverständliches in ihren Bart hinein, und siehe! da erschien ein prächtig lackirter und vergoldeter Wagen von acht Phönixen gezogen; die schwarze Ziege verschwand in dem nehmlichen Augenblick, und an ihrer statt sahe man ein kleines altes Weibchen in dem Wagen sitzen, die mit vielen Drohungen gegen die Königin und den jungen Prinzen, durch die Luft davon fuhr. Der Leib-Medicus war über eine so seltsame Wahl nicht weniger mißvergnügt, und wollte der Brunette mit dem schönen Busen den Antrag machen, ob sie nicht Lust hätte, die Stelle einer Haußmeisterin bey ihm einzunehmen; allein zum Unglück kam er schon zu spät, und mußte sichs gefallen lassen mit einer von den übrigen neunzehn tausend, neun hundert und sechs und siebenzig vorlieb zu nehmen; denn die vier und zwanzig waren alle schon bestellt.
Inzwischen machten die Drohungen der schwarzen Ziege dem Könige so bang, daß er noch an dem nehmlichen Abend seinen Staats-Rath versammlete, um sich zu berathen, was bey so gefährlichen Umständen zu thun seyn möchte; denn weil er gewohnt war, sich alle Nacht mit Mährchen einschläfern zu lassen, so wußte er wohl, daß die Feen nicht für die Langeweile zu drohen pflegen. Nachdem nun die