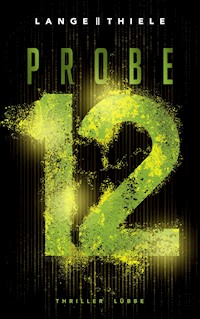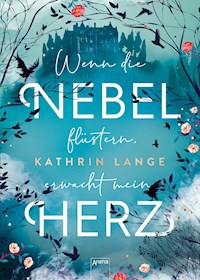7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Fabelmacht-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Liebe auf den ersten Blick - Mila hat sie erlebt, als sie nach Paris gereist und dort Nicholas begegnet ist. Doch die Fabelmacht hat ihn ihr genommen. Für Schmerz bleibt keine Zeit, denn ein fabelmächtiger Gegenspieler taucht hinter den Kulissen auf. Wie Mila hat auch er seine große Liebe verloren und ihm ist jedes Mittel recht, um diese zurückzubekommen. Als Mila sich tiefer und tiefer in seine Intrigen verstrickt, wird ihr klar: Dies ist nicht länger ein Kampf der Geschichten. Sie kann ihn nur aufhalten, wenn ihre eigene Liebe stärker ist als die Fabelmacht. Um zu bestehen, muss sie erneut gewaltige Opfer in Kauf nehmen - und am Ende sogar stärker sein als der Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Kathrin Lange
DIE
FABELMACHT- CHRONIKEN
BRENNENDE WORTE
Weitere Bücher von Kathrin Lange im Arena Verlag:
Die Fabelmacht-Chroniken – Flammende Zeichen Die Fabelmacht-Chroniken – Nicholas’ GeschichteHerz aus Glas Herz in Scherben Herz zu Asche Schattenflügel In den Schatten siehst du mich
Kathrin Lange, geboren 1969, arbeitete als Verlagsbuchhändlerin und Mediendesignerin, bevor sie 2005 das Schreiben zu ihrem Beruf machte. Seither ist sie für ihre Krimis und Jugendromane bekannt. Kathrin Lange lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Hildesheim.
1. Auflage 2018 © 2018 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Carolin Liepins unter Verwendung von Motiven von Shutterstock (© Gunnar Assmy, Lukas Gojda, spirins, SH-Vector) ISBN 978-3-401-80794-2
Besuche uns unter: www.arena-verlag.dewww.twitter.com/arenaverlagwww.facebook.com/arenaverlagfans
1
Liebe Mila!
»Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?« Diese Frage hast du mir neulich an Nicholas’ Grab gestellt. Ich habe dir nicht geantwortet, weil ich zu erschrocken war über die Verzweiflung in deiner Stimme, aber die Antwort ist: Ja.
Ja, ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick und jetzt, wo ich hier sitze und dir diesen Brief schreibe, merke ich, dass ich es schon tue, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Als du damals aus dem TGV gestiegen bist und meine dämliche Anmache mit einem Lächeln gekontert hast. Ich habe auch da schon daran geglaubt, nur bewusst war es mir wohl noch nicht. Sonst hätte ich dir kaum dein Portemonnaie und dein Handy geklaut …
Mit einem wehmütigen Lächeln strich Eric über das Notizbuch, das er auf den Knien liegen hatte. Seine Füße hingen über die Dachkante ins Leere. Fünf Stockwerke Luft unter ihm. Fast zwanzig Meter bis hinunter auf den Asphalt.
Sein Blick wanderte in die Tiefe und dann über die Straße zu dem Mehrfamilienhaus, in dem Mila mit ihrer Mutter wohnte. Milas Umriss hinter der Scheibe im vierten Stock war nur undeutlich zu erkennen, denn sie hatte kein Licht in ihrem Zimmer gemacht. So musste Eric sich vorstellen, wie sie auf der breiten Fensterbank saß und hinaus in die Abenddämmerung starrte. Ihr schmales Gesicht. Die Sommersprossen, die blass geworden waren. Seit Wochen schon hatte sie keinen Fuß vor die Tür gesetzt, hatte getrauert und geschwiegen. Immer nur geschwiegen und getrauert. Um Nicholas, ihre große Liebe. Eric seufzte. Sein Herz fühlte sich müde an.
Wie gern er Mila geholfen hätte!
Er senkte den Blick wieder auf den Brief. Der Kugelschreiber, den er zusammen mit dem Notizbuch gekauft hatte, war billig und schrieb nicht gut. Und seine Schrift sah auch ziemlich krakelig aus.
Egal.
Er schrieb weiter.
Ich muss oft daran denken, wie du mir zum ersten Mal gezeigt hast, wozu die Fabelmacht fähig ist. Wozu du fähig bist. Dieser magische Moment, als du dein Shirt von Weiß zu Schwarz umgeschrieben hast … Einfach so! Danach hatte ich das Gefühl, dir ein bisschen von meiner »Magie« zeigen zu müssen. Erinnerst du dich an die Stunden, die wir gemeinsam auf dem Dach dieses Abbruchhauses verbracht haben? Wie ich dich festgehalten habe, damit du nicht in den Abgrund stürzt?
Ich wünschte, wir könnten die Zeit zurückdrehen. Dorthin zurückkehren. Aber Nicholas würde uns auch dann nicht in Ruhe lassen, oder?
Eric las seinen letzten Satz noch einmal. Nicholas! Nicht mal aus seinen Liebesbriefen konnte dieser Typ sich raushalten, und das, obwohl er seit Wochen tot war.
Eric strich das »oder« mit ein paar energischen Strichen durch.
Ich weiß, dass ich niemals Nicholas’ Platz in deinem Herzen einnehmen kann, denn da war tatsächlich etwas Magisches zwischen euch, das muss ich zugeben. Aber wie in vielen Geschichten, in denen es um Magie geht, ist der Preis, den ihr bezahlen musstet, schrecklich hoch. Manchmal wünsche ich mir, du würdest es unfair finden, dass er dich einfach so allein gelassen hat. Mila, ich möchte dich wieder vor dem Abgrund bewahren. Wenn du mich nur lassen würdest …
Was für ein kitschiger Scheiß! Mit einem frustrierten Aufschrei warf Eric Stift und Notizbuch neben sich auf das Metalldach. Der Stift rollte auf der abschüssigen Ebene davon und fiel mit einem klickernden Geräusch ein paar Stockwerke tiefer auf einen Mauervorsprung. Das Notizbuch konnte Eric gerade noch retten.
Er atmete ein paarmal tief durch, las seine letzten Sätze noch mal. Was tat er hier eigentlich? Er wusste doch genau, dass Mila auf keinen Fall erfahren durfte, was er wirklich für sie empfand.
Es würde ihr nur ein schlechtes Gewissen bereiten, und das war wirklich das Letzte, was er wollte. Mila würde ihn niemals so lieben können, wie sie Nicholas geliebt hatte.
Mit einem Ruck trennte Eric das Blatt aus dem Notizbuch, zerriss es in tausend winzige Fetzen, warf sie in die Luft und sah zu, wie der Wind sie über Paris verteilte.
Mila saß auf der breiten Fensterbank und blickte hinaus auf die gegenüberliegende Hausfassade, aber sie sah weder die Fenster, in denen ein Licht nach dem anderen angeschaltet wurde, noch das metallbeschlagene Dach, das im Schein der letzten Sonnenstrahlen schimmerte wie Quecksilber. Stattdessen hatte sie immer und immer wieder nur ein Bild vor sich.
Nicholas in ihren Armen. Da war so schrecklich viel Blut gewesen und dann war die Welt zusammengeschrumpft, bis sich in ihrem Zentrum nur noch Nicholas und sie befanden. Kurz darauf hatte er sie allein gelassen. Für immer.
Mit einem Ruck kam sie zu sich. Ihre Augen brannten wie Feuer. Sie rieb sich die Wangen. Sie waren trocken. Schon seit Wochen hatte sie keine Tränen mehr.
Sie brauchte all ihre Energie, das Notizbuch aufzuschlagen, das sie schon vor Stunden auf ihre Knie gelegt hatte. Sie hatte sich vorgenommen zu schreiben, aber ihr wollten keine Worte einfallen, die es lohnten, niedergeschrieben zu werden. Unberührt und weiß starrte die erste Seite sie an.
Mila fröstelte.
Kalt, schrieb sie schließlich. Wie jedes Wort seit Nicholas’ Tod kam ihr auch dieses schal und inhaltsleer vor. Sie strich es wieder durch. Schrieb: eiskalt. Auch das strich sie durch, ersetzte es durch winterkalt.
Früher war Schreiben für sie so leicht wie Atmen gewesen. Die Worte waren einfach aus ihr herausgeflossen. Aber inzwischen war es ihr unmöglich geworden. Sie hatte keine Ahnung, wie sie diesen unendlichen Schmerz aushalten sollte. Was, wenn sie bis zum Ende ihres Lebens darunter leiden würde? Sie drehte das rechte Handgelenk so, dass sie auf das bläuliche Geflecht ihrer Pulsadern blicken konnte. Halb erwartete sie, blau flammende Schriftzeichen dort zu sehen, doch da war nichts. Ihre Gedanken wanderten zurück zu einem Tag kurz nach Nicholas’ Tod. Sie hatte zusammen mit Helena, ihrer Mutter, und Eric Paris verlassen wollen, doch im Zug war grellblaue Flammenschrift auf ihrem Handgelenk erschienen. Ein einziges Wort nur: Nicholas. Wie Feuer hatte es sich in ihr Fleisch gebrannt und dann war der Schmerz durch ihre Adern gerast. Höllenqualen, die schlimmer und schlimmer geworden waren, je weiter sie sich von Paris entfernt hatten. Am Ende war ihr, ihrer Mutter und Eric nichts anderes übrig geblieben, als umzukehren. Woraufhin das Flammenmal verschwunden und bis heute nicht wiedergekehrt war.
Mila legte den Hinterkopf gegen das Fenster und schloss die Augen, doch sie erreichte damit lediglich, dass sie Nicholas’ Gesicht vor sich sah. Bleiche Wangen. Augen, die diese besondere Farbe hatten. Mitternachtsblau.
Mechanisch streichelte sie die Haut an ihrem Handgelenk.
Sie wusste, dass das Flammenmal wiederkehren würde, sollte sie noch einmal versuchen, die Stadt zu verlassen. Die Fabelmacht – diese mächtige und furchtbare Gabe, die nur hier in Paris existierte und die Nicholas das Leben gekostet hatte – war noch nicht fertig mit ihr. Mila öffnete die Augen wieder. Ihr Blick wanderte zum Fenstergriff, dann hinunter auf die Straße. Die Wohnung lag im vierten Stock und die Räume waren über drei Meter hoch. Bis hinunter auf den Bürgersteig waren es also mehr als zwölf Meter. Reichte das, um …?
Sie vertrieb den Gedanken. Eric fiel ihr ein. Eric, der am Rand des Abgrunds entlangtänzelte, als gäbe es die Möglichkeit abzustürzen gar nicht.
Er war da gewesen, die unendlichen zehn Wochen seit Nicholas’ Tod.
Sie malte seinen Namen auf das Papier. Ihre Augen brannten so sehr, dass sie nur undeutlich sah, wie irgendetwas Weißes an ihrem Fenster vorbeigeweht wurde. Blütenblätter, dachte sie zuerst, obwohl doch gar nicht Frühling war, sondern fast Herbst. Erst dann begriff sie, dass es kleine Fetzen Papier waren. Irgendjemand musste sie ganz in der Nähe aus dem Fenster geworfen haben. Mila folgte ihnen mit den Blicken, bis sie sie nicht mehr sehen konnte. Dann schaute sie wieder auf das Blatt. Ihr Herz sank. Da stand nicht Eric, wie sie es vorgehabt hatte.
Da stand Nicholas.
Sie wollte seufzen, aber nicht einmal das konnte sie. Plötzlich hatte sie das Gefühl, sich nie wieder in ihrem Leben bewegen zu können.
So konnte das nicht weitergehen!
Wenn sie am Ende nicht doch noch aus dem Fenster springen wollte, musste sie etwas unternehmen. Sie schlug eine neue Seite auf, dann lauschte sie tief in sich hinein, wo ihre Fabelmacht schlummerte.
Und die ersten Worte begannen, sich zu formen.
Der Wind wehte eine alte Plastiktüte über den Bürgersteig am Quai Saint-Michel, bis sie an einer Straßenlaterne liegen blieb. Für Anfang September war es extrem kalt. Maréchal legte beide Hände um seine Teetasse. Der Buchhändler, der einen der grünbedachten Bouquinistenstände betrieb, die das Ufer der Seine säumten und die alte Bücher, Plakate und Postkarten anboten, hatte früh Mittag gemacht. Der Bistrostuhl, auf dem er saß, drückte ihm unangenehm ins Kreuz. Die Scheibe des kleinen Cafés, in dem er wie gewöhnlich seine Pause verbrachte, hätte dringend geputzt werden müssen. Die Abdrücke von verschmierten Kinderhänden waren deutlich zu sehen. Die Schicht aus Staub und Ruß schimmerte im Licht der kalten Herbstsonne. Maréchal ließ die Tasse los und nahm den Füllhalter von seinem Notizbuch. Eigentlich hatte er ein neues Gedicht schreiben wollen, aber in den letzten Wochen ging ihm das Dichten nicht mehr so leicht von der Hand wie früher.
Kein Wunder, nach allem, was geschehen war! So viel Leid und Tod. Und so viele Grübeleien seitdem. Seit Nicholas tot war, überlegte Maréchal, ob er ihn irgendwie doch hätte retten können. Aber egal, wie oft er sich die Ereignisse auch ins Gedächtnis rief: Ihm wollte einfach nicht einfallen, wie er das hätte anstellen sollen.
Er versuchte, der düsteren Gedanken Herr zu werden, als er eine junge rothaarige Frau bemerkte, die auf der anderen Straßenseite auf seinen Bücherstand zumarschierte. Direkt davor blieb sie stehen, sah sich um. Ganz offensichtlich suchte sie nach ihm, denn sie stellte Jean, seinem Standnachbarn, eine Frage. Der schüttelte den Kopf. Dann wies er über die Straße und auf das Café, in dem Maréchal saß. Die junge Frau bedankte sich bei ihm, überquerte die viel befahrene Straße in einem ziemlich waghalsigen Manöver. Als sie das Café betrat, spielte die Ansammlung von kleinen Glocken über der Ladentür die ersten Töne der kleinen Nachtmusik. Die junge Frau achtete nicht darauf. Sie trug einen schmalen hellgrauen Mantel, Stiefel mit Absätzen und über der Schulter eine Tasche, die aus bunten Lederstreifen gemacht war. Sie orientierte sich und steuerte dann direkt auf Maréchal zu.
Er unterdrückte ein Seufzen. »Hallo, Isabelle«, sagte er.
Statt ihn ebenfalls zu begrüßen, knöpfte sie ihren Mantel auf und setzte sich ihm gegenüber. Unter dem Mantel trug sie Jeans und eine helle Tunika.
»Hätten wir es verhindern können?«, fragte sie rundheraus.
Maréchal gestattete sich nun doch ein Seufzen. Isabelle war Milas beste Freundin. Sie machte sich natürlich die gleichen Gedanken wie er. »Nicholas’ Tod, meinst du?«, fragte er zurück, nur um einen Moment zum Nachdenken zu haben.
Isabelle nickte. Der Kellner erschien und sie bestellte sich einen Café au Lait. Als der Mann wieder fort war, beugte sie sich über den kleinen Tisch. »Ich habe Angst, dass sie sich etwas antut.«
»Mila?«, erwiderte er und kam sich dabei ziemlich dämlich vor. Natürlich Mila. Wer sonst?
Isabelle nickte so ernsthaft, als sei das eine völlig berechtigte Frage. »Seit Nicholas tot ist, isst sie kaum noch. Sie hockt entweder auf diesem Friedhof an seinem Grab oder auf der Fensterbank in ihrem Zimmer und starrt nach draußen. Ich habe eine Heidenangst, dass sie eines Tages einfach das Fenster aufmacht und springt.«
Maréchal schluckte. »Ich wüsste nicht, wie ich da helfen könnte.«
Isabelle schien anderer Ansicht zu sein. »Aber ich sehr wohl. Du bist fabelmächtig. Irgendetwas müsst ihr doch tun können, damit es ihr besser geht!«
Der Kellner brachte den bestellten Café au Lait und das gab Maréchal Gelegenheit, über Isabelles Frage und über die Fabelmacht nachzugrübeln, diese uralte Fähigkeit, durch Schreiben die Wirklichkeit zu verändern. Er selbst besaß sie. Ebenso wie Mila und Helena, ihre Mutter. Und auch Nicholas hatte sie besessen.
»Nein«, sagte er. »Die Fabelmacht versagt in diesem speziellen Fall, fürchte ich.« Helena hatte es probiert, das wusste er. Und auch er hatte einmal den völlig hoffnungslosen Versuch unternommen, Mila den Schmerz wegzuerzählen. Vergeblich.
»Ich habe nie richtig kapiert, wie es funktioniert«, sagte Isabelle.
»Tja …« Maréchal hatte weder Lust noch Kraft für dieses Gespräch, aber er kannte Isabelle. Sie würde nicht lockerlassen.
»Was weiß du über die Universumstheorie?«, fragte er.
Isabelle zuckte nur mit den Schultern.
»Also gut«, seufzte Maréchal. »Pass auf: Jeder Mensch, der eine Geschichte schreibt, erschafft dadurch ein neues Universum, in dem diese Geschichte wirklich passiert. Jeder Leser übrigens auch, aber das tut in unserem Fall hier nichts zur Sache. Die Fabelmacht nun befähigt dazu, Dinge, die in unserem Universum existieren, zu verändern. Ich könnte zum Beispiel ganz leicht deinen Kaffee in eine Tasse Tee umschreiben.«
Isabelle verzog das Gesicht. »Untersteh dich«, sagte sie und nahm einen Schluck.
»Manche denken, dass Fabelmächtige zwischen unserem Universum und dem, über das sie geschrieben haben, eine Verbindung schaffen«, fuhr Maréchal fort. »Man nennt es, den Schleier zwischen den Universen überschreiten. Ich finde, das Bild passt nicht besonders gut, aber es ist das Beste, das wir haben. Jedenfalls: Je größer die Veränderung ist, die herbeigeschrieben werden soll, umso mehr Macht braucht man. Einen Café au Lait umzuschreiben, ist eine Kleinigkeit. Aber, sagen wir, eine ganze Stadt vom Erdboden verschwinden zu lassen …«
»Oder jemanden von den Toten zurückholen«, warf Isabelle ein.
Maréchal nickte betreten. »… oder jemanden von den Toten zurückholen, ist so schwer, dass man dafür Riesenkräfte braucht. Kein Lebender besitzt diese Kräfte. Und vielleicht steckt auch darin die Antwort auf deine Frage, warum wir Mila die Trauer um Nicholas nicht einfach wegerzählen können. Wir haben es versucht, Helena und ich. Aber Milas Trauer ist so tief und unfassbar, dass wir mit unseren Fabelmachtkräften nicht dagegen ankommen. Genauso gut könnten wir versuchen, die Umlaufbahn der Erde um die Sonne umzukehren.«
»Hm.« Isabelle sah nicht wirklich zufrieden aus und Maréchal konnte sich vorstellen, wie sie sich fühlte. Er nutzte die Fabelmacht seit Jahrzehnten, hatte zahllose Abhandlungen und Geheimschriften über sie gelesen und selbst er hatte ihre Wirkungsweise nicht ansatzweise verstanden.
Er musste es anders versuchen. »Kennst du die Geschichte von Abélard und Héloise?«, fragte er.
Sie sah ihn verwirrt an. »Natürlich. Das französische Pendant zu Romeo und Julia. Sie lebten im dreizehnten Jahrhundert, oder?«
»Im zwölften. Abélard war Mönch und Gelehrter. Und Héloise seine Schülerin. Sie verliebten sich ineinander, aber natürlich durften sie nicht zusammen sein, also ging Héloise irgendwann auch ins Kloster. Sie schrieben sich jahrelang Liebesbriefe, die heute noch als die schönsten gelten, die je jemand erdacht hat.«
Isabelle nippte ungeduldig an ihrem Café au Lait. »Abélard und Héloise interessieren mich nicht. Mir geht es um Nicholas und Mila.«
»Das mag sein«, entgegnete Maréchal. »Aber die Geschichte gibt dir eine Vorstellung davon, wie gewaltig und wie uralt die Macht ist, mit der wir es zu tun haben. Was nämlich außer uns Fabelmächtigen niemand weiß: Abélard und Héloise gehörten zu uns. Sie waren die ersten Fabelmächtigen, die in unseren Schriften erwähnt sind. Das ist nun fast neunhundert Jahre her. Und seit all der Zeit ist die Fabelmacht nicht besiegt worden. Sie hat nur immer weiter Leid angerichtet.«
So viel Leid, wie Isabelle nicht ansatzweise ahnte. Viele schreckliche Dinge in der Geschichte der Stadt waren auf Fabelmächtige zurückzuführen, die ihre Macht zu ihrem Vorteil hatten nutzen wollen. Inzwischen waren die meisten von ihnen, die die Fähigkeit beherrschten, zur Vernunft gekommen. Sie hatten sich in einer Bruderschaft zusammengeschlossen, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Fabelmacht zu entkräften, indem sie sie nicht mehr nutzten. Doch so einfach war es nicht, das hatte die Sache mit Nicholas einmal mehr bewiesen. Nichts an der Fabelmacht war einfach.
»Diese Macht ist unerbittlich«, sagte er. »Wenn einmal eine Ereigniskette in Gang gesetzt ist, ist sie nicht mehr aufzuhalten.«
»Du redest von der Geschichte, die Nicholas als Teenager geschrieben hat, oder?«
Maréchal nickte. Als Junge hatte Nicholas keine Ahnung davon gehabt, dass er die Fabelmacht besaß. Das war erst herausgekommen, nachdem er diese unselige Liebesgeschichte geschrieben hatte, mit seinem eigenen tragischen Tod am Ende … Letztendlich hatte die Fabelmacht das getan, was sie immer tat: Sie hatte das, was Nicholas geschrieben hatte, wahr werden lassen. Tief in den Katakomben von Paris hatte sein eigener Vater die Waffe gegen ihn gerichtet und ihn erschossen. Und all ihre Versuche, ihn zu retten, waren vergeblich gewesen.
Isabelle trank ihren Kaffee aus. »Eine Liebe wie die von Nicholas und Mila – so etwas habe ich noch nie erlebt«, sagte sie. »Irgendwie glaube ich ja, dass sie ihn nur deswegen so liebt, weil die Fabelmacht sie dazu zwingt. Weil er eben in seiner Geschichte geschrieben hat, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt.«
»Nein.« Das eine Wort kam nicht von Maréchal, sondern von einer Frau, die kurz zuvor das Café betreten und auf die er nicht geachtet hatte. »Nein«, wiederholte sie. Sie zog sich einen Stuhl von einem der anderen Tische heran und setzte sich zu ihnen.
Ja, dachte Maréchal. Kommt nur alle her und verderbt mir meine Mittagspause. Laut sagte er: »Ich weiß nicht, Odette …«
»Nicholas hat ja nicht nur über Mila geschrieben«, widersprach Odette ihm. »Sondern Mila auch über ihn, und zwar lange, bevor sie sich kannten. Die beiden haben eine Verbindung, die tatsächlich einzigartig ist – selbst unter Fabelmächtigen.«
Odette war Nicholas’ Ziehmutter, eine alte Freundin seines Vaters, die sich um Nicholas gekümmert hatte, als seine Mutter gestorben war. Odette war um einiges älter als Maréchal. Sie trug ein teuer aussehendes lavendelfarbenes Kostüm, dazu eine Perlenkette und einen farblich auf Rock und Jacke abgestimmten Mantel. Statt Maréchal zu begrüßen, legte sie eine Hand auf die seine und drückte sie kurz. Ihre Haut war kühl und faltig. Unter ihrer Berührung entspannte sich Maréchal etwas. Odette hatte diese Wirkung oft auf Menschen. Obwohl sie nicht fabelmächtig war, half sie ihm immer wieder, sich selbst und auch seine Gabe besser zu verstehen.
Jetzt wandte sie sich an Isabelle. »Ich glaube fest daran, dass Mila Nicholas auch so sehr lieben würde, wenn es die Fabelmacht nicht gäbe.«
Isabelle sah nicht überzeugt aus. Das Gespräch schien ihr die Sorgen um die Freundin nicht zu nehmen, ganz im Gegenteil. Und was, wenn sie recht hatte? Was, wenn Mila tatsächlich aus dem Fenster sprang? Nicholas war in ihren Armen einen überaus gewaltsamen Tod gestorben. Selbst wenn sie ihn nicht so sehr geliebt hätte, hätte das ausgereicht, ein junges Mädchen wie sie zu zerstören.
Minutenlang hingen sie alle ihren eigenen Gedanken nach, bis Odette schließlich in einer energischen Geste den Kopf schüttelte. »Was passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Nicht mal die Fabelmacht befähigt einen, die Vergangenheit umzuschreiben.« Sie wirkte sonderbar gefasst, mit sich und den Umständen im Reinen. Wie machte sie das? Immerhin hatte sie Nicholas wie einen Sohn geliebt. »Was passiert ist, können wir nicht mehr ändern«, wiederholte sie. »Wir können nur versuchen, damit zu leben.« Sanft legte sie Isabelle eine Hand auf den Arm. »Kümmere dich um Mila. Sei für sie da.« Sie hielt inne, legte den Kopf schief. »Und kümmere dich auch um Eric.«
Fragend hob Isabelle die Augenbrauen.
»Er versucht ebenfalls alles, um Mila zu helfen. Aber er selbst, Isabelle – er hat niemanden, der ihm hilft.«
Ein fernes Lächeln glitt über Isabelles Lippen. Es sah wehmütig aus und Maréchal fragte sich, was es zu bedeuten hatte. »Ja«, hörte er sie leise sagen. »Der arme Eric liebt Mila und weiß, dass er sie nie kriegen kann. Was für eine Scheißwelt, oder?« Sie zuckte mit den Schultern und kramte nach ihrem Portemonnaie, um ihren Kaffee zu bezahlen.
Maréchal winkte ab. »Das übernehme ich.«
Sie dankte ihm. »Ich glaube, ich muss dann mal weiter …«, murmelte sie und stand auf.
»Kümmere dich um Eric!«, bat Odette sie erneut. Sie versprach es. Dann verabschiedete sie sich und verließ das Café.
Maréchal sah zu, wie sie quer über den Quai Saint-Michel davonging. Ein roter Sportwagen musste ihretwegen bremsen, aber sie schien es überhaupt nicht zu bemerken. Als Isabelle außer Sichtweite war, wandte Maréchal sich Odette zu. »Es ist nicht nur das, oder?«
Sie schaute fragend.
»Es ist nicht nur, dass du versuchst, mit Nicholas’ Tod zu leben«, präzisierte er. »Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass du sehr viel besser damit klarkommst als wir anderen. Du wirkst irgendwie – nun ja, gelassener.« Er zuckte mit den Schultern, um seinen Worten den Anflug von Vorwurf zu nehmen.
Sie lächelte schwach. »Vielleicht«, flüsterte sie. »Vielleicht hast du recht.« Sie lauschte in sich hinein. »Ich tröste mich einfach mit dem Gedanken, dass irgendwo, vielleicht in einem anderen Universum als unserem, jemand eine Geschichte geschrieben hat, in der Nicholas noch am Leben ist.«
Maréchal brauchte einen Moment, bevor er begriff, wovon sie sprach. »Das würde bedeuten, dass es mindestens ein Universum gibt, in dem er noch lebt«, sagte er.
In einem anderen Universum
Blicklos starrte Nicholas auf die regennasse Grabplatte, in der sich der wolkenzerrissene Himmel spiegelte. Milas Name war durch die Reflexion kaum zu erkennen und auch nicht das Zitat von Anaïs Nin, das unter ihrem Namen stand.
Wir schreiben, um das Leben zweimal zu schmecken.
Nicholas’ Hände krampften sich zusammen. Ein einziger Gedanke hämmerte wieder und wieder in seinen Kopf: Es war seine Schuld, dass Mila tot war. Wenn er nicht diese elende Geschichte geschrieben und seinen Vater damit gezwungen hätte, auf ihn zu schießen, dann hätte Mila sich nicht schützend vor ihn geworfen. Dann würde sie noch leben.
Das Geräusch des Schusses, der Mila getötet hatte, begleitete ihn Tag und Nacht. Und dazwischen fühlte er sein Herz, das seit ihrem Tod weiterschlug, ohne jedes Zögern, kräftig, als wäre nichts passiert.
Er war am Leben.
Während Mila tot war.
»Hey!« Jemand packte ihn von hinten an den Schultern. »Hey. Du bist immer noch hier.«
Nicholas musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer hinter ihm stand. Luc, sein bester Freund, war in den letzten Tagen immer wieder hierhergekommen. Er versuchte, Nicholas dazu zu bringen, etwas zu essen, sich ein paar Stunden hinzulegen oder wenigstens kurz bei Odette vorbeizuschauen. Manchmal gelang es ihm. Aber kaum ließ er Nicholas einen Moment unbeobachtet, stahl der sich wieder davon und kam auf den Friedhof. Hier auf Père-Lachaise konnte Nicholas sich wenigstens einreden, Mila nahe zu sein.
»Warum hat dieses Universum entschieden, dass sie sterben musste und nicht ich?«, presste er hervor. »Warum bin ich mächtig genug, um eine Geschichte zu schreiben, die niemand auf der Welt stoppen kann? Aber ich bin nicht mächtig genug, Mila zurück ins Leben zu schreiben.«
Er hatte es mehr als einmal versucht. Es hatte nicht funktioniert.
Luc schwieg für einen Moment. »So kann das nicht weitergehen, Kumpel«, sagte er schließlich. »Du isst kaum noch etwas, verbringst Tage und Nächte hier an ihrem Grab, dir ist völlig egal, ob es regnet oder saukalt ist. Dieses Universum wird dich sterben lassen, wenn du so weitermachst. Es …« Er brach ab, weil Nicholas sich nun doch zu ihm umdrehte.
Luc zuckte unter seinem Blick zusammen. »Ich weiß«, fuhr er etwas weniger scharf fort, »dass es das ist, was du willst. Aber du solltest an ein paar Menschen denken. An deinen Vater …«
»Lass meinen Vater aus dem Spiel! Er hat Mila erschossen.«
Luc schwieg wieder und Nicholas wusste, was ihm durch den Kopf ging: Ja, weil du ihn mit deiner Geschichte dazu gezwungen hast.
»Dann denk eben an Odette«, sagte Luc. »Sie liebt dich genauso, wie du Mila geliebt hast, und sie macht sich Sorgen um dich.«
Nicholas brauchte einige Augenblicke, bevor er den Kopf schütteln konnte. »Niemand liebt so, wie Mila und ich uns geliebt haben.«
»Ach, Nicholas!«
»Lass mich einfach …« Nicholas drehte sich wieder zu Milas Grab um.
Und diesmal fügte Luc sich. Schweigend blieben sie nebeneinander stehen, während die Minuten verrannen. Eine nach der anderen. Jede Einzelne ein viel zu winziges Stück näher am Tod als die vorangegangene.
Nicholas wünschte, er hätte seinem Herzen ebenso wie seinem Freund befehlen können, still zu sein. Aber das hatte er schon versucht. Es war nutzlos.
Sein Herz schlug einfach weiter. Tag für Tag. Und mit jedem Takt hallte Milas Name in ihm wider.
Mila.
Mila.
Mila.
Irgendwann sah Luc auf. »Komm«, sagte er. »Ich bringe dich nach Hause.«
2
Mila las, was sie in der letzten Viertelstunde zu Papier gebracht hatte. Es war eine ziemlich genaue Beschreibung von ihr selbst – wie sie in der Fensterbank saß und nach draußen starrte, wie sich langsam die Nacht über Paris senkte, wie sich ihr blasses, schmal gewordenes Gesicht und die wirren blonden Locken in der Scheibe spiegelten.
Es war das erste Mal seit Nicholas’ Tod, dass sie mehr als einzelne Worte aufs Papier gebracht hatte und zu ihrer Überraschung war es ihr mit der Zeit sogar erstaunlich leichtgefallen. Inzwischen wusste sie auch, wie das, was sie hier aufschrieb, enden sollte. Sie fragte sich, warum ihr das nicht schon viel eher eingefallen war. Es war die Lösung für all ihren Kummer, nachdem es unmöglich war, Nicholas von den Toten zurückzuholen.
Aber betrog sie Nicholas nicht damit, so etwas zu schreiben? Sie tippte mit dem Stift auf das Papier. Du kannst ihn nicht mehr betrügen, wisperte es in ihr. Er ist tot! Kapier das endlich. Tot!
Sie blickte auf das Papier, auf ihre geschwungene Handschrift, dann schaute sie hinüber zum Fenster. Entweder sie tat das hier – oder sie wählte früher oder später den anderen Weg, den aus dem Fenster, der wieder so viel Leid nach sich ziehen würde. Für sie wäre es dann vorbei. Aber andere Menschen würden um sie trauern. Helena, ihre Mutter. Eric. Isabelle, ihre beste Freundin.
Nein. So weit war sie noch nicht, ihnen das anzutun. Das hier war der bessere Weg.
Sie straffte die Schultern, griff den Stift fester und fügte den letzten Satz hinzu: In diesem Augenblick vergaß sie Nicholas und alles, was mit der Fabelmacht zusammenhing.
Die Spitze ihres Stiftes begann, blau zu flimmern. Das Licht ergoss sich auf das Papier, füllte die Linien und Bögen ihrer Schrift wie Wasser, das trockene Gräben füllte. Gleich darauf leuchtete der gesamte Abschnitt in diesem überirdischen Blau, das anzeigte, dass die Fabelmacht ihre Wirkung entfaltete. Gleichzeitig fühlte es sich an, als würde etwas aus Mila herausfließen, so ähnlich wie das blaue Leuchten aus dem Stift floss.
Ihre Augen brannten noch immer. Sie wusste, dass sie blinzeln musste, damit geschehen würde, was sie geschrieben hatte, aber plötzlich überwältigte sie die Panik. Es war falsch, was sie hier tat, furchtbar falsch! Oder?
Aber für ein Zurück war es zu spät. Das Fabelmachtleuchten erlosch. Langsam schloss Mila die Augen. Das Notizbuch entglitt ihren Fingern und fiel zu Boden. Ihr Herz flatterte in ihrem Brustkorb. Als sie die Lider wieder hob, brannten sie noch immer. Sie wandte den Kopf und sah sich im Raum um. Wo war sie? Wie war sie hierhergekommen? Hatte sie nicht eben noch im TGV gesessen?
Mehrere Minuten lang versuchte sie zu begreifen, was passiert war, dann flog die Tür auf. Jemand stürzte herein und blieb wie angewurzelt in der Tür stehen. Ein Junge. Er war schlaksig, hatte braunes, wirres Haar. Seine Augen waren von der Farbe von Milchkaffee und weit aufgerissen. Kurz streifte sein Blick den Stift, den sie noch immer in der Hand hielt.
»Was hast du gemacht?«, fragte er mit einem Zittern in der Stimme. »Ich habe das Fabelmachtleuchten gesehen, vom Dach gegenüber aus, und da bin ich her, so schnell ich konnte. Was hast du getan, Mila?«
Helena stand hinter ihm, das registrierte Mila nur ganz am Rande. Das Gesicht ihrer Mutter war ein fahles Oval im Halbdämmer. Schreckensweit aufgerissene Augen.
Bedächtig legte sie den Stift weg. Ihr Kopf schien wie leer gefegt. Mit zitterigen Beinen stand sie auf. Ihre rechte Seite fühlte sich kalt an von der Scheibe, gegen die sie sich gelehnt hatte. Sie sah, wie der Junge einen Schritt auf sie zumachte, und sie wusste, dass sie ihn schon einmal gesehen hatte. Bei ihrer Ankunft in Paris. Als sie aus dem TGV gestiegen war, hatte er sie angequatscht. Wann war das gewesen? Vor wenigen Augenblicken, oder? In ihrer Erinnerung klaffte ein tiefes, gähnendes Loch. Wohl doch eher gestern …
Dann, plötzlich, ein ganz kurzes Bild. Sie war über die Beine dieses Jungen gestolpert und hatte ein bisschen mit ihm herumgealbert. »Wer bist du?« Sie flüsterte die Frage. »Auf dem Bahnhof … du hast mich blöd angemacht … Eric? … So heißt du, oder?«
Er nickte. Sie zermarterte sich das Hirn, was danach geschehen war, aber das war tatsächlich das Letzte, an das sie sich erinnern konnte. Alles seitdem bis hin zu der Sekunde, in der sie eben hier auf der Fensterbank zu sich gekommen war, war wie weggewischt. »W… wo bin ich?«, murmelte sie. Verwirrt sah sie zu, wie Eric zu ihr kam, sich bückte und ein Notizbuch aufhob, das ihr offenbar heruntergefallen war. Rasch überflog er, was sie geschrieben hatte. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Schließlich ließ er das Buch sinken. »Du hast dir die gesamte Erinnerung weggeschrieben.« Er sagte es nicht als Frage, auch wenn er sichtlich fassungslos war. Nein, fassungslos war das falsche Wort. Er war geschockt.
Richtig und wahrhaftig geschockt.
»Was meinst du mit weggeschrieben?«, fragte sie. Das Wort klang sonderbar.
Helena kam heran, ließ sich von Eric das Notizbuch geben und las ebenfalls.
Auch sie wurde totenblass. »Warum hast du das getan?«, flüsterte sie. In ihren Worten schwang so viel Schrecken mit, dass sich das Unbehagen in Mila in einen schmerzhaften Knoten verwandelte.
»Was getan?« Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wovon die beiden sprachen. Mit einer weit ausholenden Geste wies sie im Zimmer umher. »Wo sind wir hier? Wie bin ich hierhergekommen?« Ihr Blick wanderte durch das Fenster hinaus in die Nacht. Ganz am Rand konnte man ein Stück des beleuchteten Eiffelturms sehen. Paris. Sie war in Paris, klar. Sie erinnerte sich ja noch daran, wie sie am Gare de l’Est aus dem Zug gestiegen war. Aber danach …
»Warum bist du hier?«, fragte sie ihre Mutter.
Helena und sie hatten sich gestritten, zu Hause in Berlin. Daran erinnerte sie sich. Sie wusste, dass sie nach diesem Streit Isabelle angerufen hatte und in den Zug gestiegen war. Und sie wusste auch noch, dass sie Helena bittere Vorwürfe gemacht hatte, weil sie ihr nicht verriet, wie ihr Vater – und auch ihr damals dreijähriger Bruder Antoine – kurz vor ihrer Geburt ums Leben gekommen waren.
»Und was …« Sie verstummte, als Helena ihre Hand ergriff, kurz auf die Innenseite des Gelenks schaute und die dünne Haut dort dann wieder und wieder streichelte.
»Kind …« Helenas Stimme war ganz flach.
Mila fühlte sich, wie mit kalten Fingerspitzen berührt. Sie hasste es, wenn ihre Mutter sie Kind nannte. Sie hasste es, wie ein unreifer Teenager behandelt zu werden. Mit einem Ruck riss sie ihrer Mutter ihre Hand weg. »Lass das!«
Helena wich zurück.
Eric trat vor sie hin.
»Was geht hier vor?«, fragte sie ihn.
Er nahm sie bei den Schultern, bugsierte sie zu einem weiß lackierten Schreibtisch und drückte sie auf dem Drehstuhl nieder. Die Tischplatte war nahezu leer. Nur eine kleine Tonfigur stand darauf, ein dicker, lächelnder Buddha. Zwei völlig runtergeschriebene Bleistifte lagen daneben. Ein brauner Kreis zeigte an, wo einmal eine Kaffeetasse gestanden haben musste.
»Okay.« Eric drehte den Stuhl so, dass Mila ihn ansehen musste. Tief sah er ihr in die Augen. »Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst?«
Mila runzelte die Stirn. »Ich stolpere über deine Füße. Du fängst mich auf und wir frotzeln ein bisschen.«
Ein Schatten flog über sein Gesicht, den sie nicht deuten konnte. Aber er nickte. Offenbar trog ihre Erinnerung sie also nicht. »Und danach?«, fragte er.
Mila senkte den Blick und rieb sich die Stirn. In ihrem Kopf befand sich ein riesiges schwarzes Loch, wo die Erinnerung hätte sein müssen. »Nichts«, antwortete sie. »Absolut nichts.«
Helena stieß einen leisen Fluch aus, dann drängte sie Eric zur Seite. Mit dem Notizbuch noch immer in der Hand beugte sie sich über Mila. »Mila«, sagte sie sehr eindringlich. »Erinnerst du dich an Nicholas?«
»Nein«, erwiderte sie. »Wer soll das sein?«
Sie war völlig überzeugt: Sie hatte den Namen noch nie zuvor gehört.
Eric fühlte sich, als würde er auf einem schwankenden Schiff stehen. Oder mehr noch: auf einem schwankenden Schiff, das kurz davor war, in eisigem Wasser zu versinken.
Mila hatte sich sämtliche Erinnerungen weggeschrieben und der allererste Gedanke, der ihm durch den Kopf schoss, war: Wenn sie sich nicht mehr an Nicholas erinnerte, erinnerte sie sich auch nicht mehr daran, wie sehr sie ihn geliebt hatte.
Vielleicht würde sie nun erkennen, dass er, Eric, der Richtige für sie war.
Er unterband diesen Gedanken. Verdammt, wie konnte er ausgerechnet jetzt nur an sich selbst denken?
Er sah Helena an, die mit dieser Entwicklung der Dinge eindeutig nicht gerechnet hatte.
»Wenn du dich nicht an Nicholas erinnerst«, sagte Milas Mutter und klang ein bisschen atemlos dabei, »dann erinnerst du dich auch nicht daran, welche Macht du besitzt?«
Mila senkte den Kopf, als seien ihre Gedanken plötzlich zu schwer für sie. »Was für eine Macht? Ich besitze keine Macht«, murmelte sie. Sie wirkte so verwirrt und verloren, dass Eric sich beherrschen musste, sie nicht in die Arme zu ziehen und festzuhalten.
»Die Fabelmacht«, setzte Helena nach. »Du weißt wirklich nicht mehr, wozu du in der Lage bist?«
Mila schüttelte den Kopf. Ihre Augen, die die ganze Zeit schon schmerzhaft gerötet aussahen, füllten sich mit Tränen. Der Anblick schnürte Eric die Kehle zu.
Mila deutete auf das Notizbuch. »Was …«
Doch Helena fiel ihr ins Wort. »Alles der Reihe nach! Wie geht es dir? Was empfindest du im Moment?«
Mila wandte den Kopf und schaute einige Augenblicke lang aus dem Fenster. Mittlerweile war es so dunkel draußen, dass Eric ihr Gesicht in der Scheibe sehen konnte wie in einem Spiegel. Obwohl sie ihm den Rücken zuwandte, konnte er erkennen, wie ihre Augen überquollen und ihr Tränen über die Wangen liefen. Lange Momente vergingen, in denen er zwischen Mitleid und Entsetzen schwankte.
»Wie fühlst du dich, Mila?«, hakte Helena behutsam nach.
Milas Schultern bebten nun, ganz leicht nur, als versuche sie, ein Schluchzen zu unterdrücken.
Eric presste die Fingernägel von Daumen und Mittelfinger in seine inneren Augenwinkel. Erst tat es einfach nur weh. Dann wurde der Schmerz stechend. Als Mila antwortete: »Traurig«, hatte er das Bedürfnis, sich irgendwo abzustützen. Es war nur ein einziges Wort, aber darin lag so vieles mehr, das konnte er hören, sehen und vor allem fühlen. Mila wandte den Kopf wieder zu ihnen und beim Blick in ihre Augen erkannte er, dass er sich nicht getäuscht hatte. In ihrem Gesicht stand Verwirrung, was verständlich war bei einem so umfassenden Gedächtnisverlust. Aber da war auch noch etwas anderes.
Bodenloser Schmerz.
Mila mochte sich die Erinnerung an Nicholas weggeschrieben haben. Aber die nachtschwarze Verzweiflung, die sie wegen seines Todes empfand, war immer noch da.
Mila lauschte in sich hinein. Es kam ihr vor, als sei mit der Erinnerung auch ein Großteil ihrer Gefühle verloren gegangen. Alles, was sie empfinden konnte, schien Traurigkeit zu sein, tiefe, lastende Traurigkeit, die wie ein Gewicht auf ihren Schultern lag und sie niederdrückte, sodass sie kaum atmen konnte.
»Irgendetwas Schlimmes ist passiert, oder?« Die Worte wollten kaum aus ihrem Mund und als sie sie endlich über die Lippen gebracht hatte, schienen sie in der Luft zu zerfasern. »Darum habe ich einen Gedächtnisverlust erlitten. Weil etwas sehr Schlimmes passiert ist.«
»Nein, du …«, setzte Eric an, doch Helena brachte ihn mit einer harschen Handbewegung zum Schweigen.
»Nicht!«, warnte sie. »Wir wissen nicht, was genau geschehen ist, wir sollten …«
Diesmal war es an Eric, sie zu unterbrechen. »Doch! Wir wissen, was geschehen ist.« Er deutete auf das Notizbuch in Helenas Händen. »Sie hat sich die Erinnerung weggeschrieben. Absichtlich.« Er wandte den Kopf und sah Mila in die Augen. »Aber es hat nicht so funktioniert, wie sie es sich gedacht hat. Sie wollte mit der Erinnerung auch den Schmerz loswerden, nur …«
Der Schmerz war noch da.
Wie ein kalter Stein saß er tief in Milas Brust.
»Ich weiß nicht, warum«, flüsterte sie. Es war kaum zu ertragen. Der Name, den Eric und Helena ihr genannt hatten, taumelte durch ihren leeren Geist.
Nicholas. Nicholas. Nicholas.
Sie spürte, dass sie dabei etwas hätte empfinden müssen, aber da war nichts. Kein Bild. Keine Stimme. Stattdessen fühlte es sich an, als würde ihr nun auch noch das letzte bisschen Kraft entzogen, das sie aufrecht gehalten hatte. Auf dem Schreibtischstuhl sackte sie vornüber, sodass Eric sie auffangen musste.
»Hey!« Er zog sie auf die Füße und als auch die Knie ihr den Dienst verweigerten, hob er sie hoch und trug sie zu ihrem Bett. Es fühlte sich merkwürdig an, dass ein Fremder so vertraut mit ihr umging. Aber im Grunde genommen war es ihr egal. Ihr war alles egal. Sie drehte sich auf die Seite und rollte sich zu einem Ball zusammen.
»Kannst du es nicht ungeschehen machen?«, hörte sie Eric Helena fragen. »Du bist auch fabelmächtig, du könntest ihr doch bestimmt die Erinnerungen wiedergeben.«
Helena schwieg lange. Sehr lange. »Nein«, erwiderte sie dann. »Du weißt so gut wie ich, dass sie mächtiger ist als ich. Außerdem hatte sie ihre Gründe für das, was sie getan hat. Wir sollten nichts überstürzen. Lassen wir sie ein bisschen ausruhen.«
Fabelmächtig. Erinnerungen wiedergeben …
All das war völlig unverständliches, wirres Zeug in Milas Ohren, aber sie empfand nicht das geringste Bedürfnis herauszufinden, wovon die beiden sprachen. Sie wollte gar nichts mehr.
Nur noch hier liegen.
Und schweigen.
In einem anderen Universum
Nicholas sprang über eine Wurzel und rannte den Hügel hinunter. Das Herz hämmerte in seiner Brust und endlich, endlich schlug es nicht mehr gleichmäßig und kräftig wie an Milas Grab, sondern so, wie sich Nicholas fühlte. Voller Verzweiflung und Panik. Am Rande der totalen Erschöpfung.
Nicholas beschleunigte sein Tempo noch.
»Komm, wir gehen laufen!« Mit diesem Vorschlag hatte Luc es endlich geschafft, ihn für ein paar Stunden von Milas Grab wegzuholen.
Früher waren sie manchmal zusammen gelaufen – bevor Mila in Paris angekommen war. Luc war Extremsportler, er hatte schon an zwei Ironman-Wettkämpfen teilgenommen. Ab und zu hatte Nicholas mit ihm gemeinsam trainiert, aber er hatte dem Ganzen nie besonders viel abgewinnen können. Er hatte sich immer gefragt, warum man sich so lange verausgaben sollte, bis der eigene Kopf nur noch ein leerer, nach Sauerstoff und Ruhe kreischender Hohlkörper war.
Heute wusste er es.
Das Tempo, das er angeschlagen hatte, war so mörderisch, dass selbst Luc Mühe hatte mitzuhalten. Nicholas erreichte das Ende des Hügels und lief auf einen See zu, dessen blaugraues Wasser wie ein glatter Spiegel zwischen den Wiesen lag.
Der Parc des Buttes-Chaumont, den sie sich für ihr Training ausgesucht hatten, war mit seinen Hügeln, seinen künstlichen Felsen und den vielen verwurzelten Wegen eine der anspruchsvollsten Laufstrecken, die es im Innenstadtbereich von Paris gab. Nicholas war froh, Lucs Vorschlag hierherzukommen, zugestimmt zu haben. Einfach an der Seine entlangzulaufen oder auf den breiten und ebenen Wegen der Tuilerien, hätte nicht seinem Gemütszustand entsprochen. Also waren sie zu Lucs Wohnung gefahren, um sich dort umzuziehen, denn seit Mila tot war, hätte nichts auf der Welt Nicholas dazu gebracht, in sein Elternhaus zurückzukehren. Er hatte seinen Vater seit Milas Beerdigung nicht mehr gesehen und wenn es nach ihm ging, konnte das für immer so bleiben. Ein paarmal hatte seine Tante Odette versucht, ihm zu erzählen, wie sein Vater es geschafft hatte, wegen Milas Tod keine Probleme mit der Polizei zu bekommen. Jedes Mal hatte Nicholas schroff und betont kühl abgewehrt. Er wollte es nicht wissen.
Kalter Regen setzte ein, als er und Luc über die rote Hängebrücke rannten, deren Boden unter ihren Füßen dumpf klang. Die kalten Nadelstiche der Wassertropfen fühlten sich an wie etwas, das er verdient hatte. Im Park waren nur wenige Menschen unterwegs, bis auf ein paar andere Jogger und einige Spaziergänger mit ihren Hunden war kaum Betrieb.
Wie viel Runden waren sie bisher gelaufen? Auch das war Nicholas egal. Wenn er noch eine Weile durchhielt, tat ihm sein Herz vielleicht endlich den Gefallen und hörte auf zu schlagen. Viel fehlte jedenfalls nicht mehr.
Er beschleunigte noch einmal. Diesmal hängte er Luc ab. Ein schrilles Kläffen ertönte hinter ihm und er wäre fast gestolpert, als ein kleiner Terrier an ihm vorbeihetzte, kehrtmachte und vor ihm alle vier Pfoten in den Schotter stemmte, um ihn empört anzubellen. Nicholas blieb stehen, weil er den Hund nicht treten wollte. Sein Atem jagte.
»Tut mir leid«, tönte eine Stimme hinter ihm. Ein Mädchen, vielleicht etwas jünger als er, kam angelaufen. Er erinnerte sich vage, sie eben überholt zu haben. »Er verfolgt gern Jogger und stellt sie dann. Dabei sag ich ihm immer, Eichhörnchen wären eher seine Kragenweite.« Sie lachte fröhlich. Ihr Gesicht war herzförmig und blonde Locken ringelten sich regennass um ihr Gesicht.
Milas Locken waren einige Töne heller gewesen, schoss es Nicholas durch den Kopf, und trotz seiner Erschöpfung brachen wieder diese Bilder über ihn herein. Milas Locken zwischen seinen Fingern, als er sie zum letzten Mal im Arm gehalten hatte. Das viele Blut. Der Schmerz in ihren Augen.
Er erinnerte sich an die Verzweiflung, als er sie hatte gesundschreiben wollen und es zu spät gewesen war. »Es ist okay«, hatte Mila gewispert. Und dann war der Tod gekommen und hatte sie ihm fortgenommen.
»Ist alles mit dir in Ordnung?«, fragte das Mädchen und riss ihn dadurch aus seinen Erinnerungen. »Du siehst aus, als wärst du einem Geist begegnet.«
Einem Geist! Nicholas hörte einen merkwürdigen Laut. Hatte er eben gelacht? Angefühlt hatte es sich wie ein Schrei. Seine Rippen schmerzten, weil sein Körper so sehr nach Luft gierte.
Das Mädchen starrte ihn an. Eilig wich sie ein Stück zurück. Offenbar hatte er wirklich geschrien. Sie tat ihm leid. Auf sie musste er wie ein Geistesgestörter wirken. »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben«, versuchte er, sie zu beruhigen, aber das schien sie ihm nicht abzunehmen. Ihr Hund hatte wieder angefangen zu kläffen. »Hector!«, wies sie ihn zurecht. »Lass das!« Sie klang jetzt, als wolle sie überall auf der Welt lieber sein als hier in diesem Park.
Luc trat neben ihn. Sein Gesicht war schweißüberströmt. Trotzdem wirkte er weniger erschöpft als vielmehr besorgt. Nicholas wusste nicht, wie lange er schon hinter ihm gestanden hatte.
Das Mädchen allerdings schien erleichtert, dass er da war. »Dein Freund«, sagte sie. »Der hat sie nicht mehr alle, oder?«
Luc sah Nicholas an, schwieg jedoch eine Sekunde zu lange. Ohne weitere Worte drehte das Mädchen sich um und machte, dass sie wegkam.
Luc schaute ihr nach. »Was hast du zu ihr gesagt?«
Nicholas zuckte nur mit den Schultern. Mittlerweile fühlten sich auch seine Gedanken schwerfällig an – bis auf einen, der in seiner ganzen Klarheit herausstach.
Er würde es nicht schaffen.
Ohne Mila würde er es einfach nicht schaffen.
Helena stand am Fenster und sah zu, wie die Nacht über Paris sich langsam dem Ende zuneigte. Im Osten färbte sich der Horizont schon fahl, aber die Straße lag noch im Schein der Laternen, die ihren ganz und gar typischen Schimmer über die Szenerie legten. Der Paris-Schimmer, den Helena immer geliebt hatte.
Sie dachte an Mila in ihrem Zimmer nebenan. Eric hatte sich bis weit nach Mitternacht geweigert, nach Hause zu gehen. Sie hatte ihn schließlich dazu zwingen müssen und der vorwurfsvolle Blick, mit dem er sich von ihr verabschiedet hatte, schmerzte sie sogar jetzt noch. Mila schlief mittlerweile. Helena hatte die Tür zu ihrem Zimmer nur angelehnt und ab und zu konnte sie ihre Tochter im Schlaf leise wimmern hören. Sie machte sich keine Vorstellung davon, wie es in dem Mädchen jetzt aussah, aber eines war deutlich: Es ging ihr nicht besser. Im Gegenteil: Sie war immer noch wie gelähmt vor Trauer. Nur dass sie jetzt den Grund dafür nicht mehr kannte.
Bis eben hatte Helena mit dem Gedanken gespielt, Mila zu erzählen, was sie vergessen hatte. Aber dann hatte sie sich dagegen entschieden. Sie hatte keine Ahnung, welche Auswirkungen das auf Milas ohnehin schon labile Psyche gehabt hätte. Besser, sie warteten eine Weile, schauten, wie sich die Dinge entwickelten.
Ist das wirklich der Grund?, flüsterte die Stimme ihres Gewissens in ihrem Hinterkopf.
Helena senkte den Kopf. Warum hatte sie Mila nie die Wahrheit gesagt und sie vorbereitet auf das alles hier? Hatte sie all die Jahre über wirklich geglaubt, sie könne ihre Tochter vor der Fabelmacht bewahren? Aber warum hatte sie dann nicht verhindert, dass Mila hierher nach Paris kam und Nicholas überhaupt traf? So viel Leid wäre ihrer Tochter erspart geblieben. Warum nur … warum … warum?
Helena kannte die Antwort auf all diese Fragen. Mila hatte eine Aufgabe, die größer war als alle Zweifel. Und wenn sie erst davon erfuhr, dann würde sie – nun, sie würde es vielleicht nicht verstehen. Aber sie würde erkennen, dass ihre Mutter keine andere Wahl gehabt hatte.
Helenas Herz machte einen Satz, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein alter Mann in einem grauen Mantel entlangging und im Kegel einer der Laternen stehen blieb. Über die Straße hinweg sah er Helena an.
Sie tat einen tiefen Atemzug. Er wusste immer, wann sie ihn brauchte. Jedes Mal. Sie schaute zu, wie er in den Schatten einer Einfahrt auf der gegenüberliegenden Seite verschwand. Eilig hastete sie zu Milas Zimmertür und zog sie ganz zu.
Als sie zurück ins Wohnzimmer kam, stand er schon da. Er hatte den Stift, mit dem er sich hierhergeschrieben hatte, noch in der Hand. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie fasziniert sie gewesen war, als sie zum ersten Mal miterlebt hatte, wie groß seine Macht war. Völlig selbstverständlich konnte er sich über die elementarsten physikalischen Gesetze hinwegsetzen. Außer ihm gab es nur wenige Fabelmächtige, die dazu in der Lage waren, ohne einen hohen körperlichen Preis zu bezahlen. Selbst für ihn galt das.
Aber all das war jetzt unwichtig.
Er lächelte.
Sie glaubte, den Geruch von Pergament und Leder wahrzunehmen, den Geruch eines Gelehrten, den sie so sehr liebte.
Sie sah ihn an. »Abélard«, sagte sie.
Sein Lächeln vertiefte sich. »Héloise.«
»Bitte«, murmelte sie. »Nicht diesen Namen.«
Er sah nicht glücklich aus darüber, aber er tat ihr den Gefallen. »Helena.«
»Mila geht es nicht besser. Die Erinnerungen an Nicholas sind verschwunden, aber sie leidet immer noch fürchterlich.«
Abélard setzte sich in einen der Sessel, schlug die Beine übereinander. Sein altes Gesicht war fast genauso grau wie sein Mantel. »Ja«, sagte er. »Das war zu erwarten.«
Helena grub die Nägel in die Handflächen. »Was sollen wir jetzt tun?«
Statt ihr zu antworten, stand er wieder auf und trat dicht vor sie hin. Helena atmete tief aus. Er hatte immer noch diese Wirkung auf sie.
Zärtlich strich er ihr mit den Fingerrücken über die Wange. »Das, was wir am besten können«, sagte er mit sanfter Stimme. »Warten.«
»Ich habe Angst, dass sie niemals verstehen wird, was ich ihr antun muss.«
»Doch, das wird sie.« Er streichelte ihren Hals. »Wir sind so weit gekommen, jetzt müssen wir es auch beenden. Wir müssen das für sie tun. Für uns. Für uns alle.«
Helena hob den Blick und begegnete seinen uralten Augen. Sie spürte, wie ihre Sicht verschwamm. »Woher nimmst du deine Sicherheit?«, flüsterte sie.
Da lächelte er wieder. »Von dir«, erwiderte er. »Du gibst sie mir, meine liebste Héloise.«
3
Die nächsten Tage verbrachte Mila im Bett und hatte nicht einmal die Kraft, sich hinzusetzen, geschweige denn aufzustehen. Alles in ihr war tiefschwarz, so, als hätte ihr jemand die Organe herausoperiert und ihren Körper inwendig mit Teer ausgefüllt. Wenn sie die Augen schloss, weil sie die weiße Zimmerdecke nicht mehr sehen konnte, ertrug sie kurze Zeit später die orangefarbenen Muster auf der Rückseite ihrer Lider nicht mehr. Die Augen wieder zu öffnen, kostete sie dann jedes Mal schier unmenschliche Kraft. Am zweiten Tag ließ Helena jemanden kommen, einen Mann, den sie seltsamerweise mit Bruder Philippe ansprach. Er trug schlichte schwarze Kleidung, fast wie ein Priester, war aber offenbar Arzt. Dieser Mann untersuchte Mila und stellte ihr ein paar Fragen, die sie nur einsilbig beantwortete. Danach verschwand er mit Helena im Wohnzimmer. Mila verstand nicht, was die beiden miteinander besprachen, und es war ihr auch egal.
Sie wollte nichts von diesem Nicholas wissen, den Eric und Helena erwähnt hatten. Und sie wollte niemanden um sich haben. Weder ihre Mutter noch ihre Freundin Isabelle, die sich jeden Tag nach ihrem Zustand erkundigte. Und auch nicht Eric, der manchmal stundenlang an ihrem Bett saß, bis Mila ihn anschrie, er solle sie endlich in Ruhe lassen.
Zeitweise fühlte sie sich wie im freien Fall, dann wieder wie in einen Schraubstock gespannt, der langsam, Windung für Windung, immer fester gedreht wurde. In manchen Minuten bekam sie kaum Luft, dann, meist kurz nachdem sie eingeschlafen war, fuhr sie in blinder Panik in die Höhe. Ihr Herz raste dann und tat so weh, dass sie hätte schreien können, wenn sie die Kraft dazu gehabt hätte.
Irgendwann in der zweiten Woche wurde es wenigstens so weit besser, dass sie in der Lage war, aufzustehen und so zu tun, als würde sie am Leben teilnehmen. Sie aß, wenn Helena sie dazu zwang, sie ging mit Isabelle spazieren, sie setzte sich mit ihrer Mutter vor den Fernseher, aber sie bekam nichts von dem mit, was über die Mattscheibe flimmerte. In der zweiten Woche nach ihrem Gedächtnisverlust lud Isabelle sie und Eric zu einer Vernissage ein, bei der ein paar von ihren Bildern ausgestellt wurden. Mila wollte sich weigern, aber zusammen mit Helena redeten Eric und Isabelle auf sie ein und schließlich gab sie nach.
Ungefähr eine Stunde, bevor die Vernissage eröffnet wurde, stand sie dann vor dem Spiegel auf dem Wohnungsflur und starrte auf das rote Minikleid, in das Helena sie gesteckt hatte. Die Farbe flimmerte vor ihren Augen, wurde immer wieder überlagert von fahlen Flecken, die in ihrem Gesichtsfeld tanzten. Ihr war schwindelig und schlecht wie so oft in den letzten Tagen.
Mit einem mühsamen Durchatmen riss sie sich zusammen. Es war ein reiner Willensakt.
»Du siehst hübsch aus«, hörte sie Helena hinter sich sagen.
Sie begegnete dem Blick ihrer Mutter im Spiegel.
Die lächelte bemüht. »Ich weiß, es kostet dich schrecklich viel Kraft, aber glaub mir, es wird dir ein bisschen besser gehen, wenn du hier mal rauskommst. Isabelle ist so stolz. Sie freut sich, wenn du kommst.«
Mila wollte nicken, aber sogar dazu war sie zu matt. Sie fragte sich, wie sie diesen Abend überstehen würde, ohne zusammenzuklappen oder sich in eine Ecke zu kauern und mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Zu ihrer Erleichterung klingelte es in diesem Moment, sodass sie nicht gezwungen war, ihrer Mutter etwas zu erwidern.
Helena ging öffnen und gleich darauf stand Eric im Flur. Er betrachtete Mila von Kopf bis Fuß und pfiff durch die Zähne. »Wow!«, rutschte es ihm heraus. Weil sie nicht reagierte, streckte er die Hand nach ihr aus. Helena hatte Milas widerspenstige blonde Locken gestylt und mit Kämmen hochgesteckt, aber jetzt, kaum eine Viertelstunde später, ringelten sich schon wieder vorwitzige Strähnen rechts und links ihrer Wangen.
Eine davon berührte Eric ganz sachte. »Du siehst umwerfend aus.«
»Was man auch von dir sagen könnte.« Helena warf Mila einen auffordernden Blick zu, sich an dem Gespräch zu beteiligen.
Mila wandte den Kopf und sah Eric an. Er hatte sich in einen schwarzen Anzug geworfen, der aus schmalen Hosen und einem modern geschnittenen Sakko bestand. Ein ziemlich krasser Gegensatz zu seinen sonst üblichen Jeans und Shirts.
»Der muss ein Vermögen gekostet haben«, zwang sie sich zu sagen. Ihre Stimme klang selbst in ihren Ohren dünn und kraftlos, aber Eric schien froh zu sein, dass sie überhaupt auf ihn reagierte.
Er zog die Nase kraus. »Keinen Cent. Ich habe ihn mir von einem Freund geliehen.« Betont fröhlich nahm er Milas cremefarbenen Kurzmantel aus Wolle vom Haken und hielt ihn ihr hin, sodass sie hineinschlüpfen konnte.
Mechanisch zog sie den Mantel an und nahm die Handtasche mit Portemonnaie, Handy und Notizbuch, die er ihr reichte.
»Dann mal los!«, sagte er munter. »Die nächste Metro fährt in zehn Minuten.«
»Nichts Metro.« Helena, die kurz im Wohnzimmer verschwunden war, kam zurück auf den Flur. In der Hand hielt sie einen Fünfzigeuroschein, den sie Eric hinhielt. »Nehmt euch ein Taxi. Das ist ein bisschen standesgemäßer, als mit der Metro zu so einer Veranstaltung zu fahren.«
Eric nahm das Geld. »Danke, Madame Corbeil.« Dann reichte er Mila übertrieben galant einen Arm. »Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, heute Abend Ihr Begleiter zu sein, Mademoiselle!«
Zu ihrer eigenen Überraschung spürte Mila Dankbarkeit. Solange Eric in der Nähe war, musste sie sich zusammenreißen. Mit äußerster Anstrengung zwang sie ihre Mundwinkel nach oben.
»Na, das ist doch schon mal ein Anfang«, sagte Eric, und bevor sie sich wehren konnte, zog er sie die Treppe hinunter in Richtung Ausgang.
Eric pfiff zum zweiten Mal an diesem Abend durch die Zähne, als das Taxi vor einem mehrstöckigen Haus hielt, das direkt an einer Uferstraße der Seine lag. »Wow!«
Das Haus, dessen Eingangstor sie nun passierten, schien sehr alt zu sein, jedenfalls wirkte es mit seinen hohen Fenstern und der verzierten Fassade so. Mila zog ihren Mantel vor dem Hals zusammen. Ein junges Mädchen mit wild in die Höhe toupierten Haaren und einem riesigen fliederfarbenen Kaugummi zwischen den Zähnen öffnete ihnen, bevor sie klingeln konnten. Dröhnende Musik fiel über sie her und weckte in Mila den Wunsch, umzudrehen und wegzulaufen. Stattdessen folgte sie Eric nach drinnen und fand sich in einem weiten, hallenartigen Raum wieder, der leer und kühl wirkte wie ein Loft. Der Blick ging direkt durch die fast komplett entkernte Etage hindurch und fiel durch eine bodentiefe Fensterfront auf eine hell erleuchtete Terrasse.
Die Musik kam aus unsichtbaren Lautsprechern. Jemand sang in unfassbarer Geschwindigkeit irgendeinen Raptext, von dem Mila nur zwei Dinge verstehen konnte: »das große Fressen« und »fickt euch«. Es war voll. Die Besucher der Vernissage kamen ihr vor wie eine bunte Mischung aus hyperaktiven, klapperdünnen Männern und Frauen in eleganter Kleidung und aus Künstlertypen der verschiedensten Arten. Eric, dessen Kinnlade für einen kurzen Moment heruntergefallen war, stieß sie an und deutete auf einen Kerl, der farbverkleckste Jeans trug und sonst nichts weiter. Keine Schuhe. Weder Hemd noch Unterhemd. Dafür aber eine spiegelnde Glatze und einen wirren, leuchtend roten Bart, dessen Farbe extrem unecht aussah. Über sein rechtes Ohr war in Pink ein Einhorn tätowiert und er war umringt von mehreren Frauen, die allesamt an seinen Lippen hingen. Worüber er dozierte, konnte Mila bei der lauten Musik nicht verstehen, aber es schien wichtig zu sein. Jedenfalls seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen.
»Na, das wird ein interessanter Abend«, murmelte Eric.
Der Lärm der Musik und das Stimmengewirr ließen den Gedanken, dass Mila das hier überstehen würde, völlig absurd wirken. Sie nickte nur und er warf ihr einen forschenden Blick zu.
In ihren Ohren schrillte es.