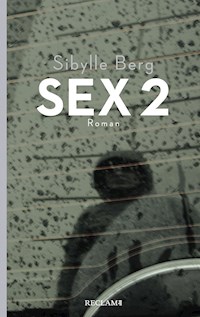4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sibylle Bergs »Die Fahrt« - endlich bei Kiepenheuer & Witsch als E-Book. Was ist nur aus uns geworden? Haben wir alles gefunden, was wir suchen, und was war das noch mal? Die fünf HeldInnen dieses Romans machen sich auf den Weg, raus aus ihrem alten Leben. Sie passieren Orte, streifen im Vorbeigehen den globalen Wahnsinn, der sie doch nie wirklich berührt, denn sie sind nur auf der Durchreise. An den Ort, der auf sie wartet. In einer Welt, die keinen von ihnen wirklich braucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sibylle Berg
Die Fahrt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sibylle Berg
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sibylle Berg
Sibylle Berg lebt in Zürich. Ihr Werk umfasst 27 Theaterstücke, 16 Bücher und wurde in 34 Sprachen übersetzt. Berg ist Herausgeberin von drei Büchern und verfasst Hörspiele und Essays. Sie erhielt diverse Preise und Auszeichnungen, u.a. den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, den Nestroy-Preis, den Schweizer Buchpreis, den Grand Prix Literatur, den Berthold-Brecht-Preis und den Johann-Peter- Hebel-Preis. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen zuletzt der Gesprächsband »Nerds retten die Welt« (2020) und der zweite Band der »GRM«-Trilogie: der Roman »RCE« (2022).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Von der rastlosen Suche nach immer neuen Erlebnissen, von der irren Hektik Reisender, die konsumieren, statt zu sehen, und von der banalen Wahrheit, dass man niemals »von sich weg« reisen kann, erzählt »Die Fahrt«. Dieser Episodenroman, der auf einer Weltreise der Autorin basiert, ist eine konsequente Fortschreibung ihres Verfahrens der kurzen Psychogramme. Die getriebenen Menschen, mit denen man hier eine Wegstrecke teilt, wird man nie wieder vergessen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Gunner Gustafson
Frank
Maria
Helena
Michael
Ruth
Frau Katz
Pia
Brian
Jakob
Helena
Tal
Serra
Miki
Peter
Pia
Juana
Peter
Bella
Helena
Susanti
Frank
Paul
Jenny
Miki
Frederick
Helena
Amirita
Pia
Mr Ling
Jenny
Miki
Ruth
Dan
Jiang
Pia
Helena
Ruth
Miki
Svenja
Frank
Paul
Miki
Lisbeth
Pia
Gulzada
Ruth
Olga
Grazia
Helena
Igor
Miki
Hanna
Peter
Ruth
Rolf
Frank
Helena
Chloe
Peter
Pia
Helena
Fatma
Ruth
Miki
Nusrat
Peter
Frank
Peter
Pia
Parul
Jakob
Pia
Peter
Ruth
Pia
Miki
Helena
Frank
Die Autorin dankt folgenden Stiftungen/Institutionen
für die Unterstützung ihrer Arbeit:
Globetrotter Reisebüro, Zürich
Stiftung Pro Helvetia, Zürich
Stiftung Landis & Gyr, Zürich
UBS Kulturstiftung, Zürich
Le ba’ali.
Bil’adecha eyneni holechet leshum makom.
Letamid!
Gunner Gustafson
Reykjavík
Es war die Jahreszeit, da es nur vier Stunden ein schwaches Licht gab in Island. Seit Tagen wehte ein properer Wind, der pfiff und heulte, der machte die Welt klappern und die Stille noch klarer, die in Gunners Haus herrschte. Eine Stille, die sich wie etwas Gefrorenes anfühlte und die jede Bewegung so langsam werden ließ, dass man nicht anders konnte, als sich von außen zu beobachten.
Seit zwei Tagen lag Gunners Frau im Wohnzimmer, auf dem Bett, unbeweglich, was außer Gunner niemanden wunderte, denn Gunners Frau war tot.
Er vermochte nicht zu verstehen, warum Gabriella aussah wie immer, nun vielleicht ein bisschen verwaschener, wie an einem besonders schlechten Tag mit Grippe, und warum sie nicht zurückkam, das verstand er nicht.
Gabriella war immer zurückgekommen. Sie war leicht zu erzürnen und liebte es, mit Gegenständen zu werfen, aus dem Haus zu rennen und tagelang zu verschwinden, aber sie war immer zurückgekehrt. Warum sollte es diesmal anders sein?
Zumal sie vor ihm lag und er sie anfassen konnte.
Doch so viel Gunner auch mit ihr redete, sie schüttelte, sich neben sie legte, sie kam nicht zurück. Es war nicht zu verstehen, was einen Menschen zum Schlagen, zum Ticken, zum Laufen und Reden brachte und welcher Stecker gezogen werden musste, damit alles in sich zusammenfiel und der Mensch zu etwas wie einem Möbel wurde.
Es kamen keine Trauergäste mehr. Hunderte waren in den Tagen, da Gabriella hier lag im Wohnzimmer, durch sein Haus gelaufen, hatten sich betrunken, geweint, geredet und waren wieder verschwunden. Gunner hatte schweigend in einer Ecke gesessen und versucht, Haltung zu bewahren, nicht zu schreien. Sie nicht aus dem Haus zu werfen, die seine schlafende Frau anstarrten und anfassten.
Gunner hatte nicht geschrien, er hatte zu Boden gesehen und rückwärts gezählt. Die Beherrschung verlor er erst, als die Bestatter kamen, um seine Frau abzuholen. Wohin abholen? Warum? Wenn sie schon nicht mehr mit ihm redete, konnte sie zumindest hier liegen bleiben. Es war immer noch besser, mit einer schweigenden Gabriella zu leben als mit gar keiner.
Die Bestatter hatten sich durchgesetzt, vermutlich kannten sie Szenen wie die des am Boden liegenden, schreienden Gunners. Sie hatten Gabriella aus dem Haus getragen. Die Tür hatten sie offen gelassen.
Es war kalt und Nacht geworden, Gunner lag unverändert auf dem Boden und wusste nicht, was er als Nächstes tun sollte. Er war am Nächsten nicht interessiert. Wie konnte einer einfach von vorne beginnen, mit Frühstück und Morgenzeitung, nachdem er dreißig Jahre einen anderen Menschen neben sich gewusst hatte, einen, der nie egal geworden war, mit dem er jede Nacht einander haltend eingeschlafen war.
Sie hatten sich immer an den Händen gehalten, von Kind an, und die Angewohnheit nie aufgegeben. Beider Hände hatten gefroren, wenn sie einander nicht hielten.
Gunner war sehr viel länger in seinem Leben mit Gabriella zusammen gewesen als mit sich oder seinen Eltern. Er hatte keine Ahnung, warum er alleine weitermachen sollte. Das Leben war doch nur mit einem anderen Menschen zu ertragen. Mit dem man lachen konnte über den ganzen Mist, über andere Leute, die noch nicht gemerkt hatten, dass alles eine große alberne Komödie war. Menschen, die ihre Mitte finden wollten, sich selbst verwirklichen, Karriere machen, Besitz anhäufen. Wie albern das war. Wie rührend.
Und wie verloren Gunner mit sich.
Die Tür immer noch auf, der kalte, nasse Wind im Haus, das ihnen kein Glück gebracht hatte. Sie wohnten seit fünf Jahren hier, weil Gabriella sich ein Holzhaus gewünscht hatte, mit einem Garten. Was willst du mit einem Garten, hatte Gunner sie gefragt, es regnet die meiste Zeit, und wenn es nicht regnet, ist es kalt. Aber Gabriella wollte Erde, einen Baum, und sie wollte morgens barfuß in diesen Garten laufen. Das hatte sie dann getan, nachdem er ihr das Haus gekauft hatte, und er vermutete nun, dass dieses Barfußgelaufe Schuld war am Krebs und daran, dass er jetzt alleine war.
Gunner überlegte sich, das Haus anzuzünden. Doch das schien ihm eine zu geringe, zu gnädige Strafe. Er würde einfach gehen, die Tür offen lassen, das Haus würde langsam zugrunde gehen. Sehr langsam.
Frank
Berlin
Irgendwann war es nicht mehr unangenehm gewesen, abends zu wissen, was am nächsten Tag geschehen würde, vielmehr schätzte Frank unterdes die Gleichförmigkeit seines Daseins. Manchmal erinnerte er sich an früher wie an einen schlechten Film, den er vor Langem gesehen hatte. An die fröstelnde Anstrengung, sein Leben aktiv zu gestalten. Dieses erniedrigende Gefühl, einen sonnigen Tag nicht zu Hause verbringen zu dürfen, weil eventuell draußen etwas passieren könnte. Sich mit Tausenden an den wenigen Grünplätzen versammeln zu müssen, die die Abwesenheit von Natur nur viel deutlicher machten. Vorbei an den ockerfarbenen Mehrfamilienhäusern, die weitgehend alles Behagliche in der Stadt vertrieben hatten, des Nachts unsicher in Bars stehen, voller Angst, dass einer ihn ansprechen könnte, was natürlich nicht passierte.
Frank wohnte in Berlin, da spricht keiner einen an, wenn es nicht darum geht, ihn auszurauben, und selbst dann begnügt man sich mit wenigen Worten. Es war nie etwas Außerordentliches geschehen in den Jahren der Unruhe. Keines der Versprechen, die das Leben ihm scheinbar gegeben hatte, war eingelöst worden. Die Menschen, die er in Bars kennenlernte, verloren untertags ihren Reiz. Doch meist waren sie einfach nur verschwunden, irgendwo in dieser großen Stadt. Frank konnte heute verstehen, dass Berlin gemeinhin als wenig anziehend galt, denn die Stadt war definitiv eine äußerst hässliche Angelegenheit. Keiner hätte geglaubt, dass dieser Klumpen eingezäunten Drecks jemals wieder so etwas wie eine Metropole werden konnte.
Nun war es eine, mit all den dazugehörigen Luxusläden, Kiezen, Parallelwelten, die sich nicht berührten. Es gab ein paar ästhetisch ansprechende Orte, doch hielten die sich immer so weit entfernt von einem selbst auf, dass man sie nie aufsuchte. Das macht man doch nicht, mal eben eine Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um ein letztes Bier zu trinken. So grenzten die Menschen mit zunehmendem Alter ihren Radius ein, gewöhnten sich an die Kneipen, Läden, Grünflecken in ihren Vierteln, die nicht größer waren als ein Dorf. Vermutlich sind Menschen von jeder Ansiedlung, die die Größe einer Kleinstadt überschreitet, überfordert.
Man kannte die Idioten im Viertel, wurde alt mit denen, die immer noch davon sprachen, alles zu ändern, doch wer bis dahin nicht weg war, wusste Frank, würde es wohl nie sein.
Franks ehemaliger Freund Peter, mit dem er eine Band hatte gründen wollen, was sie aufgegeben hatten, um in Bars zu stehen und darüber zu reden, eine Band zu gründen, war durch die halbe Welt gefahren und immer unglücklich. Nie stimmten die Orte mit den Bildern in seinem Kopf überein. Schweine. Momentan war er aus irgendwelchen Gründen in Sri Lanka, auch nicht froh.
Pia, Franks Nachbarin, mit der er manchmal angenehm schweigend auf dem Balkon gesessen hatte, hielt sich gerade in Myanmar auf und wollte dann weiter nach London. Helena, die dicke esoterische Frau, die Frank immer traf, wenn er niemanden treffen wollte, morgens beim Zeitungholen, abends im Wunsch, unbemerkt nach Hause zu gelangen, und die ihm immer von ihren neusten spirituellen Erlebnissen erzählen musste, war in Manaus, das war aber wohl auch nichts. Miki aus Tel Aviv, die lange als Bedienung um die Ecke gearbeitet hatte, lebte jetzt in Los Angeles und machte irgendwas beim Film.
Wahrscheinlich kellnerte sie.
Mit allen traf Frank sich im Internet und versprach ihnen, sie zu besuchen. Das vergaß er dann jeweils wieder, weil er dringend mit einem anderen Freund irgendwo auf der Welt reden musste, der in einer Krise steckte, weil irgendwas mit einem Visum, einer perfekten Wohnung, Papieren oder einer Arbeit nicht geklappt hatte.
Frank hatte wenige ältere Bekannte, die, wie er, in der Stadt geblieben waren, weil sie sich daran gewöhnt hatten oder wussten, dass Wohnen egal wurde, denn mit fortschreitendem Alter wusste man doch, dass es überall irgendwie aussah und es schwierig war, neu zu beginnen, mit über 40.
Was sollte ein unglamouröser Mensch wie er durch eine Großstadt laufen, da sich keiner für ihn interessierte?
Es wäre Frank nie eingefallen, Berlin als seine Heimat zu bezeichnen. Eine Heimat hatte Frank nie gehabt.
Die meisten seiner Bekannten hatten den Knall noch nicht gehört und warteten auf einen Ort, der nach ihnen verlangte. Irgendwas, das für sie bereitstünde und das sich um sie legen würde wie ein passender Mantel. Heimat findet man nicht im Internet oder durch verzweifeltes Herumgereise.
Heimat ist für Menschen, die in Bergdörfern aufgewachsen waren. Ganz reizend, man kennt alle, die Tiere, die Luft ist über jeden Zweifel erhaben, und statt ins Kino gehen alle Sonnenuntergang schauen.
Frank beobachtete, dass ihm ein kleiner Bauch wuchs. Allen wuchsen Bäuche. In all den Bäuchen all der alten Männer waren vielleicht Kinder, die bei ihrer Bestattung freigesetzt würden. Um dann Straßenkinder in Peru zu werden. Frank arbeitete in einem unattraktiven, mit alten Ikea-Möbeln und fluddrigen Ordnern zugestellten Büro, und es war wirklich egal, was er da tat. Er hatte den Gedanken, die Welt verändern zu können, schon vor langer Zeit aufgegeben. Wobei aufgeben ein zu aktives Wort war. Die Idee war eher sanft entschlafen. Frank hatte verstanden, dass nichts die Welt ändern würde, außer vielleicht etwas sehr Gewalttätiges, aber das war nicht sein Cup of Tea. Er war müde geworden, dies jedoch in einer angenehmen Art, wie einer schläfrig wird, im Sommer, auf einer weißen Liege, die in Italien in einem Garten steht. Ein Pferd wäre da auch. Tot.
Jeden Tag begab Frank sich mittags in ein Café, das sich neben seinem Büro aufhielt. Die alten Kunden waren über die Jahre verschwunden, verjagt worden von 35-jährigen Müttern, die alle wahnsinnig umweltbewusst und dämlich waren. Die Frauen tranken Milchkaffee, die Kinder terrorisierten die Gäste, und die Mütter ignorierten das, um zu zeigen, dass sie unglaublich entspannte Mütter waren. Frank saß da und versuchte, die Kinder zu mögen, die kreischend um ihn herumtobten, Sachen in seinen Kaffee warfen und auf Hunde traten. Es fiel ihm leicht, wenn er sich selbst vergaß, und die Ruhe, die er haben wollte, und die Kinder ansah, die noch nicht wussten, was ihnen bevorstand. Die wenigen Jahre der Ahnungslosigkeit!
Frank war versöhnlich geworden im Alter, und sehr oft musste er weinen, wenn er Menschen beobachtete, die versuchten, ihr Leben niedlich herumzubringen. Da sangen sie in Laienchören, tanzten in Parkanlagen und trugen kleine Tiere herum. Frank bedauerte, dass er die Menschen früher so gehasst hatte, sein Leben war nicht angenehmer gewesen dadurch.
Jeden Tag gegen fünf schloss Frank sein Büro ab, ging auf dem Heimweg in den Supermarkt, kaufte Waren, die er sich zu einem Abendessen zusammenrühren würde, eine Zeitung und begab sich gerne in seine Wohnung. Er kochte, Musik lief, danach setzte er sich, wenn es aus Versehen warm war, auf den Balkon, las in einem Comic und wunderte sich, dass es irgendwann so einfach geworden war, zufrieden zu sein. Vielleicht hatte es mit der Abwesenheit von Erwartungen zu tun. Auf eine Liebe zum Beispiel wartete Frank schon lange nicht mehr. Alle seine Liebesgeschichten waren vor langer Zeit unerfreulich geendet. Dachte er an Frauen, dann fielen ihm heute eher die lauten, unangenehmen Momente ein. Und er wusste nicht mehr zu sagen, warum er immer mit irgendeinem Mädchen gestritten hatte und worüber.
Seit ungefähr zehn Jahren hatte er keine Geschichte mehr gehabt. Seit der Bauch da war, oder andersherum. Ab und zu, wenn Frühling war, hing er auf dem Balkon alten Gefühlen nach. Die Unendlichkeit, die man spürte, im Zustand unsinniger Verliebtheit, die würde es wohl nie mehr geben, dachte er und sah den Schwalben hinterher, die im Frühling so schön weinten, bevor der Regen kam. Nach solchen Momenten der Erinnerung auf dem Balkon verlangte ihm meist nach einem Spaziergang, und unbestimmt trauernd streifte er durch die vom Frühlingsregen gereinigten Straßen, nahm die Hässlichkeit der Großstadt, die ihm normalerweise nicht mehr auffiel, bewusst war. Reizende Knospen an Büschen, die Natur imitierten und zu deren Füßen Plastiktüten lagen, und Hundehaufen. Und dann suchte er so lange, bis ihm einfiel, dass man Liebe so nicht findet, nachts, im Frühling, auf Straßen, und so ging er wieder heim, legte sich auf sein Sofa, las einen Comic, hörte eine komplizierte Schallplatte und wurde wieder ruhig darüber. Nein, Liebe fände er wohl nicht mehr, und es wäre verschwendete Energie, das zu betrauern.
So verschlurfte Frank den Frühling in angenehmer Temperatur und strich jeden Abend einen Tag seines Lebens ab, bis zu jenem Moment, da alles von einer Sekunde zur anderen eine neue Richtung hätte bekommen können.
Es war wieder so ein Abend, mit seufzendem Stehen auf dem Balkon und Schwalben, anschließendem Spaziergang und einsetzendem Niederschlag. Unter den üblich verdächtig verschissenen Büschen hörte Frank ein lautes Wimmern. Er starrte den Busch an und sah einen winzigen Vogel. Aus dem Nest gefallen und zu doof zum Fliegen. Frank bemerkte, dass er nicht allein war. Eine Frau, vermutlich in seinem Alter, dachte Frank beim schnellen Scannen, starrte auch. »Ich habe keine Ahnung«, sagte sie, »was man mit Babyvögeln anstellt.« »Ist das wie mit Rehbabys, dass die Mutter sie nicht mehr mag, wenn ein Mensch sie angegrabscht hat?«, fragte Frank. Beide zuckten die Schultern und schauten unschlüssig das Vogeljunge an. »Vielleicht gehen wir einfach weg«, sagte die Frau, »die Mutter traut sich möglicherweise nicht heran sonst.« Dann gingen beide ein paar Meter und blieben stehen, weil das Geschrei des Vogels nicht verstummte. »Selbst wenn es eine Mutter gäbe, wie sollte sie denn das Kind ins Nest zurückbringen, die haben selten kleine Rucksäcke dabei. Eher schon Koffer, das sieht man ja ab und an. Diese Vögel mit Koffer.«
Beide gingen zurück, Frank klaubte den Vogel unter dem Busch hervor, der dann seltsam zufrieden in seiner Hand hockte und nur noch ab und an schrie, vor Hunger. »Was essen kleine Vögel?«, fragte die Frau. Und Frank meinte: »Vorgekaute Würmer, wenn Sie so nett wären.« Die Frau hockte sich wieder vor den Busch und kam nach ein paar Sekunden mit einem Regenwurm zurück. Eine Mutter mit Kinderwagen schoss an ihnen vorbei, erregte sich kurz, dass der Bürgersteig nicht schnell genug für sie geräumt wurde. Ruth schaute die Frau, die aussah, als wäre sie ein ehemaliges Model für Versandhauskataloge, mit einem Ekel an, den man sonst nur besonders unattraktiven Tieren entgegenbringt.
»Ich kau den, glaube ich, doch nicht«, sagte sie. »Vielleicht hilft es, wenn wir ihn in den Mixer tun«, schlug Frank vor. Beide gingen, als hätten sie es besprochen, in seine Wohnung, sie zerstückelten ein Teil des Wurmes und steckten ihn in den Mund des Babyvogels. Hut ab, dachte Frank, eine Frau, die Würmer zerstückelt, trifft man nicht alle Tage.
Dann bauten sie ein warmes Nest aus Socken, der Vogel schlief ein, und sie setzten sich auf den Balkon mit einer Flasche Wein. Das macht man so unter älteren Menschen. Die schleppen immerzu Weinflaschen herum, vielleicht um sich erwachsen zu fühlen, denn das große Geheimnis des Lebens ist, dass kaum einer weiß, wie Erwachsensein geht. Die meisten schämen sich darum und beginnen so zu agieren, wie sie meinen, dass Erwachsene sich verhalten. Das war, was die Welt zu so einem öden Ort machte. All die Menschen, die nicht in Originaltönen reden, die sich verkleiden, wie Maschinen sprechen, langweilige Erwachsenenmaschinen.
Die Nacht begann leise zu regnen, Frank holte einen Schirm, den er in einer Hand hielt, während er mit der anderen einzelne Teile von Ruth wärmte. Sie redeten, tranken und schwiegen, und die Schwalben gingen schlafen.
Als der Morgen kam, sehr leicht, wusste Frank, dass er sich verliebt hatte, in einer Art, die nichts mehr mit den schnellen Hormontsunamis der Jugend zu tun hatte. Er wollte Ruth in seinem Leben wissen, ihr aus seinen Comics vorlesen, ihr seine Musik vorspielen, sie auf seinem Bauch zum Schlafen legen. Und als Ruth irgendwann gehen musste, weil es zu hell geworden war dafür, dass alles immer so weitergehen könnte, sagte sie: »Ich werde bald nach Tel Aviv ziehen. Zu meinem Freund. Wirst du für unseren Vogel sorgen?«
Der kleine Vogel war am dritten Tag tot.
Und Frank setzte sein Leben fort wie gewohnt.
Er lag auf dem Sofa, las Comics, ging in sein Büro, und abends saß er auf dem Balkon, wenn das Wetter danach war. Ab und an erinnerte er sich an Ruth und verstand nicht, warum sie nicht bei ihm geblieben war. Sie hätten zusammen hier sitzen können, der Vogel hätte fliegen gelernt, und es wäre ein schönes Leben gewesen, zu zweit.
Maria
Berlin
Penner, dachte Maria, und sah auf den Klumpen alten Fleisches, der ihr den Weg versperrte. Da hockten die alten Idioten, die keine Zukunft hatten, starrten hohl und versperrten dem Jetztmenschen die Zufahrt zur Zukunft. Maria hasste alte Menschen, sie hatte Mühe mit deren Geruch, sie verachtete deren Kramen in Geschichte.
Maria hasste ihre Vergangenheit, weil sie so belanglos war. Nicht einmal einen Vater gab es, der sie missbraucht hätte, nur irgendeinen, der alle Jahre ein Weihnachtspaket schickte. Sie hatte eine alleinerziehende Mutter, die auch in Ordnung war, und einen idiotischen jüngeren Bruder. Mehr war da nicht. Kein Graf in der Familie, keine dunklen Geheimnisse, keine Prothesen.
Maria fühlte sich betrogen und wusste nicht, warum.
Es regnete, sie fror, das Kind wachte auf, sie wollte nach Hause, der Feierabendverkehr setzte ein, Mütter wie sie hetzten mit Kinderwagen durch die Straßen, um vor Ladenschluss noch irgendeinen Mist zu erwerben, ihn auf den Wagen zu häufen und zu Hause in den Bauch zu schaufeln. Durch die Pfützen spritzten Autos, die Gesichter um sie waren so deutsch, so schwer, so groß. Immer diese Störungen überall, die brachten Maria aus dem Gleichgewicht, wie ein Kurzschluss im Gehirn, der sie wütend werden ließ. Sie musste sich beherrschen, ihre Züge mussten sich entspannen und schön werden, sie musste schön sein, um eine neue Wohnung zu finden. Es war nicht so leicht, eine kindgerechte Wohnung in Berlin-Mitte zu finden. Eine kindgerechte Wohnung musste schadstofffrei sein. Sie musste frei sein von Gefahrenquellen.
Die Welt war eine einzige Gefahrenquelle, überall lauerten Verletzungen, abgetrennte Gliedmaßen, Tupperwaredosen, Vergewaltiger, Terrorattentate, Giftgas.
Maria wusste nicht, warum sie so gereizt war, denn der Höhepunkt ihres Lebens fand jetzt statt. Sie war Mutter. Sie konnte stillen, wann und wo immer ihr danach war. An öffentlichen Plätzen, kein Problem, konnte sie das Kind wickeln, die schmutzigen Windeln wechseln, und es würde keiner daran Anstoß nehmen können, weil sie dafür Sorge getragen hatte, dass die verdammte Menschheit nicht ausstarb. Maria hasste so einiges. Aber am meisten hasste sie sich von innen.
Dieses fette Nichts, das immer mit ihr war, seit sie sich er-innern konnte, seit sie ein Mensch war und nicht mehr ein Gemüse. Mit sechs war es, dass sie von der Leere gefunden, von ihr infiziert worden war, an einem Sonntag, vermutlich unterwegs mit ihrer Mutter und ihrem dämlichen Bruder Poahl. Die Sonne war zu hell, sie waren im Zoo, und Maria schaute die Tiere an. Die Tiere schauten zurück, viel zu auffällig schauten die, wie die gierten und glubschten, wie ihre Zungen heraushingen und ihre Tatzen schabten. Maria starrte die Tiere an und wurde ganz schwer. In ihr war nichts. Außer dem übergroßen Wunsch, sich fallen zu lassen, sich nicht mehr bewegen zu müssen. Die Tiere hatten sie infiziert. Die Tiere waren schuld.
Es gab in den Jahren danach nichts, was Maria zu entzünden vermochte. Sie schleppte sich träge durch ihr Leben, und immer wirkte sie wie eine Eiswaffel, die zu Boden gefallen war.
Maria begann erst etwas zu fühlen, nachdem sie ihr Kind auf die Welt gebracht hatte. Sie wusste nicht, was es war, konnte die Veränderung nicht benennen, denn es ist so kleinteilig, was einen abgestorbenen zu einem lebendigen Menschen macht. Plötzliches Riechen und Schauen und Wut, die Maria willkommen hieß, denn es waren Gefühle, es war Lebendigsein.
Zum ersten Mal fragte sich Maria nicht, warum sie was als Nächstes tun musste, sondern sie ging auf im Augenblick, und jeder Augenblick hieß: nicht mehr allein sein und die erfüllende Wichtigkeit von Verantwortung spüren. Na, und all der Quatsch halt.
Verfickter Mist, dachte Maria und sah voller Verachtung das alte Paar an, das mit einem miesen kleinen Vogel am Straßenrand stand. Diese Idioten. Warum gingen die nicht sterben. Maria kam nach Hause. Stolperte über irgendein verschissenes Skateboard, und schon wieder ging es los, schoss es ihr vom Sternum in den Hals, in den Kopf, und trat gegen den Kinderwagen, bis er umfiel, das Scheißkind auf den Boden, Maria in ihr Zimmer, die Tür zugeschlagen, diese Wut, diese furchtbare, die sie manchmal wünschen ließ, die Leere würde zurückkommen.
Helena
Manaus
Helenas Haltung drückte nur unzureichend den Umfang ihres Unwohlseins aus. Sie saß auf einem schalenförmigen Plastiksessel in einer Betonhalle, die vielleicht ein Flughafen war, im Moment deutete nichts darauf hin. Drei Indigene lagen in den Ecken, kein Café, kein Duty Free, kein Anzeichen für Flugtätigkeit. Es konnte also sein, dass die Halle einfach eine Halle war und Helena die Jahre bis zu ihrem Ableben auf einem Plastikstuhl verbringen musste. Neben ihr am Boden lag mit offenem Mund Serra, den sie in Manaus kennengelernt hatte. Er schien ihr seltsam fremd, was erstaunlich war, bedachte man, dass die beiden sich immerhin schon einige Stunden kannten.
Helena hielt ihre Beine mit den Armen umklammert und suchte mit einem Ansatz von Wahn im Blick den Boden nach Kakerlaken ab. Wie konnte Serra schlafen, mit offenem Mund, da jeder wusste, dass Kakerlaken Menschenöffnungen liebten.
Sechs Stunden noch bis zum Abflug, und es war so eine Situation, die leider nicht zum Tod führen würde, sondern irgendetwas Schlimmeres war.
Brasilien ist großartig, hatten ihr Bekannte erzählt und Dutzende brasilianischer CDs aufgelegt, und ihr war übel geworden, denn das Tempo der Musik vertrug sich nicht mit ihrem eigenen. Ohne rechte Lust hatte sie dann eine Reise geplant, obwohl sie lieber nach Indien wollte, aber dort war sie schon gewesen, und außerdem hatte sie das Denguefieber, mit dem sie sich dort infiziert hatte, in unerfreulicher Erinnerung behalten.
Brasilien war ihr eigentlich nicht Dritte Welt genug, denn sie assoziierte Karneval damit und Zuckerhut und Playa. Kein Ort für sanften Tourismus.
Helena hasste den Winter in Berlin. Sie hasste auch den Sommer in Berlin, eigentlich hasste sie ihr Leben in Berlin oder sonst wo und war ständig auf der Suche nach etwas, was ihr sinnvoller erschien als sie selbst. Sie hatte Rückführungskurse gemacht und Tantra, Reiki, das volle Programm – sie redete von umfassender Liebe, und wenn sie mal einen Freund gehabt hatte, dann wollte sie an Problemen arbeiten, loslassen lernen und sich auseinandersetzen, so lange, bis der Freund weg war.
Ein Umstand, der meist sehr schnell eintrat.
Helena war kein schlechter Mensch, aber sie hatte Angst, es zu sein, und wollte darum besser werden als andere, tiefer irgendwie, und das hatte dazu geführt, dass sie außer nervös gar nichts mehr war. Immer begleitet von dem Gefühl, dass sie nicht genügte. Was irgendwie auch stimmte. Denn wem konnte eines genügen, das verspannt war und immer versucht, alles richtig zu machen.
Helena hatte außer Brasilien fast alle Länder bereist, über die ein Lonely Planet existierte.
Sie hatte gelächelt, wenn die Einheimischen sie beschimpften, wenn sie sagten, du hässliches Stück weiße Wurst, hatte sie genickt, die Hände vor der Brust gefaltet und sich mit den wenigen Sätzen, die sie vorher aus Reiseführern gelernt hatte, demütig bedankt.
Helena hatte den Vorsatz, wenn sie unterwegs war, zu leben wie die Eingeborenen, also hatte sie in Hängematten auf afrikanischen Flussschiffen geschlafen, in Lehmhütten in der Wüste und in Indien in den billigsten Herbergen. Sie hatte alle erhältlichen Infektionskrankheiten bekommen und sich nicht viele Freunde gemacht, denn wozu sollten Touristen gut sein, die kein Geld ausgaben. Helena hatte fast überall, wo sie gewesen war, eine Liebesgeschichte gehabt, und jedes Mal davon geträumt, mit dem entsprechenden Mann in seinem Land zu bleiben. Das wollten die Männer nie, sie wollten nach Deutschland, und zweimal hatte Helena einem Mann ein Flugticket geschickt. In Folge saß dann ein Taxifahrer aus Kenia in ihrer Wohnung, der sehr schnell das Reden einstellte und stattdessen Schnaps trank, das andere Mal traf es einen Mann aus Bangladesch, der für ein Sozialwerk arbeitete und in Berlin sofort depressiv wurde. Zu Hause arbeitete Helena in Kopierstuben, Kneipen, Discos, Reinigungsunternehmen, Gärtnereien, so lange, bis sie wieder das Geld für eine Reise zusammenhatte.
Nun war sie seit einer Woche in Brasilien, und es gefiel ihr überhaupt nicht. Brasilianern ging jede asiatische Sanftheit ab, könnte man sagen. Oder auch – sie hatten keinerlei Probleme zu zeigen, was Touristen für sie waren: Portemonnaies auf zwei Beinen. Helena hatte Angst gehabt, auf die Straße zu gehen, Angst, das billige Guesthouse in Manaus zu verlassen. Und als sie es dann doch tat eines Abends und durch eine Straße huschte, in der ungefähr 6000 Ratten wohnten, war sie Serra in die Arme gelaufen, der schlecht Englisch sprach und ihr bedeutete, diese Straße schnell zu verlassen, weil jeder wusste, dass dort 6000 Ratten wohnten. Er hatte sie in eine Bar gezogen und sie angesehen. Eigentlich hatten sie sich den ganzen Abend nur angesehen, weil sie kaum miteinander reden konnten. Serra hatte den Körper eines Jungen und ein faltenfreies Gesicht mit traurigen braunen Augen.
Ein Indigener, der sein Glück seit Jahren als Goldgräber suchte. Sie hatten sich nur umarmt in dieser ersten Nacht, doch das langte, dass Helena sich verliebte, es brauchte wenig, um ihre Sehnsucht zu wecken. Sie wälzte sich die ganze Nacht und sah sich mit Serra in einer einfachen Holzhütte wohnen, und ihre Liebe wäre groß genug, um das Leben zu füllen. Als der Morgen kam, war sie so unglücklich, dass sie meinte, aus dem Fenster fallen zu müssen, weil sie glaubte, ihn nie wiederzusehen, und noch drei Wochen in diesem Land, in dem sie sich nicht auf die Straße traute. Sie wollte die Ratten nicht sehen und auch nicht die Kakerlaken, die des Nachts in Pilgerzügen die Taue entlang in die Boote tigerten, die auf dem Amazonas verkehrten. Sie hatte geweint, als sie Serra vor dem Eingang des Hotels sitzen und auf sie warten sah. Er wollte sie mitnehmen zu seiner Goldmine.
Das war genau das Abenteuer, auf das Helena gewartet hatte.
Nun saß sie in einer Betonhalle, von der sie annahm, dass es sich um einen Flughafen handelte. Genaueres wusste man nicht. Serra hatte ihr noch gesagt, wann das Flugzeug gehen würde, und war dann, ohne lange zu zögern, eingeschlafen. Helena blickte die Kakerlaken an, die, wie man es Hühnern mit abgetrennten Köpfen nachsagte, hektisch durch die Halle rannten. Vielleicht hälfe es, dachte Helena, sich vorzustellen, es seien schwarz eingefärbte Küken, die da am Boden tollten, vielleicht hälfe es zu denken, sie selbst sei nicht hier, sondern an einem sicheren Ort. Und dann begann sie nachzudenken, was das für einer sein könnte.
Michael
Berlin
Michael lag auf seiner Couch und hörte alte Brasilplatten, die er auf dem Flohmarkt gefunden hatte. Michael liebte Brasilmusik; und zu liegen und ihr zu lauschen, schien ihm ein ausreichender Lebensinhalt. Es war ihm nicht gelungen, eine Frau zu finden, was sicher mit der Beinprothese zu tun hatte, die er trug. Wenn er sie trug, denn bis anhin hatte er sich eher an das Abhandensein seines Beines gewöhnt als an den erbärmlichen Fiberglasersatz. Michael hatte immer gewusst, dass er eines Tages sein Bein verlieren würde. Nun, eigentlich war es eher sein Fuß gewesen, den er ab und zu mit einer unbestimmten Trauer betrachtet hatte, wie etwas, das einem nicht gehört und wieder weggenommen würde. Als es dann bei einem Mopedunfall wirklich geschah, als seine Vespa unter die Tram schlitterte und er das Blut am anderen Ende seines Körpers sah, den seltsamen Winkel des Beines, den herausragenden Knochen, wusste er sofort, dass der Moment des Abschiednehmens gekommen war. Es war eine Erleichterung gewesen, das eintreten zu sehen, worauf er schon lange vorbereitet war. Die leere Stelle an seinem Körper war ihm selbstverständlicher erschienen als das vorher vorhandene Körperteil.
Es kam der Vorstellung, die Michael von seinem Leben hatte, sehr entgegen, dass er Invalidenrente bezog, die, wenn sie auch nicht üppig war, doch ausreichte, um auf der Couch zu liegen, Marihuana zu rauchen und Brasilplatten zu hören.
Die einzige Frau, die sich für ihn interessierte, war die Verrückte aus dem oberen Stock, die immer mit einem Kinderwagen vor seiner Tür stand, darin lag ein alter Teddybär, den sie in seiner Wohnung wickelte und stillte, weil sie ihn als den Vater des Bären bezeichnete. Normal.
Früher war die dicke Helena ab und zu zu ihm gekommen, sie liebte es, wenn er ihr Brasilmusik vorspielte. Ansonsten war Michael alleine und vegetierte in der Art vor sich hin, wie es zur gleichen Minute vermutlich 800 Millionen anderer Menschen taten. Wenn sie nicht zwingend für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten oder in Folge einer Geisteskrankheit einer Obsession nachhingen, waren die meisten Menschen nicht mehr als träges Fleisch, und es war ihnen wohl, herumzuliegen, zu stieren, etwas zu kauen und sich nicht besonders sauber zu halten.
Mit seiner abgebundenen Jogginghose und seinem T-Shirt, auf dem sich Essensreste der letzten vier Wochen aufhielten, hüpfte Michael durch seine Wohnung auf der Suche nach irgendeiner oralen Befriedigung. Essen, trinken, rauchen, austreten, um mehr war es ihm nie gegangen. Michael war ohne jede Anforderung groß geworden. Seine Eltern hatten ihn in ihren späten Jahren empfangen und sich so verhalten, wie es ältere, wohlhabende, gelangweilte Eltern oft tun: falsch. Alles in Michaels Jugend war kindgerecht, psychologisch durchdacht, Michael wurde nicht eine Sekunde sich selbst überlassen, seine Eltern gingen mit ihm zum Babyflötenspielen und Tanzen, zum Schwimmen, in Spielgruppen, Stillgruppen, seine Kleidung war schadstofffrei, das Spielzeug umweltverträglich, die Nahrung ausgewogen und die Getränke ungesüßt. Als seine Eltern starben bei einem Autounfall, vererbten sie ihm kaum etwas, weil sie all ihr Geld für seine kindgerechte Aufzucht und seine exzellente Ausbildung verwandt hatten.
Das nahm Michael seinen Eltern wirklich übel, dass sie einfach so gestorben waren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer in Folge mit ihm spielen sollte. Ein Jahr nach ihrem Verrat verlor Michael sein Bein, nun, fünf Jahre später, war er eine freundliche, übergewichtige Flasche, die das Haus selten verließ, dauernd stoned war und mit dem Sofa verschmolz.
Ab und an, in klaren Momenten, dachte Michael mit gelinder Sorge daran, dass er vielleicht noch 50 Jahre so weitermachen musste, in dieser Sozialwohnung, mit der Musik, mit den Joints, so auch an jenem Tag, von dem Michael weder sagen konnte, um welchen es sich handelte, noch, ob er bereits den Nachmittag erreicht hatte oder ob es noch früh am Morgen war. Ein Mann zu sein, ist auch nicht nur ein Zuckerschlecken, dachte Michael, ohne genau zu wissen, was er damit meinte. Er zündete sich einen großen Joint an, den er am Küchenfenster rauchte. Er merkte zu spät, dass er das Gleichgewicht verlor, aus dem Fenster stürzte und ihm eine Schlagader in der Leiste aufriss, sodass er, als er aufwachte, auch das andere Bein verloren hatte.
Michael stand jedoch so stark unter Morphium, dass ihm das keine großen Sorgen bereitete.
Nach seiner Genesung und Rehabilitation kehrte er mit zwei Prothesen in seine Wohnung zurück. Er würde bald ins Erdgeschoss umziehen, so lange würde er auf dem Sofa liegen und ein wenig Brasilmusik hören. In jener Nacht sah Michael die kleinen Tiere zum ersten Mal. Ein Rudel Hasen, Tapire und Biber, die von nun an jeden Abend kamen, um sich in Michaels Wohnung aufzuhalten. Es brauchte einige Zeit, bis Michael den Mut aufbrachte, die Tiere anzusprechen. »Entschuldigung«, sagte er, »aber das ist meine Wohnung, in der Sie sich aufhalten.« »Nichts für ungut«, antwortete einer der Hasen, »wir kommen, um Sie abzuholen. Aber lassen Sie sich ruhig noch ein wenig Zeit.«
Ruth
Tel Aviv
Ruth saß in einer leeren Wohnung in Tel Aviv. Obwohl – richtig leer ginge anders. Es gab eine Matratze und ein paar weiße Schachteln von Ikea, eine Kaffeemaschine, einen Topf.
In einer Flasche steckten Äste. Völlig unbekannte Äste. Ruth hielt Äste neben Bambus für die einzig akzeptable Blumenform. Sehr reizend, das kleine Grün aus dunklen Zweigen – doch nun staken da Äste, deren Knospen fast wie dicke Insekten am Stamm saßen. Ein großes Gefühl der Unvertrautheit – Äste, die man nicht versteht.
Ruth saß in der leeren Wohnung in einem Zustand völliger Verwirrung. Die Nerven in ihrem Körper vibrierten dermaßen, dass der Körper vor lauter Entsetzen mit einer Art Koma antwortete. Nun, wissenschaftliche Erklärungen waren nie ihres gewesen, Ruth wusste nicht genau, ob Nerven wirklich vibrieren konnten.
Um sich zu beruhigen, überlegte sie, wann ihr schon mal ein ähnliches Gefühl von Verzweiflung begegnet war, dieser Zustand, da ein Selbstmord fast vorstellbarer schien, als weiterzumachen.
Aber zum Selbstmord bräuchte es eine zielgerichtete Aktion, und die war genauso unvorstellbar, wie zu tun, was man als Mensch so tut. Essen, rumlaufen, lesen, Zeit herumbringen.
Sie erinnerte sich an dies eine Mal, zehn Jahre zuvor, als die große Leidenschaft ihres Lebens sie verlassen hatte in einem fremden Land. Da hatte sie sich so gefühlt, auf einem Hotelbett und völlig außerstande, sich irgendwohin zu bewegen. Damals hatte eine Freundin sie gerettet, die ihr am Telefon jeden weiteren Schritt vorgab, den Ruth zu tun hatte. Die Freundin war gestorben und eine neue nicht nachgewachsen.
Das Denken machte ihre Panik ein wenig dünnflüssiger. Fast atmete Ruth wieder normal, und gleich, gleich würde sie ein wenig rausgehen können, laufen, herumlaufen, sich ablenken, weitermachen. Macht man doch immer so …
Nimmt man einem Menschen Gewohnheiten und Bezugspunkte, bleibt nicht viel übrig. Ruth hatte es schon immer furchtbar anstrengend gefunden, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Darum hasste sie auch Urlaube. Sie fühlte sich wie nicht vorhanden an Orten, da keiner sie benötigte. Die Lüge des fröhlichen Entdeckens und Spaßempfindens in unvertrautem Gelände erforderte von ihr eine derart große psychische Anstrengung, dass sie nach ein paar Tagen erschöpft in ihrem Hotelbett, wo auch immer es sich aufhielt, endete und Fernsehen sah, in ihr unverständlichen Sprachen, die Rollos heruntergelassen.
In der fast leeren Wohnung in Tel Aviv gab es keinen Fernseher. Von draußen das Geräusch von Dauerregen, der auf dickblättrige Pflanzen trifft. Feiertage waren in Israel genauso öde wie überall, wenn man keine große Familie hat oder kochen muss, weil man eine große Familie hat oder religiös ist und eine große Familie hat. Das jüdische neue Jahr begann, Jom Kippur, das Laubhüttenfest, ein toter Tag jagte den nächsten, einen Monat lang.
Ruth setzte sich vom leeren Zimmer auf den leeren Balkon, der Regen war leise und dünn geworden, und irgendwas erinnerte sie an irgendwas, aber was das war, das sie auf einmal so sehnsüchtig werden ließ, fiel ihr nicht ein.
Sie war jetzt seit einem Monat in der Stadt, hatte eine Wohnung gesucht, war mit Stadtplänen herumgeirrt, wollte Möbel kaufen und hatte nur Ikea gefunden.
Ruth hatte versucht, sich so schnell wie möglich auszukennen, damit sie ihr Leben wie gewohnt würde fortsetzen können.
Sie wusste unterdes, was Israelis mit Designerwohnung (Fenster mit Bleiglas und seltsam gelben Kacheln am Boden) und modern (die Fenster lassen sich bewegen), lebhaft (Hauptstraße, Busse, da war doch was mit den Bussen) meinten. Sie wusste, welche Stadtteile gingen (Zentrum) und welche gar nicht, Bat-Yam (sah aus wie Rumänien), Bnei-Brak (sah aus wie in einer Synagoge), Yaffo (sah aus wie an einem Bahnhof in Rumänien). Nun wohnte sie um die Ecke einer Hauptstraße mit Cafés, Läden, Restaurants, das ganze Zeug, und auf der anderen Seite hinter ein paar einsturzgefährdeten Bauhausgebäuden war das Meer.
Ruth hatte schnell gelernt, nicht zu freundlich zu sein, denn Freundlichsein in Tel Aviv ließ die Männer denken: ficken, ließ die Frauen denken: geisteskrank, oder: will mit meinem Mann ficken. Sie hatte gelernt, Autos mehr zu fürchten als Terroristen, es gab 6000 Verkehrstote jedes Jahr, dagegen nur 200 Terrortote. Ruth hatte darüber nachgedacht, ob es die Anspannung war, die das Volk hier zu den beschissensten Autofahrern der Welt machte, oder ob sie alle schlechte Augen hatten. Die hohe Optikerdichte könnte darauf schließen lassen.
Untertags war Ruth herumgelaufen und über Straßen gehuscht wie durch Tretminenfelder, sie hatte versucht, Hundehaufen und Kakerlaken auszuweichen und der Hitze zu entkommen.
Bei Nacht war Tel Aviv kaum auszuhalten vor Gutaussehen. Der Verfall in Dunkel getaucht, Licht aus den Wohnungen auf Bäumen, von denen Schlingpflanzen lappten, der Geruch von fremd, alle Menschen schienen so viel interessanter als daheim, das Essen besser und das Meer vorhanden. Ab und zu, selten und nie, wenn sie es brauchte, rief einer ihrer Freunde an, die schon Jahre entfernt schienen, und Ruth hatte stets das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Die Freunde gaben sich besorgt, vielleicht weil ihnen sonst kein Thema einfiel oder weil sie ihre Wut darüber, dass Ruth in einem ihrer Meinung nach aufregenden Land saß, in einem neuen Leben, und sie alleine gelassen hatte, hinter etwas Akzeptiertem zu verstecken suchten.
Wie konnte sie denen daheim sagen, dass es eigentlich so war wie zu Hause, nur mit ein paar Schlingpflanzen? Ruth hatte keine Ahnung vom Alltag in Perth oder auf den Fidschi-Inseln, aber sie vermutete, dass sich Alltage nirgends sonderlich verwegen ausnahmen.
Das, was die meisten durch die Medien auf den kleinsten Nenner gebracht von Israel wussten, war: Politik, Mauer, explodierende Busse. Da willst du wohnen, fragten die Freunde. Ist doch egal, dachte sie, irgendwann weiß man, dass man überall wohnen kann, wo es thailändisches Essen gibt und man sich als Frau nicht verschleiern muss, außer man hat Pech und wohnt da, wo es richtig scheiße ist, in Tschetschenien oder im Sudan, aber wie es dort ist, wusste sie auch nur aus den Medien. Leben wollen doch alle mehr oder weniger in derselben Art. Ruhe und was essen, eine Familie und ein nettes Fernsehprogramm. Wenn die Menschen Pech hatten und im Sudan oder in Tschetschenien lebten, wurde es ihnen nicht unbedingt leicht gemacht, ihre kleinen Ansprüche zu realisieren.
Ruth begann ein wenig abzustumpfen, wie die meisten hier. Was kann man sich täglich aufregen, in einem Land, in dem es in vielen Orten 18 Prozent Arbeitslose gab, in dem das Geld immer weniger wert war, die Wirtschaft zusammenbrach, das Bildungssystem, das eines der besten der Welt war, bachab ging, jeden Tag ein neuer Korruptionsfall bekannt wurde und die Angst passiv das Leben bestimmte. 3838 Terroranschläge gab es im letzten Jahr, täglich wurden 40 Attentatsversuche vereitelt. Alltag ging da nur mit Verdrängen. Die Jungen waren am Strand, die schönen Kinder. Europäische und orientalische, afrikanische, indische Elternteile hatten Menschen auf die Welt gebracht, die es sonst nirgends zu geben schien, in dieser Fülle an gelungenen genetischen Kombinationen. Sie rannten am Strand rum, spielten Matkot (Pingpong ohne Tisch), flirteten und waren laut, denn das war Pflicht. Hier lief nichts ohne hupen, schreien, Türen knallen, Hundebellen – leise war für die anderen.
Ruth ging vom Meer, das seltsam grau schien, in eines der tausend Cafés, Leben gucken. Da waren schon wieder welche am Heiraten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es gab nirgends so eine Dichte an Hochzeitsausstattern, und geheiratet wurde hier, als ob das Video, was man da drehte, wichtiger wäre als Liebe oder ähnliche Albernheiten.
Ruth arbeitete als Übersetzerin, und sie tat es schon seit Langem ohne jede Euphorie. Vor 20 Jahren hatte sie für die Literatur gebrannt, nach dem richtigen Ausdruck gesucht, sie wollte die beste Übersetzerin der Welt werden. Heute erinnerte sie sich manchmal wehmütig an die Leidenschaft, die sie damals empfand.
Ruth brannte schon seit Langem für nichts mehr. Vielleicht passierte das unweigerlich, wenn man älter und alles Wiederholung wurde. Ruth konnte von ihrer Arbeit leben, sie hatte einen festen Kundenkreis, und sie war routiniert geworden.
Die Leidenschaft allerdings war nicht mehr vorhanden.
Ruth wusste nicht genau, was sie mit den eventuell übrig bleibenden 40 Jahren noch anfangen sollte. Eine Beziehung wäre nicht schlecht, hatte sie gedacht, und wie alle, die noch nie eine richtige Beziehung gehabt hatten, davon geträumt, dass sich durch einen Menschen, der nicht sie war, ihr Leben ändern würde.
In Ruths Lieblingscafé buk eine alte Dame aus Polen Burekas, und ein paar übrig gebliebene Jeckes, deutsche Juden, unterdes alle 180 Jahre alt, hielten dort täglich ihren Stammtisch. Ruth saß am Rande, um Rentner zu schauen. Die Alten in Israel waren vor allem niedlich. Damen mit bunten Haaren, Hüten, Handschuhen, geschminkten Lippen, die reizende, alte Herren streichelten. Einige von ihnen hatten noch Kibbuze gebaut und an eine gute Zukunft geglaubt. Manche glaubten gar nichts mehr. Immer wieder sah man die Alten in Wohnungen, die wie Gefängnisse schienen, da sangen sie komische Lieder oder weinten. Die Geschichten mochte keiner hören. Wenn Ruth sich langweilte, genügte es, vor die Tür zu gehen, da war immer was, wenn nicht gerade Feiertag war. Die Supermärkte 24 Stunden geöffnet, Kinos und Bars, und laut war es – immer. Alle Tel Aviver sagten, dass Tel Aviv nicht Israel sei. Jerusalem war für die Orthodoxen, die Siedlungen für die Rechten. Tel Aviv, sagten Tel Aviver, sei die schönste Stadt der Welt. Und eben nicht Israel.
Immer wenn Ruth müde wurde von zu viel Lautstärke und davon, dass jeder nur an sich dachte und bloß nicht freundlich sein, wenn es auch unfreundlich geht, gab es einen, der Ruth denken ließ – vielleicht kann ich hier zu Hause sein.
Ein alter Mann, der Vogel spielte im Wind, ein dicker Mann, der seine Hose wechselte mitten auf der Straße, Fremde, die sie irgendwelches Zeug kosten ließen, im Restaurant, alte knutschende Pärchen. Immer wieder niedliche Sachen.
Es wurde Abend, draußen begann das neue Jahr, Familien, und das hieß: 30 Leute Minimum saßen zusammen und brüllten sich an wegen des Leise-kann-jeder. Ruth, ohne Großfamilie, lief durch die angenehm leeren Straßen ihres neuen Lebens und schaute in die Wohnungen, überall war es hell, überall wurde gebrüllt, und überall wollten sie, was Menschen überall wollen: viel essen, sich verlieben, ins Kino gehen, Musik hören und alt werden, um sich mit komischen Hüten auf dem Kopf an den Händchen zu halten. So einfach.
Und so schwierig, weil doch immer etwas dazwischenkommt. Eine Bombe, ein Krieg, blöde Nachbarn oder Männer, die weglaufen, ehe etwas begonnen hat.
In der Wohnung fiel Ruth auf, dass Jakobs Reisetasche verschwunden war, mit ihm, gestern, nachdem sie gestritten hatten, weil er diese Idee vom Leben in einem Kibbuz hatte, bei der sich ihr die Haare vor Ekel aufstellten. Sie wollte nicht in die Wüste gehen, um dort Ziegen zu melken.
Sie hatte sich alles anders vorgestellt.
Das Leben mit Jakob, den sie im Internet kennengelernt hatte, mit dem sie sich so wohlgefühlt hatte diesen einen Monat, als sie hier war im Sommer, diese drei Wochen, die er bei ihr war danach. Sie hatte gedacht, dass sie endlich einen gefunden hätte, um nicht mehr alleine in einem Leben zu sitzen, das nett war und so langweilig an manchen Sonntagen. Etwas ganz Neues noch einmal, bevor sie endgültig zu alt wäre, um etwas ändern zu wollen. Nun war sie alleine hier und ein wenig müde darum, denn das Alleinsein kannte sie. Wenn ihr Leben sich ändern sollte, müsste sie das wieder ohne fremdes Zutun erledigen. Wie unendlich anstrengend das war.
Ruth sah in den Regen, und ihr fiel der Mann ein, den sie eine Woche, bevor sie hierhergezogen war, kennengelernt hatte. Der so schön ruhig war und ihre Füße gewärmt hatte. Und sie musste lachen. So albern war das Leben, dass sie nie einen Mann gefunden hatte, und dann waren da auf einmal zwei, und schon waren beide wieder weg. Und ihr war klar auf einmal, dass sie hierbleiben würde. Jakob würde zurückkommen. Oder auch nicht. Und wenn nicht, würde sie einfach weitermachen wie immer, eben in einem anderen Land. Sie setzte sich mit ihrer Instantsuppe auf den Balkon, in den Regen, und schaute das Altersheim an, auf der Straßenseite gegenüber. Ihr fremde Lieder wurden gespielt, von einer Drei-Mann-Kapelle im Speisesaal, ein paar alte Frauen tanzten miteinander, und natürlich hatten sie merkwürdige Hüte auf. Die Damen lächelten. Von der Musik kamen nur ein paar Geigentöne klar an, bei Ruth, im Regen, auf dem Balkon.
Frau Katz
Ad-mea-vehesrim-Heim
Ihre Ausgelassenheit würde überbordender sein, wenn die Augen nicht brennen wollten und sie nicht so unendlich müde wäre, dass sie direkt auf den Fußboden sinken und einschlafen hätte wollen.
Schlafentzug hat seltsame Folgen, er macht nicht müde in dem Sinn, wie man es kennt, vor wohligem Schlaf, vielmehr wird der dauernd Schlaflose gereizt, seine Sinne scheinen wie überwach, und er reagiert empfindlich auf Helligkeit, Geräusche, Stimmen und Anliegen. Frau Katz tanzte lustlos mit ihrer Zimmernachbarin, eine Rentnerband spielte Schlager aus den 50er-Jahren, und Frau Katz gähnte auffällig. Ich glaube, ich ziehe mich dann mal zurück, sagte sie. Und ging auf ihr Zimmer. Hier war sie seit sechs Jahren zu Hause, und wenn sie ehrlich war, musste sie sagen, dass sie fast jeden Tag genossen hatte, auch wenn sie nicht schlafen konnte.
Sie kannte es ja nicht anders.
Vielleicht hat jeder Mensch ein Lebensmotto, dem er sich stellen muss.
Kurz nachdem sie vor 50 Jahren geheiratet hatte, war die Mutter ihres Mannes zu ihnen gezogen. Ben, der ein großes Herz hatte, fand es selbstverständlich, dass er seine Mutter nach dem Tod des Vaters nicht alleine ließ. Was folgte, war das normale Elend. Kaum erwähnenswert, die kleine private Hölle, die ihr Bens Mutter täglich bereitet hatte. Sie war nicht laut. Nur böse. Und stand immer, wenn man sie nicht erwartete (doch mit den Jahren erwartete man sie natürlich ständig), wie ein schwarzer Vogel neben einem. Sie redete mit leiser zischender Stimme und hatte außer Egoismus und Hass auf ihre Schwiegertochter kaum Charaktereigenschaften. Selbst die Kinder waren ihr egal, wenn sie sich unbeobachtet wähnte, trat sie nach ihnen oder erzählte ihnen Geschichten, von denen sie zu weinen begannen vor Angst.
Frau Katz’ Schwiegermutter war sehr, sehr alt geworden und natürlich krank und bettlägerig die letzten zehn Jahre. Frau Katz hatte nie Zeit für sich. Nahm sie sich ein paar Minuten beim Einkaufen, in denen sie am Rande des Yaakon-Flusses saß und sich weit weg träumte, war die Gehässigkeit der Schwiegermutter umso größer, wenn sie zurückkehrte. Das Unangenehmste war, dass Frau Katz sich all die Jahre vorwarf, dass sie kein anderer Mensch war. Einer, der die Alte in die Schranken hätte weisen können, einer, der sich durchzusetzen gewusst hätte. Oder einer, der hätte schlafen können wie ihr Mann.
Frau Katz konnte nicht schlafen.
In der Nacht kamen die Kinder und die Schwiegermutter in ihr Schlafzimmer, mit Angst, Träumen, Durst oder anderen Anliegen. Das machte, dass Frau Katz den Schlaf fürchtete, weil sie wusste, dass sie auf jeden Fall erschrecken würde, irgendwann, jede Nacht.