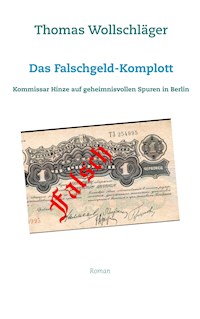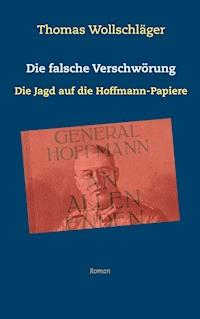
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
August 1939. Der Pariser Journalist Paul Genty erhält den Auftrag, den Nachlass des deutschen Generals Max Hoffmann aufzuspüren. Darunter könnten sich wichtige Dokumente befinden, die Redaktion rechnet mit brisantem Material und einer aufsehenerregenden Veröffentlichung. Doch die einzige Spur führt über die Witwe des Generals, die sich als Jüdin im nationalsozialistischen Berlin verborgen halten muss. Für diese Mission muss Paul also nach Berlin reisen, getarnt als Berichterstatter über eine archäologische Konferenz. Von Archäologie aber hat er keine Ahnung - wird seine Tarnung standhalten? Kann er im Zentrum des Deutschen Reiches und im Angesicht der sich immer deutlicher abzeichnenden Kriegsgefahr seine Mission rechtzeitig erfüllen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Caroline
Inhalt
Die Tat 7. Juli 1927
Der Auftrag 14. August 1939
Das Adlon 21. Dezember 1921
Die Stadt 17. August 1939
Die Nachricht 19. August 1939
Das FAUN 23. Dezember 1921
Die Maaßenstraße 20. August 1939
Das Theater 10. Oktober 1930
Der Film 22. September 1932
Die Verschwörung 20. August 1939
Der Kongress 21. August 1939
Die Villa 23. August 1939
Das Ende 25. August 1939
Der Zug 15. Februar 1945
Epilog 10. Juni 1945
Nachwort: Fiktion und Realität
Bildnachweise
07. Juli 1927
Bad Reichenhall in Süddeutschland
Die Tat
Sie kamen bei Nacht, mitten im fürchterlichsten Gewittersturm des Sommers. Pausenlos durchzuckten Blitze den pechschwarzen Himmel. Der Wind drückte so heftig auf die Bäume, dass die kleineren Stämme sich beinahe bis zum Boden durchbogen. Selbst die größten Bäume ächzten mit aller Anstrengung, und fast wie in einem vorgegriffenem Herbst wurden sie eines Großteils ihrer Blätter beraubt. Der Regen strömte so dicht, dass die Sicht nicht mehr als ein paar Schritte reichte. Durch die Windböen getrieben, peitschte das Wasser geradezu horizontal und durchnässte jeden Winkel.
Die beiden Wachposten froren trotz der vor wenigen Stunden noch hochsommerlichen Temperaturen ganz erbärmlich. Obwohl sie in feste, lange Mäntel gehüllt waren, Kragen hochgeschlagen, Stahlhelme auf dem Kopf, hatten die Sturzbäche jede Faser ihrer Körper völlig durchnässt. Der Wind fühlte sich an, als würden tausend Nadelstiche die Haut peinigen. Die Soldaten drückten sich mit aller Kraft an die Wand des Gebäudes, damit der Wind sie nicht umriss und zumindest ihr Rücken von neuen Wasserpeitschen verschont blieb.
Der Kampf gegen die Naturgewalten nahm die Kräfte beider so sehr in Anspruch, dass sie die Ankunft beinahe verpasst hätten. Inmitten der zahlreichen Blitze schienen die zwei neuen Lichter auch nur zwei von vielen zu sein. Doch sie hörten nicht auf zu strahlen, und dann wurden allmählich die dunklen Umrisse eines schweren Wagens sichtbar, der sich durch die vom Wasser geschaffene Schlammwüste kämpfte. Der tosende Regen verschluckte jedes Motorengeräusch, weshalb sich das Automobil gefühlt lautlos fortzubewegen schien. Mit sichtlichem Schlingern drehte das Gefährt eine letzte Kurve, bevor es mühsam, gleichzeitig rutschend und stockend, ein paar Meter vor den Wachposten zum Stehen kam.
Leise fluchend, weil er die Deckung der Hauswand verlassen musste, sprang Gefreiter Werner König nach vorn und öffnete die Türe des Wagenfonds. Beinahe wurde sie ihm aus der Hand gerissen, denn schon drängten die Insassen heraus und hasteten die wenigen Schritte zum Haus hinüber, zwei große, stämmig wirkende Offiziere in schweren Mänteln, die Gesichter im Dunkel und wegen der hochgeschlagenen Kragen nicht zu erkennen. Sekundenlang ließ ein Lichtschein den Regen leuchten, während die Haustür geöffnet wurde, dann waren die Neuankömmlinge drinnen verschwunden. Der Fahrer steckte kurz den Kopf aus dem Seitenfenster. Er überzeugte sich, dass seine Fahrgäste die paar Augenblicke durch den Wasservorhang überstanden hatten, stieß ein wütendes „Sauwetter“ aus und zog den Kopf schnellstens wieder zurück. Mit aufjaulendem Motor kämpfte der Mercedes einen Moment lang gegen den zähen Schlamm, ruckte dann doch an und verschwand in der Dunkelheit.
Eine ganze, lange Stunde mussten die beiden Posten ihren Kampf gegen die Naturgewalten noch fortsetzen. Dann wurde es auf einmal heller. So schnell, wie das Gewitter am vergangenen Abend begonnen hatte, beruhigte es sich jetzt. Die Blitze hörten auf, der Wind legte sich, der Regen ließ nach. Gefreiter König riskierte es, seine Taschenuhr unter dem Mantel hervorzuholen und versuchte, die Uhrzeit abzulesen. Noch ein paar Minuten bis zur Wachablösung. Bald würden sie es geschafft haben, die fürchterliche Nacht überstanden.
Die Wachablösung erfolgte pünktlich. Wie immer. König und sein Kamerad hasteten in die Wachstube, froh darüber, endlich die nasse Kleidung loswerden zu können, und ein bisschen neidisch auf die beiden Männer, die ihre Posten eingenommen hatten. Es tröpfelte nur noch leicht, die beiden Neuen würden also eine unvergleichlich angenehmere Wache haben. Abgesehen davon, dass man hier im tiefsten Bayern ohnehin keine Wache gebraucht hätte. Es herrschte tiefster Frieden, was sollte also schon passieren, dachte König bei sich. Doch derlei Dinge gingen ihn ja nichts an, er hatte zu gehorchen und all die täglichen Ungerechtigkeiten hinzunehmen. Wenigstens war der Krieg lange vorbei und der Dienst bei der Reichswehr eher eine ruhige Angelegenheit.
König bekam nicht mehr mit, dass sich in diesem Augenblick ein ihm wohlbekanntes Fahrzeug der Marke Mercedes erneut dem Haus näherte. Die beiden neuen Posten wiederum hatten keine Ahnung, dass das Auto in dieser Nacht bereits zum zweiten Mal vorfuhr. Der riesigen Pfützen und des Schlammes wegen geschah dies immer noch rutschend und schlingernd, doch behinderte diesmal kein Regen die Sicht. So konnte der Fahrer den Wagen recht punktgenau vor dem Eingang stoppen, ohne die Posten allzu sehr mit zu bespritzen.
Kurz darauf öffnete sich die Tür. Die zwei Offiziere traten heraus und gingen schnellen Schrittes zum Wagen. Obgleich es nun überhaupt nicht mehr regnete, trugen sie wiederum ihre Kragen hochgeschlagen und ins Gesicht gezogen, so dass ihre Identität verhüllt blieb. Da der Fahrer die Autotür bereits geöffnet hatte, dauerte es nur wenige Augenblicke, bis sie im Wagen verschwunden waren. Während die Tür sich noch schloss, setzte sich der Mercedes bereits in Bewegung und bahnte sich sodann seinen Weg durch die nasse Landschaft. Wenig später verschwand er im Dunkel, die Rückleuchten wie zwei entfliehende Glühwürmchen ersterbend.
Die Wachposten verschwendeten auf das Auto keinen weiteren Gedanken. Keiner der beiden ahnte, dass dessen Insassen das Fahrzeug zwar mit leeren Händen bestiegen hatten, aber dennoch jetzt den Tod mit sich führten. Noch bevor die Sonne den Morgenhimmel ganz erhellen sollte, würde ein Mensch sterben.
Die Verfolger kamen unerbittlich näher.
Zuerst war es nur ein unbestimmtes Gefühl gewesen. Eine Ahnung, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Uhrzeit war dieselbe wie jeden Tag, kurz nach Sonnenaufgang, das Gras normalerweise noch feucht vom Morgentau. Wegen des Starkregens, der die halbe Nacht getobt hatte, triefte alles vor Nässe und die Wege waren von riesigen Wasserlachen bedeckt. Doch das störte weniger als das Empfinden, dass die Ruhe des Morgens gestört zu sein schien.
Der Hüne hatte es noch nie erlebt, dass um diese Zeit jemand anderes unterwegs gewesen wäre. Stets brach er auf, wenn die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bergen hervorbrachen. Der Weg führte vom „Haus Tannenberg“ zum Kurpark hinunter, vorbei an den schlafenden Villen, Pensionen und Stadthäusern. Im Park spazierte er jeden Tag gleichermaßen entlang der Baumreihen, passierte auf verschlungenen Pfaden vielerlei Blumen und Rabatten, bis die Runde wieder zum Ausgangspunkt zurückführte. Erst dann pflegten ihm gewöhnlich die ersten Menschen zu begegnen. Ein Eisenbahner etwa, der zur Arbeit radelte; eine ältere Dame, die ihren Hund ausführte; ein Bauer, der frische Lebensmittel zu einem Ladengeschäft brachte. Allmählich würde der Kurort erwachen, während er bereits auf dem Rückweg zu seiner Pension wäre.
Heute fühlte sich alles anders an, seit dem ersten Schritt in den Park hinein. Vögel zwitscherten nicht wie gewohnt oder flatterten unruhig auf. Ein Eichhörnchen hastete mit großen Sätzen über die Wiese. Das seltsame Gefühl verstärkte sich. Der Hüne schaute sich nach allen Seiten um. Nichts zu sehen. Gelegentlich blieb er stehen, um auf Geräusche achten zu können. Bisher hörte er nichts. Aber erspürte ihre Anwesenheit.
Dann ein erstes Rascheln. Könnte es auch von einem Tier verursacht worden sein? Nein, dafür war es zu unauffällig, zu betont leise. Er verspürte keinerlei Furcht, weder vor dem Unbekannten an sich noch vor diesen Unbekannten. Doch instinktiv misstraue er ihnen. Wer immer hier um diese Zeit im Verborgenen herumschlich, konnte keine guten Absichten hegen.
Der Hüne beschleunigte seinen Schritt. Damit hatte er anscheinend ins Schwarze getroffen, denn nun vermehrten sich die Geräusche schlagartig. Häufigeres Rascheln, das Knacken eines Astes, das Plätschern einer Pfütze, Laufgeräusche wie bei einem fliehenden Tier. Dazu nahm er zum ersten Mal einen Schatten wahr, der eine Strecke rechts vor ihm hinter den Bäumen entlang huschte. Sie versuchten ihn einzuholen, ganz zweifellos.
Der Weg näherte sich einer Kreuzung. Er beschloss, nicht seine gewohnte Runde weiter zu laufen, sondern den Park so bald wie möglich zu verlassen. Rasch bog er nach links ab – und blieb abrupt stehen. Einer der Verfolger stand direkt vor ihm. Mittelgroß, unauffällige Erscheinung, nicht einmal besonders schwer atmend. Ein schlecht sitzender grauer Sommermantel verdeckte nur mühsam die darunter getragene Uniform, ebenso wie der zu große, tief sitzende Hut nur schwer verhüllen konnte, dass sein Besitzer eigentlich auf eine Uniformmütze oder einen Stahlhelm eingestimmt war.
„Was soll das?“, fragte der Hüne zornig.
„Nun, ich denke, Sie wissen es. Und Sie wissen, wer ich bin“, entgegnete der Soldat und nahm den Hut vom Kopf.
Der Hüne verzog das Gesicht. „Pabst! Sie sind also immer noch im Geschäft“, meinte er mit zynischem Unterton.
„Wenn Sie so wollen … Halt! Sie sollten besser stehen bleiben, wir sind hier noch nicht fertig“, befahl der Soldat, als sich der Hüne anschickte, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Gleichzeitig richtete er den Lauf einer schweren Armeepistole auf den Verfolgten.
Ungläubig schüttelte der Hüne seinen Kopf. „Wollen Sie mich etwa niederschießen? Noch dazu hier, mitten im Park? Damit würden Sie niemals durchkommen“.
„Damit nicht, das stimmt. Aber vielleicht so …“
In diesem Augenblick nahm der Hüne ein leichtes Aufflackern in den Augen seines Gegenübers wahr. Deren Blick führte irgendwie über seine Schulter, an ihm vorbei… verdammt! Das musste der zweite Verfolger sein, der jetzt mit Sicherheit hinter ihm stand.
Doch es war bereits zu spät. Noch ehe er sich umdrehen konnte, verspürte er bereits einen stechenden Schmerz im Nacken.
„Sind Sie wahnsinnig, was fällt Ihnen ….“
Weiter kam er nicht. Der Schmerz durchflutete wie ein Blitz seine Adern, lähmte seine Muskeln, seinen Atem. Unfähig, sich auch nur ansatzweise zu bewegen, stand der Hüne mit halbwegs zum Nacken geführter Hand noch einige Sekunden lang da. Dann gaben die Knie nach, knickten ein, und er kippte wie eine gefällte Eiche nach vorn. Der Hüne war tot.
Pabst musste schnell ein wenig zur Seite springen, sonst hätte ihn der baumlange Kerl im Fallen sogar touchiert. Im Liegen sah der Tote noch riesenhafter aus als im Stehen, eine schiere Unmasse an Körper. Lang und breit wie ein umgekippter Schrank. Und lag jetzt genauso leblos im Schmutz.
Der zweite Mann, der eigentliche Mörder, musterte ebenfalls das Opfer, während er sorgfältig eine Injektionsspritze in ein ledernes Etui verstaute.
„Das Zeug wirkt ja blitzartig“, meinte Pabst zu ihm. „Wird man wirklich nichts feststellen können?“
„Ganz sicher nicht“, winkte er ab. „Die Einstichstelle fällt kaum auf, und selbst wenn – man wird es für einen Insektenstich halten. Das Gift ist zwar theoretisch nachweisbar, aber da müsste man ihn schon innerhalb der nächsten Stunde auf dem Untersuchungstisch haben und noch dazu genau nach dem Richtigen suchen. Sehr unwahrscheinlich“.
„Gut. Dann lass uns hier verschwinden. Hoffen wir, dass ihn so schnell keiner findet“.
Ohne dem Leichnam weitere Beachtung zu schenken, wandten sich die beiden dem Weg zwischen den Bäumen zu. Bald waren sie im dichten Grün verschwunden. Langsam verhallten die Schritte der Mörder, dann kehrte die Stille zurück.
Nach einer Weile begannen die Vögel wieder zu zwitschern. Aus dem Gebüsch, keine zwei Meter von dem Toten entfernt, hüpfte eine Amsel und begann nach Würmern zu picken. Sie war die einzige Augenzeugin des Mordes gewesen.
14. August 1939
Paris
Der Auftrag
Der Auftrag überraschte mich an einem furchtbar heißen und extrem langweiligen Nachmittag in der Zentralredaktion.
Nach wochenlangem grauen Himmel und einem Sommer, der diesen Namen nicht verdiente, stöhnte Paris seit einigen Tagen unter einer plötzlichen Hitzewelle. Die Luft flimmerte in der gleißenden Sonne. Jedes Fenster in jedem Büro des Gebäudes stand sperrangelweit offen, obwohl auch das keine Erleichterung brachte, da auch kein noch so winziger Windhauch von draußen zu spüren war. Die Blätter auf den Schreibtischen begannen sich vor Hitze zu wellen, und die Tinte trocknete schneller, als sie die Füllfederhalter verließ. Einige der Kollegen hatten gar, bar jedes Dresscodes, ihre Schuhe und Strümpfe ausgezogen und kühlten ihre Füße in Schüsseln voll kalten Wassers.
Zu allem Überfluss gab es an jenem 14. August nicht die geringsten aktuellen Meldungen zur politischen Lage zu verzeichnen. Die Spannungen zwischen Deutschland und Polen hatten in den vergangenen Wochen zugenommen, doch seit drei Tagen war es ruhig geblieben. So makaber es in der Rückschau klingen mag, doch wir warteten geradezu sehnsüchtig auf den nächsten Zwischenfall, den nächsten Protest, die nächste Forderung einer der beiden Seiten. Aber nichts geschah. Die bemerkenswerteste Nachricht des Tages betraf noch die Kulturredaktion der Hauptstadt: Das berühmte Gemälde L’Indifferent von Antoine Watteau, welches seit Mitte Juni aus dem Louvre verschwunden war, hatte den Weg zurück zu den Behörden gefunden. Der Dieb erklärte, er habe das Gemälde, welches in schlechtem Zustand gewesen sei, lediglich fachgerecht restaurieren wollen ... Unser Amerika-Korrespondent vermeldete, dass der Kostümbildner Adrian die Schauspielerin Janet Gaynor geheiratet hatte. Außerdem habe Präsident Roosevelt angekündigt, den diesjährigen Termin für Thanksgiving – das amerikanische Erntedankfest mit seinen seltsamen Blüten – um eine Woche vorverlegen zu wollen.
Während sich also der Kulturredakteur mühsam, aber doch erfreut über die Abwechslung aufraffte, die erhaltenen Meldungen mit seinen Mitarbeitern in eine druckreife Fassung zu bringen und eine einigermaßen gefüllte Feuilleton-Seite aufweisen konnte, sah es für die Politik- und Wirtschaftsredaktion nach einem Debakel aus. Wie sollte ich dem Chefredakteur eine weiße Seite erklären? „Monsieur Fabry, leider hat die Hitze meinen Kopf völlig ausgedörrt, deshalb werden wir morgen früh unsere Titelseite leider leer lassen müssen“?! Über solche Phantastereien brauchte ich gar nicht weiter nachzudenken, wenn ich nicht vorhatte, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Tätigkeit als Berichterstatter mit halber Besoldung in den Wüsten Französisch-Mauretaniens anzutreten.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Träge hob ich den Hörer ab und krächzte ein mühsames „Ja?“ hinein.
„Fabry hier. Sind Sie das, Genty?“
Von einem Augenblick auf den anderen wurde ich hellwach. Das war geradezu unheimlich. Eben noch hatte ich an den Chefredakteur gedacht, schon hing er am Apparat. Konnte er Gedanken lesen oder hatte ich im Hitzedelirium versehentlich laut gedacht und jemand meine despektierlichen Worte nach oben gemeldet? Eigentlich konnte das nicht sein, befand ich, und bemühte mich, ruhig zu antworten.
„Ja, natürlich, Monsieur Fabry. Bitte verzeihen Sie, ich war gerade mit einer Sache beschäftigt“.
„Was auch immer Sie gerade tun – lassen Sie es stehen und liegen, und kommen unverzüglich in mein Büro. Ich muss Sie dringend sprechen. Jetzt“.
Oh, oh. Das klang nicht nach einem erfreulichen Anlass. Sollte ich mir doch Sorgen machen?
„Sofort, Monsieur. Ich bin schon auf dem Weg“, antwortete ich und erhob mich. Kurz überlegte ich, ob ich noch meine Krawatte umbinden sollte, die ich heute Morgen als erstes abgelegt hatte. Doch entschied ich mich dagegen. Hitze war schließlich Hitze, das musste auch ein Chefredakteur zugestehen. Ich griff lediglich nach einem leichten Gilet, welches über dem Stuhl hing und legte es auf dem Weg zur Treppe an. Dieses verdeckte wenigstens das schon nicht mehr ganz blütenweiße Hemd. Eine Minute später stand ich vor Fabrys Büro und klopfte an. Nichts geschah. Schon wollte ich ein weiteres Mal klopfen, da öffnete sich die Tür und Fabry stand vor mir.
„Ah, Sie sind es, Genty. Kommen Sie doch herein!“
Nicht zu fassen. Jean Fabry, der sonst so unnahbare Chefredakteur des Le Matin, hielt mir persönlich die Tür auf und wies mit einer einladenden Handbewegung in sein Büro hinein. Während Fabry hinter mir die Tür schloss, bemerkte ich, dass wir nicht allein waren. In einem der Besuchersessel saß ein schätzungsweise vierzigjähriger Herr mit schmalem Gesicht, Oberlippenbart und einer randlosen Brille, der sich bei meinem Eintritt sofort erhob. Unverkennbar ein Engländer, dachte ich bei mir, und fand mich sogleich bestätigt, als Fabry die Vorstellung übernahm: „Darf ich bekannt machen: Captain Basil Liddell Hart aus Hampstead – Paul Genty, unser Spezialkorrespondent für Politik und Auslandsfragen“.
„Sehr erfreut“. Wir schüttelten die Hände, dann meinte ich: „Darf ich annehmen, Sie sind der Liddell Hart – der berühmte Militärschriftsteller?“
Gewöhnlicherweise pflegen Gentlemen, noch dazu britische Gentlemen, in solch einem Moment bescheiden abzuwinken und jede Berühmtheit energisch von sich zu weisen. Der Gefragte jedoch verzog nicht die geringste Miene, sondern nickte nur kurz und bestätigte mit einem knappen „Ganz recht“. Dann setzte er sich wieder in seinen Sessel und schwieg. Da auch Fabry nichts mehr sagte, nahm ich ebenfalls in dem mir zugewiesenen Sessel Platz und wartete, bis Fabry wieder hinter seinem Schreibtisch angelangt war. Doch dieser machte noch immer keine Anstalten, etwas zu sagen. Daher fragte ich vorsichtig: „Sie hatten mich zu sich gebeten, Monsieur Fabry? Es klang recht dringend, hatte ich den Eindruck“.
Fabry hob seine rechte Hand und bedeutete mir zu warten. „So ist es auch“, entgegnete er. „Aber bitte einen Augenblick Geduld, wir sind noch nicht vollzählig“.
Es konnten zwar kaum mehr als zwei Minuten vergangen sein, dennoch kam es mir wie Stunden vor, die wir schweigend und tatenlos in Fabrys Büro warteten. Schließlich klopfte es erneut, und noch während Fabry „Herein!“ sagte, ging die Tür erneut auf und eine attraktive Frau betrat den Raum. Es war niemand anders als Stéphane Roussel.
Stéphane Roussel! Bereits damals galt sie, obwohl erst 37 Jahre alt, als eine Art lebende Legende. Sie war als Stefanie Landeis im Gefolge ihres österreichischen Vaters, der für das französische Außenministerium arbeitete, nach Paris gekommen. Nach einem Sprachenstudium gelangte sie 1930 als Sekretärin an das Berliner Büro unserer Zeitung. Durch ihre enorme Sprachbegabung und ein ungeahntes journalistisches Talent eignete sie sich perfekt für die Berichterstattung von Berlin zur Zentralredaktion in Paris und wurde dadurch praktisch zum ersten weiblichen Auslandskorrespondenten Frankreichs. Kurz darauf machte sie der damalige Generaldirektor Jules-Théophile Docteur zunächst zur kommissarischen, ab 1934 zur offiziellen Leiterin des Berliner Büros des Le Matin. Eine ganz außergewöhnliche Karriere, noch nie dagewesen für eine Frau. Da ich zu Beginn der Zwanziger Jahre selbst einige Zeit unser Berliner Büro geleitet hatte, konnte ich einigermaßen ermessen, welch ungeheure Leistungen sie dazu erbringen musste. Noch heute muss ich ihr unumwunden zugestehen, die größere Leidenschaft für ihren Beruf zu haben und ein eindrucksvolleres Bild von Berlin und Deutschland gezeichnet zu haben, als ich es je vermocht hatte. Allerdings war ihr hingebungsvoller Einsatz in Berlin im Jahre 1938 zu einem abrupten Ende gekommen, nachdem auf Veranlassung des Propagandaministeriums unser Berliner Büro geschlossen und eine große Anzahl internationaler Journalisten des Landes verwiesen worden waren. Seitdem arbeitete sie wieder in der Pariser Zentrale. Wir waren gerade dabei, uns an ihren neuen Namen zu gewöhnen, den sie bei der Heirat mit ihrem jetzigen Ehemann angenommen hatte. Im Zuge dessen hatte sie auch den Vornamen Stefanie in Stéphane abgeändert.
Derweil hatte auch Stéphane auf dem letzten verfügbaren Sessel in Fabrys Büro Platz genommen. Der Chefredakteur vergewisserte sich noch einmal, dass die Bürotür auch wirklich fest verschlossen war, bevor er zu reden begann.
„Sie haben sich wahrscheinlich gewundert, weshalb ich Sie so kurzfristig und zugegebenermaßen recht eindringlich zu mir gebeten habe“, sagte er, zu uns beiden Journalisten gewandt. „Zunächst einmal können Sie beruhigt sein – es hat nichts mit Ihrer eigentlichen Arbeit zu tun. Es handelt sich vielmehr um ein spezielles Anliegen, mit dem Captain Liddell Hart an mich herangetreten ist. Mr. Liddell Hart benötigt unsere Hilfe in einer – sagen wir, sensiblen – Angelegenheit. Da wir beide seit längerer Zeit gut befreundet sind, sehe ich mich und uns in der Pflicht, ihm zur Seite zu stehen. Außerdem könnte am Ende ein lohnenswerter Bericht für unsere Zeitung stehen, zumindest eventuell. Doch dazu kommen wir später. Basil, wenn ich dich bitten dürfte, die beiden in das einzuweihen, was du vorhin mir erzählt hast?“ Mit diesen Worten warf er Liddell Hart eine einladende Geste zu und zog sich erneut hinter seinen Schreibtisch zurück.
Der Captain legte die Pfeife beiseite, die er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, und strich sich bedächtig seinen Schnurrbart glatt. „Ich muss Ihnen zuerst die Zusicherung abverlangen, dass alles, was ich Ihnen gleich berichten werde, absoluter Vertraulichkeit unterliegt“, begann er. „Kann ich mich darauf verlassen, dass kein Wort diesen Raum verlässt?“
Er konnte. Verschwiegenheit in Bezug auf vertrauliche Informationen war und ist für uns Journalisten wahrlich kein neues Erfordernis, haben wir es doch allzu oft mit Quellen zu tun, die nicht genannt werden dürfen, mit Informanten, die unerkannt bleiben müssen und sogar mit Personen, deren Leben bedroht wäre, sollten sie als Ursprung unserer Informationen aufgedeckt werden. Um welchen dieser Fälle es sich hier handelte, wussten wir noch nicht. Aber wir nickten selbstverständlich zur Bestätigung. Liddell Hart schien zufrieden und fuhr fort.
„Sagt Ihnen der Name Max Hoffmann etwas? Generalmajor Max Hoffmann?“
Überrascht beugte ich mich nach vorn. „General Hoffmann? Aber natürlich“, meinte ich.
„Hmhm. Was wissen Sie über ihn?“
„Nun, ich habe ihn Anfang der Zwanziger Jahre in Berlin kennengelernt und interviewt. Das war…einen Augenblick, ich muss kurz überlegen…Ende 1921, glaube ich. Ja, es war Dezember 1921, kurz vor Weihnachten jenes Jahres. Mein Interview – oder besser gesagt, Hoffmanns Äußerungen in dem Interview – haben damals in Deutschland für einiges Aufsehen gesorgt“.
„Das ist uns bekannt, Genty“, winkte Fabry ungeduldig ab. „Was der Captain wissen wollte, ist vielmehr, wie Sie die Persönlichkeit Hoffmanns einschätzen und was Sie über seine Rolle wissen“.
„Das ist mir durchaus bewusst, und dazu wäre ich jetzt auch gekommen“, entgegnete ich. Diese Ungeduld war eigentlich typisch für den Chefredakteur, weshalb ich mich eben sehr gewundert hatte, dass er die Wartezeit bis zu Stéphane Roussels Eintreffen so ausgesprochen schweigsam und geduldig verbracht hatte. Vermutlich konnte er es kaum erwarten, dass wir endlich zur Sache kamen. Wobei ich immer noch nicht genau wusste, was genau der Anlass dieser Fragerunde sein sollte.
„Für meine Begriffe“, fuhr ich fort, „ist General Hoffmann einer der entscheidenden deutschen Militärs an der Ostfront gewesen. Den meisten dürfte er wegen seiner Rolle bei den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk ein Begriff sein. Dort hat er eine maßgebliche Rolle gespielt und durch seine unnachgiebige Haltung und die Februaroffensive von 1918 den Siegfrieden über Russland erzwungen. Außerdem war Hoffmann, was viel weniger Menschen wissen, der eigentliche Kopf hinter dem großen Sieg von Tannenberg und anderen Operationen. Obwohl er es „nur“ zum Generalmajor gebracht hat, war er dennoch als Generalstabschef des Kommandos OberOst von 1916 bis zum Kriegsende der faktische Befehlshaber der deutschen Ostfront“.
„Und nach dem Krieg? Hat er in der Reichswehr noch ein Kommando übernommen? Was doch nicht verwunderlich wäre, wenn er eine so nennenswerte Rolle gespielt hat, wie Sie sagen“, wollte Fabry wissen.
„Nein, hat er nicht. Er wollte den Versailler Vertrag nicht hinnehmen und musste deswegen seinen Abschied nehmen. Seitdem verfolgte er unermüdlich den Plan einer Militärintervention in Sowjetrussland und erregte damit allerlei Aufsehen. Darüber hinaus hat er sich nach dem Krieg mit General Ludendorff ziemlich überworfen, weil Hoffmann in allerlei Büchern den Feldherrenstatus von Ludendorff infrage gestellt hat. Abgesehen davon, dass Ludendorff sich durch sein Zusammengehen mit Hitler selbst diskreditiert hat, scheint die Bewertung von Hoffmann recht zutreffend zu sein. Das war allerdings während meiner Begegnung mit Hoffmann noch kein Thema, weil …“ Weiter kam ich nicht, da mich Liddell Hart mit einer Handbewegung unterbrach.
„Gut, gut. Das genügt schon“, sagte er. „Wie steht es mit Ihnen, Madame Roussell?“
Stéphane zuckte mit den Schultern. „Ich kenne ihn nur vom Namen her. Sein berüchtigter „Faustschlag“ auf den Verhandlungstisch von Brest-Litowsk ist mir natürlich ein Begriff, doch ich weiß sicherlich weit weniger über ihn als der Kollege Genty. Hoffmann soll eine ziemlich schillernde Persönlichkeit gewesen sein, soweit mir bekannt ist“.
Liddell Hart nickte. „Das könnte man möglicherweise so sagen … Noch eine Frage, Monsieur Genty: Haben Sie damals Hoffmanns Frau kennen gelernt?“
Das musste ich verneinen. „Ein einziges Mal habe ich damals mit ihr am Telefon gesprochen, meine ich. Aber zu einem persönlichen Treffen mit ihr ist es nie gekommen“.
„Und Sie, Madame Roussel?“
Stirnrunzelnd schüttelte Stéphane den Kopf. „Nein, schon gar nicht. Ich verstehe auch nicht ganz, warum Sie mich das fragen – oder vielmehr, warum ich überhaupt hier bin. Mir scheint, dass ich zu Ihren Fragen recht wenig beitragen kann“.
„Es wird in Kürze ersichtlich werden, vertrauen Sie mir“, versicherte Liddell Hart. „Sie müssen wissen, dass ich die Gelegenheit hatte, die Bekanntschaft von Cornelia Hoffmann zu machen. Zwar auch nicht von Angesicht zu Angesicht, doch wir standen seit einigen Jahren in brieflichem Kontakt. Dieser Kontakt ist seit einigen Monaten plötzlich abgerissen. Leider muss ich für sie das Schlimmste befürchten ...“ Er schwieg einen Augenblick. „Doch ich möchte mich mit dieser Befürchtung nicht zufrieden geben. Es gilt herauszufinden, was geschehen ist und es müsste unbedingt der Kontakt zu ihr wiederhergestellt werden. Deshalb bin ich hier. Ich habe Jean Fabry um Hilfe gebeten und er hat mir versichert, dass der Fall bei Ihnen in den besten Händen wäre, Monsieur Genty!" „Bei mir? Aber … aber wie sollte ich Ihnen in dieser Angelegenheit helfen können?“
„Ich möchte, dass Sie nach Berlin fahren, Genty!“ Fabry hatte die ganze Zeit schweigend unserer Unterhaltung zugehört, nun aber meldete er sich, gewohnt bestimmend, mit diesem Ausruf zu Wort. „Finden Sie Frau Hoffmann. Nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und, falls es irgendwie machbar wäre, bringen Sie sie und die Papiere außer Landes!“
Abgesehen davon, dass ich von dem Ansinnen, jemanden aus Deutschland herausbringen zu müssen, völlig konsterniert war, machte mich in dem Moment eines vor allem stutzig. „Moment, Moment…Sie sagten: Die Papiere. Welche Papiere meinen Sie damit?“
„Richtig, die Papiere. Dazu war ich noch gar nicht gekommen“, entschuldigte sich Liddell Hart, griff hinter sich und nahm von einem kleinen Beistelltischchen einen Stapel Blätter an sich. Er suchte kurz ein bestimmtes Blatt heraus und reichte es mir hinüber.
„Lesen Sie das. Es handelt sich zwar nicht um einen Brief von Frau Hoffmann. Er stammt vielmehr von Barry Sullivan; ein Freund von mir, der im Juni dieses Jahres geschäftlich in Berlin zu tun hatte und den ich überreden konnte, Frau Hoffmann aufzusuchen. Das war der letzte Kontakt, den jemand zu ihr hatte. Der Bericht von Barry dürfte einiges für Sie erhellen“.
Stéphane bat den Captain darum, mich den Brief laut vorlesen zu lassen, um ebenfalls im Bilde zu sein, was dieser zugestand. Der Text begann mitten im Satz, war also offensichtlich nur eine Seite aus einem längeren Brief. So las ich folgendes:
„… sie haben in den Fällen, wo sie die wirklichen Tatsachen kannten, niemals die Wahrheit enthüllt. Aber der finanzielle Druck ist für sie im Moment sehr hoch, und obwohl sie überzeugt ist, dass es ertragreicher wäre, die Briefe im Ausland zu verkaufen, könnte sie dennoch gezwungen sein, sie in Deutschland abzugeben, wenn es kein gutes Angebot von auswärts gäbe.
Unter keinen Umständen scheint sie derzeit darauf vorbereitet, die Briefe herauszuschmuggeln. Sie würde dadurch nichts gewinnen, sie könnte für ihre Lebenshaltung nicht mehr aufkommen, und sie hat eine Tochter, die bei einer Rundfunkanstalt arbeitet (in Karlsruhe, glaube ich). Sie hat mir ganz offen gesagt, selbst wenn der Verkauf ins Ausland scheitern würde, könnte das ihre Position stärken, wenn sie mit den Reichsbehörden verhandeln muss. Aber sie hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Verkauf ins Ausland erlaubt werden würde. Ihr verstorbener Mann wird noch immer verehrt; im Herbst wird beispielsweise eine preiswerte „Volksausgabe“ seiner Werke erscheinen.
Bezüglich seiner Briefe: Ein kleiner Teil ist im Rahmen seiner Schriften zum Kriege veröffentlicht worden. Einen anderen, viel umfangreicheren Teil hat sie an einen sicheren Platz schaffen lassen, weil er Aussagen über L und H enthielt, die nicht zu veröffentlichen waren. Aber dieser Teil ist nie vernichtet worden“.
Langsam ließ ich den Brief sinken. Ich versuchte, die Puzzlesteine zu einem sinnvollen Bild zusammenzusetzen. „Wenn ich das richtig verstehe, schwebt Frau Hoffmann in einer wirtschaftlichen Notlage und ist deshalb gezwungen, die Briefe ihres Mannes zu Geld zu machen“, entgegnete ich. „Müsste sie als Generalswitwe aber nicht zumindest über eine gewisse Pension verfügen können?“
„Offenbar über weniger, als man denken könnte. Warten Sie …hier. Barry schreibt am Anfang seines Briefes, der General habe nach seinem plötzlichen Tod seiner Frau nur wenig hinterlassen, und die gesamten Ersparnisse seien durch die Inflation aufgezehrt gewesen. Dazu kommt, dass sich die Lage seit Anfang dieses Jahres für sie nochmals deutlich verschärft haben dürfte“.
„Inwiefern?“
„Nun … Sie müssen wissen, Cornelia Hoffmann ist Jüdin“. Der Satz verfehlte seine Wirkung nicht. Betroffen schauten Stéphane Roussel und ich uns an. Damit hatten wir nicht gerechnet. Die Rechtlosigkeit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland hatte in den letzten Jahren stetig zugenommen. Für Kriegsteilnehmer und deren Angehörige gab es zwar selbst in den berüchtigten Nürnberger Rassegesetzen noch ein paar Ausnahmen, und als Witwe eines prominenten preußischen Generals mochte Cornelia Hoffmann zusätzlich ein gewisser Schutz zuteil geworden sein. Doch spätestens nach der entsetzlichen ‚Reichskristallnacht‘ vom November letzten Jahres waren viele Schranken gefallen. Juden wurden verstärkt zur Auswanderung gezwungen. Eine eigens ins Leben gerufene Reichsvereinigung der Juden in Deutschland organisierte gar deren Auswanderung – unter Aufsicht der Gestapo und unter der Maßgabe, fast das gesamte Vermögen im Reich zurücklassen zu müssen. Wer den Geist der Zeit erkannte und es sich leisten konnte, wanderte auf Eigeninitiative hin aus, vorausgesetzt, ein anderes Land erlaubte die Einwanderung. Zunehmend jedoch verschlossen viele Staaten ihre Tore, ob die Schweiz, die Vereinigten Staaten, England, ja sogar unser eigenes Land. Und wenn man über so gut wie keine finanziellen Mittel verfügte, dann sah die Lage erst recht trostlos aus. Angesichts dessen war es sehr nachvollziehbar, dass Liddell Hart über das Schicksal Cornelia Hoffmanns düstere Vorahnungen hatte.
„Das erklärt einiges“, meinte ich schließlich. „Sie wollen also Frau Hoffmann retten, weil sie als Jüdin in Existenznot lebt und womöglich in noch größerer Gefahr schwebt?“
Der Captain deutete mit der Hand eine zweifelnde Geste an. „Ihre Herkunft ist zweifellos ein Grund, warum die Situation sehr ernst ist. Jedoch nicht der einzige“.
„Sondern?“
„Vergessen Sie schon wieder die Papiere? Sie haben es doch gerade gelesen – Hoffmanns Briefe. Der größte Teil davon ist nie veröffentlicht worden. Werfen Sie nochmals einen Blick auf den letzten Absatz“, forderte er mich auf.
Ich tat, wie mir geheißen. Tatsächlich – es stand die ganze Zeit vor meinen Augen. Wie hatte ich das nur übersehen können?
„Jemand will verhindern, dass die Briefe an die Öffentlichkeit gelangen. Das meinten Sie doch, oder?“
„Ausgezeichnet, Monsieur Genty! Exakt das meinte ich“, stimmte Liddell Hart zu. „Es steht ganz außer Frage, dass …“
An dieser Stelle unterbrach ihn Stéphane, die uns einigermaßen verwirrt anschaute. „Einen Augenblick bitte, Messieurs. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so unhöflich unterbreche, aber ich habe nicht die leiseste Idee, wovon Sie gerade sprechen“.
„Kein Problem. Genty, würden Sie Madame Roussel den Brief geben?“
Ich reichte ihr das Blatt hinüber, während Liddell Hart die Erklärung übernahm. „Sehen Sie, Madame, dort steht, dass Frau Hoffmann den umfangreichsten Teil der Briefe an einem sicheren Platz versteckt hält. Warum? Weil er kompromittierende Aussagen über L und H enthält. Genty, wer sind ihrer Meinung nach L und H?“
„Ludendorff und Hindenburg, anders kann es gar nicht sein“, erklärte ich überzeugt.
„Ganz zweifellos, richtig. Nicht einmal General Hoffmann selbst konnte es zu seinen Lebzeiten zustande bringen oder überhaupt wagen, diese Korrespondenz zu veröffentlichen. Und nach allem, was ich über den General weiß, hat er es nie gescheut, Konflikte auszutragen und war der letzte, der sich vor irgendwem fürchtete. Sie nicken, Genty? Da Sie den General persönlich kennengelernt haben, dürften Sie das sogar besser beurteilen können als ich. Außerdem hat Hoffmann in seinen Weltkriegsbüchern alles andere getan, als sich mit Kritik an Ludendorff zurückzuhalten. Wieviel brisanter müssen also diese Briefe sein! Kein Wunder, dass es Leute gibt, die alles tun würden, um ihre Veröffentlichung zu verhindern“.
„Soweit klingt das ja plausibel“, gab Stéphane zu. „Doch Ludendorff und Hindenburg sind mittlerweile beide tot. Wer sollte jetzt noch ein Interesse daran haben, die Briefe zu unterdrücken? Die Erben etwa?“
„Nein, die meine ich nicht. Sie vergessen, verehrte Stéphane, dass die Reichswehr jetzt Wehrmacht heißt, der oberste Befehlshaber Hitler, und dass Hitlers Reich sehr eifersüchtig über die Ehre seiner Helden wacht. Tatsachen aus erster Hand sind dabei manchmal sehr unliebsame Störungen. Wir wissen außerdem, dass das Reich schon versucht hat, die Papiere in die Hände zu bekommen. Dazu muss ich ihnen noch eine Passage aus Barrys Bericht vorlesen – einen Augenblick“. Liddell Hart holte ein anderes Blatt vom Stapel, überflog es kurz und hatte dann den Abschnitt gefunden, den er suchte. Diesen las er uns vor:
„Kurz nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, begann sich das Reichsarchiv für die Briefe zu interessieren und schlug ihr vor, dass sie diese der Nation für einen symbolischen Preis überlassen solle. Kürzlich kam ein anderer Mann, von dem sie wusste, dass er mit dem Reichsarchiv in Verbindung steht auf sie zu; sie nimmt an, dass sie die Papiere nunmehr kaufen wollen. Dieser letzte Versuch geschah im Frühling, aber sie ist sich sicher, dass ein neuerlicher erfolgen wird“.
Liddell Hart legte das Blatt beiseite. „Es scheint doch so zu sein: Das Reich – also irgendwer aus der Regierung, Hitlers Umgebung oder der Wehrmachtführung – versucht, an die Papiere heranzukommen. Zuerst versucht man die Witwe zu überreden, sie als Nachlass dem Reichsarchiv zu übereignen. Das tut sie natürlich nicht. Dann bietet man etwas Geld an, aber es scheint noch zu wenig gewesen zu sein. Frau Hoffmann wendet sich an mich und teilt mit, mangels eines besseren Angebots aus dem Ausland muss sie vielleicht doch dem Betrag zustimmen, den ihr die Regierung bietet. Können Sie dem soweit folgen?“
Wir versuchten, den vorliegenden Informationen mögliche Alternativen abzugewinnen, doch mussten wir seine Interpretation letztlich als durchaus wahrscheinlich anerkennen.
„Nun wird es undurchsichtig“, fuhr er fort. „Cornelia Hoffmann vermutete, man würde mit einer neuerlichen Offerte an sie herantreten. Ist das inzwischen geschehen? Wissen wir nicht. Falls ja, und sie hätte sie angenommen – warum antwortet sie dann nicht mehr? Andernfalls – wenn sie ein neuerliches Angebot weiterhin abgelehnt hat oder man zu dem Schluss gekommen wäre, weitere Versuche seien zwecklos, was dann? Ist es nicht möglich, dass man dann zu ganz anderen Maßnahmen gegriffen haben könnte, um an die Papiere heranzukommen?“
Nachdenklich starrte ich den Captain an. „Angesichts dessen, dass sie als Jüdin ohnehin äußerst angreifbar ist und keinen Rechtsstaat hinter sich weiß … nein, angesichts dessen ist das leider nicht auszuschließen. Im Gegenteil, mich beschleicht ein ganz ungutes Gefühl, was das Wohlbefinden von Frau Hoffmann betrifft“.
„Genauso ist es“, meinte Fabry. „Dieses Gefühl hatten – oder vielmehr haben – wir auch. Deshalb wiederhole ich meine Bitte: Wären Sie bereit, nach Berlin zu reisen, um Licht in die Sache zu bringen und möglicherweise zu helfen, sowohl sie als auch die Papiere außer Landes zu bringen? Nicht dass Sie mich falsch verstehen – das persönliche Wohlergehen von Cornelia Hoffmann steht selbstredend an erster Stelle. Doch die Veröffentlichung der Briefe des Generals wäre fraglos eine politische und journalistische Sensation ersten Ranges. Es versteht sich natürlich von selbst, dass sämtliche Erlöse aus einer Veröffentlichung in vollem Umfang Frau Hoffmann zugutekommen würden. Dazu jedoch müssen wir sie erst einmal haben. Also, Genty – wie sieht es aus?“
Drei Augenpaare waren erwartungsvoll auf mich gerichtet. Ich brauchte allerdings nicht lange zu überlegen.
„Unter diesen Umständen bin ich selbstverständlich dazu bereit, das ist gar keine Frage“, erklärte ich. „Doch das Unterfangen dürfte alles andere als einfach werden, das ist Ihnen sicherlich bewusst?“
Alle nickten. Es war ihnen klar. Ich war mir immer noch nicht sicher, warum sie ausgerechnet mich auf eine solche schwierige und gefährliche Mission schicken wollten, aber genau dazu wollte ich noch einmal nachhaken.
„Zwei Fragen hätte ich allerdings noch, Monsieur Fabry. Die erste wäre, wie ich überhaupt nach Berlin gelange, ohne Verdacht zu erregen. Ich bräuchte ja irgendeinen plausiblen Reiseanlass, eine Akkreditierung als Journalist wird sicher kaum möglich sein“.
Fabry lächelte geheimnisvoll. „Ganz im Gegenteil, mein lieber Genty. Sie werden ganz offiziell reisen – mit Akkreditierung. Und zwar zum Internationalen Kongress für Archäologie, welcher in einer Woche in Berlin beginnt. Unser Wissenschaftsredakteur, der dazu eine Akkreditierung erhalten hat, wird – zumindest werden wir das verlautbaren lassen – leider erkrankt sein, so dass Sie als sein Vertreter den Platz einnehmen können. Diese Tarnung ist geradezu ideal, denn die verschiedenen Tagungsstätten und die einschlägigen Museen sind über halb Berlin verstreut. Sie müssen geradezu ständig durch die Stadt unterwegs sein“.
Ich schaute Fabry skeptisch an. „Ein Archäologenkongress? Mit Verlaub, aber von Archäologie habe ich nun sehr wenig Ahnung. Wie soll ich diese Rolle glaubwürdig spielen?“
„Dafür wird gesorgt sein“, versicherte Fabry. „Captain Liddell Hart hatte dazu eine ganz ausgezeichnete Idee. Doch lassen Sie uns gleich im Anschluss darüber reden. Sie sagten, Sie hätten noch eine zweite Frage?“
„Ja, durchaus. Auch, wenn ich bereit bin, nach Berlin zu reisen – es ist etliche Jahre her, seit ich das letzte Mal dort war. Und das war vor der Machtergreifung der Nazis. Ich fürchte, die Verhältnisse in der Stadt werden jetzt völlig andere sein, als ich Sie damals gewohnt gewesen war. Auf meine damaligen Kontakte werde ich sicher auch kaum noch zurückgreifen können. Das dürfte meine Bemühungen ernsthaft behindern“, gab ich zu bedenken.