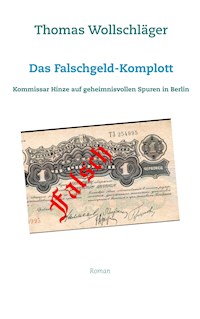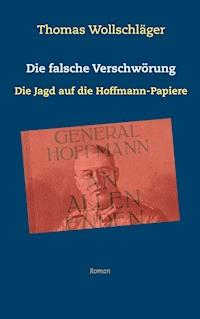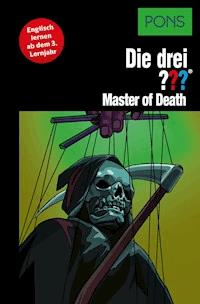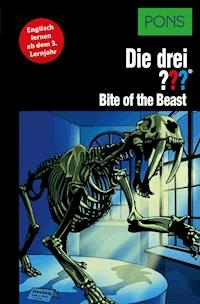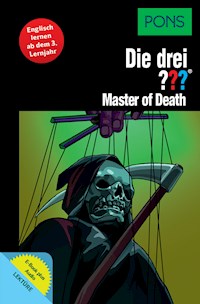Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 1837 startet eine der bedeutendsten Forschungsexpeditionen Frankreichs im 19. Jahrhundert. Kapitän Jules Dumont d'Urville will im Auftrag des Königs zum Südpol vordringen, die Inselwelt Ozeaniens erkunden und zahlreiche andere Stationen rund um die Welt anlaufen. Auf der fast dreijährigen Weltumsegelung macht die Besatzung auf den zwei Korvetten Astrolabe und Zelée unzählige Entdeckungen, muss dabei aber auch viele gefährliche Situationen überstehen. Das Packeis und Krankheiten bringen die Expedition an den Rand des Scheiterns. Die Erzählung schildert die abenteuerliche Reise der großen Expedition und setzt dem Kampf der Offiziere und Besatzungen gegen Naturgewalten, Zeit und anderen Widrigkeiten ein Denkmal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für David
Inhalt
Prolog: Wanderlust
Abreise aus Toulon
Magellans Land
Patagonier und Nicht-Patagonier
Eisfahrt
Wale und Walfang
Skorbut
Die Sorge um die Kranken
Verluste
Eine neue Aufgabe
Verzweifelte Versuche
Strafende Gerechtigkeit
Vanikoro
Dysenteria
Gescheiterte Vernunft
Adelieland
Heimkehr
Epilog: Der Zug
Anhang: Die Offiziere der beiden Schiffe
Nachwort: Fiktion und Realität
Bildnachweis
Prolog: Wanderlust
Aus dem Tagebuch des Kommandanten Jules-Sebastien César Dumont d’Urville
Ach, welchen Preis die Reise schon gefordert hat, noch ehe sie begonnen! Der einfache Befehl, sich zur Vorbereitung der großen Expedition im Hafen von Toulon einzufinden, hat meiner kleinen Tochter das Leben gekostet. Voller Eifer und Begierde, keine Zeit zu verlieren, war ich dem Befehle unverzüglich gefolgt und mit meiner Familie umgesiedelt, nicht bedenkend, dass in jenem Monat Juni in diesem Teil der Provence die Cholera wütete. Unbarmherzig hat diese furchtbare Seuche sogleich unseren kleinen Sonnenschein hinweggerafft. Völlig umsonst und sinnlos, wie sich zeigt, denn es ist keineswegs abzusehen, dass die notwendigen Genehmigungen, die finanziellen Mittel und die Rekrutierung der Offiziere und Wissenschaftler, welche wir brauchen werden, auch nur ansatzweise Fortschritte machen.
So versuche ich nun, meine Zeit und Kraft der Erziehung meines einzig überlebenden Sohnes zu widmen sowie für mich selbst mein Studium der Ethnologie und Sprachen Ozeaniens wieder aufzunehmen. Ich war so erfreut, dass mein Vorschlag, die Völker Ozeaniens in Melanesier, Polynesier und Mikronesier zu untergliedern, in Fachkreisen sehr wohlwollend aufgenommen worden ist. Diese Studium muss ich weiter vervollkommnen und festhalten, welche noch ausstehenden Fragen ich während der kommenden Expedition beantworten muss.
Eigentlich müssten mich diese Dinge nicht wenig befriedigen, da ich von meinem Wesen her ein außerordentlich häuslicher und der Familie hingegebener Mensch bin. Doch muss ich feststellen, dass ich zunehmend eine unerklärliche Unruhe verspüre. Zum einen treibt mich eine Art schlechtes Gewissen, einem Hang zur Ruhe nachzugehen, während ich noch die Kraft hätte, eine erneute Seereise zu unternehmen; zudem sollte es vielleicht meine Pflicht sein, meine Ruhe zu opfern, um der Familie eine anständige Zukunft zu sichern? Zum anderen plagen mich fast jede Nacht sonderbare Träume, in denen ich an Bord der Astrolabe immer weiter zum Pol vordringe und unzählige gefährliche Ereignisse durchlebe und die mich dann erwachen lassen.
Wie sehr liegen diese Beweggründe miteinander im Streit! All diese Unruhe, meine Sorgen und meine Pläne gegen das glückliche und ruhige Leben, die Gesellschaft meiner geliebten Adèle und die Freude, an der Entwicklung meines Sohnes teilzuhaben. Dennoch – ich fühle, dass die Wanderlust letztendlich den Sieg davontragen wird. Jetzt obliegt es mir, mich der Zustimmung meiner Ehefrau zu versichern.
Tatsächlich hat Adèle, nachdem ich ihr die ersten Male meine Absichten kundgetan habe, ihren deutlichen Missmut zum Ausdruck gebracht. Mittlerweile aber hat sie ihre Einwilligung in die erneute, bestimmt sehr schmerzhafte Trennung gegeben. Sie hat meine Beweggründe, besonders in Bezug auf die Familie, reiflich erwogen und stimmt diesen jetzt vorbehaltlos zu. Ja, sie beginnt sogar, meine Vorbereitungen für die neue Reise eifrig und mit mutiger Hingabe zu unterstützen. Wie kann ich anders empfinden, als ihr lebenslang unendlich dankbar zu sein!
Abreise aus Toulon
Ein Krokodil im Hafen von Toulon? Unmöglich, wird man sagen. Niemals kann ein solches Tier an der Küste des Mittelmeeres beobachtet werden! Und man hätte in der Tat Recht – wenn es sich denn um ein Tier handeln würde. Doch es ist mitnichten ein langes, schuppiges Exemplar der gepanzerten Echse, welches soeben das brackige Wasser des Hafens durchpflügt, sondern ein Dampfboot. Wer auch immer dem Gefährt diesen Namen gegeben hat, muss über eine blühende Phantasie verfügen, denn keine der Eigenschaften, die man gewöhnlich mit einem Krokodil in Verbindung bringen würde – wie Schnelligkeit, Gefährlichkeit, Verschlagenheit, Standhaftigkeit, Unberechenbarkeit oder ehrfurchtgebietende Eleganz – passt auch nur im entferntesten zu dem hässlichen, unförmig gedrungenen, schmutzigen und qualmenden Vehikel.
Besser, man hätte dem Boot eine Nummer statt eines Namens gegeben, denkt sich daher Dumont d’Urville. Dies würde dem Anblick vielleicht gerechter werden. Aber es ist nicht allein der Name oder das Aussehen des Dampfschiffs, was den zweiundvierzigjährigen Seeoffizier ärgert, sondern vielmehr die Tatsache als solche, dass sein Schiff, die stolze Astrolabe, von diesem kleinen und schäbigen Etwas aus dem Hafen geschleppt werden muss. Nichts gegen den Fortschritt und die neue Dampftechnik, die sich in immer mehr Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft ausbreitet, oh nein. Dumont d’Urville hält sich für einen sehr fortschrittlichen Menschen, der seit jeher auf der Höhe der Zeit gewesen und den neusten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen gegenüber stets aufgeschlossen gewesen ist. Schließlich profitiert seine gerade beginnende Expedition ganz erheblich von den gewaltigen Errungenschaften, die seine Schiffe seetüchtiger denn je und seine Offiziere und Forscher fähiger denn je ausrüsten, die enormen Herausforderungen dieser Reise zu bewältigen.
Nein, das ist es nicht. Jedoch ist es eine Selbstverständlichkeit für jeden Segelschiffskapitän, sein Schiff mit gesetzten Segeln und aus eigener Kraft von der Reede auf die offene See zu bewegen. Die Zelée, das Schwesterschiff der Astrolabe, hat einfach Glück gehabt: eine Stunde früher hat der laue Wind noch kräftig genug geweht, um sie langsam, aber stetig aus dem Hafen zu bringen. Die Astrolabe, welche als Flaggschiff zuletzt den Anker lichten sollte, ist dafür von der darauf folgenden Flaute voll getroffen worden. Nun also bedarf es der Barkasse Krokodil, die Astrolabe ins Schlepptau zu nehmen. Seufzend lässt Dumont d’Urville dem Dampfschlepper signalisieren, dass die Leinen befestigt und die Astrolabe zum Schleppen bereit sei. Es dauert aber beinahe noch eine weitere Stunde, bis das Krokodil genügend Dampf auf den Kesseln hat, um den Dreimaster auch wirklich anzuziehen.
Bis es soweit ist, schweifen seine Blicke über die vollzählig an Deck versammelte Besatzung und seine Gedanken über die vor ihnen liegende, auf mehrere Jahre geplante Fahrt. Mit der Ernennung zum Kommandanten der großen Forschungsexpedition hat Jules-Sebastien César Dumont d’Urville den Zenit seiner maritimen Laufbahn erklommen: 1820, Teilnahme an seiner ersten kartografischen Expedition in die Ägäis; 1822 bis 1824, wissenschaftliche Expedition in die Südsee; 1826 bis 1829, als Fregattenkapitän erstes eigenes Kommando über die Astrolabe auf einer großen Expedition durch ganz Ozeanien. Und nun, mit der altbewährten Astrolabe und zusätzlich mit der Zelée, ist er Linienschiffskapitän und befehligt die seit Jahrzehnten umfangreichste Forschungs- und Entdeckungsreise Frankreichs. Nicht weniger als die Erkundung der Magellanstraße, erneut großer Teile Ozeaniens – namentlich die bisher am wenigsten erforschten –, der Gewässer zwischen Ozeanien und Australien sowie viele weitere Details stehen auf dem Programm. Dazu kommt, als neuer und überaus bedeutsamer Auftrag, die Erforschung der dem Südpol nahen Gewässer. Wie der König wörtlich gesagt hat: „Sie werden ihre Nachforschungen gegen den Pol soweit fortsetzen, als es nur immer die Polareisfelder gestatten!“ Die Tatsache, dass die Reise dabei eine erneute Weltumsegelung zur Folge haben wird, ist angesichts dessen schon beinahe eine Nebensache.
Selbstverständlich gedenkt Dumont d’Urville, diesen Auftrag von König Louis-Philippe vollständig und gründlich umzusetzen, ja nach Möglichkeit die Pläne und Erwartungen weit zu übertreffen. Es ist allein schon eine Frage der Ehre, die eigenen Arbeiten über Ozeanien, die auf den vorherigen Fahrten unternommen wurden, zu vervollständigen und die geografische wie ethnologische Wissenschaft wesentlich zu bereichern. Die riesige Palette der Zusatz- und Sonderaufträge, die ihm der König, das Marineministerium, weitere Behörden und Akademien mitgegeben haben, ist aber nicht nur eine ehrgeizige Herausforderung, sondern vielmehr ein aufregender, spannender Anreiz, welcher die Unternehmungslust, die Wissbegier und den Forschergeist des Kommandanten befriedigen soll. Selbst dann, wenn es nicht ohne große persönliche Opfer geschieht. Die lange Trennung von seiner Familie, vor allem von seiner geliebten Adèle, gefällt weder ihm und noch viel weniger ihr. Doch er sieht keinen anderen Weg, seine Lebensaufgabe zu krönen.
Dass dieses gewagte Unternehmen gelingen wird, daran hegt Dumont d’Urville keinen Zweifel. Die Astrolabe und Zelée sind tüchtige Schiffe. Die Astrolabe kennt der Kapitän in- und auswendig. Noch unter dem alten Namen Coquille hat sie ihn das erste Mal in die Südsee geführt, bei der zweiten Reise als nunmehrige Astrolabe sicher und zuverlässig rund um die Welt. Fast ein Jahr lang hat man die beiden Korvetten nun gründlich überholt und dabei Balken und Verstrebungen verstärkt; sämtliche Taue und das Segelwerk ausgetauscht; den Rumpf neu kalfatert; sowie tausenderlei kleine und kleinste Ausbesserungen und Verbesserungen vorgenommen. Aus den Erfahrungen der vorangegangenen großen Expeditionen hat Dumont d’Urville sorgfältig genaue Listen zusammengestellt, welche Vorräte und Ausrüstungen unbedingt erforderlich sind, um sowohl Schiffe als auch Mannschaft vernünftig und sicher auszurüsten. Wieder und wieder hat er in den vergangenen Wochen akribisch überprüft, ob die Hafenbehörden, Handwerker und Lieferanten den Vorgaben auch genau gefolgt sind. Sie sind es.
Zudem kann sich der Kommandant auf seinen besten Mann hundertprozentig verlassen – Charles Hector Jacquinot. Als Fähnrich ist Jacquinot bereits auf Dumont d’Urvilles erster Südseereise dabei gewesen, auf der großen Weltfahrt vor zehn Jahren hat er als Erster Offizier der Astrolabe gedient und nun kommandiert er als Fregattenkapitän die Zelée. Die beiden verfolgen ein gemeinsames Ziel und sind sich über alle wesentlichen, die Expedition betreffenden Dinge absolut einig. Außerdem sind beide begeisterte Wissenschaftler, die sowohl eigene Forschungsinteressen verfolgen als auch gemeinsam darauf achten werden, die Ergebnisse der Forscher, Entdecker, Kartografen, Ingenieure und Ärzte genauestens festzuhalten. Ja, die Zelée ist in guten Händen. Deshalb gönnt Dumont d’Urville seinem Freund im Grunde genommen auch gerne das kleine Vergnügen, beim Auslaufen die Nase vorn gehabt und als erster das offene Meer erreicht zu haben.
Ein jaulendes Tuten unterbricht Dumont d’Urvilles Gedanken. Offensichtlich hat die Krokodil mittlerweile einen ausreichenden Dampfdruck erreicht und schickt sich an, den Schleppvorgang zu beginnen. Kurze Signale werden gewechselt, dann straffen sich die Leinen und der dampfende Pott nimmt Fahrt auf. Immerhin, das muss man ihm lassen, die Kraft der Dampfmaschine scheint zu stimmen. Das Boot entwickelt einen ordentlichen Zug und stapft unverdrossen auf die Hafenausfahrt zu. Die Astrolabe folgt wie ein getreuer Hund an langer Leine hinterher. Auf diese Weise dauert es gar nicht lange, bis der Hafen hinter dem Gespann liegt und freies Fahrwasser erreicht ist. Hier setzt auch wieder eine frische Brise ein.
Dumont d’Urville lässt deshalb die Abschleppflagge auf- und niederholen, um der Barkasse anzuzeigen, dass man jetzt aus eigener Kraft weitersegeln kann. Das Signal wird erwidert und die Krokodil drosselt ihre Fahrt. Kurz darauf sind die Leinen gelöst, Zum Abschied noch ein Signalaustausch, dann verschwindet das Dampfboot hinter einer gewaltigen schwarzweißen Rauchwolke und kehrt nach Toulon zurück. Die Astrolabe setzt eilig ihre Segel und nimmt Kurs auf die Zelée, die einige Meilen voraus kreuzt und auf das Flaggschiff wartet.
Die große Fahrt um die Welt hat begonnen.
Magellans Land
Die Besatzungen der Astrolabe und der Zelée können sich des Kopfschüttelns nicht erwehren, als sie zum ersten Mal Feuerland erblicken. Die beiden Schiffe haben wie geplant die Einfahrt zur Magellanstraße erreicht, deren südliche Begrenzung die große Insel Feuerland bildet. Doch anders, als der Name suggeriert, handelt es sich nicht um eine warme oder gar heiße Gegend, die etwa von leuchtender Sonne oder heißen Quellen geprägt wäre. Ganz im Gegenteil, die Küste ist ausgesprochen karg. Das Ufer besteht aus steinigem, oftmals nacktem Boden, der nur äußerst spärlich von Pflanzen bedeckt ist. Wind und Wasser sind kühl bis ausgesprochen kalt, was allerlei subarktischen Tieren, wie Robben, Pinguinen, Albatrossen und Sturmvögeln sehr angenehm zu sein scheint, da sie sich in zahlreichen und großen Gruppen allenthalben beobachten lassen.
Einigen Matrosen, die sich besonders lautstark und abfällig über die Beschaffenheit der Landschaft äußern, werden von Fähnrich Marescot zurechtgewiesen. Es widerspreche dem Zweck der Expedition, die unterwegs angesteuerten Stationen so geringschätzig zu behandeln. Schließlich müssten die Leute jederzeit bereit sein, auf Befehl des Kommandanten an Land zu gehen, die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit zu unterstützen oder auf irgendeine andere Weise zum Gelingen des Unternehmens beizutragen, meint Marescot. Er lässt es sich auch nicht nehmen, denen, die es wissen wollen – und auch denen, die es nicht wollen – den Grund zu erläutern, wieso die Gegend den anscheinend so unpassenden Namen Feuerland erhalten hat. Niemand anders als Ferdinand Magellan selbst, der Generalkapitän der spanischen Expedition, die als erste diese Straße entdeckt und befahren hat, gab ihr nämlich einst diesen Namen. Wie Antonio Pigafetta, Magellans Chronist, berichtet hat, fand man damals die nördliche Küste der Meeresstraße gänzlich unbesiedelt vor. An der südlichen Küste sichteten die Spanier des Nachts zahlreiche Feuerscheine, die offensichtlich von Lagerfeuern der Eingeborenen stammten. Da die Expedition nur diese Feuer, aber keinen der Eingeborenen selbst zu Gesicht bekam, nannte Magellan das Land daraufhin „Feuerland“.
Dies soll sich nach dem Willen von Dumont d’Urville nun grundlegend ändern. Zwar haben seit Magellan mittlerweile einige europäische Expeditionen die Magellanstraße und die umliegenden Landstreifen erforscht; als erster der Spanier Bartolomé García de Nodal Anfang des Siebzehnten Jahrhunderts und zuletzt die Engländer King und FitzRoy kurz vor und kurz nach 1830. Doch über die Einwohner Feuerlands gibt es bislang nur spärliche Nachrichten. Hier ist es (natürlich!) ein Franzose gewesen, der zuallererst den unbedingten Kontakt mit den Feuerländern suchte – Louis Antoine de Bougainville auf der ersten Etappe seiner großen Weltumsegelung von 1766 bis 1769. Bougainville hat auch die heutige Bezeichnung für die Bewohner Feuerlands geprägt, die „Pescheräh“, womit er sie von den „Patagoniern“, den Ureinwohnern des Landes nördlich der Magellanstraße, zu unterscheiden suchte. Aber wie leben die Feuerländer? Welche Bräuche pflegen sie? Kann man mit ihnen handeln oder von ihnen nützliche Dinge erfahren? All dies und noch mehr gilt es zu erkunden, und so ist Dumont d’Urville entschlossen, in die Fußstapfen Bougainvilles zu treten und die nähere Untersuchung Feuerlands zu einer der ersten Stationen seiner eigenen Weltreise zu erheben.
Tatsächlich erblickt die Mannschaft eines Morgens auf beiden Seiten der Philipps-Bai, der zweiten großen Bucht der Magellanstraße, die erhofften großen Lichtscheine. Offensichtlich halten sich also sowohl Patagonier als auch Pescheräh in der Gegend auf. Einige Besatzungsmitglieder glauben sogar, an der feuerländischen Küste Pferde zu sehen. Dies ist ein Irrtum; wie sich herausstellt, handelt es sich um Guanakos. Der Kommandant befiehlt, die Südküste anzusteuern und dort zu ankern. Das ist schwieriger als gedacht. Es stellt sich heraus, dass die Magellanstraße ein äußerst tückisches Gewässer sein kann. Der Wind hat deutlich aufgefrischt, und die zahlreichen Wind- und Regenböen treiben die Schiffe hin und her. Dazu kommt eine ziemlich starke Strömung, wodurch das Ankern zu einer komplizierten Sache gerät, zumal die Tiefenlotungen nur unpräzise gelingen. Es dauert nahezu den ganzen Tag, bis das Anlegen gelingt, wozu der nachlassende Wind nicht wenig beiträgt.
Immerhin ist die mühsame und gefährliche Arbeit nicht gänzlich umsonst gewesen, denn die Kapitäne und die hydrographischen Ingenieure können wertvolle Erkenntnisse über die Beschaffenheit, Segelbarkeit und Navigierbarkeit der Meeresstraße festhalten.
Die wissenschaftlichen Erkundungen stehen auch als erstes an, als am kommenden Morgen die Boote ausgeschifft werden und die Besatzung, verteilt auf zahlreiche kleine Erkundungstrupps unter Führung der Forscher und Offiziere, an Land ausschwärmt. Die erste Gruppe unter Lieutenant Roquemaurel – die wichtigste – kümmert sich um die Ergänzung der Frischwasservorräte, danach um die Beschaffung von Holz, welches an Bord immer für Ausbesserungsarbeiten und die Kombüse benötigt wird. Eine zweite Gruppe, angeführt von den Ärzten Hombron und Jacquinot (ein Verwandter des Kapitäns der Zelée), widmet sich der Botanik. Neben der Sammlung von Nahrungsmitteln, darunter eine große Anzahl praktischerweise nahe beim Ufer wachsender Sellerieknollen, gehört dazu aber auch die Erkundung der sonstigen Vegetation. Eine dritte Mannschaft unternimmt es, in der weitläufigen Bucht auf Fischfang zu gehen, und die letzte Gruppe schließlich, unter der Führung des Kommandanten persönlich und einschließlich einer größeren Gruppe von Offizieren, macht sich mit der schnellsten Schaluppe auf zum nördlichen Ufer, um dort nach den Resten einer einstigen spanischen Ansiedlung zu suchen. Um 1580 nämlich versuchte der damalige König Philipp II., die Magellanstraße mit der Gründung einer Stadt namens Rey Don Felipe für das spanische Weltreich zu sichern. Doch der Ansiedlungsversuch scheiterte kläglich. Mehr als dreihundert Männer, Frauen und Kinder verhungerten jämmerlich, da es ihnen nicht gelang, aus der spärlichen Pflanzenwelt genügend Essbares zu gewinnen oder selbst Feldfrüchte anzubauen. Spätere Expeditionen fanden nur noch ausgestorbene Ruinen und zahlreiche Gräber vor. Seither heißt diese Bucht „Hungerhafen“ – Port Famine, trägt Dumont d’Urville in sein Reisejournal ein.