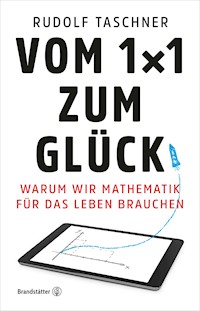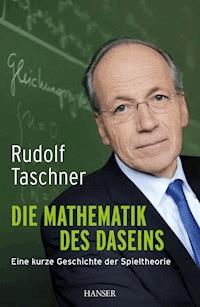8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine Liebeserklärung an den Zauber der Zahlen und eine fulminante Reise durch die Mathematik. „Taschner ist ein begnadeter Geschichtenerzähler.“ F.A.Z. Wie kann etwas zugleich korrekt, aber nicht wahr sein? Was verrät ein Kartenspiel über das Wesen der Zeit? Und was haben Quadratzahlen mit Farben zu tun? Rudolf Taschner nimmt uns mit auf eine fulminante Reise an die Grenze von Mathematik und Philosophie und zeigt, dass in Zahlen Antworten auf die größten Fragen verborgen liegen. Wir erfahren, warum schon Pythagoras in den Zahlen den Ursprung des Kosmos erblickte und weshalb Nobelpreisträger bis heute darüber rätseln, warum die Mathematik die Natur auf so wundersam treffende Weise zu beschreiben vermag. „Die Farben der Quadratzahlen“ ist ein Buch voller verblüffender Fakten, das zum Staunen über die Schönheit der Mathematik einlädt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Quadratzahlen und Farben, das Geheimnis von Gabriels Posaune, Mathematik, Zeit und Zufall - Bestseller Autor Rudolf Taschner nimmt uns mit auf eine fulminante Reise entlang der Grenze von Mathematik und Philosophie. Unterhaltsam und verständlich erzählt er, warum schon Pythagoras in den Zahlen den Ursprung des Kosmos erblickte und weshalb Nobelpreisträger bis heute darüber rätseln, warum die Mathematik die Natur auf so wundersam treffende Weise zu beschreiben vermag.
Die Farben der Quadratzahlen ist ein Buch voller verblüffender Fakten, das auch Zahlen-Phobiker zum Staunen über die Schönheit der Mathematik einlädt. Ganz im Sinne Pascals: »Die Mathematik als Disziplin ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, sie unterhaltsam zu gestalten.«
Rudolf Taschner
Die Farben der Quadratzahlen
Kleine Anleitung zum mathematischen Staunen
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Vorwort
Paradoxien des Zufalls und die Grenzen des Möglichkeitssinns
Gabriels Posaune und die Freude an der Erkenntnis
Geheimnisvolle Primzahlen und die Frage nach ewiger Gewissheit
Die wundersame Anwendbarkeit der Quadratzahlen
Die tiefe Kluft zwischen Wahrheit und Korrektheit
Danksagung
Register
Vorwort
»They did what could be done.« So antwortete der Mathematiker Harold Davenport, als man ihn fragte, wie ihm die Vorträge bei einem Kongress gefallen hätten. Ein vernichtendes Urteil. Nur etwas zu erfahren, das nicht überrascht, empfand Davenport als öde. Allein für das Unerwartete, für das Überraschende konnte er sich begeistern.
In diesem Buch soll von Überraschendem und Unerwartetem berichtet werden. Es handelt sich jedoch nicht um bloße Kuriositäten, die man beiläufig kennenlernt, sondern das Erstaunliche, von dem hier die Rede ist, birgt wertvolles Wissen und tiefe Einsichten in sich. In fünf Kapiteln werden eigenartige Phänomene aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, der Geometrie, der Zahlentheorie, der angewandten Mathematik und der reinen Mathematik erörtert und philosophisch beleuchtet.
Dieses Buch ist ein Essay. Als solches trägt es den Charakter des Vorläufigen in sich. Zwar ist viel von dem, worüber hier berichtet wird, schon sehr lange bekannt, einiges sogar mehrere hundert, ja tausend Jahre. Aber es lohnt, immer wieder aufs Neue darüber nachzudenken. Denn die Erkenntnisse sind so tiefschürfend und so weittragend, dass sich bei jeder erneuten Reflexion neue, unvermutete Aspekte zeigen. Den Anspruch, hier Endgültiges zu sagen, will das Buch keinesfalls erheben. Dafür ist es zu sehr dem Feuilletonistischen verpflichtet. Man sollte dies als Vorteil sehen. Bietet es doch damit allen Leserinnen und Lesern die verlockende Gelegenheit, eigene Gedanken weiterzuführen. Man kann sich kein schöneres intellektuelles Vergnügen vorstellen. So ist zu hoffen, dass trotz der vielen Zahlen und Rechnungen, die manche Seiten des Buches füllen, Leichtigkeit und Amüsement im Lesen nicht zu kurz kommen.
Was bedeutet es, dass aus einem Deck von 22 Karten »zufällig« gerade diese gewählt wurde?
Paradoxien des Zufalls und die Grenzen des Möglichkeitssinns
Walter Krämer, Mathematiker und Professor an der Fakultät Statistik der Technischen Universität Dortmund, betreibt mit seinen Büchern, vor allem mit seinem Klassiker »So lügt man mit Statistik«, wertvolle Aufklärung. Er beweist, wie wichtig ein kluger Blick auf eine Fülle von Daten ist. Denn erstaunlich schnell kann man in Fallen tappen, die sich hinter schlecht aufbereiteten oder tendenziös gestalteten statistischen Informationen verbergen.
Zusammen mit Gerd Gigerenzer, Psychologe und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, und dem am Essener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung tätigen und an der Ruhr-Universität Bochum lehrenden Ökonomen Thomas Bauer gibt Walter Krämer seit 2012 die »Unstatistik des Monats« heraus. Damit setzen sich die drei Vorkämpfer für ein klares, vorurteilsfreies Denken das Ziel, eine breite Öffentlichkeit zu ermuntern, »mit Daten und Fakten vernünftig umzugehen, in Zahlen gefasste Abbilder der Wirklichkeit korrekt zu interpretieren und eine immer komplexere Welt und Umwelt sinnvoller zu beschreiben«.
Dazu benötigt es weder Spezialwissen, das nur Eingeweihten zugänglich ist, noch besonderes Rechentalent. Es reichen ein paar Momente nüchternen Erwägens. Wenn zum Beispiel ein aufgewühlter Journalist in den Tagesthemen verkündet, ein Vermögen sei nach zweimal aufeinanderfolgenden 50 Prozent Verlust bei null gelandet, weiß ein aufmerksamer Zuseher auch ohne höhere Mathematik, dass sich der Fernsehmann irrt. Es ist bei 25 Prozent gelandet, nicht bei null.
Ein wenig mehr Zahlen kommen bei einem Beispiel zum Tragen, das Bauer, Gigerenzer und Krämer in ihre »Unstatistik« aufnahmen und das einen besonders eigenartigen Effekt in sich birgt. Es lohnt, darüber nachzudenken, weil die dem Beispiel innewohnende Paradoxie nicht allein bei ihm, sondern auch bei vielen anderen, ähnlich gelagerten Fällen verstörend wirkt.
Massentestung und Fehlalarme
Am Bahnhof Südkreuz in Berlin installierte 2018 die Deutsche Bahn auf Anregung der Polizei und des Innenministeriums eine digitale Gesichtserkennungsanlage. Die Betreiber zeigten sich begeistert: Die Anlage, so stellten sie stolz fest, besitzt eine Trefferrate von 80 Prozent und eine Fehlalarmrate von bloß einem Promille, also 0.1 Prozent.
Halten wir zunächst fest, was die beiden Zahlen 80 Prozent und 1 Promille in diesem Kontext bedeuten:
Die Polizei fahndet nach Personen, derer sie wegen des Verdachts der massiven Gefährdung öffentlicher Sicherheit habhaft werden möchte. Eine Trefferrate von 80 Prozent bei einer für diesen Zweck eingerichteten Anlage bedeutet: Wenn sich unter den Passanten 10 von der Polizei gesuchte Verdächtige befinden, werden 8 von ihnen von der Anlage aufgespürt. Die restlichen 2 kommen unentdeckt an der Anlage vorbei.
Eine Rate von 1 Promille Fehlalarme heißt: Wenn 1000 völlig unverdächtige Personen an der Anlage vorbeiziehen und die Anlage deren Gesichter registriert, wird sie bei einem dieser tausend Passanten Alarm auslösen, weil sie ihn fälschlich als einen von der Polizei gesuchten Verdächtigen identifiziert.
Die Errichtung dieser Anlage ist also, so könnte man in gutem Glauben vermuten, eine sinnvolle Investition. Und zwar nicht nur am Bahnhof Südkreuz in Berlin, sondern an allen Bahnhöfen des Landes.
Eine einfache und sehr unscharfe Überschlagsrechnung hingegen lässt daran zweifeln, ob diese Investition wirklich vernünftig ist:
Gehen wir, sehr grob geschätzt, von einer Bevölkerungszahl von 100 Millionen aus und nehmen wir, genauso grob geschätzt, an, dass 10 Prozent der Bevölkerung täglich durch Bahnhöfe schreiten. Dies sind somit rund 10 Millionen Personen. Nehmen wir ferner an, dass die Polizei die Gesichter von 1000 Verdächtigen kennt, welche die öffentliche Sicherheit massiv zu gefährden drohen. Auch bei diesen Verdächtigen nehmen wir an, dass 10 Prozent von ihnen täglich Bahnhöfe passieren: 100 Personen, die pro Tag von der Gesichtserkennung erfasst werden. Bei 80 von ihnen schlägt der Alarm an, und sie können – schnelles Handeln der Polizei vorausgesetzt – ergriffen werden.
Doch es werden auch die restlichen 10 Millionen Unverdächtigen von der Gesichtserkennung registriert, und bei 1 Promille von ihnen – dies sind immerhin 10.000 Personen – schlägt ebenfalls der Alarm an. Somit stehen 80 zielführenden Gefahrensignalen 10.000 Fehlalarme gegenüber. Oder anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich beim Ertönen der Sirene um einen echten Alarm handelt, beträgt rund 80⁄10.000, also 8 Promille, nicht einmal ein Prozent.
Nun mag man dagegenhalten, dass die genannten Zahlen allzu groben Schätzungen unterliegen. Das ist richtig. Aber solange sich die Zahl der Verdächtigen im Vergleich zur Zahl der Bevölkerung im Hundertstel-, ja nur im Zehntelpromillebereich befindet und solange die Zahl der Fehlalarme nicht fast exakt mit null übereinstimmt, wird sich das hier beschriebene Phänomen nicht vermeiden lassen.
Damit soll nichts gegen Anlagen zur Gesichtserkennung gesagt sein. Sinnvoll angewendet, mögen sie tatsächlich für mehr Sicherheit im Land sorgen. Aber zur sinnvollen Anwendung gehört auch das Wissen um das Problem der Fehlalarme.
Ganz ähnlich ist es bei der Erkennung sehr seltener Krankheiten. Hier ist die Spezifität des Tests das entscheidende Merkmal. Unter ihr versteht man die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei Nichtvorliegen der Erkrankung auch der Test ein negatives Resultat liefert. Eine Spezifität von 100 Prozent besagt, dass es – in der Sprache des obigen Beispiels – keine »Fehlalarme« geben kann. Doch sollte die Spezifität99 Prozent betragen und ist die Krankheit wirklich so selten, dass im Durchschnitt ein Kranker 100.000 gesunden Personen gegenübersteht, schlägt der oben beschriebene Effekt ebenfalls zu. Es wird zwar vom Test der eine Kranke erfasst – wenn der Test zu 100 Prozent sensitiv ist, also bei Krankheit immer anspricht –, aber 1 Prozent der 100.000 Gesunden, und dies sind tausend Patienten, sprechen auf den Test positiv an, obwohl sie die Krankheit nicht haben. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit dafür, bei einem positiven Test an der Krankheit zu leiden, liegt also bei bloß 1 Promille.
Grosse, kleine und alle Nierensteine
Leider handelt es sich beim Nierensteinleiden nicht um eine so seltene Krankheit, dass sie nur bei einer von 100.000 Personen auftritt. 1986 veröffentlichten vier Ärzte im British Medical Journal eine von ihnen durchgeführte Untersuchung, die mehrere Behandlungsmethoden unter die Lupe nahm. Der Einfachheit halber wollen wir uns hier auf zwei der Methoden beschränken: auf ein operatives Verfahren und auf das Zertrümmern der Steine durch Stoßwellen, die außerhalb des Körpers erzeugt werden.
Im gleichen Journal wiesen acht Jahre später Stephen Julious und Mark Mullee, zwei medizinische Statistiker der University of Southampton, darauf hin, dass die Ergebnisse der obigen Untersuchung höchst eigenartig sind:
Die Ärzte operierten 87 Patienten mit kleinen Nierensteinen, die einen Durchmesser von weniger als zwei Zentimeter besitzen. Hierbei waren 81 Patienten der insgesamt 87 nach der Operation geheilt. Das entspricht einer Erfolgsquote von 81⁄87, also rund 93 Prozent. Bei 270 Patienten mit kleinen Nierensteinen wurde das Verfahren der Zertrümmerung durch äußere Stoßwellen angewendet, und 234 von ihnen konnten danach als geheilt entlassen werden. Das entspricht einer Erfolgsquote von 234⁄270, also rund 87 Prozent.
Bei kleinen Nierensteinen schnitt somit die Operation als Therapie besser ab als die Steinzertrümmerung.
263 Patienten mit großen Nierensteinen mit mindestens zwei Zentimeter Durchmesser wurden operiert, und 192 unter ihnen wurden danach gesund. Das entspricht einer Erfolgsquote von 192⁄263, also ziemlich genau 73 Prozent. Bei 80 Patienten mit großen Nierensteinen versuchte man sich an der Zertrümmerung durch äußere Stoßwellen und erreichte bei 55 unter ihnen eine Heilung. Das entspricht einer Erfolgsquote von 55⁄80, also rund 69 Prozent.
Auch bei den großen Nierensteinen schnitt die Operation als Therapie besser ab als die Steinzertrümmerung.
Nun aber addierten Julious und Mullee die Anzahlen der operierten Patienten: Jene 87 mit den kleinen und jene 263 mit den großen Nierensteinen ergeben insgesamt 350 Personen, die mit dem Skalpell behandelt wurden. Und 81 + 192, also 273 von ihnen, wurden geheilt. Dies bedeutet, im Ganzen betrachtet, für die Methode der Operation eine Erfolgsquote von 273⁄350, also exakt 78 Prozent.
Genauso addierten Julious und Mullee die Anzahlen der Patienten, an denen die Methode der Zertrümmerung durch äußere Stoßwellen angewendet wurde. Es handelte sich ebenfalls um insgesamt 270 + 80350 Personen, von denen sich 234 + 55289 von ihrem Nierensteinleiden befreien konnten. Bemerkenswerter ist jetzt die Erfolgsquote der Zertrümmerung: Sie lautet 289⁄350, also fast 83 Prozent, und ist größer als die der Operation.
Im Ganzen betrachtet schnitt die Zertrümmerung besser ab als die Operation.
Was ist daher bei Nierensteinen die Therapie der Wahl? Aus den vorliegenden Zahlen lässt sich diese Frage offenbar nicht beantworten.
Schon zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hatten die britischen Statistiker Karl Pearson und Udny Yule solche paradoxen Resultate entdeckt. Fünfzig Jahre später stellte ihr Landsmann Edward Simpson das Auftreten dieser Paradoxie erneut fest, und seither wird sie nach ihm benannt. 1973 erlangte Simpsons Paradoxon öffentliche Beachtung, als man der University of Berkeley in Kalifornien die Diskriminierung weiblicher Studenten vorwarf.
In einer etwas vereinfachten Fassung, die das Wesentliche hervorhebt, gehen wir davon aus, dass sich 960 Frauen und 680 Männer als Studenten einer Fakultät der University of Berkeley bewarben, die zwei Studiengänge anbot. Da diese Fakultät 480 Frauen und 408 Männer als Studenten aufnahm, stand der Verdacht im Raum, dass die Frauen benachteiligt wurden. Denn ihre Aufnahmequote betrug 480⁄960, also 50 Prozent, und die der Männer 408⁄680, also 60 Prozent.
Doch eine genauere Betrachtung macht stutzig. Der erste der beiden Studiengänge war bei Männern sehr beliebt. Nur 240 der 960 Frauen hatten sich für ihn beworben, aber 510 der 680 Männer. 192 Frauen und 357 Männer wurden zugelassen. Für Frauen bedeutete dies eine Aufnahmequote von 192⁄240, also von 80 Prozent, bei den Männern von 357⁄510, also 70 Prozent. Der erste Studiengang bevorzugte somit Frauen.
Beim zweiten Studiengang bewarben sich die restlichen 720 Frauen und die verbliebenen 170 Männer. Da von den insgesamt 480 zur Fakultät zugelassenen Frauen 192 den ersten Studiengang wählten, wurden beim zweiten Studiengang 288 Frauen aufgenommen. Und da von den insgesamt 408 zur Fakultät zugelassenen Männern 357 auf den ersten Studiengang entfielen, wurden beim zweiten Studiengang nur 51 Männer aufgenommen. Für Frauen bedeutete dies beim zweiten Studiengang eine Aufnahmequote von 288⁄720, also 40 Prozent, bei den Männern lautete die Aufnahmequote 51⁄170, also 30 Prozent. Auch der zweite Studiengang bevorzugte Frauen.
Sollen die weiblichen oder sollen die männlichen Studienbewerber gegen die Fakultät wegen Diskriminierung ihres Geschlechtes klagen?
Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit
Bisher war nur von Häufigkeiten die Rede: Wenn 273 von 350 Patienten bei einer Therapie geheilt werden, ist das Verhältnis 273⁄350, umgerechnet 78 Prozent, die Erfolgsquote dieser Behandlung. Denn dieses Verhältnis beziehungsweise die aus ihm ermittelte Prozentzahl nennt die Häufigkeit, genauer: die relative Häufigkeit für die Wirksamkeit der Therapie. Wenn sich 240 Frauen für einen Studiengang bewerben und 192 von ihnen Aufnahme finden, benennt das Verhältnis 192⁄240, 80 Prozent, die relative Häufigkeit, mit der Frauen Zugang zu dem Studiengang finden.
Kurz gesagt benennt die Häufigkeit, wie groß – meistens in Prozent bemessen – der Anteil einer bestimmten Population ist, wenn ein spezielles Merkmal vorliegen soll. Stellt man zum Beispiel fest, dass Frauen mit einer Häufigkeit von 80 Prozent Zugang zu einem Studiengang erhalten, drückt man dies mit Worten so aus, dass von 100 Bewerberinnen rund 80 Aufnahme finden. Oder noch knapper formuliert: Von fünf Frauen, die den Studiengang anstreben, werden etwa vier aufgenommen.
Damit verbunden ist die Äußerung, eine den Prüfungssaal zum Bewerbungsgespräch betretende Frau werde mit der Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent einen positiven Bescheid erhalten. Doch das bedeutet für die gerade jetzt in Betracht gezogene konkrete Person wenig. Denn diese wird entweder aufgenommen oder abgelehnt. Im Einzelfall spielen die 80 Prozent keine Rolle.
Es ist zu beachten: Die Feststellung, dass die Häufigkeit80 Prozent beträgt, mit der Frauen Zugang zum Studiengang erhalten, wurde mit zwei Zählungen begründet: Zum einen erhebt man die Zahl 240 der Bewerberinnen, zum anderen die Zahl 192 der tatsächlich unter ihnen Aufgenommenen. Danach dividiert man die zweite, kleinere der beiden Zahlen durch die erste, größere. Das Ergebnis ist, wenn man die Division nach zwei berechneten Nachkommastellen abbricht, eine Dezimalzahl mit zwei Stellen nach dem Dezimalpunkt. In unserem Fall 192 : 2400.80. Mit 100 multipliziert, bekommt man so die Häufigkeit als Zahl von Prozenten. Mit Wahrscheinlichkeit hat das vordergründig überhaupt nichts zu tun.
Der aus dem damals noch zur Donaumonarchie gehörenden Lemberg stammende Richard Edler von Mises versuchte dennoch, eine Brücke von der Häufigkeit zur Wahrscheinlichkeit zu schlagen. Am Beispiel der Aufnahme von Frauen zu einem Studiengang können wir seinen Gedanken nachvollziehen: Zunächst, so malen wir uns dies aus, stellt von Mises fest, dass am von ihm willkürlich herausgegriffenen, fünften Bewerbungstag, an dem 10 Frauen kamen, 9 von ihnen zum Studiengang zugelassen wurden. Sodann erkundet von Mises, dass in der mittleren Bewerbungswoche, an der 50 Frauen kamen, 40 von ihnen Aufnahme zum Studiengang fanden. Schließlich stellt von Mises fest, dass in den letzten beiden Bewerbungswochen, an denen sich 100 Frauen um Aufnahme bemühten, 78 positiv beschieden wurden. Von Mises ermittelt also nicht eine Häufigkeit, sondern mehrere Häufigkeiten mit immer größer werdenden Nennern in den Verhältnissen, nämlich 9⁄10 oder 90 Prozent, 40⁄50 oder 80 Prozent und schließlich 78⁄100 oder 78 Prozent. Alle genannten Häufigkeiten kreisen um den Wert von 80 Prozent. Er ist daher nicht überrascht, dass im gesamten Bewerbungszeitraum, in dem 240 Frauen die Aufnahme für den Studiengang anstrebten, die Erfolgsquote dafür 80 Prozent betrug. Und er erlaubt sich die Vorhersage, dass bei gleich bleibenden Bedingungen im nächsten Studienjahr mit der gleichen Häufigkeit von 80 Prozent erfolgreicher Bewerberinnen zu rechnen ist.
(1.1) Die Häufigkeiten9⁄10, 40⁄50 und 78⁄100 der weißen Quadrate unter den von den Rechtecken umfassten Quadraten kreisen um den Wert von 80 Prozent.
Hierin zeigt sich der wesentliche Unterschied zwischen Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit: Die Häufigkeit beschreibt eine bereits vergangene Situation. Die Wahrscheinlichkeit erlaubt eine Vorausschau in die Zukunft. Allerdings nicht für den Einzelfall, sondern nur für viele, gleichartige und voneinander unabhängige Fälle.
Die Eigenschaftswörter »viel«, »gleichartig« und »voneinander unabhängig« sind dabei sehr wichtig:
Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich, wenn sie das Vorkommen eines bestimmten Merkmals in Prozentzahlen zu fassen versucht, auf viele Fälle, niemals auf den Einzelfall. Nur angesichts vieler Fälle ist es erlaubt, von »Zufall« zu sprechen, wenn einer dieser Fälle das Merkmal aufweist oder nicht.
Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf gleichartige Fälle. Im Beispiel der Zulassung zu den Studiengängen zeigte sich, dass die Aufnahmequoten nach Studiengang und nach Geschlecht verschieden waren. Frauen, nicht jedoch Männer, die sich für den ersten, nicht jedoch für den zweiten Studiengang um Aufnahme bewerben, werden mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit Erfolg haben. Nähme man auf das Geschlecht oder auf die Wahl des Studiengangs keine Rücksicht, läge eine völlig andere Situation vor, die eine andere Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme zur Folge hätte.
Die Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf voneinander unabhängige Fälle. Im Beispiel der Zulassung zu den Studiengängen dürfen die Bewerbungen einander nicht beeinflussen. Man hofft dies mit schriftlichen, standardisierten, vielleicht sogar nur aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehenden Tests verwirklichen zu können. Führt man indes Aufnahmegespräche durch, ist die Forderung, sich von zuvor geführten Gesprächen nicht beeinflussen zu lassen, schwer zu erfüllen. Worin sich allgemein die Tücken der Statistik auftun. Denn alle Voraussetzungen zu schaffen, die eine sichere Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewährleisten, ist alles andere als eine einfache Aufgabe.
Das Gesetz der grossen Zahlen
Beim Münzwurf, beim Würfeln, beim Ziehen einer Karte aus einem Kartendeck liegen Idealfälle vor, bei denen es sich wirklich um gleichartige und voneinander unabhängige Ereignisse handelt.
Dass nach dem Münzwurf »Kopf« oder »Zahl« aufscheint, ist gleich wahrscheinlich. Man weiß dies von vornherein, ohne die Münze dafür mehrfach fallen lassen zu müssen. Denn die Münze ist – von der Gravur abgesehen – völlig symmetrisch: Ein Vertauschen von Unter- und Oberseite ergibt das gleiche Bild. Dieser Symmetrie ist es zu verdanken, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine dieser beiden Seiten nach oben zeigt, 1⁄2 oder 50 Prozent ist.
Dass man die Augenzahl Sechs würfelt, ist genauso wahrscheinlich wie das Würfeln einer anderen der sechs Augenzahlen. Man weiß dies von vornherein, ohne dafür oft würfeln zu müssen. Denn die Seitenflächen des Würfels sind – von den eingekerbten oder aufgemalten Augen abgesehen – völlig symmetrisch: Dreht man den Würfel so, dass eine andere Facette nach oben zeigt, sieht er genauso aus wie zuvor. Aufgrund der Symmetrie des Würfels lautet die Wahrscheinlichkeit dafür, eine bestimmte Augenzahl zu würfeln, 1⁄6 oder rund 17 Prozent.
Dass man aus dem Deck von 52 gut gemischten Karten des französischen Blatts beim blinden Ziehen einer Karte just die Pikdame wählt, ist genauso wahrscheinlich wie das Ziehen einer anderen Karte aus dem Kartendeck. Darum beträgt diese Wahrscheinlichkeit 1⁄52 oder knapp weniger als 2 Prozent. Und weil je 13 der 52 Karten die Farben Pik, Herz, Karo und Treff tragen, ist die Wahrscheinlichkeit, beim blinden Ziehen einer Karte eine in der Farbe Herz zu wählen, 13⁄52, gekürzt 1⁄4 oder 25 Prozent. All dies weiß man von vornherein, weil das Mischen der Karten sichert, dass beim Ziehen allein der Zufall am Werk ist.
Zweihundert Jahre bevor Richard von Mises die Wahrscheinlichkeit aus einer Folge von Häufigkeiten zu erschließen versuchte, die sich um diesen Wert der Wahrscheinlichkeit scharen, gelang dem Basler Mathematiker Jakob Bernoulli das Umgekehrte: Er bewies in seinem 1713, acht Jahre nach seinem Tod erschienenen Buch »Ars Conjectandi«, wörtlich übersetzt: »Die Technik des Vermutens«, einen Satz, den er das »Goldene Theorem« nannte und der heute als das »Gesetz der großen Zahlen« bekannt ist.
Vereinfacht besagt der Satz von Jakob Bernoulli: Wenn ein Vorgang, dessen mögliche Endstände allein vom Zufall abhängen, sehr oft wiederholt wird, stimmt die Häufigkeit für einen bestimmten Endstand sehr genau mit der Wahrscheinlichkeit dieses Endstands überein. Dabei darf man – von etwaigen »Ausreißern« abgesehen, die manchmal vorkommen – mit einer umso besseren Übereinstimmung rechnen, je öfter der Vorgang wiederholt wird. Daher der Name »Gesetz der großen Zahlen«.
(1.2) Gesetz der großen Zahlen: Oben ist bei 2400 Würfen mit einem Würfel eingetragen, wann die Augenzahl Sechs gewürfelt wurde. Die Summe der Flächeninhalte der grauen Quadrate im Verhältnis zum Flächeninhalt aller 2400 Quadrate teilt die Häufigkeit des Würfelns der Augenzahl Sechs mit. Sie stimmt ziemlich genau mit 1⁄6 überein. Unten sind die Seitenflächen eines Würfels schematisch gezeichnet. Das Verhältnis des Flächeninhalts des Quadrats mit der Augenzahl Sechs zum Flächeninhalt aller Seitenflächen des Würfels teilt die Wahrscheinlichkeit des Würfelns der Augenzahl Sechs mit. Sie beträgt exakt 1⁄6.
Wichtig ist, dass es allein vom Zufall abhängt, wie der Vorgang verläuft. Denn nur dann hat der Begriff Wahrscheinlichkeit überhaupt seine Berechtigung. Diesem Zweck dienen das völlig unkontrollierte Werfen der Münze oder des Würfels und das mehrfache Mischen der Karten. Legt jemand den Würfel so auf den Tisch, dass die Augenzahl Sechs nach oben weist, spricht niemand davon, dass dies zufällig der Fall ist. Und sitzt man einem Trickspieler auf, der das Falschmischen von Karten beherrscht, darf man sich nicht wundern, wenn er ohne Unterlass die Pikdame aus dem Kartendeck errät. Denn da er weiß, wo sie sich befindet, stimmt für ihn schlicht nicht, dass die Wahrscheinlichkeit ihres Erratens weniger als 2 Prozent beträgt.
Darin liegt das Wesen des Zufalls: Er ist die ausschlaggebende Bedingung dafür, dass man mit Wahrscheinlichkeiten korrekte Prognosen trifft.
Jedenfalls wusste Bernoulli aufgrund seines Gesetzes: Wirft man eine Münze 100-mal, darf man erwarten, dass sie rund 50-mal Zahl zeigt. Wirft man sie 1000-mal, darf man erwarten, dass sie rund 500-mal Zahl zeigt. Natürlich selten so genau, aber mit nur wenigen Abweichungen von den von der Wahrscheinlichkeit vorausgesagten Werten. Würfelt man 60-mal, kann man mit rund 10 Würfen der Sechs rechnen. Würfelt man 300-mal oder 2400-mal, kann man im ersten Fall mit rund 50 und im zweiten Fall mit rund 400 Würfen der Sechs rechnen. Auch hier nur selten so genau, aber mit nur wenigen Abweichungen von den von der Wahrscheinlichkeit vorausgesagten Werten.
Ähnliches gilt auch beim Ziehen von Karten, wenn zuvor das Kartendeck sehr gut gemischt wurde. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird im Folgenden ein Glücksspiel vorgestellt, das aus zwei Phasen besteht. In seiner ersten Phase lernen wir, wie die üblichen Glücksspiele im Casino oder beim Lotto im Prinzip immer ablaufen. Doch die zweite Phase dieses Spiels ist es, die eine eigenartige Paradoxie in sich birgt.
Die Vorbereitung des Spiels: die Karten
Für das Spiel verwenden wir die Karten des Tarockspiels. Diese schönen 54 Karten teilen sich in 22 Tarockkarten und 32 Karten der klassischen Farben Herz, Karo, Pik und Treff auf.
21 der 22 Tarockkarten sind mit den römischen Zahlen von I bis XXI bezeichnet und zeigen je zwei Genreszenen aus dem Barock oder Biedermeier. Die 22. Tarockkarte ist der »Sküs«, abgeleitet vom französischen s’excuser, sich entschuldigen, weil diese Karte beim Tarockspiel (bis auf eine sehr spezielle Ausnahme) alle anderen Karten sticht und man dabei höflich um Nachsicht bittet, dass man diesen Trumpf spielt. Der Sküs ist mit einem Joker oder Harlekin vergleichbar. Tarock I, der »Pagat«, und TarockXXI, der »Mond«, bilden zusammen mit dem Sküs die »Trull«. In den meisten Regelvarianten des Tarockspiels nehmen diese drei Karten eine besondere Rolle ein. Das Wort Pagat kommt vom italienischen bagata, die Kleinigkeit; es ist die Tarockkarte mit der kleinsten Zahl. Und TarockXXI hat nur vordergründig etwas mit dem Mond zu tun, eigentlich kommt es vom französischen Wort le monde, die Welt. Genauso wie das eigenartige Wort Trull aus dem französischen tous les trois, alle drei, verballhornt ist.
Manchmal wird der Pagat als Tarockkarte mit der kleinsten Zahl auch der »Spatz« genannt. Dies passt dazu, dass man TarockII den »Uhu«, TarockIII den »Kakadu« und TarockIIII, vom tschechischen kvapil, er ist geeilt, herrührend, den »Quapil« oder aber den »Marabu« nennt. Dementsprechend heißen die Tarockkarten mit den ersten vier römischen Zahlen I, II, III und IIII die »Vögel«.
Die 32 Karten in den Farben Herz, Karo, Pik und Treff teilen sich in jeder Farbe in vier Figurenkarten und vier Zählkarten auf. Die Figuren sind der König, die Dame, der Cavall, abgeleitet vom italienischen cavallo, Pferd, weil er als Reiter dargestellt wird, und der Bube. Die vier Zählkarten sind in den schwarzen Farben Zehn, Neun, Acht und Sieben und in den roten Farben Ass, Zwei, Drei und Vier. Diese Zählkarten werden die »Skartindeln« genannt, weil sie beim Tarockspiel als die schwächsten und entbehrlichsten Karten gelten. Das italienische scarto bedeutet Ramsch oder Abfall.
Tarock mit den 54 Karten wird noch immer in den Nachfolgestaaten der Donaumonarchie gespielt, in seiner Variante Cego auch im süddeutschen Raum. Es ist ein höchst amüsantes Spiel mit einer Unzahl von Möglichkeiten und Regelvarianten, die in ihrem mittelalterlichen Ursprung auf Aberglauben und Mystifikation beruhen, wovon man aber kaum mehr etwas weiß. Denn bevor man Tarock ab dem 15. Jahrhundert in Italien, danach im 17. Jahrhundert in Frankreich, im 18. Jahrhundert in ganz Europa und danach vornehmlich in den Ländern des Habsburgerreiches zum Vergnügen spielte, waren diese Karten in den Händen von Gauklern und Wahrsagerinnen. Viele glaubten, ihr Auflegen sei für das Schicksal entscheidend. Denn im Mittelalter kannte man keinen Zufall. Alles Geschehen war entweder für Fromme in des Ewigen unerfindlichem Ratschluss geborgen oder aber für Abergläubische irgendwelchen obskuren Mächten überantwortet. Oft war man beides: fromm und abergläubisch zugleich. Doch womöglich, so meinte man, konnte ein Blick in die aufgeschlagenen Tarockkarten etwas über die Zukunft verraten. Geld verdienen konnte man mit der Wahrsagerei jedenfalls prächtig.
Wir aber wollen uns hier der Karten des Tarock nicht für solche Spiegelfechtereien bedienen, sondern mit ihnen anhand eines Glücksspiels zeigen, wie die Begriffe Wahrscheinlichkeit, Risiko und Information zusammenhängen.
(1.3) Die 54 Karten des Tarock.
Die erste Spielphase: Der Topf wird gefüllt
Zwei Personen sitzen bei unserem Spiel einander gegenüber. Die eine Person, der Spieler genannt, zahlt für jede Spielrunde eine bestimmte Summe Geldes, sagen wir 10 Euro, als Einsatz und legt dieses Geld in einen Topf. Die andere Person, die Bank genannt, hat ein riesiges Reservoir an Geld zur Verfügung. Die Bank legt verdeckt und in fünf Päckchen aufgeteilt die 54 Karten des Tarockspiels auf den Spieltisch. Im dicksten der Päckchen sind die 22 Tarockkarten gut gemischt versammelt. In den anderen vier Päckchen, ebenfalls jedes Päckchen gut gemischt, die acht Karten der Farben Herz, Karo, Pik und Treff. Obwohl die Karten verdeckt liegen, kennt man die Farben der Karten der einzelnen Päckchen.
(1.4) Erste Spielphase: Die gut gemischten Karten der Farben Herz, Karo, Pik, Treff und Tarock werden verdeckt vor dem Spieler auf den Tisch gelegt …
Zu Beginn der Spielrunde lässt die Bank den Spieler von jedem der fünf Päckchen je eine Karte ziehen, die der Spieler aber nicht sieht, sondern von der Bank verdeckt vor ihm hingelegt werden. Die restlichen 49 Karten kommen zur Seite, sie werden im weiteren Verlauf der Runde nicht mehr benötigt.
(1.5) … der Spieler wählt aus jedem der fünf Päckchen eine Karte …
In der nun folgenden ersten Spielphase kann der Spieler durch glückliches Raten erreichen, dass seine Gewinnchance für die zweite Spielphase erheblich gesteigert wird. Man könnte theoretisch diese erste Spielphase übergehen, und der Spieler kann dies auch verlangen. Aber mit einem solchen Überspringen begäbe sich der Spieler der Möglichkeit, viel mehr zu gewinnen als die von ihm eingesetzten 10 Euro.
Bei der von ihm aus den Päckchen mit den Herzkarten gezogenen Karte kann der Spieler entweder die Karte verdeckt lassen oder aber raten, um welche Kartengruppe oder um welche Karte es sich handelt. Dann wird sie von der Bank vor dem Spieler aufgedeckt. Hat der Spieler richtig geraten, erhöht sich die Gewinnchance des Spielers. Hat der Spieler falsch geraten, ist die Spielrunde zu Ende, es gibt auch keine zweite Spielphase, und das Geld, das sich im Topf befindet, geht an die Bank.
Rät der Spieler zum Beispiel, dass die gezogene Herzkarte ein Skartindel ist, verdoppelt die Bank, falls dies stimmt, den im Topf befindlichen Einsatz. Genauso wird zu dem im Topf befindlichen Geld von der Bank gleich viel dazugelegt, wenn der Spieler richtig rät, dass die gezogene Herzkarte eine Figur ist. Rät der Spieler, dass die gezogene Herzkarte der Herzkönig ist (oder eine andere bestimmte Karte in Herz), und stellt sich heraus, dass dies stimmt, gibt die Bank das Siebenfache von dem Geld, das sich im Topf befindet, hinzu. Im Topf ist dann das Achtfache des Geldes.
Bei den von dem Spieler aus den Päckchen der Farben Karo, Pik und Treff gezogenen Karten geht man genauso vor. Ein übervorsichtiger Spieler, der nichts riskiert, lässt alle vier Karten verdeckt liegen und bleibt auf Nummer sicher bei seinem Einsatz von 10 Euro. Ein beherzter Spieler, der zum Beispiel bei den Farben Herz und Karo darauf setzt, dass er bei ihnen Figuren gezogen hat, bei den Farben Pik und Treff aber die Karten liegen lässt, erhöht, wenn ihm das Glück hold ist, seine Gewinnchance, weil sich im Topf jetzt 2 × 2 mal 10 Euro, also 40 Euro befinden. Und ein wagemutiger Spieler, der bei jeder Farbe darauf setzt, den König gezogen zu haben, und das unerhörte Glück hat, damit richtigzuliegen, besitzt nun einen Topf, in dem sich 8 × 8 × 8 × 8 mal 10 Euro, also 40.960 Euro befinden.
Auch bei der vom Spieler gezogenen Tarockkarte kann er durch Raten seine Gewinnchance weiter erhöhen: Setzt er auf »unter XII« oder auf »über XI«, wird das Geld im Topf verdoppelt, wenn im ersten Fall die gezogene Karte eine der elf vom Pagat aufsteigend bis zu TarockXI ist oder im zweiten Fall eine der elf von TarockXII aufsteigend bis zum Mond und zum Sküs ist. Setzt er auf »Vögel« oder auf »Trull«, wird im Falle, dass er Glück hat, das Geld im Topf verfünffacht oder versiebenfacht. Setzt er gar auf »Sküs« (oder auf eine andere bestimmte Tarockkarte), gibt ihm im Falle, dass er richtig rät, die Bank das 21-Fache von dem Geld, das sich im Topf befindet, hinzu.
Falls der oben genannte wagemutige Spieler die Tollkühnheit besitzt, bei der gezogenen Tarockkarte auf »Pagat« zu setzen, und sich tatsächlich beim Umdrehen die Karte als Tarock I herausstellt, schreitet er zur zweiten Spielphase mit einem Einsatz von 22 × 40.960, also von 901.120 Euro im Topf.
(1.6) … der Spieler rät, dass er bei Herz und Karo eine Figur und bei Tarock eine Karte über XI gewählt hat. Diese Karten werden gezeigt, und der Spieler hat in allen drei Fällen richtig getippt. Das Geld in seinem Topf wird nun verachtfacht.
Allerdings darf nicht übersehen werden: Sobald ein Spieler mit seinem Raten bei irgendeinem der fünf Päckchen falschliegt, verliert er das Geld im Topf an die Bank, und die Spielrunde ist vollends vorbei.
Die erste Spielphase als klassisches und faires Spiel
Bevor wir die zweite Spielphase beschreiben, die den eigentlichen Clou des Spiels in sich trägt, überzeugen wir uns, dass die beschriebenen Erhöhungen der Spielchancen für die Bank auf lange Sicht kein Risiko in sich tragen. Sie wird zwar nicht reicher, aber auch nicht ärmer.
Nehmen wir an, es werden 8000 Runden der ersten Spielphase gespielt. Wir betrachten das Päckchen mit den acht Karten in Herz, von denen in jeder Runde eine gezogen wird.
Nehmen wir an, dass der Spieler andauernd darauf setzt, Figuren gezogen zu haben. Dem Gesetz der großen Zahlen zufolge können wir davon ausgehen, dass rund 4000-mal wirklich eine Figur gezogen wurde und rund 4000-mal ein Skartindel. In den Fällen, in denen ein Skartindel gezogen wurde, erhält die Bank vom Spieler den Einsatz von 10 Euro. Und wenn eine Figur gezogen wurde, legt die Bank weitere 10 Euro in den Topf, verdoppelt also den Einsatz. Da es sich um etwa gleich viele Fälle handelt, gleichen sich Gewinn und Verlust der Bank ziemlich genau aus.
Nun nehmen wir an, dass der Spieler andauernd darauf setzt, eine bestimmte Karte der acht Karten in Herz gezogen zu haben. Dem Gesetz der großen Zahlen zufolge können wir davon ausgehen, dass er rund 1000-mal Glück hat und die richtige Karte errät. In diesen rund tausend Fällen bekommt er zu seinem Einsatz von 10 Euro von der Bank noch 70 Euro hinzu. In den restlichen rund 7000 Fällen kassiert die Bank stets 10 Euro vom Spieler. Auch hier gleichen sich Gewinn und Verlust der Bank ziemlich genau aus.
Genauso argumentiert man beim Päckchen der Tarockkarten, wenn der Spieler in jeder der Runden entweder auf »unter XII« oder auf »über XI« setzt: Stets handelt es sich dabei um die Hälfte der Karten des Päckchens, von denen der Spieler meint, aus dieser habe er eine gezogen. Darum kann es sich die Bank erlauben, beim richtigen Raten des Spielers den im Topf befindlichen Einsatz zu verdoppeln.
Setzt der Spieler beim Päckchen der Tarockkarten andauernd auf eine der 22 Karten, wird er bei angenommenen 22.000 Runden nur bei rund 1000 dieser Runden Glück haben. Das Geld, das die Bank vom Topf des Spielers aus den restlichen rund 21.000 Runden erhält, bei denen er falschliegt, stimmt mit jenem überein, das sie bei den wenigen Glücksrunden des Spielers zur Erhöhung des Einsatzes ausgibt.
Wie man sieht, ist das Spiel dann fair, also sowohl für die Bank als auch für den Spieler auf lange Sicht weder ein Gewinn noch ein Verlust, wenn die Bank den im Topf befindlichen Betrag mit dem Kehrwert jener Größe multipliziert, die mit der Wahrscheinlichkeit übereinstimmt, dass der Spieler richtig geraten hat.
Ein klein wenig unfair ist die Vereinbarung, dass der Einsatz des Spielers verfünffacht beziehungsweise versiebenfacht wird, wenn er bei der aus dem Päckchen der Tarockkarten gezogenen Karte rät, sie sei ein Vogel oder eine Trullkarte, und damit richtigliegt. Denn die Wahrscheinlichkeit, einen der vier Vögel aus den 22 Tarockkarten zu ziehen, beträgt 4⁄22, und ihr Kehrwert ist 22⁄4, also etwas größer als fünf. Analog dazu ist die Wahrscheinlichkeit, Pagat, Mond oder Sküs aus den 22 Tarockkarten zu ziehen, 3⁄22. Ihr Kehrwert ist 22⁄3, also etwas größer als sieben. Bei den oben getroffenen Festsetzungen ist die Bank gegenüber dem Spieler ein wenig im Vorteil.
Man könnte völlige Fairness auch in diesen Fällen walten lassen, indem man zum Beispiel als Zusatzbestimmung festlegt: Setzt der Spieler auf Vögel und ist die von ihm gezogene Karte der Mond oder der Sküs, bleibt das Geld im Topf erhalten und wird weder vermehrt oder vermindert. Es ist so, als ob der Spieler beim Päckchen der Tarockkarten gar nicht gesetzt hätte. Mond und Sküs bilden gleichsam »Rettungskarten« vor dem drohenden Entleeren des Topfes zugunsten der Bank. In ähnlicher Weise kann man zum Beispiel den Uhu zur Rettungskarte erklären, wenn der Spieler auf die Trull setzt und keine Trullkarte gezogen hat.
Im Übrigen ist eine leichte Unfairness zugunsten der Bank im professionellen Geschäft mit Glücksspielen das A und O der Haushaltsführung. Man vereinbart einfach, dass das Geld im Topf des Spielers nicht genau mit dem Kehrwert jener Größe multipliziert wird, die mit der Wahrscheinlichkeit des Gewinns übereinstimmt, sondern mit einem etwas kleineren Wert. Mit diesem Trick wird die Bank auf lange Sicht reicher, als sie ohnehin schon ist.
Beim französischen Roulette ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, eine der 37 Nummern zwischen 0 und 36 zu erraten, in deren Fach auf dem Rouletterad die Kugel fällt, offenkundig 1⁄37. Aber nur um das 36-Fache wird im Falle des Gewinns das Geld im Topf des Spielers multipliziert – oder, wie die Casinos geschickt umschleiernd sagen: Zu dem vom Spieler auf die Nummer gesetzten Geld gibt die Bank den 35-fachen Betrag hinzu.