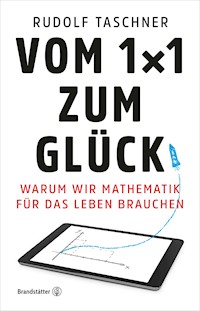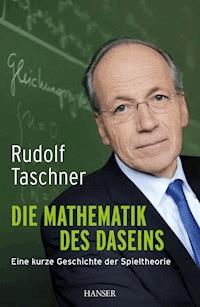14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Sprache: Deutsch
Was ist denn schon gerecht? Der Ort unserer Geburt? Unsere Herkunft? Unsere Gene, die scheinbar Schicksal spielen? Der Zufall, der uns vor einem Unglück bewahrt, oder uns über Nacht zum Millionär werden lässt? Sind wir nicht alle gleich? Gerechtigkeit gibt es nicht!, rufen die traurigen, hoffnungslosen Realisten. Es ist eine wunderschöne Illusion, die uns hoffen und schaffen lässt, die anderen. Rudolf Taschner wird Ihnen keinen Schiedsspruch über Gerechtigkeit liefern, er wird keinen Freibrief für Vorurteile ausstellen, kein Machtwort über Geld, Gesetz, Geschichte und Gewissen sprechen. Aber er wird Sie fühlen lassen, dass Ihr Glück nicht davon abhängt, wie groß Ihr Stück vom Kuchen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rudolf Taschner
GERECHTIGKEIT SIEGT –ABER NUR IM FILM
Rudolf Taschner
GERECHTIGKEITSIEGT –ABER NUR IM FILM
Rudolf Taschner
Gerechtigkeit siegt – aber nur im Film
Umschlagidee und -gestaltung: kratkys.net
1. Auflage
© 2011 Ecowin Verlag, Salzburg
Lektorat: Mag. Josef Rabl
Gesamtherstellung: www.theiss.at
Gesetzt aus der Sabon
Printed in Austria
ISBN 978-3-7110-5009-0
www.ecowin.at
Inhalt
Prolog
Gerechtigkeit und Gleichheit
Gerechtigkeit und Generationen
Gerechtigkeit und Gesetz
Gerechtigkeit und Geschichte
Gerechtigkeit und Geschäft
Gerechtigkeit und Gestaltung
Gerechtigkeit und Gewissen
Gerechtigkeit und Gnade
Danksagung
Literaturverzeichnis
Personenregister
Prolog
Gerechtigkeit: ein Wieselwort
(Friedrich August von Hayek, 1899–1992,Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften)
„Früher hieß es: Die kleinen Diebe hängt man, die großen lässt man laufen. Jetzt aber: Die kleinen Diebe hängt man, den großen läuft man nach.“ Pointierter und treffender als Daniel Spitzer, Jurist, Journalist, Aphoristiker und Satiriker der österreichischen Monarchie, konnte zu seiner Zeit wohl niemand die Ernüchterung derer beschreiben, die auf Gerechtigkeit setzten. Und verprellt wurden.
Was Daniel Spitzer einst erkannte, ist bis heute gang und gäbe.
Wir stolpern von einer Verwerfung des Vertrauens auf Gerechtigkeit in die nächste. Erinnern wir uns, was die Krisen der letzten Jahre bescherten: Das Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends, bei der viele Kleinanleger im blinden Glauben an den ungebremsten Anstieg der Technologie-Kurse ihr Vermögen verloren. Die Subprime-Krise als Folge eines spekulativ aufgeblähten Wirtschaftswachstums in den USA und einer global kreditfinanzierten Massenspekulation, in der Lehman Brothers in die Brüche ging, nicht aber andere ähnlich pleitegefährdete Institute. Die Krise der überschuldeten europäischen Staaten, bei der die hehre Ankündigung, Griechenland, das erste der vom Bankrott bedrohten Länder, „retten“ zu wollen, sich als Schonung von Bankinstituten in Frankreich, in Deutschland und in anderen Staaten entpuppte, die um den Wert ihrer griechischen Wertpapiere bangten. Bei all den fatalen Auswirkungen dieser Schlamassel ist die fatalste wohl jene, dass der Schaden in den seltensten Fällen den trifft, der ihn angerichtet hat.
Bernard Madoff, Milliardenbetrüger einsamster Klasse, hatte so brutal über die Stränge geschlagen und so perfide Tausende in den blanken Ruin getrieben, dass er schließlich der Justiz in die Fänge geriet. Ein Sieg der Gerechtigkeit? Manch andere Gauner, die wie die Hollywood-Figur Gordon Gekko, von Gier und Geiz getrieben, vor keiner üblen Machenschaft zurückschrecken, haben ihre Schäfchen ins Trockene gebracht und lachen sich ins Fäustchen. Nur Hollywood verheißt, dass letztendlich das Gute triumphiert. Dem Abspann des Films folgt die Ernüchterung.
Denn es gibt sie, die Matadore der Finanzkrisen, die Profiteure des Unglücks. Nicht selten sind es jene, die zu den Verursachern von Krisen zählen. Wer auf einen totalen Kursverfall mit anschließendem Börsencrash setzt, die Macht und den Einfluss hat, den Eintritt des Debakels zu forcieren und mit dem gerissenen Instrument des Leerverkaufs darauf wettet, kann mit dem Unglück und der Not anderer Milliarden verdienen.
Und es gibt sie, die Verlierer. Es mögen jene unter ihnen nicht frei von Schuld sein, die ihre Ersparnisse dank schlechter Beratung und mangelnder Kenntnis in Schrottpapiere investiert haben. Aber waren ihre fehlende Umsicht und ihr mangelndes Risikobewusstsein so schlimm, dass der bittere Verlust des einst ehrlich erworbenen Vermögens, der komplette Wegfall der Pensionsvorsorge einen dafür angemessenen Schicksalsschlag bedeuten? Und welches Fehlverhalten haben sich die vielen Angestellten in der Finanzbranche vorzuhalten, die nun vor dem Nichts stehen, nachdem ihre einstigen Chefs, die damaligen „Masters of the Universe“, den totalen Kollaps angerichtet haben?
Den Krisen auf den Finanzmärkten folgten unmittelbar die Krisen der überschuldeten Staaten. Kaum jemand weiß, wie sie zu überwinden sind, wenn man Grundsätze der Gerechtigkeit nicht über Bord werfen möchte. Wie weit, so stellt sich die Frage, kann man die Solidarität in einer Staatengemeinschaft beanspruchen, bis es von der Bevölkerung eines Landes mit solider Volkswirtschaft als bitter ungerecht empfunden wird, Pleitestaaten unter die Arme zu greifen? Ein Leserbrief zum Artikel „Das letzte Gefecht. Wie Europa seine Währung ruiniert“ des „Spiegel“ vom Dezember 2010 verdeutlicht den Aberwitz: „Zunächst bemühen sich einige Staaten unter großer Anstrengung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern – was nichts anderes heißt, als zu Lasten der eigenen Arbeitnehmer und der gesamten Binnenkonjunktur die Löhne zu drücken. Ist dadurch dann schließlich ein Exportvorteil gegenüber anderen Ländern entstanden, werden diese mit gigantischen Finanzmitteln ,aufgepeppt‘: Der errungene Wettbewerbsvorteil wird bewusst wieder zunichte gemacht … und zu diesem Zweck werden auch noch zig Milliarden an Steuergeldern gezahlt. Absurder geht es kaum.“
Unschuldig kommen Arbeiter und Angestellte auch solider Unternehmen der Realwirtschaft zum Handkuss, wenn infolge von Staatskrisen der Konsum abebbt, Investitionen zurückgesteckt werden, der Export an Schwung verliert, die Produktion gedrosselt wird. Selbst jene, die glauben, in krisensicheren Sektoren tätig zu sein, sollten sich hüten zu frohlocken: Schlägt die Krise massiv durch, geht der Kelch auch an ihnen nicht vorüber. Denn die Bereitschaft und die Möglichkeiten der Banken, Kredite zu vergeben, sinken. Die Bonitätsanforderungen steigen, ebenso die Zinsen für Autos, für Möbel und für vieles mehr. Und Unternehmen, die weniger Gewinn machen, können sich keine nennenswerten Lohn- oder Gehaltssteigerungen leisten. Am allerwenigsten der Staat, der hochverschuldet glücklich sein darf, wenn er zumindest die Zinsen bedienen kann. Und künftige Generationen, die nur sehr wenige dauerhafte Errungenschaften, dafür im Gegenzug eine nicht zu bewältigende Flut von Schulden erben werden, dürfen jene, die dies alles angerichtet haben, mit Fug und Recht der Ungerechtigkeit zeihen.
„Zeit für Gerechtigkeit“, so lautet die Losung des österreichischen Bundeskanzlers angesichts der von der größten Krise seit fast 80 Jahren angerichteten finanziellen, ökonomischen, sozialen und politischen Zerwürfnisse. „Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit“, sekundiert der Vizekanzler und Finanzminister im Kampf gegen das Budgetdefizit, gegen Sozial- und Steuerbetrug. „Zeit für Gerechtigkeit“, „Gerechtigkeit beginnt mit Ehrlichkeit“: große Worte. Denn alle sehnen sich, so scheint es, nach Gerechtigkeit. Aber wissen wir, was Gerechtigkeit bedeutet? Ob Gerechtigkeit ein letztes Ziel darstellt? Gar ob es Gerechtigkeit gibt?
Es gibt keine Gerechtigkeit, zumindest nicht auf Erden.
Dieses Buch beleuchtet den Begriff „Gerechtigkeit“ aus den verschiedensten Blickwinkeln. Dabei stellt sich heraus: Man scheitert, wenn man sich um eine konzise und unumstößliche allgemeingültige Beschreibung dessen bemüht, worauf Gerechtigkeit gründet, worin Gerechtigkeit besteht, wonach Gerechtigkeit zielt. Denn Gerechtigkeit ist ein allzu flüchtiges Wort, ein der scharfen Definition unzugänglicher, ein opaker Begriff. Darum ist dieses Buch im Stil des Feuilletons verfasst. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Es geht nicht systematisch vor. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Manches, das in ihm gesucht wird, mag ungeschrieben bleiben. Manches andere, das man in ihm findet, mag überflüssig scheinen.
Die zentrale Botschaft hingegen, die aus dem im Buch vollzogenen Kreisen um den Begriff „Gerechtigkeit“ in vielfältigster Weise hervordringt, soll gleich hier zu Beginn ohne Umschweife klipp und klar ausgesprochen werden:
Es gibt sie nicht auf Erden: die Gerechtigkeit.
Sehr wohl aber gibt es die Sehnsucht nach ihr. Denn wir alle fühlen: Diese Welt ist nicht das Paradies, von dem wir träumen. Die Menschen werden an den verschiedensten Plätzen geboren: Manche sind vom Glück bevorzugt und wachsen im Überfluss auf. Andere sind vom Schicksal geschlagen, sie kommen in einem von Armut und Drangsal beherrschten Flecken der Erde zur Welt, sie werden, selbst wenn sie bis zu den Grenzen der wohlhabenden Länder gelangen, bürokratisch kalt abgewiesen. In dieser Welt klafft ein Abgrund zwischen Reich und Arm: Manchen ist Fortuna hold und sie werden unversehens, fast ohne Zutun Millionäre. Andere rackern sich zeit ihres Lebens ab und entrinnen doch nicht der Schuldenfalle, in die sie ohne eigenes Versagen geraten sind. In dieser Welt sind wir dem Zufall hilflos ausgeliefert: Manchen ist ein langes sorgenfreies Leben beschieden und sie sterben friedlich und – wie die Bibel sagt – „lebenssatt“ im Kreis ihrer Kinder und Kindeskinder. Andere werden von einer teuflischen Krankheit gepeinigt, die sie bitterem Leid aussetzt, allzu früh dem irdischen Dasein entreißt. In dieser Welt garantiert der Anstand nicht den Erfolg: Manche entdecken gerissen Gesetzeslücken, die ihnen zugute kommen, beanspruchen unverfroren Privilegien, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Andere hoffen auf die Verlässlichkeit und Ehrlichkeit ihrer Partner, werden betrogen und getäuscht, haben nicht die geringste Chance, sich dagegen zu wehren.
Doch selbst wenn man das Träumen vom Paradies auf Erden aufgegeben hat, bleibt die Sehnsucht danach, sich dem Ungemach überall dort zu widersetzen, wo dies nur möglich ist. Unüberhörbar erschallt der Ruf nach Gerechtigkeit.
In den ersten sechs Kapiteln wird beschrieben, wie man versuchte und versucht, der Gerechtigkeit in den verschiedensten Sphären des öffentlichen Lebens zum Durchbruch zu verhelfen. Viele Beispiele, ein Großteil davon aus dem Fundus der Geschichte, begleiten diese Betrachtung. Selbst wenn man bis in die Antike zurückblickt: Bereits damals beherrschte die Sehnsucht nach Gerechtigkeit die Menschen so wie heute. Die Probleme von einst sind so aktuell, so brennend, so widerspenstig wie die gegenwärtigen. Fast alle großen Erzählungen und Schauspiele, mit den „Persern“ des Aischylos beginnend bis hin zu „Les Justes“ („Die Gerechten“) von Albert Camus, erfahren ihre Dramatik im vergeblichen Ringen um Gerechtigkeit. Alle mit großer Geste vorgetragenen politischen Programme, alle mit dem Pathos der Weltverbesserung verbundenen Vorhaben und Maßnahmen der Mächtigen sind – zumindest nach außen hin – vom Ziel geleitet, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wie ehrenwert diese Versuche auch sein mögen: Sie werden immer Stückwerk bleiben.
Es gibt sie nicht auf Erden: die Gerechtigkeit.
Doch dies ist kein Grund zur Resignation.
Denn im vorletzten Kapitel wird gezeigt: Wenn man die Verantwortung des Einzelnen in den Blick nimmt, verankert man die Gerechtigkeit in der Seele und verleiht der Gerechtigkeit eine auf den Einzelnen zugeschnittene, unverwechselbare Kontur. Gerechtigkeit verwandelt sich zur Lauterkeit, zur Redlichkeit, zum Anstand. Im Zuge dieser Verwandlung verliert sie die ihr sonst eigene beklemmende Flüchtigkeit.
Und im letzten Kapitel kommt zur Sprache: Wenn es schon keine Gerechtigkeit auf Erden gibt, mag man auf eine letzte, eine absolute, eine nicht mehr irdische Gerechtigkeit zählen, mit dieser rechnen, auf diese seine Sehnsucht und seine Träume setzen. Doch auch hierbei ist man nicht vor Überraschungen gefeit.
Gerechtigkeit und Gleichheit
… that all men are created equal …
… dass alle Menschen gleich erschaffen sind …
(Aus der Präambel der Unabhängigkeitserklärungder Vereinigten Staaten vom 4. Juli 1776)
Jeder ist davon betroffen, keinem bleibt ein Ausweg offen: Ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, im Tod sind alle gleich.
Im Mittelalter fand diese Erkenntnis im Bild des Totentanzes seinen Ausdruck: Mit dem Sensenmann müssen der Papst und der Kaiser ebenso ihren letzten Walzer drehen wie der Bürger, wie der Bauer, wie der Bettler. Denn mit der Sense wird der hohe Halm genauso geschnitten wie das zarte Gras.
Es gibt Schrullige, die gern auf Friedhöfen lustwandeln. Sie genießen beim Anblick der Tausenden Gräber den Gedanken, dass schließlich eine unabänderliche Gerechtigkeit herrschen wird. Denn wir alle werden vom Tod hingerafft. Mögen die Grüfte noch so prunkvoll, die Hügel noch so kümmerlich sein, im Inneren ereignet sich bei allen das Gleiche: Verwesung und Vergehen.
Für nicht so Kauzige, für unverzagt Lebensbejahende bietet die Vorstellung einer solch morbiden, allein den Verfall in den Blick nehmenden Gerechtigkeit weder Ansporn noch Trost. Gerechtigkeit sollte sich, so hoffen jene, die auf das Leben setzen – und dies tun wir in unseren guten Stunden allzumal –, doch hier und jetzt ereignen. Nur Lebende erstreben Gerechtigkeit. Für die Toten kommt sie zu spät.
Tatsächlich scheint sie ganz am Anfang des Lebens gewahrt: Nicht nur im Tod, auch in der Geburt sind alle gleich. Alle Menschen sind gleich erschaffen. So jedenfalls wollen wir es glauben.
Allein, es stimmt nicht.
Warum Mozart nichts anderes übrigblieb, als Musiker zu werden.
Es stimmte nicht in den alten Zeiten. Damals gab es Privilegien der Geburt. Königskinder, Prinzessinnen und Prinzen kamen auf Rosen gebettet zur Welt. Die Kinder von Leuten niederen Standes, die Kinder der Armen gar, konnten nur in den seltensten Fällen des unerwartet glücklichen Zufalls die Gelegenheit am Schopf packen, ihrem vorgezeichneten Schicksal zu entkommen. Der Kinderreim
Kaiser, König, Edelmann
Bürger, Bauer, Bettelmann
erinnert daran: Der Bürger wird nicht Graf, und der Bauer als Millionär ist nur ein Zaubermärchen. Auch die englische Version dieses Reims
Tinker, tailor
soldier, sailor
rich man, poor man
beggar man, thief
teilt die gleiche Botschaft mit: Ein tinker ist und bleibt für immer ein Kesselflicker, ein tailor für immer ein Schneider, ein soldier für immer ein Soldat, ein sailor für immer ein Seemann. Die zwei Folgezeilen künden schließlich davon, dass dies nicht nur bei diesen Berufen, sondern bei allen Menschen der Fall ist: Der Reiche bleibt reich, der Arme bleibt arm, auch der Bettler, sogar der Dieb ist zu seinem Los verdammt. Die Frage, ob dies gerecht sei, stellte sich nicht. Denn man konnte sich damals nichts anderes vorstellen.
Mozart, den Wolfgang Hildesheimer in seiner epochalen Biographie das wohl größte Genie nannte, das auf Erden wandelte, wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Niemand kann ermessen, ob sein musikalisches Talent je zur Geltung gekommen wäre, hätte er nicht seinen Vater Leopold, Vizekapellmeister im Dienst des Fürsterzbischofs von Salzburg, als Lehrer und Förderer gehabt.
Auch Johann Sebastian Bach entstammt einer weitverzweigten Musikerfamilie, deren bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgbare Vorfahren als Kantoren, Organisten, Stadtpfeifer, Mitglieder von Hofkapellen oder als Clavichord-, Cembalo- und Lautenbauer tätig waren. Vivaldis Vater war wie der Mozarts Violinist, nachdem er seine Laufbahn als Barbier aufgegeben hatte. Und schon der Großvater Beethovens, der ebenfalls Ludwig van Beethoven hieß, war in Bonn kurkölnischer Kapellmeister.
Was hier beispielhaft für die Musik skizziert wurde, galt bis ins 19. Jahrhundert hinein weithin: Man lebte in einer Ständegesellschaft, in abgeschlossenen sozialen Gruppen. Einzelne konnten nicht leicht von Stand zu Stand wechseln, sie wurden in ihr klar vorgezeichnetes Geschick hineingeboren, ob sie es wollten oder nicht. Das Schicksal war bereits mit der Geburt geprägt. Die Talente, die Neigungen, die jemand vielleicht hätte entwickeln können, kamen nicht zum Vorschein, wenn diese im geplanten Lebensentwurf keine Rolle spielten.
So war zum Beispiel Mozart mit großer Sicherheit mathematisch außerordentlich begabt. Er besaß stupende kombinatorische Fähigkeiten. Es sei erwähnt, dass er – und dies eigentlich nur zum Scherz – eine sogenannte Würfelkomposition schuf: Für jeden der 16 Takte eines Walzers schrieb er elf Auswahlmöglichkeiten. Damit, erklärte Mozart, sei es möglich, einen 16-taktigen Walzer zu komponieren, ohne auch nur die geringste Ahnung von Musik oder gar vom Notenlesen zu haben. Man braucht nur zwei Würfel 16-mal zu werfen und dabei immer die Summe der Augenzahlen zu notieren. Die Summe des ersten Wurfes teilt mit, welcher der elf Takte aus seiner Liste für den ersten Takt zu nehmen sei, die Summe des zweiten Wurfes, welcher für den zweiten Takt, und dies so weiter bis zum 16. Takt. Egal wie man kombiniert, immer erhält man einen, wenn auch nicht überwältigend klingenden, so doch angenehm ertönenden Walzer. Zwar hat Mozart einige der 16 × 11 = 176 Takte gleich geschrieben, aber dennoch verbleibt für die daraus zu bildenden Walzer die gigantische Zahl von mehr als einer dreiviertel Billiarde Kombinationsmöglichkeiten. Deshalb darf man sicher sein, dass nach jedem 16-fachen Wurf des Würfelpaars eine völlig neue Walzerkomposition geschaffen wird.
Aber nie in seinem Leben wäre Mozart der Gedanke gekommen, sich eher der Mathematik als der Musik zu widmen. Sein Werdegang als Musiker war ab seiner Geburt vorherbestimmt.
Es sei nebenbei bemerkt, dass derartige Würfelkompositionen in der Barockzeit recht beliebt waren. Johann Philipp Kirnberger hat viele derartige „Würfelspiele“ entwickelt – auch er, wie Mozart mathematisch hochbegabt, stammte aus einer Musikerfamilie und ergriff daher ebenfalls den Beruf des Komponisten und Musiktheoretikers.
Standesgrenzen werden überwunden, und die Schule ist daran schuld.
Bezeichnenderweise war es die Zeit, als nach Friedrich II. in Preußen, nach Maria Theresia im Habsburgerreich, nach der bürgerlichen Revolution von 1789 sowie nach Napoleon in Frankreich die Schulpflicht in Europa weite Verbreitung fand, ab der Kinder nicht mehr unbedingt auf den von ihren Vorfahren ausgetretenen Pfaden wandeln mussten. Auch wurden die Schulen nach und nach dem Klerus aus der Hand genommen, der sie zuvor als Lateinschulen wie ein Monopol geführt hatte – naturgemäß mit dem Ziel, auf diese Weise den geistlichen Nachwuchs zu rekrutieren.
Beispielhaft für diese Umwälzung ist die Geschichte des jungen Carl Friedrich Gauß, das einzige, 1777 in Braunschweig geborene Kind der Eheleute Gerhard Dietrich und Dorothea Gauß. Die Mutter, eine nahezu analphabetische, jedoch in hohem Grad intelligente Tochter eines armen Steinmetzen, arbeitete als Dienstmädchen, bevor sie die zweite Frau von Gerhard Dietrich Gauß wurde. Dieser hatte viele Berufe, war unter anderem Gärtner, Schlachter, Maurer. Wäre Carl Friedrich Gauß um zwei oder drei Generationen früher geboren worden, seine Laufbahn als biederer Handwerker – ausgenommen, man hätte ihn, das hochtalentierte Kind, für einen geistlichen Beruf abwerben können – wäre absehbar gewesen. So aber besuchte er wie alle anderen Kinder aus dem ärmlichen Bezirk von Braunschweig die dortige Volksschule. Sein Lehrer Johann Georg Büttner erkannte, dass er außerordentlich begabt war: In Sekundenschnelle gelang es ihm, keine neun Jahre alt, alle Zahlen zwischen eins und hundert zu addieren. Büttner selbst fühlte sich überfordert, dem Kind noch etwas in Mathematik beizubringen. Er besorgte ein Rechenbuch aus Hamburg, engagierte für Gauß einen Hauslehrer und arrangierte – gegen den Widerstand des Vaters, der sich nicht vorstellen konnte, dass der Bub nicht später in seine Fußstapfen als Handwerksmann treten sollte – ein Stipendium für Gauß ans Martino-Katharineum-Gymnasium. Schließlich sorgte er, nach Fürsprache des Herzogs von Braunschweig, für einen Studienplatz am Collegium Carolinum, dem Vorläufer der heutigen Technischen Universität Braunschweig.
Wäre Büttner nicht ein so engagierter und weitsichtiger Lehrer gewesen, das Talent von Gauß wäre verschüttet geblieben. Wobei anzumerken ist, dass sich Gauß bis zu seinem 19. Lebensjahr nicht sicher war, ob er eher Mathematik oder aber die alten Sprachen und Philosophie studieren solle, denn auch in diesen Disziplinen war er außerordentlich begabt.
Gauß ist gerade zur rechten Zeit zur Welt gekommen. Seit der Aufklärung wurde der einzelne Mensch als autonomes Wesen wahrgenommen. Nicht nur Privilegierte, vom Schicksal auserkorene Herrscher oder ganz wenige, durch ein glückliches Los aus der gesichtslosen Masse Herausragende, sondern jeder einzelne von einer Mutter geborene Mensch darf sich seither als souveräne Person fühlen. Dieser Mensch ist nicht eines unter vielen gesichtslosen Wesen. Nicht seine Sippe bestimmt über ihn. Nicht sein Stand legt sein Schicksal fest. Er ist nicht der bloße Untertan des einen über ihn herrschenden Staates. Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit.
Thomas Jefferson plant einen Staat ohne König.
Die Präambel der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, die von der Unantastbarkeit der Rechte des Einzelnen schwärmt, wurde im Geist ebendieser Aufklärung verfasst. In der etwas altertümlichen Sprache der deutschen Fassung im „Pennsylvanischen Staatsboten“, worin sie zum ersten Mal veröffentlicht wurde, lesen wir die folgenden markanten Sätze:
„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit sind. Dass zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen, die auf solche Grundsätze gegründet, und deren Macht und Gewalt solchergestalt gebildet wird, als ihnen zur Erhaltung ihrer Sicherheit und Glückseligkeit am schicklichsten zu seyn dünket.“
Thomas Jefferson, der große Staatstheoretiker, hatte den Text dieser Präambel maßgeblich gestaltet. Aus ihm spricht die Überzeugung Jeffersons, dass der Schöpfer selbst dafür Sorge getragen habe, alle Menschen mit gleichen Rechten auszustatten. Dabei ist das Wort vom Schöpfer eher als eine in der damaligen Zeit gängige Redewendung zu verstehen denn als Ausdruck religiösen Glaubens. Die Väter der Unabhängigkeitserklärung hätten ihre Präambel auch ohne Bezug zu einem Schöpfer formulieren können. Denn worauf es ihnen ankam, war die auf den britischen Philosophen John Locke zurückreichende Überzeugung: Allen Menschen stehen von Natur aus unantastbare Rechte zu.
Die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika konnten es aufgrund des von ihnen vertretenen Standpunkts nicht zulassen, dass ein Monarch über sie herrschen sollte. Denn die Kinder einer Herrscherdynastie hätten kraft ihrer Herkunft höhere Rechte als andere Menschenkinder. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass alle Menschen von Natur aus gleich zur Welt kommen. Darum beschlossen sie, als Staatsoberhaupt einen Präsidenten für eine bestimmte Amtszeit wählen zu lassen. Und niemand sollte vom Zugang zu diesem Amt ausgeschlossen sein.
Dieser Entschluss war derart unkonventionell, dass sofort die Frage auftauchte, wie angesichts der überall sonst üblichen Monarchien, angesichts der mit Titeln überhäuften Majestäten, der im neu gegründeten amerikanischen Staat als einfacher Mensch aus dem Volk gewählte Präsident anzusprechen sei. Im ersten Kongress im Frühjahr und Sommer 1789 votierten Vizepräsident John Adams sowie eine Mehrheit der Senatoren für die Einführung von formellen Anreden wie zum Beispiel „His Highness the President of the United States of America, and Protector of their Liberties“, also für einen regelrechten Hoheitstitel. Die Mehrheit des Repräsentantenhauses weigerte sich jedoch aus guten Gründen, jegliche Titel einzuführen, weil sie nämlich von der von Natur aus bestehenden Gleichheit aller Menschen überzeugt war. Deshalb stellt bis heute das einfache „Mister President“ die einzig korrekte Anrede dar.
Man kann zwar argumentieren, dass auch die katholische Kirche keine Erblichkeit der hohen Ämter, vor allem des Amtes des Nachfolgers Petri, kennt. Prinzipiell kann jeder gläubige männliche – männlich muss er immer noch sein! – Katholik zum Papst gewählt werden. Aber als solcher ist er – ganz im Unterschied zum Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten – Monarch und wird nicht mehr als ein Mensch unter Gleichen betrachtet. Denn es geziemt sich, vor ihm in die Knie zu sinken, den Ring an seinem Finger zu küssen und ihn mit „Eure Heiligkeit“ anzusprechen.
Deshalb stellt tatsächlich die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika das erste und entscheidende Ereignis dar, das die Botschaft der von Natur aus gegebenen Ebenbürtigkeit aller Menschen, die unbesehen ihres Standes mit gleichen Rechten ausgestattet sind, eindrucksvoll dokumentiert.
Alte Standesdünkel vergehen – neue entstehen.
Nun darf man aber nicht glauben, die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika stünde mit der Entwicklung des Schulsystems in Europa, insbesondere mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht, in direktem Zusammenhang. Maria Theresia hatte zum Beispiel ein völlig anderes, ein viel profaneres Motiv als jenes, ihren Untertanen die ihnen von Natur aus gebührenden Rechte der freien, nur nach ihren Eignungen und Neigungen ausgerichteten Persönlichkeitsentwicklung zu gönnen. Sie sah im Krieg mit Preußen um das ihr entrissene schlesische Erbe ihre Soldaten die Schlachten verlieren. Auf die Frage, woran das liege, gaben die Berater zur Antwort: Die preußischen Soldaten können im Allgemeinen alle lesen, Befehle lassen sich schriftlich erteilen. Die österreichischen Soldaten sind zu einem Großteil des Lesens unkundig, Befehle müssen mündlich weitergegeben werden und erleiden auf diese Weise sehr oft das übliche Schicksal einer Botschaft bei der Stillen Post. Also, entschied die Monarchin, müsse man allen das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen.
Und hatte bei der Einrichtung der Schulen sogleich mit dem Widerstand der Eltern zu kämpfen. Denn die Eltern, zumeist Bauern oder Handwerker, brauchten die Kinder zur Arbeit im Familienbetrieb. Nach alter österreichischer Tradition kam es zu einem Kompromiss: am Vormittag Schule, und am Nachmittag können die Kinder arbeiten. Auch die zwei Monate Sommerferien wurden nicht als Entlastung vom Schulalltag zugestanden, sondern weil in dieser Zeit alle Kräfte bei der Ernte benötigt wurden. Schule bedeutete damals wirklich das, was im griechischen Wort scholé zum Ausdruck kommt: Befreiung von der Arbeit, nämlich von der aufgezwungenen Arbeit, der Fron im Kampf ums tägliche Brot.
Auch rang man sich nur langsam zur Einsicht durch, dass Schulen mehr leisten können, als mit den Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens ausgestattete folgsame und fleißige Untergebene zu erziehen, die sich in die seit Jahrhunderten übernommene politische, gesellschaftliche und ökonomische Ordnung bereitwillig einfügen. Vor allem in den deutschsprachigen Ländern entwickelte sich mit der Zeit eine bahnbrechende Idee: Bildung – ein Wort, das es bezeichnenderweise im Englischen oder Französischen so nicht gibt, sondern mit Begriffen wie literacy oder éducation umschrieben wird – schafft die Möglichkeit, die Ungleichheit zwischen den Menschen, je nachdem in welchem Milieu sie geboren sind, zu mildern. Eine Ungleichheit, die es von Natur aus gar nicht geben dürfte, die folglich nicht gerecht ist.
Wir haben uns seither so sehr daran gewöhnt, dass uns der Gegensatz zu früheren Zeiten eigenartig fremd geworden ist. Es waren Zeiten, in denen zwischen der Gesellschaft der Adeligen – und selbst unter diesen gab es ein strenges Kastensystem – und jener der Bürgerlichen und „Gemeinen“ eine unüberbrückbare Kluft bestand. Tatsächlich beschäftigt der hohe Adel – wenn man diese Menschen nicht um ihrer selbst, sondern nur ihrer Herkunft wegen interessant findet – heute bestenfalls noch die Regenbogenpresse. Mein Freund Georg Prinz zu Fürstenberg deutete einmal in einer Rede an, allein die Last, einen großen Namen zu tragen, sei ihm geblieben. Allein die ihm anerzogene Verantwortung seinen Vorfahren gegenüber, aber gewiss und zu Recht keine Privilegien. Heutzutage würde man es für skurril, wenn nicht gar für abwegig erachten, behauptete jemand, er sei einfach deshalb ein „besserer“ Mensch, weil „blaues“ Blut in seinen Adern fließe. Unterschiede der Herkunft wurden in der Tat eingeebnet.
Allerdings bildete sich, parallel zum Verschwinden der Privilegien des Adels und des hohen Klerus, eine neue Gesellschaftsschicht. Sobald man der Bildung einen hohen Stellenwert einräumte, entstand, vornehmlich in den deutschsprachigen Ländern, das Bildungsbürgertum: eine einflussreiche Kaste, bestehend aus Professoren und Lehrern, aus Apothekern und Ärzten, aus Rechtsanwälten und Richtern, aus Künstlern und Ingenieuren, aus leitenden Beamten und weltgewandten Kaufleuten. Diesen Menschen gemeinsam war die Idee, sich nicht aufgrund eines geburtsständischen Anrechts, sondern aufgrund eigener geistiger Leistungen von den nicht zu ihnen Gehörenden zu unterscheiden, eine Elite zu bilden.
Somit wiederholte sich das Spiel. In dem Buch „Das wilhelminische Bildungsbürgertum“, herausgegeben von Klaus Vondung, wird ausführlich dargelegt, wie sich durch die gemeinsam beschrittenen Bildungswege die Schicht der Bildungsbürger von anderen sozialen Gruppen abzuheben trachtet. Es entstand gleichsam eine Art neuer Aristokratie, die sich durch eine ihr eigene Arroganz auszeichnete, sich als „kulturelle Elite“ empfand, peinlich darauf achtete, die eigenen Nachkommen ja nicht aus der Kaste ausbrechen zu lassen, die wichtigen politischen Positionen zu besetzen oder zumindest auf deren Inhaber Einfluss zu nehmen.
Alle Menschen sind gleich geschaffen, und die das verkünden, sind privilegiert.
In Frankreich entsprach der „Citoyen“, jener Begriff, mit dem man im Gefolge der Französischen Revolution von 1789, nachdem alle Adelstitel verworfen waren, einander ansprach, dem deutschen Bildungsbürger. Im Gegensatz zum Bourgeois, dem allein auf sein eigenes Wohlergehen und sein Vermögen bedachten Menschen, ist das Idealbild des Citoyen dadurch gekennzeichnet, dass dieser als gebildeter Mensch der Tradition und dem Geist der Aufklärung und der ab 1789 verkündeten Parole von der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit verpflichtet ist. Der Citoyen nimmt am Gemeinwesen teil, gestaltet dieses mit und übernimmt zugleich Verantwortung auch für all jene, die ungebildet geblieben sind und daher dieser Führung bedürfen.
Signifikant davon abweichend, aber ebenfalls die alten Standesgrenzen negierend, bildete sich im zaristischen Russland an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert immer deutlicher die sogenannte „Intelligentsia“ heraus. Der russische Journalist Pjotr Dimitrijewitsch Boborykin beschrieb sie als gesellschaftliche Schicht von Menschen, die „klug, verständnisvoll, wissend, denkend und auf professionellem Niveau kreativ beschäftigt sind und zur Entwicklung und Verbreitung von Kultur beitragen“. Nicht so freundlich, eher abschätzig, beurteilt Richard Pipes
in seinem Monumentalwerk über die Russische Revolution die Intelligentsia: „Der Begriff wurde nie exakt definiert, und in der vorrevolutionären Literatur wurde immer wieder darum gestritten, was er bedeutete und auf wen er sich bezog. Obgleich tatsächlich die Mehrzahl derer, die in Russland als intelligenty bezeichnet wurden, über eine höhere Bildung verfügte, war Bildung an sich noch kein Kriterium: So gehörte ein Geschäftsmann oder ein Bürokrat mit akademischem Abschluss nicht der Intelligentsia an, der Erstere, weil er für seinen eigenen, und der Letztere, weil er für den Nutzen des Zaren arbeitete. Es gehörten nur jene dazu, die dem Gemeinwohl verpflichtet waren, selbst wenn sie nur halbgebildete Arbeiter oder Bauern waren. In der Praxis waren damit die hommes de lettres – Journalisten, Akademiker, Schriftsteller – und die Berufsrevolutionäre gemeint. Wer dazugehören wollte, musste zudem bestimmten philosophischen Anschauungen über den Menschen und die Gesellschaft anhängen.“
Und an anderer Stelle beschreibt Richard Pipes diesen Eckpfeiler, auf dem die Intelligentsia fußt: „Eine Ideologie, die auf der Überzeugung beruht, dass der Mensch nicht ein besonderes, mit einer unsterblichen Seele ausgestattetes Geschöpf ist, sondern eine stoffliche Masse, die ausschließlich durch ihre Umwelt geformt wird. Aus dieser Prämisse folgt, dass es durch eine Neuordnung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Umwelt des Menschen anhand ,rationaler‘ Rezepte möglich ist, eine neue Gattung vollkommen rationaler Menschenwesen zu produzieren. Diese Überzeugung erhebt die Intellektuellen als die Träger der Rationalität in den Stand von Sozialtechnikern und rechtfertigt ihren Ehrgeiz, die herrschende Elite von ihrem Platz zu verdrängen.“
Damit werden die Ideale eines Thomas Jefferson weit überzogen, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt. Forderte die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unverzichtbare Rechte der Einzelperson, verlangen die Ideologen der Intelligentsia Verfahren zur Bildung eines gleichsam auf dem Zeichenbrett konstruierten „neuen Menschen“. Statt des Rechts, sein persönliches Glück zu erstreben, „The Pursuit of Happyness“, wird dem Menschen aufgrund „rational“ genannter Maßnahmen ein vorgegebener Lebensentwurf von außen aufgedrängt. Wer sich dagegen wehrt, versündigt sich gegen das zum Fortschritt strebende Gesetz der Geschichte. Doch das Wesentlichste ist, dass die schließlich allein mit Berufsrevolutionären bestückte Intelligentsia die Zügel für den Lauf der Geschichte in der Hand hält. Folgerichtig entstand nach der Machtübernahme der Berufsrevolutionäre die alle übrigen sozialen Schichten übermächtig beherrschende Kaste der Nomenklatura.
Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit – hehre Ideale?
Allerdings belegen die geschichtlichen Beispiele keineswegs, dass die Einführung von Schulen und die möglichst breite Vermittlung von Bildung nicht nur die alten Standesgrenzen zum Verschwinden bringen, sondern unbedingt neue privilegierte Gruppen entstehen lassen. Man muss, so lautet jedenfalls die Theorie, für Chancengerechtigkeit beim Zugang zur Bildung sorgen. Es gelte daher, das Elite-Denken zum Verschwinden zu bringen; ein Elite-Denken, das zum Beispiel in den deutschsprachigen Ländern aus der Tradition des Bildungsbürgertums kommt. Dies scheint umso mehr gerechtfertigt, als ebendieses Bildungsbürgertum schmählich versagte, als sich die Hitlerei 1933 Deutschlands und 1938 Österreichs unter dem Jubel und der Begeisterung auch einer Unzahl von Bildungsbürgern bemächtigte.
Eine Erkenntnis, die sich in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts Bahn brach. Zuvor waren die Menschen von den Zerstörungen und Verwerfungen der Nazizeit wie in Agonie versetzt gewesen. Danach hatten sie mit Wiederaufbau und Wirtschaftswunder eine Ausflucht vor der Konfrontation mit den damaligen Geschehnissen gefunden. Doch im Gefolge der sogenannten Achtundsechziger-Bewegung verlangte die nachfolgende Generation mit energischer Bestimmtheit, soziale Strukturen umzustülpen. Jedenfalls jene traditionellen, die ein Unrechtsregime nicht verhindern hatten können: Warum war der Ausritt in die Barbarei möglich gewesen? Das Bildungsbürgertum hatte augenscheinlich versagt. Schulen, so die Forderung, dürfen nicht mehr bevorzugte Klassen schaffen, die ohnehin vor dem politischen Debakel nicht gefeit sind. In den Schulen hat Chancengleichheit zu herrschen. Oder, praktisch im gleichen Sinne proklamiert: Chancengerechtigkeit.
Dieser Ruf tönt bis in die jüngste Gegenwart: „Bildung für alle“, fordern Studentinnen und Studenten, die den freien Hochschulzugang gewahrt wissen wollen, den sie in den Siebzigerjahren errungen haben. „Bildung für alle“ bedeutet zugleich, dass die Idee des Gymnasiums, der Bildungsstätte künftiger Eliten, der Idee der Gesamtschule oder der gemeinsamen Schule der Zehn- bis Vierzehnjährigen oder der Neuen Mittelschule zu weichen hat – wie immer man diese Lehr- und Bildungsstätten nennen möchte. Jedenfalls sollen sie Kindern aus allen Bevölkerungsschichten, unabhängig von deren Herkunft, aber auch von deren Vorbildung, offenstehen. „Durchmischte Klassen wecken Neugier“, argumentiert die österreichische Bildungsexpertin Christa Koenne: „Homogene Klassen sind für Lehrer natürlich einfacher. Als ich als Schülerin begonnen habe, konnte niemand lesen und schreiben. Aber alle konnten Deutsch. In heutigen ersten Klassen gibt es welche, die können lesen und schreiben, andere können nicht einmal Deutsch. Die Heterogenität ist größer geworden. Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Wir leben in einem globalen Dorf, da müssen wir uns auch mit dem anderen beschäftigen. Und es ist gut, wenn das im Bildungsprozess schon passiert.“ Und sie warnt davor, auf einem differenzierten Schulsystem zu beharren, bei dem eine Selektion – allein das Wort ist von der Geschichte belastet – der Zehnjährigen in die mindere Hauptschule und in das karriereversprechende Gymnasium stattfindet: „Meine allergrößte Sorge ist im urbanen Bereich, dass wir jene jungen Menschen, die in der Schule keine Erfolge haben, verlieren und dass diese ihre Identitäten dann in ihren Peergroups suchen. Dort geht es um Rituale, die ich unserer Gesellschaft nicht wünschen will.“
Wie man mit Spieltheorie ein paradoxes Verhalten verstehen lernt.
Das Eigenartige: Diesen vernünftig klingenden Argumenten wird nicht geglaubt. Ursula Weidenfeld, deutsche Wirtschaftsjournalistin und leitende Redakteurin des „Tagesspiegel“, weiß, warum: „Für das eigene Kind nur das Beste. Nach diesem Leitsatz wünschen sich Eltern den schönsten Kindergarten, die beste Schule und die solideste Berufsausbildung für ihr Kind. Nach Lage der Dinge ist das für die Schulzeit das Gymnasium. Es ist nicht weiter erstaunlich, dass bildungsbürgerliche Eltern schulpflichtiger Kinder die erbittertsten Gegner von Schulreformen und die wärmsten Fürsprecher für ein differenziertes Bildungssystem sind. Erstaunlich ist aber, dass sich diese Haltung über alle politischen Präferenzen hinweg findet. So formulieren in Hamburg und Berlin linksbürgerliche Eltern gemeinsam mit eingefleischten Konservativen den lautesten Protest gegen die Gemeinschaftsschule und zu wenig Plätze am Gymnasium. Wenn die Kinder das Abitur gemacht und die Schule verlassen haben, sieht die Sache schnell anders aus.
Dann lassen sich die ehemaligen Schülereltern gern einmal herab, die Gemeinschaftsschule zu loben und einen längeren gemeinsamen Unterricht für alle Kinder zu verlangen. Zum Wohl aller Kinder, wie sie dann betonen. Denn inzwischen zeigen viele Studien, dass ein möglichst langjähriger gemeinsamer Unterricht nicht schaden muss.“
Spieltheoretisch gesehen ist diese auf den ersten Blick unaufrichtig empfundene Haltung nur allzu verständlich: Will man für seine Kinder den größten Nutzen erreichen – oder das, was man für den größten Nutzen hält –, hat man nicht nur dafür zu sorgen, dass die eigenen Kinder in jenem Schultyp erzogen werden, der diesen maximalen Nutzen verspricht. Man wird auch daran interessiert sein, das Umfeld so umzugestalten, dass dieser für die eigenen Kinder erzielte Vorteil für die Allgemeinheit verschwindet. Man mag diese Haltung für ungerecht halten, sie unredlich zu nennen, wäre jedoch übertrieben. Denn wer will leugnen, dass jedem das Ziel vorschwebt, ja sogar vorschweben muss, für die eigenen Kinder nur das Beste zu wollen?