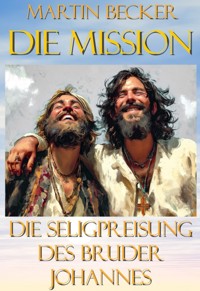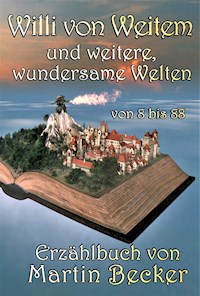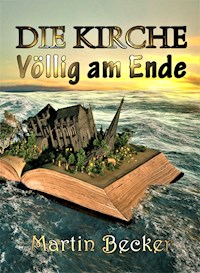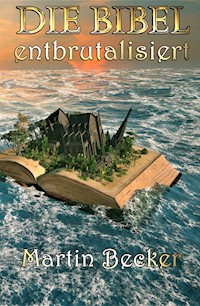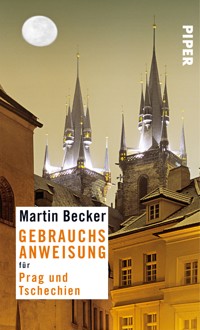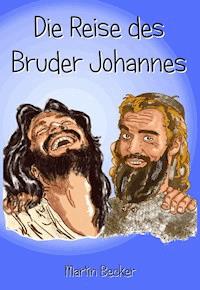Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Prag 1913. Kisch und der Weltenbrand An einem gleißend hellen Frühlingsmorgen im Jahr 1913 steht der Fluss in Flammen. Ein herrenloses Schiff treibt brennend über die Moldau und versetzt die Stadt in Sorge. Auch Egon Erwin Kisch betrachtet das Spektakel auf dem Wasser – und geht zum Fußball. Doch das Feuer auf der Moldau hat einen Mann unter Deck das Leben gekostet. Es handelt sich um einen jungen belgischen Diplomaten. Rasend schnell verbreitet sich in Prag das Gerücht, es könne sich um einen geplanten Mord handeln, der Tote sei ein Spion – nur für wen hat er spioniert? Und wer hatte ein Interesse daran, ihn umzubringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
kanon verlag
ISBN 978-3-98568-151-8
1. Auflage 2025
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2025
Belziger Straße 35, 10823 Berlin
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining
im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung und Buchbezug: zero-media.net, München
Unter Verwendung eines Motivs von ©FinPic®, München
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
INHALT
ERSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZWEITER TEIL
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
DRITTER TEIL
42
43
44
45
46
47
48
Martin Becker / Tabea Soergel Nachwort Der Weltenbrand, ein Solokarpfen und die Kraft der Fiktion
Danksagung
Martin Becker / Tabea Soergel
Die Feuer von Prag
ERSTER TEIL
1
Die Stadt kannte keine Dunkelheit. Zumindest nicht an diesem Abend, der viel zu kalt war für einen Maisamstag. Auch Prag spürte die Sonnenstürme des Jahres 1913. Es wurde einfach nicht mehr warm. Und die Menschen feierten wie zum Trotz. Überall in der Stadt hatten sie kleine Feuer entzündet: auf dem Laurenziberg, neben dem Veitsdom, im Paradiesgarten. Es gab Geburtstagsfeste, Pfingstfeiern, Gelage unter freiem Himmel. Es wurde getrunken, getanzt und gesungen.
Für eine Weile stand Egon Erwin Kisch allein auf dem Deck des Dampfschiffs und rauchte eine Zigarette. Er hörte dem ausgelassenen Treiben der Stadt zu und unterdrückte ein Gähnen. Gerade war er am Staatsbahnhof aus dem Zug gesprungen, nachdem er wochenlang den Balkan bereist hatte, um über den Krieg dort zu berichten. Vom Bahnhof aus war er zum Bärenhaus in der Melantrichgasse geeilt, hatte seiner Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Wange gedrückt und ihr nicht ohne Stolz die Abendausgabe der bohemia überreicht, wo er in den letzten Wochen über seine Abenteuer in Montenegro geschrieben hatte. Über Maulesel, die im harten Kalkboden nach Gras suchten, über Prager Soldaten, die in Zelten hausten und ausgezehrt waren vom Heimweh, über sein Mitleid mit den montenegrinischen Straßenhunden inmitten des Krieges. Seine Artikel gehörten zu den wenigen in der bohemia, die namentlich gezeichnet waren.
»Willst du dich denn gar nicht ausruhen, mein Junge«, hatte seine Mutter gefragt.
Kisch hatte den Kopf geschüttelt, sich gewaschen und umgekleidet, dann war er zum Ufer der Moldau aufgebrochen. Das größte Fest des Frühjahrs wartete auf ihn.
Das Deck des Dampfschiffs füllte sich nach und nach mit Gästen. Kisch blickte in die anbrechende Nacht über der Moldau und auf die Prager Burg. Er war gerührt. Wieder hatte er Prag verlassen müssen, um zu spüren, wie sehr er an seiner Geburtsstadt hing. Und obwohl er gerade erst von seiner langen Reise zurückgekehrt war, schmeckte alles nach Abschied. Er wusste genau, dass er nicht einmal mehr den ganzen Sommer hier verbringen würde, bevor …
»Sieh an, der Herr ist zurück von der Front!«
Kisch erkannte die warme, freundliche Stimme sogleich. Er drehte sich um. Neckisch verbeugte sich sein Freund Brod vor ihm, etwas zu tief für eine aufrichtige Ehrerbietung. »Für einen Feingeist wie Sie«, erwiderte Kisch, »dürfte der Schützengraben jedenfalls zu viel des Dramas bedeuten.«
Brod schmunzelte. »Jetzt erzähl schon, wie war es?«
»Später«, sagte Kisch. »Lass uns zuerst ein Glas nehmen. Gleich kommt der Oberst. Über dieses Stück hier kannst du deine nächste Theaterkritik schreiben.«
Während sich Brod auf die Suche nach Wein machte, blieb Kisch an seinem Platz und zündete sich eine Zigarette an. Sie konnten verschiedener kaum sein, dachte er: Er selbst arbeitete als Kriminalreporter und neuerdings als Kriegsberichterstatter für die Tageszeitung bohemia und scheute bei seinen Recherchen kein Risiko. Brod hingegen schrieb gerade an einem Buch über die Schönheit hässlicher Bilder in der Kunst. Hässliche Bilder, dachte Kisch, davon hättest du in Dalmatien genug sehen können. Er tastete nach dem Browning in der Innentasche seines Mantels. Dem Revolver für den Notfall. Er hatte ihn während seiner Reise an der Front auch nachts nie abgelegt und trug ihn noch, um sich das Gefühl der Verwegenheit für diesen Abend zu bewahren.
Wer in der Stadt Rang und Namen hatte, kam zum Pfingstfest auf den Dampfer. Ärzte, Offiziere, Fabrikanten, hohe Beamte und Direktoren, selbst Diplomaten, als schmückendes Beiwerk des Abends natürlich auch Schauspieler und Künstler; und zu guter Letzt Leute wie Kisch und Brod, die über das rauschende Fest auf dem Fluss schreiben würden. Der Gastgeber wusste, wie er die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, nach der er sich so sehnte.
Brod kehrte zurück, reichte Kisch ein Glas, und sie stießen an.
»Lustige Mädels?«, fragte Kisch.
»Nicht mal unlustige«, sagte Brod.
»Wollen wir doch mal abwarten, wen der Oberst noch anschleppt«, sagte Kisch.
»Ach, der Oberst«, wiederholte Brod zweideutig.
Dann drehten sie sich zum Moldauufer um, tranken von ihrem Wein und beobachteten die Ankunft der Gäste. Kisch wusste um ihren Glanz, ihre Leistungen im Militär oder in der Medizin, um ihren grenzenlosen Stolz, der sie bei gesellschaftlichen Anlässen wie diesem umgab wie eine Aureole. Aber er wusste auch genau, was sie im Schimmer solcher Nächte zu verbergen suchten: ihre schmutzigen Geheimnisse. Jeder von ihnen verfügte über mindestens eines. Und Kisch kannte sie alle. Er machte gar keine Anstalten, den gesammelten Klatsch für sich zu behalten.
»Pass auf«, sagte er zu Brod und wies auf den Wagen am Ufer, aus dem umständlich ein Herr stieg, »da kommt unser Staatskundler Professor Benesch. Schau genau hin, seine Frau ist ihm immer einen Schritt voraus. Ein Wunder, dass sie ihm nicht gleich davonläuft, wenn man bedenkt, dass er schon dem zweiten Hausmädchen in Folge ein Kind angehängt hat.«
Brod gluckste. Der nächste Wagen hielt, und ein gedrungener Mann stieg aus.
»Der bedauernswerte Doktor Molek«, sagte Kisch. »Er müsste in seiner Dejwitzer Praxis zehn Männern am Tag alle Zähne ziehen, um seiner allabendlich wachsenden Spielschulden Herr zu werden.«
So hielt ein Automobil nach dem anderen, und Kisch breitete mit großer Lust sein exklusives Wissen über die Verfehlungen der feinen Prager Gesellschaft aus.
Dann begann das Spektakel, auf das alle warteten. Trommelschläge erklangen, die Marschkapelle spielte auf. Die Festgesellschaft sammelte sich auf dem Deck des Dampfschiffs und blickte erwartungsvoll zum Ufer. Der Oberst kündigte sich an.
»Jetzt kommt der Kaiser von Prag«, flüsterte Brod, und Kisch lachte laut auf.
Natürlich war der Gastgeber des Abends nicht der tatsächliche Kaiser. Die österreichisch-ungarische Monarchie verglühte nach und nach wie ein Stern, und einer seiner eifrigsten Diener bemühte sich darum, selbst umso mehr zu strahlen: Oberst Alfred Redl, seit dem vergangenen Jahr Generalstabschef des viii. Armeekorps in Prag, ein ehrgeiziger Geheimdienstler, mit allen Wassern gewaschen, so diszipliniert wie vergnügungssüchtig, so kalt wie eitel. Selbst für Kisch war der Oberst in weiten Teilen ein Rätsel, noch jedenfalls. Bei Tage, das wusste Kisch, leuchtete Redls flammend rotes Automobil wie ein Fanal, und selbst jetzt, bei Nacht, verfehlte es seine Wirkung nicht. Ein Raunen ging durch die Menge der Wartenden. Dann folgte ein weiterer Wagen mit Redls Entourage. Es kam in der Tat dem Auftritt einer Majestät gleich. Zur Militärmusik der Kapelle entstieg zunächst Redls Begleitung, drei junge Männer, dem Oberst stets zu Diensten. Dann erschien Redl selbst aus dem Inneren des für ihn eigens nach seinem Geschmack ausgestatteten Automobils mit roten Ledersitzen, ließ seinen Blick über die Menge der Gäste schweifen und hob die Hand, woraufhin Applaus aufbrandete.
Kisch schüttelte den Kopf. »Es ist tatsächlich wie auf dem Theater«, sagte er, »fürchterlich.« Er knuffte seinem Freund Brod in die Seite, der selbstvergessen ebenfalls applaudiert hatte und nun verlegen seine Hände in den Manteltaschen vergrub.
»Woher stammt nur dieser Reichtum?«, fragte Brod.
Kisch zuckte mit den Schultern. »Die Geschäfte rollen vor ihm her. Und er ist gefährlich. Auch aus Angst lässt sich Geld machen.«
»Du dramatisierst mal wieder«, erwiderte Brod.
»Du täuschst dich«, raunte Kisch. »Redl geht über Leichen. Wenn jemand in seinen Augen der Spionage verdächtig ist, dann ist sein Schicksal besiegelt. Dann ist er ein toter Mann.«
»Du dramatisierst«, wiederholte Brod.
Redl genoss das Bad in der Menge. Er schüttelte Hände, tätschelte Schultern, nahm mit gespielter Bescheidenheit Lob für das Fest und seinen Auftritt zur Kenntnis. Nicht wenige der geladenen Gäste, wusste Kisch, fieberten dem weiteren Verlauf des Abends entgegen. Wenn der Oberst einlud, so raunte man einander zu, uferten die Zusammenkünfte in dionysischen Orgien aus, über die am nächsten Tag niemand ein Wort verlor.
Schließlich erreichte Redl bei seiner Begrüßungsrunde auch Brod und Kisch, die sich an den äußersten Rand des Decks zurückgezogen hatten und mittlerweile beim dritten Glas Wein angelangt waren. Der Oberst begrüßte Brod, den er offenkundig nicht kannte, mit einem knappen Nicken und wandte sich dann Kisch zu. Er schüttelte ihm lange die Hand und sah ihm dabei direkt in die Augen.
»Herr Spezialberichterstatter Kisch, es ist mir eine Ehre«, sagte Redl. Sein Lächeln war so mechanisch wie sein Blick, Kisch erkannte keine Freude darin. Er würde später noch erschaudern, wenn er an diese Begegnung mit Redl dachte, doch er hielt dem Blick des Obersten stand und erwiderte: »Sie sind bestens informiert, Herr Generalstabschef. Die Ehre ist ganz meinerseits.«
Einen Moment starrten sie einander an, als handle es sich nicht um eine Begrüßung, sondern um ein Duell. Dann ließ Redl Kischs Hand los und schlug ihm kurz und wuchtig auf die Schulter. »Genug der Höflichkeiten«, sagte er, »nun wird gefeiert.«
Als hätte die ganze Festgesellschaft Redls Worte vernommen, begann die Marschkapelle erneut zu spielen, leicht und belebt, und schon wiegten sich die ersten Gäste im Takt. Ein Glas später hatte auch Kisch seine Müdigkeit vergessen und tanzte, während der Browning mit jeder Drehung gegen seinen Körper schlug.
In den folgenden Stunden war Kisch ganz in seinem Element. Er schäkerte mit jungen Frauen, er gab Heldengeschichten vom Balkan zum Besten, in denen er mehr noch als in seinen Zeitungsartikeln von der Front übertrieb, er beteiligte sich an einem Wettrauchen mit mehreren Offiziersanwärtern. Als ärgster Konkurrent erwies sich ein junger Diplomat aus Belgien, aber auch ihn rauchte Kisch in Grund und Boden und gewann unter dem Johlen der Menge, die einen Halbkreis um sie gebildet hatte und sie anfeuerte, eine ganze Schachtel Gauloises.
Man hätte meinen können, dass der Kriminalreporter der bohemia immer betrunkener, ausgelassener und enthemmter wurde, doch das stimmte nicht. Kisch allein wusste, und hielt es sogar vor seinem Freund Brod geheim, dass es nicht die kleinen Exzesse der Festgesellschaft waren, die ihn in dieser Nacht an die Moldau gelockt hatten. Er ließ Redl nicht aus den Augen, verfolgte genau, mit wem der Oberst sprach und wie sich seine Miene dabei veränderte. Alfred Redl, so hatte Kisch gerüchteweise auch von Prager Militärangehörigen auf dem Balkan erfahren, werde erpresst. Weshalb und von wem, das wollte Kisch bald herausfinden.
Nach Mitternacht loderte dann der Himmel auf. Ein fulminantes Feuerwerk erleuchtete die Moldau, und selbst Redls Gesichtszüge wurden ganz weich, während er zusah. Nach dem letzten Raketenschuss, bevor die Kapelle erneut aufspielte, trat für einige Sekunden eine erschöpfte Stille auf dem Moldaudampfer ein. Auch Kisch wurde plötzlich von bleischwerer Müdigkeit heimgesucht. Er wollte, er musste nach Hause, denn am nächsten Morgen wartete ein anderer Wettkampf auf ihn, den er zu gewinnen gedachte: ein Fußballspiel seiner Mannschaft dbc Sturm Prag. Das über Wochen aufgestaute Schlafbedürfnis brach sich jetzt Bahn, Kisch fühlte sich nicht einmal mehr in der Lage, den Fußweg zum Bärenhaus zu bewältigen. Er drängte sich an den Feiernden vorbei und entdeckte Brod, der in ein Gespräch mit einer jungen Frau vertieft war und sich zerstreut umdrehte, als Kisch ihm im Vorbeigehen auf die Schulter schlug. Unter Deck fand Kisch eine unverschlossene Tür, die zu einer kleinen Kabine führte, der Garderobe der Bediensteten. Kisch zögerte nicht lang, zog die Tür hinter sich zu und ging in die Hocke. Nur kurz ausruhen, dachte er, zündete sich eine Zigarette an und war schon nach dem ersten Zug mit der brennenden Sport in der Hand eingeschlafen.
2
Oberst Alfred Redl betrat schwerfällig den Salon seines Domizils. Nach dem Feuerwerk hatte er noch mit seinen bedeutendsten Gästen angestoßen und den Tanz auf dem Schiff beobachtet, dann entschuldigte er sich wegen dringender Dienstangelegenheiten und kehrte mit seiner Entourage ins Hauptquartier des viii. k.u.k. Korpskommandos zurück, worin sich auch seine Wohnung befand. Er nahm die Kappe ab, rieb sich Augen und Wangen und gähnte. Der wenige Schlaf der letzten Wochen machte sich bemerkbar. Nicht mehr als zwei oder drei Stunden ruhte Redl in jeder Nacht, dann widmete er sich wieder seinen Geschäften.
Der Feind arbeitete dem Kaiserreich unentwegt entgegen, Redl wusste das. Und der Kaiser wusste es erst recht. Es gab einen Spion in den eigenen Reihen, der halb Europa mit den geheimen Kriegsplänen der Monarchie versorgen könnte. Der Thronfolger Franz Ferdinand hatte Redl deshalb damit beauftragt, diesen Spion dingfest zu machen. Dies war einer der Gründe, weshalb Redl das Fest auf der Moldau überhaupt veranstaltet hatte. Möglicherweise, so hatte er es ins Evidenzbureau nach Wien übermitteln lassen, würde der Spion auf dem Dampfschiff auftauchen, um weiter an seinem Netz zu spinnen, vielleicht würde er sich im Laufe des Abends selbst in den klebrigen Fäden verheddern, wenn Redl etwas nachhalf.
Die Vorhänge des Salons waren geschlossen, eine funzelige Lampe ließ die Schatten in jedem Winkel noch dunkler wirken. Redl setzte sich an den Kopf der schweren Tafel aus Ulmenholz. Sogleich betrat einer seiner Diener den Salon und brachte ihm seinen Hund, dem Redl das warme Köpfchen küsste.
Dann folgte Leutnant István von Bebek. Ein junger blasser Mann mit rötlichem Haar, Redls rechte Hand, sein treuester Untergebener, der ihm schon bei seinen militärischen Stationen in Galizien, Russland und im Kriegsministerium in Wien zur Seite gestanden hatte. Unter dem Arm trug der Leutnant einen Schwung Akten. Er breitete Papiere und Photographien vor Redl aus, sortierte die Dokumente, trat dann einige Schritte zurück und salutierte. »Herr Oberst, melde gehorsamst: Bereit zum Rapport.«
»Setz dich, István«, sagte Redl in väterlichem Ton. »Glaubst du, das Fest hat allen gefallen?«
»Da sich die Gäste zur Stunde noch immer dort amüsieren, macht es jedenfalls diesen Eindruck«, erwiderte der Leutnant.
»Beginnen wir unverzüglich«, sagte Redl, »die letzten Tage haben mir ein wenig zugesetzt.«
»Zu Befehl«, erwiderte Bebek, und Redl lächelte ihm ob dieser Förmlichkeit zu, während er gedankenverloren den Hund auf seinem Schoß streichelte.
»De Smet hat sich unauffällig gegeben«, sagte der Leutnant. »Seine Gespräche waren ausschließlich oberflächlicher Natur, keine Anbahnungen, nichts. Seit unserem Aufbruch wurde er nicht mehr gesehen. Er wird ins Hotel zurückgekehrt sein.«
Redl seufzte. »Wann zeigt dieser belgische Schweinehund endlich, was er will?«
»Den von ihm begehrten Goldzahn hat er ja nun erhalten«, sagte Bebek.
Redl lachte. »Sonstige Auffälligkeiten?«
»Nun ja«, sagte Bebek, »dieser Kriminalreporter ist eine perturbation.«
»Auch ein Schweinehund«, sagte Redl und schüttelte den Kopf. »Was haben wir über ihn?«
Leutnant Bebek griff nach einigen Dokumenten, Photographien und Abschriften, und schob sie Redl zu: Zeitungsartikel, Kopien von Zeugnissen und Beurteilungen, dazu Bilder von Kisch in verschiedenen Alltagssituationen. Am Schreibtisch in der Redaktion der bohemia. Zusammen mit Freunden vor einem Ausflugslokal. Jubelnd auf dem Fußballplatz. Im Gespräch mit einem kleinen Mädchen am Ufer der Moldau. Aber auch: Kisch betrunken inmitten von einigen jungen Frauen im Hinterzimmer eines verrufenen Lokals. Beim Betreten eines vom Krieg verheerten Hauses in Dalmatien. Im Zwiegespräch mit Polizisten während einer nächtlichen Kontrolle.
»Kennt weder Regeln noch Gesetze, ist unberechenbar«, sagte Bebek. »Gilt als zäh, unnachgiebig und schwer einzuschüchtern.«
»Ich sage es ja, ein Schweinehund. Ist er käuflich, István?«
»In begrenztem Maße durchaus. Geld beeindruckt ihn nicht. Schmeichelei, Ruhm und Ehre dagegen schon.«
»Was weiß er über unsere Schwierigkeiten?«
»Nicht genug.«
»Haben wir etwas gegen ihn in der Hand?«
»Nicht viel. Er verheimlicht, dass er bald Prag verlassen und nach Berlin gehen wird. Seine Stellung in der Redaktion wird sein jüngerer Bruder Paul Kisch übernehmen.«
»Warum hält er das geheim?«
»Er fürchtet um die Loyalität seiner Freunde, nach bisherigen Erkenntnissen seine größte Schwachstelle. Er würde vieles opfern, wenn sein engster Kreis in Gefahr geriete.«
»Das ist doch besser als nichts«, sagte Redl. »Wir sollten ihn uns vom Leib halten, um jeden Preis.«
»Was schlagen Sie vor, Herr Oberst?«
»Wenn wir uns seiner entledigen wollen, dann müssen wir ihn für uns gewinnen. Wir werden unsere Verführungskunst anwenden: Umgarnen, Betören, Unterwerfen. Dann wird er Kostproben unserer Gewalt erhalten, bis er freiwillig sämtliche Manöver unterlässt.«
Leutnant Bebek lächelte und sagte mehr zu sich selbst: »Sie sind ein Monster, Herr Oberst.«
Redl betrachtete die Photographien von Kisch und las aufmerksam einige der Dokumente. »Ich werde die Angelegenheit selbst übernehmen«, sagte er. »Dieser Kisch wird wieder in Erscheinung treten, und das eher früher als später. Du bereitest eine Operation für diesen Fall vor.«
»Zu Befehl«, sagte Bebek und sammelte die vor Redl ausgebreiteten Dokumente ein.
»Wir müssen«, sagte Redl, »mit aller Macht gegen die Feinde der Donaumonarchie vorgehen. Sie zersetzen uns von innen. Wenn wir untergehen, geht auch der Kaiser unter, István.«
Leutnant Bebek nickte. »Dagegen werde ich ankämpfen, solange ich lebe«, sagte er.
»Und jetzt lass uns einen Schlaftrunk nehmen. Cognac oder Likör?«
»Cognac.«
Redl klingelte, drückte dem Diener den Hund in den Arm und bestellte die Getränke. Danach saßen er und Bebek schweigend da. Redl hatte die Augen geschlossen. Von außen wirkte es so, als sei er eingenickt, doch innerlich war er in großer Unruhe. Die Gefahr war einstweilen gebannt. Anfang Mai hatte man den Balkankrieg mit einem Waffenstillstand beendet, aber die Truppen waren immer noch in Dalmatien. Der Frieden genügte dem Thronfolger in Wien nicht, er strebte nach territorialer Ausweitung, um sich und dem behäbig gewordenen Reich, das er bald erben würde, neue Bedeutung zu verleihen. Redl kannte sämtliche Aufmarschpläne, Kriegsvorbereitungen und strategischen Überlegungen. Kein Zweifel, der große, unerbittliche Krieg würde kommen. Die Frage war nur: wann? Und wie gut würde die Armee vorbereitet sein?
Redl knöpfte seinen Waffenrock auf, lehnte sich zurück und sah Leutnant von Bebek an. »István«, sagte er, »wir sollten nicht weiter grübeln, sondern uns bald ausruhen.«
Dann hörten sie eilige Schritte. Ohne ein Klopfen wurden die Flügeltüren des Salons aufgerissen, und mehrere Wachsoldaten drängten hinein.
Redl erhob sich, ging auf einen der Männer zu und blieb dicht vor ihm stehen. »Was fällt Ihnen ein?«, sagte er mit schneidender Stimme. »Melden Sie sich gefälligst ordentlich an, ehe Sie meine Privatgemächer betreten!«
»Melde gehorsamst, Herr Oberst«, rief der junge Mann, während er angestrengt Redls Blick auswich, »eine Katastrophe ist passiert. Franz Josef steht in Flammen.«
Redl verstand einen quälenden Moment lang nicht, was das heißen sollte. War etwa der Kaiser gestorben?
3
Während es nun allmählich zu dämmern begann, wärmten sich die Unbehausten an den verlassenen Glutnestern unter freiem Himmel. Die Stunde des ersten Lichts teilten sie alle miteinander; die einen, die noch nicht schliefen, weil sie die Nacht zum Tag gemacht hatten, und die anderen, die nicht mehr schliefen, da ihr Tagwerk schon im Morgengrauen begann, die Prag in Gang hielten, damit es niemals erlösche.
Jana stand am Fenster und beobachtete, wie die Prager Burg am Horizont langsam aus der Dunkelheit ins Licht trat. Obwohl sie schon seit zwei Jahren als Haushälterin in der großzügigen Wohnung an der Moldau wohnte, konnte sie sich an diesem Ausblick nicht sattsehen. Jeden Morgen war es für sie das gleiche Wunder. Nach wenigen Minuten riss sie sich davon los, um das Frühstück für ihre Herrschaften vorzubereiten. Sonntags gab sie sich besonders große Mühe. Sie schnitt Gurken und Paprika in mundgerechte Stücke, streute die wenigen Beeren, die sie auf dem Wochenmarkt hatte auftreiben können, in eine Schüssel, briet Omeletts, kochte Kaffee und Tee, holte den Gugelhupf aus dem Ofen und stellte ihn zum Ausdampfen aufs Fensterbrett, richtete eine Platte mit kaltem Rindsbraten an.
Ihre Tochter kam in die Küche gerannt und zupfte Jana aufgeregt an der Schürze. »Maminko, hoří!«
»To je nesmysl«, sagte Jana, »da ist kein Feuer, das ist nur die Sonne. Jetzt trag den Kuchen in den Salon. Und sei leise, Herr und Frau Brodesser schlafen noch.«
Sie goss Rahm in einen Rührbecher. Marie war zwar erst zweieinhalb Jahre alt, aber an bestimmte Regeln konnte man sich gar nicht früh genug gewöhnen. Als die Tortenplatte mit einem kleinen metallischen Scheppern abgestellt und ein Stück über die Tischplatte geschoben wurde, nickte Jana kurz und stellte den Quirl an, doch ehe der Rahm steif geschlagen war, hörte sie Marie wieder rufen. Ihre Stimme war noch lauter als der Quirl. »Feuer!«, schrie sie, diesmal auf Deutsch und aus voller Lunge.
Verärgert schaltete Jana den Quirl ab, legte ihn auf ein Geschirrtuch neben dem Rührbecher mit dem Rahm, der sich später in keinen guten Schlagobers mehr verwandeln lassen würde, und ging nach nebenan, um ihre Tochter zum Schweigen zu bringen.
Marie hatte ihre Stirn ans Salonfenster gepresst, was ihr strengstens verboten war, und starrte hinaus.
»Marie«, zischte Jana, und ihre Tochter wandte sich um. Den Ausdruck, der auf ihrem Gesicht lag, hatte Jana noch nie an ihr gesehen: eine Mischung aus Entsetzen und Faszination. Marie presste ihren Zeigefinger ans Fenster, dann drehte sie sich wieder um. »Feuer«, sagte sie. In diesem Moment sah Jana es auch. Das Kind hatte recht: Die Moldau stand in Flammen.
Jana fuhr zusammen, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürte. Lenka stand schlaftrunken bei ihr und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, das noch ganz rosig war von der Wärme des Betts. Jana blickte sich schnell nach Marie um. Das Kind war ganz im Bann der Szene vor dem Fenster. Jana griff nach Lenkas Hand und drückte sie, dann vergrub sie beide Hände in den Schürzentaschen.
»Was geht da vor sich?«, fragte Lenka.
»Feuer«, sagte Marie andächtig.
»Wir dachten, der ganze Fluss brennt«, sagte Jana, »aber es ist nur ein Schiff.«
Lenka trat ebenfalls ans Fenster und blickte hinaus. Ein Dampfer trieb lodernd über die Moldau. Am Ufer sammelten sich bereits Schaulustige.
»Ist das nicht …«, sagte Lenka. Sie interessierte sich nicht sonderlich für Schiffe, doch dieses kam ihr bekannt vor. Eine Begleiterscheinung einer Wohnung mit Flussblick. Das Schaufelrad des Dampfers drehte sich langsam, während es Flammen schlug. In seiner Mitte konnte man noch die kaiserliche Krone erkennen.
»Das ist doch …«, sagte sie.
»Das ist doch Feuer«, sagte Marie.
Lenka musste lachen. »Das ist Feuer, da gebe ich dir recht.«
Am Ufer war die Feuerwehr vorgefahren. Lenka holte den Feldstecher aus ihrem Arbeitszimmer und beobachtete vom Balkon aus, wie der Kommandant der Altstädter Feuerwehr Anweisungen erteilte, seine Männer Schläuche entrollten und mehrere von ihnen auf ein kleines Ruderboot stiegen.
»Guten Morgen, Herr Brodesser«, hörte sie Jana hinter sich im Zimmer sagen. Lenka ließ den Feldstecher sinken. Marie, die mit ihr auf den Balkon hinausgehuscht war, griff danach.
Brodesser stand unschlüssig an seinem Sessel. Er war frisch rasiert und sonntäglich gekleidet, statt Krawatte trug er eine dunkle Seidenschleife um den Hals. Wie jeden Morgen freute und wunderte sich Lenka darüber, dass sie gemeinsam mit diesem freundlichen, adretten Mann in dieser Wohnung lebte, die keine Ähnlichkeit mit den Wohnungen ihrer Eltern hatte. Nirgends Goldbordüren, Samtvorhänge oder dunkle Ölgemälde, keine Porzellanfiguren auf Beistelltischchen, zum Glück auch keine Beistelltischchen. Nicht mehr Teppiche als unbedingt nötig. Über dem Esstisch hing eine schlichte Lampe aus Messing mit Milchglasschirm anstelle eines Kristalllüsters. Alles hier hatte eine Funktion, nichts diente nur der Dekoration. Selbst der Papagei, den ihr Nennonkel Bertel ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte, war in Wahrheit ein Krug. Er stand nun mit frischem Wasser gefüllt vor Brodesser auf dem Frühstückstisch.
»Es feuert«, rief Marie. Sie stand leicht schwankend im Wind, der von der Moldau heraufwehte.
»Es brennt«, korrigierte Brodesser sie lächelnd. Er stutzte. »Es brennt?«
Jana, die anscheinend jetzt erst bemerkt hatte, dass sich ihre Tochter ohne Mantel auf dem Balkon verkühlte, griff nach Maries Arm und zog sie zurück in den Salon.
»Kaiser Franz Josef treibt brennend über die Moldau«, sagte Lenka.
Sie sahen von oben dabei zu, wie die Menschen aus dem Weg sprangen, als der glänzende Motorwagen der Prager Kriminalpolizei am Moldauufer vorfuhr. Der Chauffeur öffnete die beiden hinteren Wagenschläge. Die Männer, die ausstiegen, ihre Hosenbeine ausschüttelten und mit verschränkten Armen an die Uferböschung traten, kannte Lenka nicht. Sie reichte Brodesser das Fernglas. »Wer ist das?«
»Dr. Öllinger und Dr. Sklenička«, sagte er nach ein paar Sekunden. »Wenn die beiden ausrücken, muss es eine große Sache sein. Ach, und da ist ja auch unser Fritz.«
Er gab ihr das Fernglas zurück. Unverkennbar Fritz. Er lehnte am Geländer, die Schiebermütze in den Händen, und schien die Menschenmenge abzusuchen, vielleicht wartete er auf jemanden. Hinter ihm erhob sich der verkohlte Schornstein des Kaiser Franz Josef in den Himmel, der mittlerweile ans Ufer geschleppt und vertäut worden war.
»Ich gehe rasch zu ihm nach unten«, sagte Lenka.
»Hat das nicht auch Zeit bis nach dem Frühstück?«, fragte Jana. »Es wäre schade, wenn die ganze Mühe umsonst gewesen wäre.«
In Momenten wie diesem war sich Lenka nicht sicher, ob sie und Jana als Angestellte und Vorgesetzte oder als Freundinnen miteinander sprachen. Seitdem František fort war, in Žižkow niemand mehr auf Jana und Marie wartete und sie auch an den Wochenenden hier bei Lenka und Brodesser waren, fühlte es sich für Lenka einerseits wie ein einziger ausgedehnter Urlaubstag an, andererseits umtänzelten sie und Jana einander zuweilen noch mehr als früher. Und auch Marie wurde älter und verstand immer besser, was sie sah und hörte.
»Natürlich«, sagte Lenka, »wir müssen alle etwas essen. Ich werde später nach Fritz schauen. Sollte er dann schon fort sein, weiß ich ja, wo ich ihn finde.«
Fritz hatte als Botenjunge in der bohemia angefangen. Als Lenka dort vor drei Jahren die ersten Handschriftenanalysen verfasst hatte, war er noch ein Kind gewesen. Inzwischen war er Redaktionsdiener und erledigte »Spezialaufträge« für Kisch, wie der es nannte. Es war beeindruckend, wie viele Assistenten Kisch in der Redaktion hatte. Ihm war ein eigener Redakteur zur Seite gestellt worden, um seine Artikel gegenzulesen und ihn zu überreden, die größten Übertreibungen noch einmal abzumildern. Die Leute liebten Kischs Texte gerade wegen dieser Übertreibungen, doch manchmal brauchte er einen Bremser. Dieser Bremser war Brodesser.
Sie setzten sich und aßen nur einen Bruchteil dessen, was Jana aufgetischt hatte, Lenka aus Ungeduld und Zerstreutheit, Marie, weil sie, anstatt zu essen, lieber mit den Beeren spielen und dabei vor sich hinsummen wollte, und Brodesser, weil nach zwei Bissen, die er von seinem Kuchenstück genommen hatte, das Telephon im Wohnungsflur klingelte und Jana ihn holte.
»Die Redaktion, Herr Brodesser.«
Brodesser war der Vertreter von Glauser, der wiederum der Vertreter von Katzenbach war, dem Chefredakteur. Offenbar war an diesem Pfingstsonntag der unwahrscheinliche Fall eingetreten, dass man sich seiner erinnerte.
Lenka hielt Jana am Handgelenk fest, als sie schon wieder auf dem Weg aus dem Salon hinaus war. »Setz dich doch für einen Moment zu uns«, sagte sie.
Jana blieb abrupt stehen und blickte auf Lenka hinab. Dann schrillte in der Küche die Eieruhr.
»Gleich«, sagte Jana.
Die Omeletts, die sie am Morgen zubereitet hatte, waren kalt geworden, und sie hatte darauf bestanden, stattdessen wenigstens gekochte Eier zu servieren. Jana glaubte an stärkende, tröstliche Lebensmittel, und da Lenka kein Fleisch aß, waren Eier der Kompromiss. Man merkte, dass Jana in ihrer Kindheit oft Hunger gelitten hatte. Auch die kalten Omeletts würde sie nicht wegwerfen, sondern später gewiss selbst essen. Da Jana auch an den Sonntag als kleinen Festtag glaubte, ließ es sich nicht verhindern, dass jede sonntägliche Mahlzeit zu einem Festmahl geriet.
Jana stellte den Eierwärmer auf den Tisch und sank auf den Sessel neben Lenka. Sie betrachtete Marie, die an einem Stück Gurke herumknabberte. Das Einzige, was dieses Kind seit dem Frühjahr essen mochte, falls man dies so nennen wollte, waren Gurken.
»Sitz gerade«, sagte Jana auf Tschechisch zu ihr und dann auf Deutsch zu Lenka: »Verwöhnen wir sie zu sehr?«
»Sie ist doch noch so klein«, sagte Lenka. »Und sie vermisst ihren Vater.«
Sie steckte sich eine Erdbeere in den Mund, die so sauer war, dass sie das Gesicht verzog.
»Sie vermisst ihn wirklich«, sagte Jana, und Lenka spürte einen Stich wie von einer Nähnadel, die man in diesem Moment durch den festen Stoff ihrer Bluse schob. Unwillkürlich fasste sie sich an die Brust und betrachtete anschließend ihre Handfläche. Kein Blut. »Die Erdbeeren taugen nichts«, sagte sie.
Jana nickte, erhob sich und schenkte ihr Kaffee nach, selbst nahm sie noch immer keinen.
»Es ist auch Tee da«, sagte Lenka.
Jana lachte auf. »Ich weiß«, sagte sie.
Brodesser kam im Mantel in den Salon zurück.
»Ich muss leider gehen«, sagte er. »Die Redaktion braucht mich.« Der zweite Satz klang eher ungläubig als entschuldigend.
»Das Feuer?«, fragte Lenka.
Marie ließ das Stück Gurke fallen, das sie über ihren Teller hatte hüpfen lassen wie einen kleinen blassen Frosch, und fixierte Brodesser.
»Ich soll direkt nach unten gehen und alles aufschreiben. Auf dem Dampfer«, sagte er und zögerte kurz, »hat gestern ein großes Fest stattgefunden.«
Lenka hatte das Gefühl, dass er eigentlich etwas anderes hatte sagen wollen. Er lächelte Marie zu.
»Richtig, ich habe davon gelesen«, sagte Lenka. »Dieses Pfingstfest, nicht wahr?«
»Und nun hat man nach dem Löschen noch etwas auf dem Dampfer gefunden«, sagte er. Er räusperte sich etwas zu lang. »Etwas Unerwartetes.«
Lenka erstarrte. Sie wusste, was er meinte. Auf dem Schiff lag ein Toter.
»Warum schicken sie nicht Kisch? Das ist doch sein Beritt.«
»Sie erreichen ihn schon den ganzen Vormittag nicht. Seine Mutter hat gesagt, er sei gestern Abend nur kurz nach Hause gekommen, um sich umzukleiden, und dann sei er wieder ausgegangen. Heute habe sie ihn noch nicht gesehen.«
Lenka rieb sich die Stirn. Es sähe Kisch ähnlich, wenn auch er auf dem großen Fest gewesen wäre. Sie war in der Nacht vom Feuerwerk über dem Fluss aufgewacht. Vielleicht war einer der Feuerwerkskörper auf das Schiff gestürzt, hatte dort unbemerkt über mehrere Stunden vor sich hingeglommen und war schließlich von einem Windstoß wieder angefacht worden? Vielleicht hatte Kisch heimlich auf dem Dampfer übernachtet, um dieses Detail in einem Artikel zu verwenden – Meine Nacht auf dem Kaiser. Wie ich Pfingsten mit den Vornehmsten des Reichs verschlafen habe? Diese Überschrift hätte Brodesser ihm natürlich niemals durchgehen lassen. Vielleicht war Kisch mit einer seiner verdammten Zigaretten eingeschlafen und so betrunken gewesen, dass er das Feuer erst bemerkt hatte, als es schon zu spät war?
»Wahrscheinlich liegt er in dieser Minute im Batignolles unter dem Tisch«, sagte sie. Sie versuchte, sich ihre Beklommenheit nicht anmerken zu lassen.
Jana beugte sich zu ihr herüber und strich ihr über den Rücken. »Er wird schon wieder auftauchen«, sagte sie leise.
Lenka schloss die Augen, damit Marie ihre Angst nicht sah. »Warte kurz«, sagte sie dann zu Brodesser. »Ich hole meinen Mantel und den Photoapparat.«
4
Das Feuer war noch größer, als er es sich ausgemalt hatte. Nachdem die ersten Menschen aus den umliegenden Häusern am Franzens-Kai zusammengelaufen waren, hatte er sein Versteck am Wehr verlassen und zugesehen, wie das Schiff aufglühte, als wäre es ein großes Werkstück, wie es barst und splitterte und zerfiel. Das Schaufelrad drehte sich langsam, während die Flammen daran fraßen und ihm Gesicht und Hals wärmten. Als der Löschzug der Altstädter Feuerwehr am Kai hielt, ging er davon, als sei er gerade aus einem Traum erwacht.
Im Franz-Josefs-Bahnhof herrschte Feiertagsbetrieb. Die Reisenden waren fremd und in guter Stimmung und blickten unternehmungslustig umher. Einem schoss er ein Steinchen an den Schuh, und als der Mann sich umsah, rempelte er ihn wie zufällig an und zog ihm blitzschnell die Geldbörse aus dem Jackett. Ein anderer suchte für ihn minutenlang auf dem Pfingstfahrplan nach dem Schnellzug nach Tabor, konnte ihn aber nicht finden. Als sie sich voneinander trennten, steckte unter seinem Hemd ein Geldbündel, das dort vorher nicht gewesen war. Er ging davon, als sei es nicht seine eigene Hand gewesen, die in die fremde Hosentasche geglitten war, und wiederholte stumm drei Dinge: Schiff, Geld, Lebertran. Sein Dienstgeber hatte nur nach dem brennenden Schiff verlangt, aber er wusste, dass er auch eine Flasche Lebertran benötigte, und um eine Flasche Lebertran zu kaufen, brauchte er Geld. Er lächelte. Sein Dienstgeber konnte froh sein, einen solch fähigen Dienstnehmer wie ihn zu haben.
Vor dem Bahnhof war ein Junge mit einem Fahrrad. Der Junge stieß die Kette des Fahrrads mit der Schuhspitze an, hob das Hinterrad an und versuchte, mit einem Fußtritt die Pedalen zu bewegen, doch sie standen still.
»Du hast Glück«, sagte er zum Jungen, »ich bin nämlich Mechaniker. Die Kette liegt nicht richtig auf dem Zahnrad, schau.«
Der Junge schaute und nickte.
»Ich kann sie eben für dich richten«, sagte er.
»Du wirst dir die Hände schmutzig machen«, sagte der Junge. Er klang wie ein Tscheche.
»Wenn du mir dein Taschentuch leihst, sind wir quitt und ledig«, sagte er.
Er bückte sich, schob mit einem geübten Griff die Kette zurecht und wischte sich die Hände am blütenweißen Taschentuch ab.
»Wenn du mir dein Fahrrad anvertraust«, sagte er, »dann drehe ich zur Probe noch eine kleine Runde damit. So machen wir Mechaniker das.«
Der Junge nickte überrascht und dankbar.
Er schob das Rad des Jungen auf die Fahrbahn, trat in die Pedalen und drehte eine kleine Runde.
»Es lässt sich gut an«, sagte er, als er wieder zum Stehen kam, und der Junge streckte die Hand nach dem Lenker aus, um ihm das Fahrrad abzunehmen. Er drückte ihm stattdessen das schmutzige Taschentuch in die Hand.
»Da hast du dein Tüchlein zurück«, sagte er. »Zur Sicherheit muss ich noch eine kleine Runde mit deinem Fahrrad drehen, das siehst du doch ein?«
Er schwang sich auf den Sattel. Der Junge blickte ihm nach. Als endgültig feststand, dass er nicht mehr umkehren würde, rief der Junge etwas, aber er war schon zu weit entfernt, um es zu verstehen. Er fuhr die Parkgasse hinab und bog in die Karlsgasse ein, und dann wehte er wie der Wind durch den Paradiesgarten. Aus der Tiefe tauchten drei Bilder auf. Ein brennendes Schiff. Eine Hand in einer fremden Jacketttasche. Eine Flasche Lebertran.
Er trat in die Pedalen und lachte, als habe er mit sich selbst nichts zu tun.
5
Während der Brandgeruch noch in den Gassen der Altstadt hing und sich ganz Prag fragte, wer beim Schiffsfeuer auf der Moldau ums Leben gekommen war, schoss Kisch ein Tor. Er stand als linker Außenstürmer auf dem Fußballplatz und jubelte. Eins zu null für dbc Sturm Prag. Die Morgensonne blendete die Spieler auf dem Platz in Holleschowitz, und Kisch war in seinem Element. Seine Mannschaft war bei diesem Derby in blendender Form. Ihr Gegner war der fc Deutsche Sportbrüder Prag, aber offenkundig hatten deren Spieler die Pfingstfeierlichkeiten des Vorabends schlechter verkraftet.
Nach nur fünf Minuten stand Kisch völlig frei vor dem Tor, der Goalmann der Sportbrüder konnte gegen seinen Schuss nichts ausrichten. Natürlich träumte Kisch davon, sich wie als Reporter auch auf dem Fußballplatz einen Namen zu machen. Seinem Kollegen Johann Schwarz war das gelungen. Vor ein paar Jahren hatten Kisch und er sich noch die Bälle im Sturm zugespielt, dann war Hans als Torjäger bis in die österreichische Nationalmannschaft aufgestiegen. Kisch dachte beim Jubel an Hans, denn ausgerechnet er, einer der besten Stürmer Böhmens, schoss gerade keine Tore mehr. In Wien hatten sie seinen Verein wegen »Züchtung des Berufssports« verurteilt und Hans für den Rest der Saison gesperrt. Und so sehr Kisch seinen alten Mannschaftskameraden Hans auch schätzte: Fußball war in seinen Augen nun wirklich keine Arbeit. Obwohl Kisch den Sport mindestens so sehr liebte wie seinen Beruf bei der Zeitung. Gerade weil die englische Krankheit in seiner Jugend so verschrien gewesen, weil er von den Lehrern in der Schule bestraft worden war, hatte sich Kisch dem Spiel umso inniger hingegeben. Er kannte schon als Junge den gesamten Wortschatz, der damals gerade erst nach Europa und damit auch nach Prag gelangt war: Outline, Halfback, Endback, Goal.
Die Sportbrüder hatten den Angriffen von dbc Sturm Prag wenig entgegenzusetzen. Zur Halbzeit stand es drei zu null für Kischs Mannschaft. Aber dann erwachten die Sportbrüder aus ihrer Trägheit und schossen kurz vor Ende des Derbys binnen fünf Minuten unter dem Raunen der Zuschauer drei Tore. Der letzte Angriff lief, und Kisch rannte wie von Sinnen los. Er ignorierte das Stechen in seiner Lunge. Unter den Anfeuerungen des Publikums gelang ihm ein übermächtiger, haarscharfer und gut gefälschter Stoß. Goal!
Den Pfiff des Schiedsrichters nahm Kisch gar nicht mehr wahr, er hüpfte und jubelte und umarmte am Spielfeldrand den erstbesten Zuschauer.
»Kisch, du lebst«, sagte der Mann.
»Und ob!«, rief Kisch. »Wir haben gewonnen!«
Erst jetzt erkannte er den unerwarteten Gast, den er noch nie bei einem Fußballspiel des dbc Sturm Prag gesehen hatte, obwohl er nicht müde wurde, ihn Mal ums Mal einzuladen. Es war sein Redakteurskollege und Freund Heinrich Brodesser. Gleich war sein Jubel vergessen. Wenn Brodesser hier auftauchte, dann war etwas geschehen.
Brodesser betrachtete etwas ratlos seinen von Kischs stürmischer Umarmung zerknitterten und mit Schweiß benetzten Sonntagsanzug. »Ich bin froh, dich zu sehen. Wir hatten schon befürchtet, dir sei etwas zugestoßen«, sagte er.
»Brodesser, wie soll mir denn etwas zustoßen?«, antwortete Kisch, und Brodesser lächelte gequält. »Ihr habt doch gewusst, dass ich aus Montenegro zurückkehren und heute auf dem Fußballplatz stehen würde.«
»Ja«, sagte Brodesser, »wir haben aber auch geahnt, dass du dich dazwischen auf dem Fest von Oberst Redl verlustieren würdest.«
»Ich habe mich nicht verlustiert«, sagte Kisch, »ich habe Nachforschungen betrieben.« Brodesser blickte sich um. »Jean-Jacques-Baptiste De Smet«, fragte er dann leise, »bist du ihm begegnet?«
»Wer soll das sein?«
»Ein belgischer Diplomat.«
»Ach ja«, rief Kisch, »der war auch auf dem Fest. Ich habe ihn im Wettrauchen besiegt.«
»Sein Leichnam ist heute Morgen unter Deck gefunden worden«, sagte Brodesser noch leiser als zuvor.
Jetzt sah Kisch sich verstohlen um. »Wie ist er zu Tode gekommen?«
»Es hat ein Feuer gegeben«, sagte Brodesser, »deshalb waren wir ja in Sorge um dich. Und jetzt solltest du dich rasch umkleiden. Lenka erwartet uns am Pathologischen Institut.«
Kisch bereute nur kurz, dass die Mannschaft ihr Siegesbier ohne ihn trinken würde. Es würden noch genug Gelegenheiten dazukommen. War er Minuten zuvor noch dem entscheidenden Tor nachgejagt, war er nun hinter einer großen Geschichte her. Immerhin hatte er dafür etwas mehr Zeit als üblich, am Pfingstmontag erschien die bohemia nicht, und er konnte in Ruhe ermitteln.
In der Nacht zuvor hatte sich Kisch auf dem Dampfschiff an der Glut seiner Zigarette die Fingerkuppe verbrannt. Davon war er aufgewacht, ohne Abschied zum Bärenhaus zurückgewankt und in tiefen Schlaf gefallen. Die Haushälterin hatte ihn geweckt, und Kisch hatte ohne Frühstück das Haus verlassen, um rechtzeitig zum Spielbeginn den Fußballplatz zu erreichen. Auch ihm war der starke Brandgeruch aufgefallen, der nicht nur auf die Öfen in diesem kalten Frühling zurückzuführen sein konnte, doch entgegen seiner sonstigen Gewohnheit hatte er beim Überqueren der Moldaubrücke nicht auf den Fluss geachtet.
Brodesser lotste Kisch zur wartenden Autodroschke. Noch immer freute sich Kisch über jede einzelne Fahrt. Es war ein Luxus, in dessen Genuss er längst nicht jeden Tag kam. Der Chauffeur des böhmischen Laurin & Klement GDV, einem Modell, das mittlerweile zumeist wohlhabende Fahrgäste nicht nur durch Prag, sondern auch durch Budapest und Sankt Petersburg kutschierte, sprang von seinem Sitz und öffnete ihnen den Wagenschlag. Während der Fahrer der Witterung ausgesetzt war, saßen die Passagiere warm und sicher in der Droschkenkabine. Und nicht nur sie waren zuverlässig geschützt, sondern auch die Worte, die sie wechselten. Kaum hatte das Automobil die ersten Meter zurückgelegt, brachte Brodesser Kisch auf den neuesten Stand.
»Janas Tochter hat das brennende Schiff vor uns entdeckt, vom Salonfenster aus. Von dort aus hatte man einen ausgezeichneten Blick aufs Geschehen. Die Feuerwehr ist bald am Unglücksort gewesen. Noch während der Löscharbeiten sind Öllinger und seine kriminalpolizeiliche Gefolgschaft aufgetaucht, und unmittelbar danach ist ein Automobil des Armeekorps vorgefahren. Das Schiff ist teilweise verdeckt gewesen, sodass der Abtransport des Leichnams den Blicken der Schaulustigen entzogen war. Ach ja, wir haben Fritz am Ufer gesehen, vielleicht hat er andere Beobachtungen gemacht als wir. Du solltest ihn befragen.«
»Woher weißt du«, fragte Kisch, »dass es sich beim Toten um De Smet handelt?«
Brodesser errötete. »Nachdem Lenka und ich uns unter die Schaulustigen am Ufer gemischt hatten, habe ich mich geschäftig gegeben und das Gespräch zweier Wachleute belauscht. Sie haben sich über den Toten unterhalten, als wäre ich gar nicht da.«
»Aus dir wird noch etwas«, sagte Kisch und stieß Brodesser in die Seite. Die Autodroschke fuhr auf die Hlávka-Brücke, die erste Prager Brücke aus Beton. Sie war im letzten Jahr eröffnet worden. Brodesser betrachtete interessiert die Baustelle auf der Hetzinsel. Dort entstand ein Wasserkraftwerk, das nach seiner Fertigstellung an ein französisches Schlösschen erinnern sollte. Auch Kisch hing seinen Gedanken nach, während sie die Moldau überquerten. Er freute sich darauf, Lenka nach der langen Zeit wiederzusehen. Und er war, was er niemals zugegeben hätte, bewegt gewesen von Brodessers Auftauchen am Spielfeldrand. Sie hatten sich wirklich Sorgen um ihn gemacht.
Lenka, Brodesser und er waren seit drei Jahren Freunde, nein, mehr als das: Verbündete. Er zählte sie zu seiner Familie, und sie, davon war er überzeugt, empfanden ebenso. Lenka hatte im Jahr 1910 ihr Medizinstudium in Berlin abgebrochen und war nach Prag zurückgekehrt, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. Sie hatte dazu ihr Allerwertvollstes in Berlin zurücklassen müssen, ihre große Liebe, ein, wie Kisch fand, äußerst borniertes Mädchen namens Claire. Schon in ihrer ersten Nacht in Prag waren Lenka und Kisch aufeinander getroffen. Er hatte ihr eine Stellung bei der bohemia verschafft und sie mit seinem Kollegen Brodesser bekannt gemacht. Diese Verbindung war segensreich für alle geworden. Lenka hatte kein Interesse an Männern, Brodessers Leidenschaft gehörte ausschließlich den Büchern. Lenka und Brodesser hatten beschlossen, zu heiraten und auf diese Weise für immer Ruhe zu haben: vor ihren Eltern, vor neugierigen Nachbarn und Vorgesetzten, vor dem Gesetz. Während dieser Teil ihrer Verbindung ins Private gehörte und es sogar Kisch gelang, nicht davon zu sprechen, prahlte er, wo er nur konnte, mit dem öffentlichen Ruhm, den ihnen ihre Freundschaft beschert hatte. Gemeinsam hatten Lenka, Brodesser und er im Frühsommer 1910 ihr Leben riskiert und eine Mordserie aufgeklärt, die sich als Verschwörung deutschnationaler Extremisten herausgestellt hatte. Ihr gemeinsamer Artikel hatte Kisch als Reporter endgültig berühmt gemacht und Lenka und Brodesser unerschütterliche Positionen in der bohemia-Redaktion gesichert. Zufrieden war Kisch dennoch nicht: In Prag war er zwar im zarten Alter von 28 Jahren bereits eine Legende, doch der Rest Europas hatte von der Verschwörung kaum etwas mitbekommen, auch weil die Behörden in Prag und Wien den Umsturzversuch sogleich heruntergespielt hatten, um jede Unruhe im Keim zu ersticken.
Drei Jahre später geht es wieder von vorn los, dachte Kisch, als er aus der Autodroschke ausstieg. Er war sich nicht sicher, ob er innerlich wie nach einem Goal jubeln oder sich fürchten sollte.
»Du bist am Leben«, rief Lenka mit einer Mischung aus Spott und echter Erleichterung, als sich Kisch mit Brodesser dem Gebäude des Pathologischen Instituts näherte.
»Das habe ich heute doch schon einmal gehört«, erwiderte Kisch. »Und du siehst es ja selbst, ich habe das Fest springlebendig verlassen.«
Lenka hielt seine Hand einen Moment länger als nötig. »Du hast gefehlt«, sagte sie leise.
Kisch gingen die Worte zu Herzen, und wie üblich in solchen Fällen stand er da und wusste außer einem Nicken nichts zu erwidern. Zum Glück entband Lenka ihn von der Verpflichtung einer adäquaten Antwort. »Wir sollten hineingehen. Zelma erwartet uns«, sagte sie.
Brodesser trat einen Schritt zurück. »Wir wollen Frau Doktor Zypkin nicht zu sehr in Beschlag nehmen. Zudem würde ein inoffizieller Besuch hier mit meiner offiziellen Rolle als Redaktionsleiter kollidieren.«
Lenka und Kisch warfen einander einen Blick zu. Sie wussten, dass Brodesser zwar eine ganze Abhandlung über das Wesen des Pathologischen Institut und seiner alltäglichen Vorgänge mit Vergnügen lesen, keinesfalls aber selbst einen Fuß in den Sektionssaal setzen würde, wenn es sich vermeiden ließe. Auch Kisch war in dieser Hinsicht längst nicht so hartgesotten, wie er sich gab. Aber er verbarg sein Unbehagen vor Lenka.
»Wieso hast du neuerdings eigentlich die besseren Verbindungen als ich«, fragte er, nachdem Lenka an der Institutstür geläutet hatte und sie auf Einlass warteten.
»Nicht erst neuerdings«, sagte sie. »Ich kenne Zelma noch aus dem Studium. Als ich in Berlin war, hat sie ein Semester in Zürich verbracht. Professor Weiss hat ihr Talent erkannt und ihr die Stelle als seine Assistentin verschafft, als er nach Prag berufen worden ist. Sie ist die erste Frau im Pathologischen Institut. Offiziell leitet natürlich Professor Weiss die Pathologie, aber nicht am Wochenende, an Feiertagen oder nach 12 Uhr mittags. Sagen wir es so: Er überlässt Zelma die praktische Arbeit und beschränkt sich auf repräsentative Aufgaben.« Kisch nickte anerkennend.
Ein Diener öffnete ihnen die Tür. »Sie werden schon erwartet.«
Das Pathologische Institut war noch vor wenigen Jahren ein Hort des Grauens gewesen. Sein ehemaliger Leiter war an der nationalistischen Verschwörung beteiligt und auch darüber hinaus ein widerwärtiger Mensch gewesen. Und obwohl sie das Komplott aufgedeckt und zerschlagen hatten, konnte Kisch seine alte Abneigung gegen diesen Ort nicht abschütteln. Die kalt blitzenden Instrumente und klinisch reinen Oberflächen beschworen in ihm Bilder von Blut und anderen namenlosen Flüssigkeiten herauf. So sehr ihn die Lebenden anzogen, so sehr stießen ihn die Toten ab. Er mochte sie einfach nicht.
Im Sektionssaal stieg Kisch etwas in die Nase, was er dort nicht erwartet hatte. »Hier riecht es ja wie im Wirtshaus!«, platzte es aus ihm heraus.
Er zuckte zusammen, als dicht hinter ihm jemand sagte: »Der menschliche Körper verhält sich bei hohen Temperaturen nicht anders als ein prächtiges Stück vom Rind. Fleisch bleibt Fleisch.«
Er unterdrückte ein Würgen. Die Pathologin Dr. Zypkin begrüßte Lenka herzlich. Kisch reichte sie ihre Hand, und er ergriff sie zögerlich.
»Sie sind also der Held von der Zeitung«, sagte sie. »Keine Sorge, meine Hände sind frisch sterilisiert.«
Allmählich schwante Kisch, was auf ihn zukam. Er beneidete Brodesser, der sich im rechten Moment aus der Affäre gezogen hatte. Für ihn selbst war es dazu nun zu spät. Sie traten an den Sektionstisch, und Dr. Zypkin hob das Tuch. Eine zusammengekrümmte Brandleiche, die so aussah, als bleckte sie die Zähne. Kisch wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Er erkannte den goldenen Eckzahn seines Widersachers beim Wettrauchen auf dem Pfingstfest wieder. »Er hat die Haltung eines Boxers im Kampf«, sagte er, um sein Unwohlsein zu überspielen.
»Gut beobachtet, Herr Kriminalreporter«, sagte Dr. Zypkin.
»Was wir hier sehen, ist die sogenannte Fechterstellung«, ergänzte Lenka.
»Können wir bitte zur Sache kommen?«, sagte Kisch. »Ich vertrage Details in dieser Fülle nicht.« Er drehte sich ein wenig zur Seite, immer noch den Geruch nach Gebratenem in der Nase, der für die nächsten Tage einen beständigen Ekel in ihm hervorrufen würde.
»Also schön«, sagte Dr. Zypkin. »Im Grunde ein exemplarischer Fall. Beim Verbrennen war das Opfer bereits einer Rauchgasintoxikation erlegen. Man hat den Mann in aufrechter Haltung sitzend gefunden, was wir ausgesprochen präzise rekapitulieren können anhand dieses Merkmals.« Dr. Zypkin machte sich am Schädel des Toten zu schaffen. Lenka trat noch näher an den Sektionstisch heran und beugte sich vor, während Kisch sich abwandte.
»Der Verbrennungsprozess hat nicht viel vom sicher einst tadellos funktionierenden Gehirn übrig gelassen. Als Relikt verbleibt lediglich dieser kleine Brandfleck im Inneren des Schädels, an dem wir ablesen können, welche Position der Kopf im Augenblick des Unglücks hatte.«
»Merkmale von äußerer Gewalt?«, fragte Kisch. Ihm wurde bewusst, worauf er seit einer Minute starrte: eine Vitrine voller Gläser, in denen Obskures in Formaldehyd trieb.
»Keine, soweit sich dies bei einer solch starken Verbrennung noch beurteilen lässt«, sagte Dr. Zypkin.
Kisch atmete tief durch den Mund ein und aus, und obwohl er seine Nase zugestellt hatte, konnte er den Geruch schmecken. Um ein Haar hätte er ausgespuckt.
»Was glaubst du«, fragte Lenka, »hat jemand sein Ableben forciert?«
Er wandte sich den Frauen zu, ein Auge zugekniffen, das zweite halb geschlossen. Unscharf sah er, wie Dr. Zypkin mit den Schultern zuckte.
»Eine weitere Nachforschung entzieht sich leider meinen Möglichkeiten infolge des, wie soll ich sagen, defektiven Zustands, in welchem sich der Leichnam befindet. Die ersten Ermittlungsergebnisse der Polizei unterliegen der Geheimhaltung. Und nun«, sagte sie und bedeckte den Leichnam wieder mit dem Tuch, »rate ich zur Eile. Die Kriminalpolizei wird jeden Moment hier erscheinen. Man sollte euch besser nicht im Institut antreffen. Ich begleite euch durch den Seiteneingang hinaus.«
So leichtfüßig, als hätte er endlich einen schweren Kater überwunden, lief Kisch über die Flure des Pathologischen Instituts. Er war erleichtert, diesen Teil der Recherchen hinter sich gebracht zu haben, ohne sich zu übergeben. »Können Sie uns zu den polizeilichen Erkenntnissen gar nichts verraten?«, fragte er. »Sie können auch gern Vermutungen anstellen, so ganz unter uns.«
Dr. Zypkin lachte auf. »Du hast mir nicht zu viel versprochen«, sagte sie zu Lenka. Sie schloss die Tür zum Garten des Pathologischen Instituts auf, über den ein kleiner Trampelpfad zur Straße führte. »Werter Herr Kisch«, sagte sie, »Ihre weiteren Fragen sollten Sie besser im Sicherheitsdepartement stellen. Zum Beispiel könnten Sie sich danach erkundigen, ob der Verstorbene auf einer Sitzgelegenheit in einer kleinen Kabine gefunden worden ist, die eigentlich dem Personal auf dem Schiff vorbehalten war. Oder auch danach, ob die Tür zu dieser Kabine vor seinem Auffinden eventuell von außen oder aber von innen zugesperrt worden war. Es ist ja durchaus denkbar, dass darüber noch Unklarheit herrscht.«
»Haben Sie von Herzen Dank«, sagte Kisch. »Unter anderen Umständen wäre es mir ein noch größeres Vergnügen gewesen.« Er verneigte sich vor der Pathologin und deutete einen Handkuss an.
Lenka ahnte bereits, dass Kisch ihr auf dem gemeinsamen Weg in erster Linie Fragen zu ihrer Freundin stellen würde und nicht zum Toten auf dem Dampfschiff. »Danke für deine Hilfe, Zelma«, sagte sie. »Kommst du nächste Woche zum Klubabend?«
»Falls nicht wieder Schiffe brennen«, sagte Dr. Zypkin und lachte.
Kisch und Lenka traten auf die kühle sonnige Gasse hinaus. In der Nähe des Karlsplatzes kam ihnen ein Automobil entgegen, das sein Tempo plötzlich verringerte. Durch das Fenster erkannte Kisch Kriminalrat Dr. Öllinger, der im selben Moment den Blick abwandte. Nun wusste das Sicherheitsdepartement, dass auch Kisch die Sache verfolgte, aber das musste nicht von Nachteil sein.
Lenka begleitete Kisch zum Bärenhaus. Wie erwartet wollte Kisch unterwegs alles über Zelma wissen. War sie verheiratet? Wann war sie nach Prag gekommen? Wo wohnte sie? Was hatte Lenka ihr von ihm erzählt? Lenka machte sich einen Spaß daraus, die Fragen mit Beobachtungen aus dem Sektionssaal zu kontern. Waren ihm die zu Fäusten geballten Hände des Toten aufgefallen? Hatte er gewusst, dass durch die Hitze eines Brandes die Muskeln schrumpften, weil die Masse der Beugemuskeln größer als die der Streckmuskulatur war? Schließlich gab Kisch auf.
»Wie ist es denn euch ohne mich ergangen?«, fragte er.
Na endlich, dachte Lenka. »Fade ist es uns zwar nicht geworden«, sagte sie, »aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das Chaos in der Stadt erst ausbricht, wenn du in der Nähe bist.«
»Das ist ein Fehlschluss«, erwiderte Kisch. »Das Chaos waltet, wie es will. Ich bin nur derjenige, der es ans Tageslicht befördert.«
»Ich merke, die Front hat dich in keiner Weise verändert«, sagte Lenka.
»Wie geht es Jana?«, fragte Kisch. »Und wie macht sich Marie? Ich habe oft an euch gedacht.«
Mit diesem Geständnis hatte Lenka nicht gerechnet, nachdem sie es zwischenzeitlich schon bereut hatte, den Spaziergang mit Kisch zu unternehmen. Sie wusste ja, dass er eine weiche, mitunter sogar sentimentale Seite besaß. Er ließ sie bloß so gut wie nie durchscheinen, und normalerweise bedurfte es dazu mehrerer Gläser Schnaps. Hatte er in den vergangenen Wochen vielleicht doch erschütternde Dinge erlebt?
»Es geht uns allen gut«, sagte Lenka. »Marie ist lebhaft, sie hat viel nach dir gefragt. Im Augenblick sieht sie überall Feuer, wo keine sind, aber das ist wenig überraschend nach dem Inferno auf der Moldau. Und Jana ist froh, dass wir momentan so leben können, wie wir leben, glaube ich. Der unsägliche František ist im Feldlager, seine Rückkehr verschiebt sich von Woche zu Woche. Ich wage es kaum zu denken, aber ich wünschte, er bliebe für immer in Dalmatien.«
Kisch nickte.
»Und ich führe die Unterredungen in der Kammer meiner Mutter fort. Es sind immer mehr Frauen, die sich mir anvertrauen. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, Analytikerin zu sein, aber doch glaube ich, dass allein das Vertrauen darauf, dass ich mit den inneren Zuständen meines Gegenübers …«
»Schau mal«, fiel Kisch ihr ins Wort, als sie durch die Perlengasse gingen, »da wohnen die Eltern von Max. Ich habe ihn gestern auf dem Fest aus den Augen verloren. Sein Innerstes solltest du mal nach außen kehren. Verheiratet ist er mittlerweile, aber trotzdem noch getrieben, falls du verstehst, was ich meine. Vielleicht werde ich ihn heute noch zu seiner Sicht auf den gestrigen Abend befragen, das wird uns sicher voranbringen.«
Lenka seufzte. Es fiel Kisch nicht einmal auf, dass er sie mitten im Satz unterbrochen hatte. Den Rest des Weges erzählte er Geschichten von seiner Reise. Dabei hatte sie schon in der bohe- mia