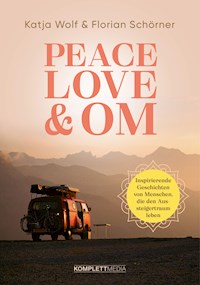5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Sie hätte der größte Star der 30er Jahre werden können – aber sie liebte den falschen Mann: »Die Filmdiva« von Katja Wolf jetzt als eBook bei dotbooks. Im Berlin der frühen 1930er Jahre kennt jeder den Schlager »Ich bin ja heut‘ so glücklich« – und seine Sängerin, die alle Herzen höherschlagen lässt. Die junge, bildschöne Renate Müller ist auf dem besten Weg, zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Films zu werden. Doch dann trifft sie eine Entscheidung, die alles verändert: Weil Renate einen jüdischen Bankierssohn liebt, verweigert sie sich Hitler. Ist ihr Tod kurze Zeit später wirklich ein tragischer Unfall? 1943 soll die Journalistin Catherine im bombenbedrohten London eine Reportage über die vergessene Diva und ihren Widerstand schreiben – und ahnt nicht, welches Geheimnis sie dabei aufdecken wird … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Filmdiva« von Katja Wolf – ein fesselndes Lesevergnügen für die Fans der Künstlerinnenromane von Michelle Marly. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im Berlin der frühen 1930er Jahre kennt jeder den Schlager »Ich bin ja heut‘ so glücklich« – und seine Sängerin, die alle Herzen höherschlagen lässt. Die junge, bildschöne Renate Müller ist auf dem besten Weg, zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Films zu werden. Doch dann trifft sie eine Entscheidung, die alles verändert: Weil Renate einen jüdischen Bankierssohn liebt, verweigert sie sich Hitler. Ist ihr Tod kurze Zeit später wirklich ein tragischer Unfall? 1943 soll die Journalistin Catherine im bombenbedrohten London eine Reportage über die vergessene Diva und ihren Widerstand schreiben – und ahnt nicht, welches Geheimnis sie dabei aufdecken wird …
Über die Autorin:
Katja Wolf ist das Pseudonym einer erfolgreichen britischen Autorin, die für ihre gefühlvollen Familiengeschichten und Komödien bekannt ist – und sich mit dem Roman »Die Filmdiva« einen langgehegten Wunsch erfüllte: der viel zu früh gestorbenen und heute weitestgehend vergessenen deutschen Schauspielerin Renate Müller (1906–1937) ein Denkmal zu setzen.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die deutsche Erstausgabe dieses Romans, den die Autorin 2001 unter dem Titel »Today I Feel So Happy« schrieb, erschien im selben Jahr unter dem Titel »Ich bin ja heut‘ so glücklich« bei dtv.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2001 Katja Wolf
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock/Hank Shiffman, Marten_House, pavila, elxeneize, Andy Vinnikov, Songdech Kothmongkol
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-917-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Filmdiva« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Katja Wolf
Die Filmdiva –Die Frau, die Hitler trotzte
Roman
Aus dem Englischen von Sonja Hauser
dotbooks.
Prolog
Samstag, 20. Februar 1943: London, Charing Cross Station, Gleis 2
Billy Palmer war erst seit drei Wochen Gepäckträger, aber er wußte sofort, wann er einen Betrunkenen vor sich hatte. Und der hier sah irgendwie komisch aus.
»Mr. Moffat?«
Der ältere Kollege des Jungen hob halb den Blick von der Sendung Trockenmilch, die gerade erst verspätet mit dem Vier-Uhrzweiunddreißig-Zug angekommen war und mit dem ausgefallenen Zug um fünf Uhr siebenunddreißig hätte weitertransportiert werden sollen. Amos Moffat richtete sein gesamtes Leben am Fahrplan der Southern Railway aus, und dieser Krieg spielte seinen Nerven übel mit.
»Was ist?«
»Er ist immer noch da. Der Mann.«
»Was für ein Mann?«
»Der Betrunkene im Wartesaal. Ich hab’ grade reingeschaut; er muß die ganze Nacht dringewesen sein.«
Moffat zog den Bleistift hinterm Ohr hervor und befeuchtete die Spitze mit der Zunge. »Tja, dann wirst du ihn wohl woandershin verfrachten müssen.«
Billy fragte ängstlich: »Ich? Und was ist, wenn er mir ’nen Kinnhaken verpaßt?«
»Dann duckst du dich.« Moffat strich »5.37« aus und ersetzte es durch »8.45«. Die Uhrzeit war nur geraten, entsprach aber mit Sicherheit eher der Realität als die alte. Als er den Blick hob, sah er Billy immer noch dastehen. »Worauf wartest du denn, Junge?«
»O bitte, Mister Moffat.«
»Mein Gott.« Moffat erhob sich mit knackenden Gelenken. »Sag mir, wo er ist, dann kümmere ich mich um ihn.« Er folgte Billy naserümpfend. »Ihr jungen Kerle von heute habt einfach keinen Mumm in den Knochen.«
Die Tür zum Wartesaal stand einen Spalt offen. »Da ist er«, sagte Billy und blieb auf der Schwelle stehen. In dem Raum lag ein Mann in einem dunklen Mantel von guter Qualität ausgestreckt auf einer Bank, das Gesicht der Wand zugekehrt. Offenbar schlief er tief und fest. Ein Arm hing über den Rand der Bank herunter, so daß die Finger den schmutzigen Boden berührten, aber das schien den Mann nicht zu kümmern. Den wirklich Betrunkenen war das meist egal.
Moffat marschierte in den Wartesaal, die Daumen in die Taschen seiner Weste gesteckt, die Brust vorgereckt. »Hallo, Sie da. Stehen Sie auf.« Der Mann reagierte nicht.
»Wenn Sie nicht aufstehen, machen wir Ihnen Beine«, meldete sich Billy mit zitternder Stimme zu Wort.
Moffat stieß den Mann in die Rippen, doch er hätte genausogut einen toten Fisch anstoßen können. »Der ist sturzbesoffen. Aber ein Penner ist er nicht, dazu ist der Mantel zu gut. Nun mach schon, Kumpel, ich hab’ nicht den ganzen Tag Zeit.«
Verärgert packte er den Mann an der Schulter und schüttelte ihn. Der Mann rollte herum und landete auf dem Rücken wie ein gestrandeter Wal.
»Jesus, Maria und Joseph!« Moffat trat stolpernd zurück, die rechte Hand rot und klebrig. »Billy, hol’nen Polizisten. Los, mach! «
Doch Billy rührte sich nicht von der Stelle. Er hatte noch nie eine Leiche gesehen, nicht einmal damals, als die Heinkel in die Schrebergärten am Ende der Bradley Road gekracht war. Er stand einfach da und schaute und hätte sich am liebsten übergeben. Und der Tote lächelte ihn aus zwei Mündern an, der eine in seinem Gesicht und der andere an der Stelle, wo das Messer seine Kehle durchtrennt hatte.
***
Samstag, 20. Februar 1943: London
Das Büro im ersten Stock des schmalen Hauses war klein und heruntergekommen und hätte dringend einen neuen Anstrich gebraucht.
Das Tageslicht, das durch das Oberlicht hereinkroch, fiel auf Einrichtungsgegenstände, die gut in einen Roman von Dickens gepaßt hätten: einen schweren Mahagonischreibtisch, einen Drehstuhl mit brüchiger Ledersitzfläche, häßliche Regalfächer an der Wand, alle leer. Lediglich das Telefon und die Karte von Südamerika, die erst vor kurzem an die Wand gegenüber der Tür gepinnt worden war, wiesen darauf hin, daß hier tatsächlich noch Geschäfte gemacht wurden.
Der kleingewachsene Mann mit dem spitzen Gesicht und den funkelnden schwarzen Augen stand eine Weile gedankenverloren da, die Hand auf dem Aktenschrank. Dann zog er, als sei er zu einer endgültigen Entscheidung gelangt, die mittlere Schublade auf und nahm einen dünnen Ordner aus Pappe heraus.
Er legte ihn auf den Schreibtisch und klappte ihn auf. Es befand sich ein halbes Dutzend Blätter darin, alle mit Maschine beschrieben. Der Mann zündete sie nacheinander an, hielt sie an einer Ecke, bis die Flamme beinahe seine Fingerspitzen erreichte, und ließ dann den glimmenden Rest in den Abfallkorb aus Metall zu seinen Füßen fallen.
Sein Gesicht entspannte sich erst, als nur noch ein Häufchen Asche übrig war. Dann nahm er seine Jacke von der Rückenlehne des Stuhles, machte die Bürotür auf und ging hinaus. Dabei drehte er das Schild mit der Aufschrift »Geöffnet« um. Jetzt stand da »Geschlossen«.
Kapitel 1
Samstag, 20. Februar 1943: Aus dem Tagebuch von Dr. Ryszard Lem, Direktor der Jessner-Klinik
Sie fasziniert mich.
Erst gestern abend ist sie hier in der Jessner-Klinik eingetroffen. Offenbar kommt sie aus einer anderen Klinik oder Nervenheilanstalt, doch woher, das hat man mir leider vorenthalten. Zweifelsohne haben die Ärzte dort ihren Fall als zu schwierig und ihre Persönlichkeit als zu verstörend empfunden. Die Frau kann tatsächlich bisweilen ausgesprochen feindselig sein, und ihre schlechte körperliche Verfassung gibt in Verbindung mit den schweren epileptischen Anfällen, unter denen sie leidet, Anlaß zur Beunruhigung. Als ich sie heute morgen befragen wollte, hat sie das so erregt, daß ich sie zu ihrer eigenen Sicherheit wieder sedieren mußte.
Doch schon nach diesem ersten Gespräch beginnen sich gewisse Tatsachen herauszukristallisieren: Erstens sind die Wahnvorstellungen der Patientin verführerisch und faszinierend; zweitens läßt sie sich durch nichts davon abbringen. Ihrer Ansicht nach ist sie Renate Müller.
Das ist unmöglich, denn Renate Müller starb 1937. Es war damals in jeder Zeitung zu lesen. Aber der Wahn hat seine eigene Logik, und sie spielt die Rolle so überzeugend, daß man ihr fast glauben könnte.
Ich sehe großes Potential in dieser Patientin.
***
Dienstag, 2. März 1943: British Defiant Filmstudios, Buckinghamshire
Im Studio von British Defiant herrschte wie üblich Chaos, doch ganz allmählich begann Catherine Law die Strukturen dahinter zu entdecken.
In den wenigen Wochen, die sie nun für die Recherche-Einheit FRU, die Features Research Unit des Informationsministeriums, arbeitete, hatte Catherine bereits eine Menge über die Welt des Films gelernt. Jedenfalls genug, um zu wissen, daß Renate Müller ein Rätsel war.
Alle erklärten bereitwillig ihre Theorien oder erzählten von Gerüchten, die sie gehört hatten, aber niemand hatte Fakten. Catherine hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie jemals genug Informationen für einen Film über Renate Müllers kurzes Leben zusammenbekommen sollte. Doch – und daran erinnerte sie der Leiter der Einheit immer wieder – sie war nicht hier, um Fragen zu stellen, sondern um das zu tun, was man ihr sagte.
Aber nicht einmal das war leicht. Zum Beispiel war es so gut wie unmöglich, ein Interview zu führen, wenn das Team gerade dabei war, eine Szene zu filmen.
»Maxie, das Licht ...« Der Regisseur deutete auf einen Scheinwerfer.
»Die Sieben aus.« Der Scheinwerfer zischte und fauchte wie ein in die Enge getriebener Kater und ging aus.
»Nummer drei.«
»Drei an.«
»Und jetzt die Sieben.«
»Okay, die Sieben an.« Das Licht strahlte so hell, daß Catherine spürte, wie ihr Lippenstift schmolz wie Butter in der Sonne.
»Gut. Ruhe.«
»Ruhe! Alle!«
»Kamera?«
»Okay«
»Ton?«
Der Laufjunge trat aus den Schatten. »Ton okay«
Eine Stimme rief: »Rotes Licht!«
»Gut. Film ab. Und diesmal setzt ihr mir die Szene nicht wieder in den Sand, verstanden?«
Catherine wanderte im Dunkeln am Rande des Set umher und versuchte, nicht über das Kabelgewirr am Boden zu stolpern. Sie hätte das Interview lieber in einer der leeren Garderoben geführt. Ein zehnminütiges Gespräch, und die Sache wäre erledigt. Dann hätte sie noch genug Zeit fürs Mittagessen. Aber wenn die Hauptmaskenbildnerin Anna Weiss den ganzen Vormittag am Set gebraucht wurde und das der einzige Ort war, an dem Catherine sich mit ihr unterhalten konnte, nun, dann mußte es eben so gehen. Jedenfalls hatte sie nicht vor, noch mal nach Buckinghamshire hinauszufahren, nicht einmal, wenn sie dort möglicherweise einen Blick auf Leslie Howard in Husarenuniform erhaschen konnte.
Soweit Catherine das beurteilen konnte, handelte es sich bei dem Film, der hier gedreht wurde, um eine seichte historische Komödie über einen Prinzen, eine Hutmachergehilfin und eine Reihe unwahrscheinlicher Verwicklungen. Dazu kamen Pferde, stramme Soldaten und hübsche Mädchen, die im Walzertakt einen Wiener Boulevard entlangtanzten. Catherine war ziemlich beeindruckt von dem Boulevard; er sah erstaunlich echt aus, wenn man nicht zu nahe an die Sperrholzattrappen herantrat.
Falls sich hinter Viennese Fancy eine Propagandabotschaft verbarg, gelang es Catherine nicht, sie zu entdecken, obwohl der Schauspieler, der den Erzherzog spielte, oberflächlich Ähnlichkeit mit Mussolini hatte.
Die nächste Aufnahme schien Catherine ganz in Ordnung, aber alles mußte wiederholt werden, weil die Scheinwerfer Schatten auf das Gesicht der Hauptdarstellerin warfen. Catherine war erstaunt über die Nüchternheit des Ganzen: die Hitze, die endlosen Wiederholungen, das stundenlange Warten, nur um dann zehn Sekunden Dialog aufzunehmen. Wahrscheinlich war das in allen Filmstudios des Landes das gleiche, dachte sie; vielleicht sogar in Deutschland, wo ja angeblich niemals etwas schiefging.
»Film ab.«
Diesmal rutschte ein walzertanzendes Pferd auf dem glatten Kopfsteinpflaster bei der Konditorei an der Ecke der Straße aus, scheute und warf seinen Reiter in eine Gruppe von Statisten ab.
»Schnitt! Ich sagte Schnitt!« Der Regisseur sprang von seinem Stuhl auf, die kahle Stelle auf seinem Kopf glänzte tiefrot. »Alles in Ordnung? Was? Wird man das sehen? Steht nicht so rum hier, sondern verbindet ihn, los. Dreißig Minuten Pause für alle.«
Die Scheinwerfer zischten widerwillig, als sie ausgeschaltet wurden. Elektriker kletterten auf die Brücke über dem Set und begannen, Melodien aus dem Film zu pfeifen, während sie sich mit der Beleuchtung beschäftigten. Eine junge Frau in weißer Uniform tauchte mit einem Verbandskasten hinter der Konditorei auf. Die Schauspieler entfernten sich plaudernd, lachend und rauchend.
»Ich verstehe nicht, wie Sie das aushalten«, sagte Catherine, holte ein Taschentuch heraus und wischte sich damit über den Nacken.
Anna Weiss zuckte mit den Achseln. »Ich kenne nichts anderes«, sagte sie mit ihrer leisen, rauhen Stimme, in der nur ein ganz leichter Akzent mitschwang. Sie hob einen der kostbaren Lippenstifte vom Boden auf, verschloß ihn und legte ihn wieder zu den anderen Schminkutensilien. »Wir können gar nicht genug sparen«, erklärte sie. »Man kriegt einfach keinen ordentlichen Lippenstift mehr. Heute nimmt man flüssiges Paraffin mit ein bißchen Bienenwachs, aber das hält der Hitze der Scheinwerfer nicht stand.«
»Und sogar für die minderwertigsten Sachen muß man ein Vermögen zahlen«, pflichtete ihr Catherine bei. »Ich benutze immer noch die Yardley-Seife, die ich aus der Vorkriegszeit rübergerettet habe. Aber die wird auch nicht ewig halten.«
»So, das wär’s«, sagte Anna, nachdem sie ihre Schminkutensilien sortiert, sich die Hände an ihrem Kittel abgewischt und sich aufgerichtet hatte. Sie selbst benutzte keinerlei Make-up; ihre Haut war glatt und schön, und in ihrem seidigen braunen Haar befanden sich nur ein paar graue Strähnen. Catherine hätte sich gewünscht, mit fünfundvierzig auch noch so gut auszusehen. »Was soll ich Ihnen sonst noch erzählen?«
Catherine hätte am liebsten geantwortet: »Etwas Interessantes.« Bis jetzt gestaltete sich dieses Gespräch wie die anderen davor: Sie hörte nur wieder, was für eine uninteressante Persönlichkeit Renate Müller letztlich gewesen sein mußte. Fast hätte Catherine das auch gesagt. Statt dessen fragte sie: »Bei welchen Filmen von Renate Müller haben Sie mitgearbeitet?«
»Nicht bei vielen.« Anna dachte einen Augenblick nach. »Sohn der weißen Berge, Wenn die Liebe Mode macht ... ja, und natürlich Die Privatsekretärin. Das ist der bekannteste Film von Fräulein Müller. Von dem haben Sie wahrscheinlich schon gehört.«
»Den hat man doch in England als Sunshine Susie noch mal gedreht, stimmt’s?«
»Ja, genau. Ein wunderbarer Film. So ... so fröhlich.«
»Das habe ich gehört.« Catherine bekam allmählich Kopfschmerzen. »Aber wie war Renate Müller wirklich? Das möchte ich eigentlich herausfinden.«
»Fräulein Müller?« Anna wirkte überrascht über die Frage. »Nun, sehr nett.«
»Natürlich«, murmelte Catherine mit einem stummen Seufzer. »Aber wie war sie?«
»Wie ich sagte: nett und freundlich.«
»Sie kann doch nicht die ganze Zeit nett und freundlich gewesen sein«, sagte Catherine verzweifelt.
»Natürlich nicht die ganze Zeit, das wäre unmöglich. Sie war bekannt für ihren Jähzorn – am Set hat sie manchmal ganz schöne Szenen gemacht.«
»Ach?« Endlich etwas Interessantes, dachte Catherine. »Warum? Welche Dinge haben sie aus der Fassung gebracht?«
»Ach, alles und nichts. Vielleicht hatte ein Techniker einen schlechten Witz über ihre Figur gemacht, oder sie bekam ein Kostüm, das sie für unvorteilhaft hielt ... Sie war ein bißchen zu rund für einen Filmstar. Ich habe gehört, daß sie in den Ufa-Studios ziemlich mit ihr umgesprungen sind. Sie haben sie hungern lassen, bis sie kaum noch Fleisch auf den Knochen hatte.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Haben Sie denn Eskapade nicht gesehen? Oder Togger? Das war der letzte Film, den sie gedreht hat. Sie war schrecklich dünn ... Natürlich hat sie manchmal die Fassung verloren, wenn die Leute unfreundlich zu ihr waren.« Anna lächelte. »Das geht uns doch allen so, oder?«
»Tja, wahrscheinlich«, sagte Catherine, die selbst hin und wieder in die Luft ging. »Dann war Renate also für ihren Jähzorn bekannt?«
»Ach, sie war auch nicht schlimmer als die meisten anderen großen Stars. Bei ihr hat’s auch nie länger als zehn Minuten gedauert, und dann war’s wieder vorbei.« Anna reinigte den letzten Make-up-Pinsel und legte ihn zu den anderen Utensilien. »Nun, ich habe nur bei drei Filmen mit ihr zusammengearbeitet.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Daß ich eine unter vielen war. Nur die Frau fürs Make-up. Ich habe ihr bloß bei ein paar Filmen die Nase gepudert. Nach 1933 habe ich überhaupt nicht mehr mit ihr zusammengearbeitet, nachdem die Nazis die Reichsfilmkammer gegründet hatten, in der keine Juden sein durften.«
Catherines Enttäuschung kehrte zurück. »Dann haben Sie sie also wirklich kaum gekannt?«
»Stimmt. Aber sie hat sich an mich erinnert. Und 1934, als ich Berufsverbot hatte und nicht einmal genug Geld, um mir etwas zu essen zu kaufen, hat Renate Müller mir das Geld zum Emigrieren gegeben. Ja, Miss Law, sie hat es mir geschenkt, es war kein Darlehen. Und wissen Sie, wieviel Reichsmark man brauchte, um sich die für die Ausreise nötigen Dokumente zu beschaffen?«
»Nun, nicht so genau«, sagte Catherine.
»Tausende, Miss Law. Tausende. Fräulein Müller war ein großer Star, aber sie war keine reiche Frau, auch wenn die Leute das Gegenteil behaupteten.«
»Sie hat doch sicher eine Menge Geld verdient mit ihren Filmen.«
»Das war alles weg, Miss Law.«
»Weg? Wohin denn?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie’s ausgegeben, vielleicht hat sie’s auch verschenkt.« Anna beugte sich zu Catherine vor und sagte in vertraulichem Tonfall: »Ich habe gehört, daß sie nichts außer ihrem Haus und ihren Schulden hinterlassen hat.«
Catherine war jetzt ziemlich verwirrt. »Aber warum? Und wenn sie selbst so wenig hatte, wieso war sie dann zu jemandem, den sie kaum kannte, so großzügig?«
Eine Stimme rief: »Alle auf Position. In zwei Minuten geht’s weiter.«
Anna Weiss erhob sich. »Weil Renate Müller ein guter Mensch war, Miss Law. Lassen Sie sich von niemandem einreden, daß das nicht stimmt.«
Kapitel 2
Dienstag, 2. März 1943: British Defiant Filmstudios, Buckinghamshire
Catherine machte sich auf die Suche nach Lily. Sie fand sie auf einem Requisitenkorb sitzend im Flur, völlig vertieft in ihren Daily Mirror.
Lily Sutton sah aus wie eine Westentaschenvenus: klein, aber mit großzügigen Rundungen ausgestattet. Diese sowie ihr knallroter Schmollmund und ihr eindrucksvolles Repertoire an zotigen Geschichten machten sie bei den Jungs beliebt. Sie war außerdem die einzige wirklich gute Freundin, die Catherine in London hatte.
»Hallo, Cath«, begrüßte Lily sie fröhlich. »Sie haben den Mord immer noch nicht aufgeklärt.«
»Was für einen Mord denn?«
»Die Leiche von Charing Cross, der Mann, den man mit aufgeschlitzter Kehle gefunden hat. Er war Psychiater, weißt du«, sagte sie. »Wenn du mich fragst, hat’s einer von seinen Irren gemacht.«
»Ich frag’ dich aber nicht. Willst du noch lange diesen Quatsch lesen, oder gehen wir?«
»Das ist kein Quatsch, sondern informativ.« Lily legte die Zeitung zusammen und steckte sie in ihre Kameratasche. »Außerdem bin ich schon seit Ewigkeiten fertig. Wieso hast du denn so lange gebraucht?«
»Die Husaren haben immer wieder glänzende Nasen gekriegt.«
»Wie bitte?«
»Ich erzähl’s dir beim Essen.«
Lily sammelte ihre Linsen und Stative ein, und dann machten sie sich auf den Weg.
»Na, wie findest du den?« Lily versetzte Catherine einen Stoß in die Rippen. »Sieht nicht schlecht aus, was?«
Catherine gab sich alle Mühe, den jungen Kulissenschreiner nicht anzusehen, der gerade In the Mood pfeifend an ihnen vorbeiging. »Lily, wann wirst du das endlich kapieren? Ich habe kein Interesse.«
»Schon verstanden. Bist wohl immer noch scharf auf den schönen Alistair, was?«
Catherine zuckte zusammen. Ihre Beziehung mit Alistair Young, dem Leiter der Einheit, war aus, und sie wurde nicht gern daran erinnert. »Ach was, Unsinn.«
»Ha.«
»Was soll denn das heißen?«
»Tja, überleg mal.«
»Du weißt wahrscheinlich, was du bist, oder?«
»Nein, aber das sagst du mir sicher gleich.«
»Eine Nymphomanin.«
Lily prustete. Dabei kam die Lücke zwischen ihren beiden Schneidezähnen zum Vorschein. »Das kann nicht sein, Cath. Das kann ich ja nicht mal buchstabieren.«
Sie gingen an Plakaten der letzten Filme von British Defiant vorbei: Moonlight Raid, Hearts Triumphant, Robin of Locksley ... »Hast du alle Bilder gekriegt, die du wolltest?« fragte Catherine.
»Wie viele Fotos von Greer Garsons Garderobe kann Alistair wohl wollen? Und was ist mit dir? Bist du zurechtgekommen mit dieser Wie-heißt-sie-doch-gleich?«
»Anna Weiss? Ja, es war ganz in Ordnung. Sie war ziemlich genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe.«
»Was? Doch nicht etwa wieder eine Verehrerin der heiligen Renate, oder?«
»Doch. Tja, soweit ich das beurteilen kann ...« Catherine wich aus, als eine Gipsbüste von Napoleon auf einem Wägelchen vorbeigeschoben wurde. »... hat Renate Müller, wenn sie nicht gerade damit beschäftigt war, die Kranken zu heilen oder übers Wasser zu wandeln, mittellosen Juden dabei geholfen, Deutschland zu verlassen.«
»Die wäre mir ganz schön auf den Wecker gegangen«, meinte Lily.
»Vielleicht«, sagte Catherine. »Aber alle sagen, daß sie sie gut leiden konnten.«
»Kein Wunder, wenn sie ihnen das Geld bloß so nachgeworfen hat.«
»Das Problem ist nur, daß ich das Gefühl habe, nicht weiterzukommen. Diese ganzen Leute, mit denen ich mich unterhalte – die Hälfte hat sie kaum gekannt, und die andere Hälfte hat Deutschland 1933 verlassen. Ich müßte jemanden finden, der später noch mit ihr Kontakt hatte, auch noch 1937, als sie gestorben ist.«
»Schau mich nicht so an, Cath. Ich bin Fotografin, kein Orakel.« Lily drückte gegen eine Schwingtür, und die beiden bogen nach rechts in einen weiteren gesichtslosen Flur ab. »Woran ist diese Renate Müller eigentlich gestorben?«
»In den Zeitungen steht, es sei ein Unfall oder ein Anfall oder so gewesen. Aber es gibt auch Gerüchte, daß sie Selbstmord begangen hat. Niemand kann mir das mit Sicherheit sagen.«
Lily hob dramatisch die Augenbrauen. »Selbstmord, aha.«
»Es ist bloß ein Gerücht. Wie gesagt: Genau weiß es niemand.«
»Oder niemand will was sagen.«
»Gerüchte, Lily«, sagte Catherine. »Ich bin Journalistin, ich brauche Fakten.«
»Nun stell dich nicht so an«, sagte Lily. »Was du brauchst, ist eine gute Story. Wenn du keine Fakten kriegst, mußt du sie dir eben ausdenken. Das erfährt schon keiner.«
»Aber ich weiß es.«
Sie durchquerten das mit Teppichboden ausgelegte Foyer voll signierter Fotos und Topfpflanzen und gingen zu einer großen Glastür, die zur Sicherung kreuz und quer verklebt war. Die Filmstudios von British Defiant waren zwar kaum achtzig Kilometer von London entfernt, aber es fiel schwer, sich vorzustellen, daß darauf Bomben abgeworfen wurden.
Ein weißhaariger Portier, der zu alt für den Militärdienst war, öffnete ihnen die Tür. Lily stolzierte hindurch wie ein Hollywood-Starlet, und Catherine folgte ihr mit einem verlegenen Lächeln. Draußen empfing sie der Märzwind mit einer kräftigen Ohrfeige.
»Verdammt«, sagte Lily zitternd und stampfte mit den Füßen. »Sieht fast so aus, als ob’s wieder anfängt zu schneien.«
»Gut«, sagte Catherine, »dann gehen wir gleich ins Ministerium zurück.«
Lily warf einen Blick auf ihre Uhr. »Aber ein bißchen Zeit für einen Drink ist vorher noch, wenn du möchtest.« Sie grinste. »Oder kannst du’s gar nicht mehr erwarten, Alistair zu sehen?«
Catherine sah sie böse an. »Warum ich dir die Sache mit ihm und mir erzählt habe, ist mir inzwischen ein Rätsel.«
»Das hast du mir gar nicht erzählen müssen, Schätzchen. Das hab’ ich selber gesehen. Der schmachtet dich doch die ganze Zeit an wie ein mondsüchtiges Kalb.«
»Das ist gar nicht wahr!«
»Und erzähl mir bloß nicht, daß du nicht mehr in ihn verschossen bist.«
»Du bist wirklich albern.«
»Ach, warum kriegst du dann plötzlich ganz rote Ohren?«
Catherine starrte Lilys Rücken finster an, als diese die lange betonierte Auffahrt zum Eingangstor hinunterhüpfte. Doch sie holte sie schon bald wieder ein. »Du weißt überhaupt nicht, was du da redest.«
Lily schenkte ihr keine Beachtung. »Zurück zu dieser Renate Müller.«
»Was ist mit ihr?«
»Sie mochte die Männer, oder? Hatte sicher auch ein paar Liebhaber.«
»Wahrscheinlich. Warum?«
Lily drückte ihren lackierten Fingernagel gegen Catherines Schlüsselbein. »Weil die sicher was über sie wüßten. Da mußt du anfangen, Cath: im Bett.«
***
Dienstag, 2. März 1943: Jessner-Klinik
Dr. Ryszard Lem betrat sein Sprechzimmer und wandte sich dem Pfleger zu. »Sie können uns allein lassen. Aber bitte bleiben Sie vor dem Zimmer«, fügte er hinzu. »Es könnte sein, daß ich Sie brauche.«
Die schwere Holztür schloß sich mit einem Knall, der den ganzen Flur entlangzuhallen schien.
Lems neue Patientin erwartete ihn bereits. Mit ihren blauen Augen beobachtete sie, wie er ihre Akte heraussuchte und sie auf den Schreibtisch legte, seinen Stuhl zurechtrückte und sich ihr gegenüber hinsetzte. In der Luft hing ein Geruch nach Desinfektionsmitteln und alten Büchern und anderen, weniger angenehmen Dingen.
Er faltete die Hände auf der Schreibtischplatte und versuchte, die Sorge in seiner Stimme zu unterdrücken. »Guten Morgen, Käthe. Ich bin Dr. Lem. Erinnern Sie sich noch an mich?«
Die Antwort klang mißmutig. »Natürlich erinnere ich mich an Sie. Und mein Name ist nicht Käthe.«
Käthe Hachmann, Lems neue Patientin, hockte auf der Kante ihres Stuhls wie ein Vogel mit gestutzten Flügeln, der noch nicht ganz vergessen hatte, daß er einmal hatte fliegen können. Sie wirkte zerbrechlich, fast schon durchsichtig. Die wiederholten epileptischen Anfälle hatten sie sehr geschwächt und ausgezehrt. In ihrer Akte stand, daß sie achtunddreißig Jahre alt war, aber ihr schrecklich vernarbtes Gesicht wirkte gleichzeitig älter und jünger, als sei das verunstaltete Fleisch lediglich eine Maske, hinter der sich ein inneres Leben verbarg, das jeden Augenblick durchbrechen konnte. Lem musterte sie eine ganze Weile. Sie faszinierte ihn von Mal zu Mal mehr.
»Gestern ging es Ihnen nicht gut«, begann er.
»Tatsächlich?«
»Das wissen Sie doch. Sie hatten einen Ihrer Anfälle, und wir mußten Sie ruhigstellen.«
Der Gesichtsausdruck der Frau verhärtete sich. »Das sagen Sie zumindest.«
»Warum sollte ich Sie anlügen?« fragte er.
»Warum sollten Sie mir die Wahrheit sagen?« konterte sie.
Er verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl, dessen gummiverstärkte Füße ein quietschendes Geräusch auf dem polierten Parkettboden verursachten. »Aber jetzt geht es Ihnen besser, oder?«
Käthe Hachmann musterte ihn mit ihren verstörend intelligenten blauen Augen. »Sie sind der Arzt«, sagte sie. »Das müssen Sie wissen.«
Er merkte, daß sie verärgert war, und bohrte lieber nicht nach. Das konnte er später immer noch tun. »Wir könnten uns auf deutsch unterhalten, wenn Ihnen das leichter fällt«, schlug er vor, bereit, jede Taktik anzuwenden, die sie vielleicht in zugänglichere Stimmung versetzte.
»Die Sprache habe ich fast vergessen«, erwiderte sie mit tonloser Stimme. »Es ist alles schon so lange her.«
»Tja, da haben Sie wohl recht.« Lem klappte die Krankenakte auf. Sie war letztlich nicht wegen der Informationen interessant, die sie enthielt, sondern wegen der Dinge, die nicht erwähnt waren. Obwohl Käthe Hachmann angeblich seit Mitte der dreißiger Jahre in England lebte, befand sich nichts aus den Jahren vor 1941 in ihrer Akte, als sie bei einem Autounfall verletzt wurde, bei dem ihr Mann umkam. Es stand auch sehr wenig über ihre vorhergehende Behandlung darin. Lem fand kaum Nützliches in den Unterlagen, nur eine Beschreibung ihrer Verletzungen, eine vorsichtige Diagnose und eine Liste der verschriebenen Mittel, zum größten Teil starke Beruhigungsmittel. Es war alles ausgesprochen unbefriedigend – und ziemlich irritierend.
Er sah ihr in die Augen. »Können Sie mir sagen, welcher Tag heute ist?«
»Warum wollen Sie das wissen?«
»Ist das wichtig?«
»Warum soll ich Ihre Fragen beantworten, wenn Sie die meinen nicht beantworten?«
Er unterdrückte seine Ungeduld und versuchte es noch einmal. Schließlich hatte er eine kranke Frau vor sich. »Wie heißen Sie?«
Sie zögerte keine Sekunde: »Renate Müller.«
»Hier steht aber etwas anderes.« Lem glättete die Seite und las daraus vor. »Hier steht, daß Sie Käthe Hachmann heißen. Ihr Mann Simon war ein jüdischer Fabrikbesitzer in Stuttgart, aber Sie selbst sind keine Jüdin. Sie waren seine Sekretärin, bevor Sie ihn geheiratet haben. Sie sind aus Deutschland geflohen im Jahr 19...«
»Mein Name ist Renate Müller«, wiederholte sie wie ein trotziges Kind. »Ich bin keine Sekretärin, sondern Filmschauspielerin.«
Er spürte den starken Willen in dem schwachen Körper und staunte – nicht zum erstenmal – über die kreative Kraft des Wahns.
»Na schön«, sagte er. »Dann gehen wir vorerst also davon aus, daß Sie Renate Müller sind.«
»Das ist aber sehr nett von Ihnen.« Jetzt schwang Ironie in ihrer Stimme mit; doch ihr Gesichtsausdruck blieb mißtrauisch und feindselig.
»Warum erzählen Sie mir nicht von sich?«
»Von Renate?«
»Ja.«
»Sie spielen ein Spiel mit mir.«
»Ich versuche lediglich, Ihnen zu helfen, das können Sie mir glauben. Sagen Sie mir doch ... sagen Sie mir, wo Sie geboren wurden.«
»Das ist leicht. In München, am sechsundzwanzigsten April 1906.« Es kam wie aus der Pistole geschossen. »Aber dann haben sie das Geburtsdatum geändert. Plötzlich war es 1907 ...«
»Sie?«
»Das Studio.«
»Ach, das Studio. Natürlich.«
»Aber nur, weil ich damals schon fast dreißig war, und Filmstars müssen immer jung sein. Wir müssen mit dem Rücken zum Licht sitzen, damit die Kamera unsere Falten nicht sieht. Als ich bei der Ufa war, haben sie ...« Sie hörte abrupt auf zu sprechen, schloß die Augen und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Ich bin in München geboren. Ist es das, was Sie wissen wollten?«
Lem nickte. »Ja, es ist ein Anfang. Und ... Sie sind auch in München aufgewachsen?«
Sie öffnete die Augen ein wenig und beobachtete ihn mißtrauisch. »Das Haus meines Vaters war ein bißchen außerhalb der Stadt. Aber meine Großmutter hat direkt in der Stadt gewohnt, in der Leopoldstraße. Wir haben sie jeden Sonntag besucht. Damals gab es in Schwabing so viele Schauspieler und Künstler, es war einfach herrlich. Sind Sie schon mal in Schwabing gewesen, Doktor?«
»Nein. Aber ich war schon in München.«
Sie sah ihn an. »Sie sind weder Engländer noch Deutscher. Was sind Sie?«
Er gab ihr keine Antwort. »Sagen Sie mir, wo Sie wohnten. Als Kind.«
»Was sind Sie, Dr. Lem?« Die Stimme klang müde, aber beharrlich.
Er gab sich geschlagen. »Ich bin Pole und komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Krakau. Ich bin Flüchtling, genau wie Sie. Aber bitte sagen Sie mir doch, wo Sie gelebt haben.«
»In einem kleinen Ort namens Emmering. Mein Vater hat sich dort eine Villa bauen lassen, gleich nach der Geburt von Gabriele. Der Garten ging bis zur Amper. Wir hatten Apfelbäume und Hühner und einen Holzschuppen und ...«
»Gabriele?« fiel Lem ihr ins Wort. »Wer ist denn Gabriele?«
»Natürlich meine Schwester. Meine kluge kleine Schwester.« Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl vor, die Augen jetzt weit offen. Die größte der Narben verlief im Zickzack mitten durch ihr Gesicht wie ein dicker rosafarbener Wurm. War sie einmal schön gewesen? Schwer zu sagen. »Lassen Sie mich hier heraus, wenn ich Ihnen alles sage? Bitte, ich will nur wieder frei sein.«
Ihre Klarheit brachte ihn aus der Fassung. Sie war zu rational, zu überzeugend. Aber natürlich hatte sie Jahre Zeit gehabt, sich in ihre Rolle einzuleben. Und vielleicht war Käthe Hachmann abgesehen von dieser einen Wahnvorstellung ja auch völlig rational.
»Vielleicht«, sagte er, darauf bedacht, ihr nichts zu versprechen. »Wenn Sie absolut aufrichtig zu mir sind.«
Er suchte in seinem Gedächtnis nach den Dingen, die er über Renate Müller wußte. Es waren schon viele Jahre vergangen, seit er als schmaler junger Mann zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester Die englische Heirat in einem Krakauer Kino gesehen hatte. Außerdem waren ihm persönlich Cowboyfilme immer lieber gewesen als Musikkomödien. »Wie lange haben Sie in Emmering gelebt? Bis zum Schulabschluß?«
»Wir sind nach Danzig gezogen, als ich vierzehn war.«
»Das ist sehr weit weg von Bayern.«
»Es hatte mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Er war Herausgeber einer wichtigen Zeitung. Armer Vati. Er wollte, daß ich auf der Schule bleibe und Abitur mache und Journalistin werde ...«
»Und Sie wollten das nicht?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Was wollten Sie?«
Sie antwortete, ohne zu zögern: »Ich wollte Opernsängerin werden.«
Dann herrschte langes Schweigen. Von draußen war lediglich das Geräusch sich entfernender Schritte zu hören. Irgendwo rief jemand etwas, und dann schlug eine Tür zu. »Aber dazu kam es nie?«
»Das wissen Sie doch.«
»Und warum nicht?«
»Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich will keine Fragen mehr beantworten.« Sie strich sich müde mit der Hand über die Stirn und wischte eine blonde Strähne weg. »Das ist alles so lange her...«
»Nur noch ein paar Fragen«, sagte Lem. »Sagen Sie mir, was danach passiert ist. Sind Sie wieder zurück nach München?«
»Nein, nur in den Ferien. Als ich siebzehn war, ist Vater zum Berliner Tageblatt gekommen. Ich war so glücklich in der großen Stadt; es war eine ganz andere Welt ... Eines Tages bin ich zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, daß ich einen Platz am Max-Reinhardt-Seminar habe. Ich wollte kein Abitur, ich wollte Schauspielerin werden!«
Ihre Augen glänzten bei der Erinnerung. Lem beugte sich ein wenig vor. »Sie haben zuvor gesagt, Sie wollten Opernsängerin werden«, erinnerte er sie.
»Ja, das stimmt.« Ein Lächeln spielte um ihren schiefen Mund. »Ich wollte so viele Dinge; mit siebzehn wollte ich alles. Armer Vati, er hat immer gesagt, ich soll vernünftig sein, aber vernünftig ist langweilig, stimmt’s? Ich dachte damals, ich könnte alles. Wirklich alles.«
Lem erinnerte sich noch an die Zeit, in der auch er sich für unbesiegbar gehalten hatte: Er war trunken gewesen von der Jugend und hoffnungslos optimistisch. Irgendwie konnte er Käthe Hachmanns nostalgische Phantasien nachvollziehen. Das ärgerte ihn. Es war ausgesprochen unprofessionell, sich mit einem Patienten zu identifizieren; im schlimmsten Fall konnte es sogar gefährlich werden.
Er hörte einen Augenblick lang auf, sich Notizen zu machen. Sein Stift war feucht von Schweiß und rutschte ihm immer wieder aus den Fingern. Er wischte ihn am Ärmel seines Kittels ab. »Und genau das machen Sie jetzt, Sie spielen eine Rolle. Stimmt’s?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Ich denke doch, Käthe. Was würden Sie sagen, wenn ich behaupte, Sie sind nicht gern der Mensch, der Sie tatsächlich sind, und geben deshalb vor, ein anderer zu sein? Jemand, der Sie lieber wären?«
»Dann halten Sie mich also auch für verrückt«, flüsterte sie in vorwurfsvollem Tonfall.
»Dieses Wort verwenden wir hier nicht, Käthe. Wir nennen das nicht mehr ›verrückt‹.«
»Worte, nichts als Worte! Aber niemand glaubt das, was ich sage.«
Er versuchte, sie noch einmal zu locken: »Die Wahrheit würde ich Ihnen vielleicht glauben.«
»Die Wahrheit! « Sie wäre fast von ihrem Stuhl aufgesprungen, am ganzen Körper zitternd, in den Mundwinkeln Speichelfetzen. »Ich bin Renate Müller, das ist die Wahrheit! Meinen Sie denn nicht, daß ich daran etwas ändern würde, wenn ich könnte? Sehen Sie sich dieses Gesicht an, Doktor. Und dann sagen Sie mir, daß ich nicht die bin, die ich behaupte zu sein.«
Es bestand eine gewisse Ähnlichkeit, das mußte selbst Lem zugeben. In einem günstigeren Licht, ohne die Narben und die Asymmetrie ihres schlecht verheilten Wangenknochenbruchs, hätte man sie für Renate Müllers Cousine halten können. Aber hier in dem winterlichen Licht, das durch das vergitterte Fenster hereindrang, sah Lem lediglich die traurigen Überreste eines ehemals runden, hübschen Gesichtes.
»Renate Müller ist tot«, sagte er ohne jede Boshaftigkeit.
»Ich bin nicht tot.«
»Sie lebt nicht mehr, Käthe. Sie ist vor sechs Jahren gestorben. Hunderte von Menschen waren auf ihrer Beerdigung. Goebbels hat einen Kranz geschickt ...« Er schwieg einen Augenblick, als er merkte, daß seine Worte keinerlei Eindruck hinterließen. »Na schön. Wenn Sie wirklich Renate Müller sind, dann erklären Sie mir bitte etwas. Warum sind Sie hier?«
Einen Moment lang sah sie ihn an, dann senkte sie den Blick auf den formlosen braunen Rock, der ihre Knie bedeckte. Wahrscheinlich, dachte Lem, hatte sie einmal hübsche Beine gehabt. Selbst als Arzt ertappte er sich manchmal dabei, daß er als Mann dachte. Aber der komplizierte Bruch, den sie sich bei dem Unfall zugezogen hatte, hatte ihr rechtes Bein deformiert und geschwächt. Wahrscheinlich hatte sie Glück gehabt, daß man es nicht hatte amputieren müssen.
»Ich weiß es nicht.« Sie schien sich ganz in das dunkelrote Polster zurückzuziehen. »Ich erinnere mich nicht mehr, warum.«
Er nutzte ihre kurzzeitige Verwirrung. »Aber an all die anderen Dinge erinnern Sie sich? An Emmering und Danzig und an die Schauspielschule?«
»Ich lüge nicht.« Sie hob den Blick. »Ich möchte Ihnen etwas sagen, Doktor.«
»Was wollen Sie mir sagen?« Er hoffte, einigermaßen mitfühlend zu klingen.
»Ich möchte Ihnen von dem Tag erzählen, an dem ich meinen eigenen Tod gesehen habe.«
Lem bekam unwillkürlich eine Gänsehaut. »Gut.« Dann sah er nervös auf den Regulator neben der Tür. Er hatte noch zehn, vielleicht sogar fünfzehn Minuten Zeit. Hier schien es sowieso niemanden zu kümmern, wie er seine Zeit verbrachte oder was er mit den Patienten machte.
»Ich war fünfundzwanzig Jahre alt, Doktor. Der Erfolg war so schnell gekommen. Als Schünzel mich für Die Privatsekretärin engagierte, hat er mich zur berühmtesten Komödienschauspielerin Deutschlands, vielleicht sogar Europas, gemacht. Plötzlich haben mich alle geliebt. Jeder Mann wollte mich heiraten, und jede junge Frau wollte so sein wie ich. Können Sie sich das vorstellen?«
»Es war bestimmt aufregend.«
»Ja, sicher. Was ich alles mit der Post bekommen habe: Torten und Halsbänder für meine Hunde und sogar Heiratsanträge. Ich dachte, ich würde ewig leben.« Der lebhafte Ausdruck verschwand so schnell aus ihrem Gesicht, wie er gekommen war. »Und dann habe ich angefangen, Filme in England zu machen.«
»Erzählen Sie weiter«, sagte Lem, der sich fragte, was als nächstes kommen würde.
»1931 hat Victor Savile mich hierhergebracht, um Sunshine Susie mit mir zu drehen, die englische Version von Die Privatsekretärin. Ich war ja so aufgeregt. Ich dachte, heute bin ich ein großer Star in England, morgen erobere ich Amerika. Es war einfach perfekt, genau so, wie ich es geplant hatte. Tja, und dann wurde ich krank. Genau an dem Tag, an dem die Dreharbeiten beginnen sollten. Am Tag zuvor hatte ich leichte Bauchschmerzen gehabt. Anfangs dachte ich, das sei die Nervosität, oder ich hätte etwas Falsches gegessen, aber es wurde immer schlimmer, und als das Zimmermädchen am nächsten Morgen kam, konnte ich vor Schmerzen nicht einmal vom Bett aufstehen. Sie haben mich ins Krankenhaus gebracht und mich operiert, und die Ärzte haben ...« Sie schluckte. »Ich brauche einen Schluck Wasser.«
Er reichte ihr ein Glas Wasser und sah, daß ihre Hand zitterte, als sie es zum Mund führte. »Erzählen Sie weiter.«
»Die Ärzte dachten, ich schlafe, aber ich habe jedes Wort gehört. Mein Englisch war damals auch schon ziemlich gut, Doktor, also habe ich sie sehr gut verstanden. Sie haben Herrn Savile gesagt, ich könnte keine Kinder mehr bekommen, aber das wäre nicht so schlimm, weil ich sowieso sterben würde.«
Plötzlich fand Lem es sehr kühl in dem Raum. »Aber Sie ... sie ... ist nicht gestorben.«
»Nein.«
»Und der Film wurde gedreht, und er war ein Erfolg.«
»Aber nichts war mehr wie zuvor. Alles hatte sich verändert.«
»Warum? Und wie?« Lem stellte fest, daß er mit ihr redete, als sei sie tatsächlich Renate Müller. »Weil Sie fast gestorben sind? Weil Sie keine Kinder mehr bekommen konnten?«
»Weil ich plötzlich nicht mehr unsterblich war.«
Es herrschte langes Schweigen. Sie schloß die Augen, und der Kopf sank ihr langsam auf die Brust. »Bitte. Ich kann nicht mehr.«
Lem klappte den Ordner zu und steckte den Stift in die obere Tasche seines weißen Kittels. »Ja, Sie sind müde. Wir unterhalten uns bald wieder.« Dann ging er zur Tür und öffnete sie. »Pfleger!«
Sie sah ihn erschöpft und voller Haß an. »Was hat es für einen Sinn, sich zu unterhalten, wenn Sie mir sowieso nicht glauben?«
»Ich versuche, Ihnen zu helfen, Käthe. Aber ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir nicht vertrauen.«
»Vertrauen! Und was ist mit mir? Wer vertraut mir?«
Käthe Hachmann wurde immer erregter. Lem erkannte die Signale. Im einen Augenblick konnte ein Wahnpatient noch ganz ruhig und vernünftig klingen, doch im nächsten fügte er sich möglicherweise schon ernsthaften Schaden zu. »Pfleger!« rief er.
Ein kräftiger Mann mit groben Gesichtszügen kam den Flur entlanggelaufen. Manchmal, dachte Lem, war es in der Klinik gar nicht so leicht, die Pfleger von den Patienten zu unterscheiden.
»Ja, Doktor?«
»Bringen Sie Frau Hachmann in ihr Zimmer zurück. Und achten Sie darauf, daß sie diesmal ihre Arzneien nimmt. Schließlich wollen wir nicht, daß wieder so etwas wie gestern passiert, oder, Käthe?«
Er lächelte sie nachsichtig an. Sie erwiderte seinen Blick leidend.
***
Dienstag, 2. März 1943: Janus Pub, nahe der Marylebone Station
Das Janus befand sich an einer halbvergessenen Straßenecke, nicht weit von der Marylebone Station entfernt. Die mangelnde Qualität des Bieres machte es durch seine Kuriositäten wett: Die Wände waren mit Pferdedrucken, Jockeykleidung, alten Wettscheinen und anderen Souvenirs von Pferderennen bedeckt.
»Früher war’s hier natürlich nicht so schick wie jetzt«, sagte Lily und nahm einen Schluck Port and Lemon, in dem sich wenig Port und überhaupt keine Zitrone befand.
»Ach«, sagte Catherine und ließ dabei den Blick durch den Raum schweifen. In Friedenszeiten hatten hier wahrscheinlich Eisenbahnarbeiter und der eine oder andere Angestellte im braunen Anzug ihre Mittagspause verbracht. Jetzt waren die Gäste Eisenbahnarbeiterinnen und Frauen von der freiwilligen Feuerwehr, die die Seeleute am Dartboard ungeniert musterten. Die Zeiten hatten sich geändert, und nicht unbedingt zum schlechteren.
»Vor ein paar Jahren war das hier noch eine richtige Spelunke.«
»Lily, das ist es heute noch.«
»Ach was, Cath. Fred Greenman steckt sein Geld nur in Projekte, die Gewinn abwerfen, und er hat ’ne ganze Menge investiert, um das Pub hier auf Vordermann zu bringen. Wäre wirklich schade, wenn ’ne deutsche Bombe drauf fallen würde.«
»Das liebe ich so an dir, Lily«, sagte Catherine lächelnd. »Du bist so optimistisch.«
Lily streckte die Hand nach Catherines Glas aus. »Willst du noch was?«
Catherine legte die Hand über ihr Glas. »Lieber nicht. Du weißt, daß wir noch zu tun haben.«
»Spielverderberin.«
»Du kannst ja hierbleiben und deinen Job aufs Spiel setzen«, sagte Catherine, »aber ich gehe. Die machen hier sowieso gleich zu.« Sie nahm Lilys Mantel und warf ihn ihr zu. »Komm, trink aus, und dann machen wir uns auf die Socken.«
Nachdem sie ihre Mäntel angezogen hatten, gingen sie in den kalten Nachmittag hinaus. Lily plapperte vor sich hin, während Catherine darüber nachdachte, was sie Alistair Young sagen würde. Sie kam zu spät, roch nach Alkohol und hatte noch immer keine interessante Story über Renate Müller aufgespürt. Er würde bestimmt freundlich und vernünftig sein wie immer, aber darum ging es nicht: In Catherines Augen war alles andere als der große Erfolg ein Eingeständnis, daß sie versagt hatte.
Und das Wort »versagen« war genau das, was ihr jedesmal in den Sinn kam, wenn sie Captain Alistair Young ansah. Der Anblick seines Gesichts brachte ihr unweigerlich in Erinnerung, was in Edinburgh zwischen ihnen vorgefallen war – eine leidenschaftliche Affäre, die wie ein Feuerwerk begonnen und wie ein Rohrkrepierer geendet hatte. Catherine kam nicht gut mit Mißerfolgen zurecht.
Sie bogen in die Bendall Street ein, ihre Absätze klapperten auf dem kalten Pflaster. »Und ich hab’ zu ihm gesagt ... Cath, hörst du mir überhaupt zu?«
»Ja, ja, ich hör’ dir zu.« Aber das stimmte nicht. Sie sah sich um und fragte sich, ob sie es sich nur einbildete.
»Und ich hab’ zu ihm gesagt, wenn du meinst, daß ich das für fünf Shilling mache, hast du dich getäuscht ...«
Catherine sah sich noch einmal um. Ja, vielleicht bildete sie es sich wirklich nur ein. Mysteriöse Männer verfolgten einen nicht am hellichten Tag, jedenfalls nicht im wirklichen Leben. »Erzähl weiter«, sagte sie, und Lily ließ sich nicht lange bitten.
Lilys pausenloses Geplapper wirkte merkwürdig beruhigend. Es war schon komisch, wie schnell sie sich angefreundet hatten, dabei hatten sie auf den ersten Blick keinerlei Gemeinsamkeiten. Na ja, vielleicht doch. Statt ihrem Vater in seiner Fischbude zu helfen, war Lily jeden Sommer den Southend Pier auf und ab geschlendert und hatte Erinnerungsfotos von Ausflüglern gemacht. Sie hatte fünf Jahre gebraucht, einen echten Fotografen dazu zu überreden, daß er sie als Lehrling anstellte.
Und die Arzttochter Catherine hätte keinerlei Probleme gehabt, in Cambridge aufgenommen zu werden, wenn sie es sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, den schwierigen Weg zu wählen. Was bedeutete, daß sie als Mädchen für alles bei der Wantage Evening Post anfing und auf eine Chance wartete, vier Zeilen über die örtliche Landwirtschaftsschau schreiben zu dürfen. Ja, vielleicht hatten sie und Lily wirklich etwas gemeinsam.
»... und dann«, sagte Lily gerade, »und dann hat er – Cath?« Catherine warf einen Blick über die Schulter und stieß einen Fluch aus. »Cath, was ist los?«
»Verdammt.« Catherine packte Lily am Ellbogen. »Ich hab’ mich also doch nicht getäuscht. Er ist wieder da.«
»Er? Wer denn?«
»Ein Mann. Ich glaube, er folgt mir.« Lily wollte sich umdrehen, doch Catherine zog sie weiter. »Nein, schau nicht hin, er soll nicht merken, daß wir ihn gesehen haben.«
»Er folgt dir? Wer?«
»Ein kräftiger Mann mit sandfarbenen Haaren, nicht gerade eine Schönheit. Drüben auf der anderen Straßenseite. Da vorn ist ein Schaufenster. Schau ihn dir im Spiegelbild an, aber mach’s nicht zu auffällig, ja?«
Als sie an dem Geschäft vorbeikamen, sah Catherine kurz ins Fenster. Er war noch da, der blonde Riese, den sie nun schon seit fast einer Woche immer wieder aus den Augenwinkeln wahrnahm. Er stand im Eingang zu einem Tabakladen und tat so, als sehe er ins Schaufenster, aber er war ihr bereits zu oft aufgefallen, als daß sie sich davon täuschen ließ.
»Was, der?« Lily klang enttäuscht. »Der sieht doch aus wie der Laufbursche von ’nem Buchmacher.«
»Ja, genau der. Komm, wir gehen nach rechts. Mach ein bißchen schneller.« Sie riß Lily zur Seite und bog abrupt in die William Street ein.
»Aua! « Lily rutschte auf dem nassen Pflaster aus und verdrehte sich den Knöchel. »Wo willst du denn hin?«
»Zur U-Bahn.«
Lily hüpfte auf einem Bein weiter und rieb sich dabei den verletzten Knöchel. »Aber die ist doch in der entgegengesetzten Richtung.«
»Red nicht so viel, ich versuche, ihn abzuhängen. Er verfolgt mich jetzt schon seit Tagen, und langsam habe ich die Nase voll davon. Komm nach links, nein, nach rechts, das verwirrt ihn.«
»Catherine«, keuchte Lily, »das hier sind nicht die Neununddreißig Stufen.«
»Abbiegen und dann in die andere Richtung. Ja, das weiß ich.«
»Und du bist nicht Madeleine Carroll. Warum sollte dir denn jemand folgen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Schuldest du irgend jemandem Geld? Mein Onkel Lenny...«
»Hör auf mit dem Blödsinn.« Sie näherten sich einer Straßenecke. »Rechts. Nein, warte.« Sie packte Lily am Mantel. »Warte einen Augenblick. Tu so, als ob du dir die Schuhe bindest.«
»Was?«
»Vielleicht haben wir ihn schon abgehängt.« Catherine holte ihre Puderdose aus der Handtasche und klappte sie auf. In dem Spiegel darin das zu beobachten, was hinter ihr vor sich ging, war längst nicht so einfach, wie es in den Agentenfilmen immer aussah. Doch als sie den Spiegel ein wenig drehte, entdeckte sie zwei große Füße, die aus einem Eingang auf der anderen Straßenseite hervorragten. »Verflixt.«
»Ist er immer noch da?«
»Sieht ganz so aus.«
Lily blinzelte. »Vielleicht verfolgt er dich wirklich. Weißt du was: Geh rüber zu ihm und frag ihn, was er sich eigentlich einbildet. Wenn du willst, erledige ich das für dich ...«
Catherine hielt sie zurück. »O nein, das tust du nicht.«
»Na schön, dann holen wir eben einen Polizisten und überlassen es dem.«
Catherine schüttelte den Kopf. »Und ich sage dann: ›Entschuldigen Sie, Officer, aber ich habe das Gefühl, daß ich verfolgt werde.‹ Der wird mir antworten: ›Tatsächlich, Madam? Wir haben wohl ein bißchen zu tief ins Glas geschaut, was?‹ Lily, du mußt zugeben, daß das ziemlich abstrus klingt. Außerdem möchte ich die Angelegenheit selber regeln. Komm, hängen wir ihn ab.«
Lily bekam große Augen. »Catherine Law, dir macht das alles einen Riesenspaß!«
»Quatsch.« Sie ging schnellen Schrittes weiter. »Welches ist die nächste U-Bahn-Station?«
»Ich glaube, Edgware Road.«
»Also los.«
Kapitel 3
Mittwoch, 3. März 1943: Tivoli-Kino, London
»Sie haben ihr den Spitznamen ›Pummelchen‹ gegeben.«
Catherine fragte erstaunt: »Wie bitte?«
»Pummelchen«, wiederholte der Kinobesitzer und verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl, um den Schmerz in seinem steifen Bein zu lindern. »So haben sie sie genannt, als sie rübergekommen ist.« Er nickte in Richtung der Leinwand. In dem riesigen leeren Zuschauerraum schien sie unendlich weit weg zu sein, als schauten er und Catherine durch einen Lichttunnel in eine andere, hellere Welt. »Sie sehen ja, warum.«
Das Urteil war vielleicht ein bißchen hart, aber Catherine begriff, was der Mann meinte. Trotz ihres lausbübischen Charmes wirkte Renate Müller doch auch ziemlich handfest.
»Am Ende hat sie uns alle um den Finger gewickelt«, überlegte der Mann laut. »Sogar mich, und ich war damals ein ganz schön harter Brocken.«
Catherine wandte den Blick von der Leinwand ab. »Sie haben gesagt, daß Sie früher Kameramann waren, stimmt’s?«
»Ja, das stimmt. Zumindest habe ich die Ausbildung dazu gemacht. Ich hätte genauso gut werden können wie Mutz Greenbaum, wenn ich nicht von einer Scheinwerferbrücke gefallen wäre. Ich war zu der Zeit, als Renate Müller Marry Me gedreht hat, sein Assistent in Islington.«
»Das heißt, Sie haben sie gekannt?«
»Nun, kennen ist zuviel gesagt. Aber sie hatte immer ein freundliches Wort für mich.« Er kicherte. »Allerdings waren das nicht immer Ausdrücke, die man in der Öffentlichkeit so ohne weiteres wiederholen würde.«
»Also war sie nicht gerade ein Tugendlämmchen?« fragte Catherine hoffnungsvoll.
»Du lieber Himmel, nein. Die liebe Renate hatte ein ganz schönes Temperament. Und ohne eine Zigarette in der einen und ein Champagnerglas in der anderen Hand hat sie’s nicht ausgehalten. Aber sie war ein nettes Mädchen, viel Charme. Talent hatte sie auch – 1931 ist sie zur beliebtesten britischen Filmschauspielerin gewählt worden.«
Der ältere Vorführer, der auf der Armlehne eines Seitenplatzes hockte, keuchte wie ein kaputtes Akkordeon. »Britisch – ist schon witzig, was? Die war ungefähr so britisch wie Hitlers Oma.«
»Halt den Mund, Bob«, sagte der Kinobesitzer. »Miss Law will sich den Film ansehen.«
Auf der Leinwand tanzte Renate als »Privatsekretärin« gerade mit einem Papierkorb um einen Schreibtisch herum. Dabei verstreute sie überall im Büro ihres Chefs Papierschnipsel und sang: »Ich bin ja heut’ so glücklich ...«
Der Kinobesitzer seufzte. »Genau so war sie: frech und lustig, und sie hat sich nie drum geschert, was die anderen über sie dachten. Genau deswegen haben wir sie geliebt.«
»... so glücklich, so glücklich ...«
Das Lied war ein Schlager, ein richtiger Ohrwurm. Es war im Jahr 1931 der Hit gewesen, und hin und wieder hörte man es noch im Radio, auch wenn es nun nicht mehr allzuviel gab, worüber man glücklich sein konnte.
Und die Stimme? Catherine schloß die Augen und lauschte. Sie hatte irgendwo gelesen, daß Renate Müller Opernsängerin hatte werden wollen. Nun, dachte sie, träumen kostet nichts. Jeder braucht seinen ganz speziellen Ehrgeiz, auch deutsche Schauspielerinnen mit Vollmondgesicht und schriller Stimme.
Schrill? Nein, das war nicht fair. Die Stimme war gar nicht so schlecht; sie klang melodiös und fröhlich, und komischerweise machte gerade ihre Schlichtheit sie so reizvoll. »Tra-la-la-laaa, tra-la-la-laaa, wie ein kleiner Vogel, der singt.« Jemand mit höherem musikalischem Anspruch hätte den Text mit Sicherheit nicht so glaubwürdig vortragen können.
Dann schwoll die fröhliche Stimme zum Crescendo an: »... Ich weiß nicht, warum ich so glücklich bin, ich weiß nur, daß ich es bin!«
Und da wären wir bei dem Geheimnis dieser Frau, dachte Catherine mit widerwilliger Hochachtung. Eins war sicher: Nur wenige Schauspielerinnen hätten etwas so Banales so reizvoll erscheinen lassen können. Catherine fiel niemand ein, der die merkwürdige Fähigkeit dieser Frau gehabt hätte, dem Zynismus den Wind aus den Segeln zu nehmen und einen glauben zu machen, daß das Unmögliche tatsächlich wahr war.
»Wirklich traurig, was mit ihr passiert ist«, meinte der Kinobesitzer, während der Vorführer nach hinten ging, um die Rolle zu wechseln.
»Mmm«, murmelte Catherine, ohne ihm richtig zuzuhören. Sie war damit beschäftigt, sich die Gestalt auf der Leinwand genau anzusehen und herauszufinden, was den alles andere als perfekt proportionierten Körper dieser Schauspielerin so anziehend machte. Sie hatte zu blondes Haar, einen zu großen Kopf auf einem zu kurzen Hals, runde Arme, breite Hüften und eine kleine, platte Nase. Diese Frau war keine Greta Garbo, soviel stand fest. Sie war nicht einmal eine Gracie Fields.
Der Vorführer kam schweren Schrittes zurück. Er setzte sich wieder auf die Armlehne und holte ein Sandwich heraus. »Natürlich haben sie sie umgebracht«, sagte er ganz beiläufig.
»Umgebracht?« fragte Catherine erstaunt. »Wollen Sie damit sagen, daß jemand sie ermordet hat?«
»Ja.«
»Wer?«
»Die. Sie wissen schon. Die.« Krümel regneten aus seinem Mund. »Die Deutschen.«
»Und wie?«
Da fiel Catherine ein Gerücht wieder ein, das sie gehört hatte: Sie ist aus dem Fenster gefallen ... jedenfalls haben sie das behauptet. Aber wir wissen alle, daß die Gestapo sie runtergestoßen hat.
»Die haben dafür gesorgt, daß sie sich zu Tode geschuftet hat. Besonders gesund war sie sowieso nie. Tja, und irgendwann hat sie zu trinken angefangen. Ich sag’ Ihnen, mich hat das nicht überrascht, wie ich gehört habe, daß sie tot umgefallen ist.«
»Ich habe ein Gerücht gehört, daß sie ...«
»Daß sie Selbstmord begangen hat? Nein, das ist Unsinn. Manche Leute haben einfach zuviel Phantasie, wenn Sie mich fragen.«
»Ja, Bob«, sagte der Kinobesitzer in vielsagendem Tonfall. »Das stimmt allerdings.«
Catherine lehnte sich auf ihrem Sitz zurück, wieder einmal enttäuscht. Eine tragische Selbstmordgeschichte um Renate Müller konnte durchaus Interesse erzeugen, und ein hübscher kleiner Nazi-Mord wäre hervorragender Stoff für einen Film. Aber wer würde sich schon für eine Frau interessieren, die ein paar Champagner-Cocktails zuviel gekippt hatte? Sie versuchte, dem Vorführer Näheres zu entlocken. »Ich habe irgendwo gelesen, daß sie unglücklich war und eine Überdosis Schlaftabletten genommen hat. Die Nazis haben das angeblich vertuscht.«
Der Kinobesitzer tat diesen Gedanken mit einer Geste ab. »Ach, natürlich hat es Gerüchte gegeben. Filmstars ohne Gerüchte gibt es nicht. Aber denen darf man keinen Glauben schenken. Wissen Sie, es gibt auch Leute, die behauptet haben, sie sei umgebracht worden, weil sie den Nazis nicht in die Hände arbeiten wollte.«
Der Vorführer lachte. »Das stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die haben sie aus dem Fenster gestoßen oder so was Ähnliches.«
Catherine beugte sich ein wenig vor. »Wirklich?«
»Ja, da gab’s alle möglichen Gerüchte. Man hat sich auch erzählt, sie wollte Hitler heiraten. ›Hitlers Schwarm‹ haben sie sie genannt.«
Catherine hob fragend die Augenbrauen. »Wer hat sie so genannt?«
»Die Zeitungen, aber das war nur Klatsch. Ich meine, eine Frau wie sie würde sich doch nicht mit einem dürren Männchen wie dem abgeben, oder? Aber egal.« Er wischte sich die fettigen Finger an seinem Kittel ab. »Was für eine Bedeutung hat das noch? Jetzt ist sie unter der Erde, und eine tote Deutsche mehr oder weniger macht auch keinen Unterschied.« Er erhob sich. »Der Projektor läuft schon wieder zu langsam. Ich muß hinter und mir die Sache anschauen.«
Der Film wurde angehalten, und die Lichter gingen an. »Sie arbeiten also fürs Ministerium?« fragte der Kinobesitzer.
»Ja, für die Features Research Unit, die ist Teil der Filmabteilung.«
»Und wozu das alles? Wir werden nicht oft von offizieller Seite um Privatvorführungen gebeten.«