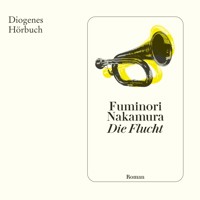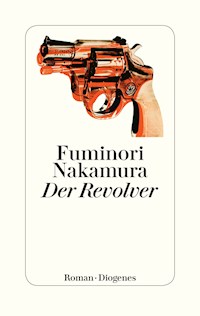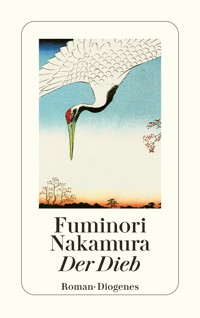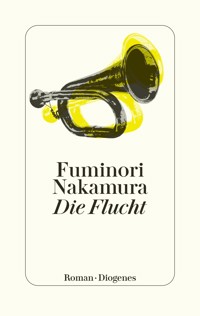
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kenji Yamamine kommt in den Besitz der legendären Teufelstrompete des Komponisten Suzuki. Ihr wird die Macht zugeschrieben, Menschen zu begeistern und zu fanatisieren. Bei Recherchen auf den Philippinen trifft Kenji die junge Anh. Sie verlieben sich, Anh folgt ihm nach Tokio, wo sie gewaltsam stirbt. Neben der Trauer um Anh wird Kenji von einer rätselhaften religiösen Sekte verfolgt, die die Trompete für ihre Zwecke nutzen will. Was Kenji jetzt noch bleibt, ist, das Rätsel der Trompete zu lösen und sich mit der Welt in Liebe zu versöhnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Fuminori Nakamura
Die Flucht
Roman
Aus dem Japanischen von Luise Steggewentz
Diogenes
Ein Hund bellt.
Es ist der, der immer an dem dürren Baum vor dem alten Mietshaus angeleint ist. Plötzlich verstummt das klägliche Kläffen. Ich frage mich, ob sie ihm etwas angetan haben. Ob ich gefunden und der Hund gewaltsam ruhiggestellt wurde. Im nächsten Moment höre ich deutlich, wie jemand die knarrende Holztreppe des Mietshauses emporsteigt. Mein Puls geht in die Höhe. Ich weiß nicht, was ich tun soll, und kann nur wie gelähmt den sich nähernden Schritten lauschen. Automatisch wandert mein Blick zum Fenster hinter mir. Aber die Wohnung liegt im zweiten Stock, zu springen ist keine Option. Vielleicht wissen sie wirklich, dass ich hier bin. Die Schritte werden immer lauter, bis das Geräusch direkt vor der Wohnung verstummt. Ich hole bewusst tief Luft. Bloß keinen Laut von mir geben. Die Tür ist verriegelt. Ich sitze völlig reglos auf meinem Stuhl.
In der Stille überkommt mich das Gefühl, selbst nur ein Bett, Regal oder Stuhl in diesem Zimmer zu sein. Ein vergessenes Möbelstück, das die Welt nicht mehr braucht. So eine Geschichte hatte ich mir früher einmal ausgedacht. Eine Geschichte über einsame Männer in einem Hotel im Ausland, die sich einer nach dem anderen in Teile der Einrichtung verwandeln. Am Ende entschließt sich der Hotelbesitzer seufzend, einen Entrümpler kommen zu lassen.
Ich starre unentwegt auf die Tür, die auf einmal ein hartes Knacken von sich gibt. Jemand hat das Schloss aufgebrochen, und jetzt öffnet sie sich. Fast hätte ich laut aufgeschrien, obwohl mir klar ist, dass sich niemand, der mich finden und bis hierhin verfolgen würde, von so einem alten Türschloss aufhalten ließe.
Ein hochgewachsener Mann betritt den Raum. Im Halbdunkel sehe ich ihn schlecht, aber ich bin mir sicher, dass ich ihn nicht kenne. Seine Haut ist hell und sein blondes Haar leicht ergraut. Als er mich bemerkt, zieht er einen Mundwinkel nach oben. Vielleicht ein Grinsen. Er kommt zum Stehen, und die alten Dielen knarren trocken.
»Ich dachte schon, du seist ausgeflogen, aber da bist du ja«, sagt der Mann auf Englisch.
Ich kann nicht einordnen, woher er kommt. Er sieht aus, als wäre er um die vierzig oder fünfzig. Zu einem schwarzen Anzug aus feinem Stoff trägt er einen schwarzen Hut. Ein Hauch von Eau de Cologne hängt in der Luft.
»Du wunderst dich sicherlich, dass ich die Tür öffnen konnte.«
Seine Stimme ist tief.
»Als ob so eine einfache Wohnungstür für einen Mann wie mich, der in dieser Welt schon alles Mögliche zuwege gebracht hat, ein Problem darstellen würde. Aber lassen wir das. Du kennst mich nicht und brauchst mich auch nicht zu kennen. Also …«
Sein Blick schweift durchs Zimmer.
»Wo ist sie?«
Er schließt die Tür hinter sich. Behutsam. Mit Händen in weißen Handschuhen.
»Was ist? Meinst du meine Aufmachung?«
Wie als Antwort auf meinen Blick breitet er die Arme aus und schaut an sich herunter.
»Kommt in Momenten wie diesen, in Situationen wie diesen nicht immer ein Mann im schwarzen Anzug? Ein rätselhafter Unbekannter, der aus dem Nichts erscheint und eine schicksalhafte Botschaft überbringt? Haha! Wie ich das Leben liebe. Wie ich diese Szenen des Lebens liebe. Mit meiner Kleidung zolle ich der Situation Respekt. Obwohl … Liebe ist das falsche Wort. Verachtung trifft es besser.«
Der Mann grinst noch immer.
»Und da ich gern rede, will ich dir eine Frage beantworten, die du mir gar nicht gestellt hast. Weißt du, warum ich die Tür hinter mir so sorgfältig zugezogen habe? Na? Natürlich, damit niemand draußen mitbekommt, was für schlimme, schlimme Dinge ich dir gleich antun werde.«
Ich hätte nicht still sitzen bleiben, sondern sofort die Flucht ergreifen sollen. Wie hat er mich gefunden? Ich habe keinen Schimmer. Das hätte nicht passieren dürfen. Es ging viel zu schnell. Im Zimmer wird es immer kälter, vielleicht weil der Mann kühle, trockene Luft von draußen hereingetragen hat.
»Warum so still? So zu tun, als könntest du kein Englisch, bringt nichts. Ich weiß, dass du die Sprache ganz gut beherrschst.«
Der Mann kommt auf mich zu. In seinen Schuhen.
»Ich weiß auch, dass du sonst um diese Uhrzeit allein spazieren gehst, mit deprimiertem Blick durch Köln streifst und vor dem Dom die Touristen beobachtest. Schwermütig und apathisch.«
Ist der Mann Deutscher? Schweizer? Ich hole tief Luft.
»Wo ist was?«
»Du kannst ja doch reden!«
Mit jedem seiner Schritte wird etwas Staub aufgewirbelt.
»Aber das Theater kannst du dir sparen. Ich weiß alles. Zum Beispiel auch, dass du deine japanische Heimat verlassen hast, um dich hier in Deutschland zu verkriechen, weil dich das Leben enttäuscht hat.«
Der Mann nimmt mit einer Hand seinen Hut ab, als wäre ihm plötzlich alles lästig.
»Also, kommen wir auf den Punkt … Das Meisterwerk ›Fanaticism‹. Die Trompete.«
Er spricht weiter. Als hielte er mir einen Vortrag.
»Ein legendäres Instrument, das während des Zweiten Weltkriegs ein Manöver der japanischen Armee auf dramatische Weise zum Erfolg geführt hat. Es gehörte einem genialen Trompeter des japanischen Musikkorps und wurde auch das ›Instrument des Teufels‹ genannt. Bei besagtem Manöver sind zwar auch Japaner draufgegangen, aber eure Soldaten haben es geschafft, das zahlenmäßig überlegene amerikanisch-englische Heer in Stücke zu reißen. Es heißt, die Trompete habe dieses Werk Gottes vollbracht. Die Trompete, die jetzt in deinem Besitz ist …«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
»Seit die Trompete vor einigen Jahren auf wundersame Weise in der philippinischen Hauptstadt Manila gefunden wurde, sind die verschiedensten Leute scharf darauf. Willst du wissen, wer?«
Der Mann lässt sich in das alte Sofa gegenüber von mir sinken. Es kümmert ihn nicht, dass es staubig ist. Ich bekomme Durst.
»Da ist zum Beispiel diese Terrororganisation aus dem Nahen Osten. Sie sympathisiert mit dem alten japanischen Kaiserreich, das einen offenen Krieg gegen Amerika geführt hat. Die rechte Hand des Anführers will die Trompete wieder erklingen lassen, weil sie die Soldaten damals so betört haben soll, dass das Unmögliche möglich wurde. Er nennt die Trompete das ›Instrument Gottes‹. Gott soll sie den Menschen geschenkt haben, um die amerikanischen Teufel zurückzuschlagen … Das hat mir der Kerl mit einem Lächeln erzählt. Ihm ist kein Preis zu hoch. Haha! Dann gibt es noch Händler auf dem Schwarzmarkt für Instrumente, Mafiaclans, exzentrische Sammler und mehrere rechte Gruppierungen in Japan, die hinter der Trompete her sind. Wenn ich alle aufzählen würde, säße ich noch ewig hier.«
Die gräulichen Augen des Mannes ruhen auf mir.
»Eigentlich sollte das Instrument den Hinterbliebenen dieses Trompeters aus dem Musikkorps überlassen werden, aber es wurde gestohlen … In der strengen Auslegung der Scharia wird Dieben die Hand abgehackt. Diese Strafe fordert besagte Terrororganisation für den Kerl, der das Instrument Gottes gestohlen hat. Natürlich nur im Scherz. Aber es wäre für diese Leute auch nicht mehr als ein Scherz, es wirklich zu tun. Die Gerüchte über das Instrument haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet. In der Unterwelt wurde sogar ein Kopfgeld auf den Dieb ausgesetzt. Wer immer das Ding gerade hat, ist ein armes Schwein.«
»Keine Ahnung, wovon Sie sprechen«, sage ich mit einem Kopfschütteln. »Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Sie brechen in eine fremde Wohnung ein und reden von Dingen, die mir nichts sagen. Was wollen Sie?«
Mein Blick ist auf das Sofa gerichtet, auf dem der Mann sitzt. Darunter liegt die Trompete.
»Normalerweise hätte ich meinen Gehilfen geschickt, aber du interessierst mich.«
Der Mann übergeht alles, was ich sage.
»Ich habe natürlich deinen Artikel über die Trompete gelesen, aber deine Arbeit als freiberuflicher Journalist ist mir einerlei. Mich interessiert deine Herkunft. Du bist in Urakami in Nagasaki geboren, habe ich recht?«
Nein, nicht ganz, denke ich, aber ich sage nichts.
»Zur Zeit der Christenverfolgung in Japan lebten in Urakami viele Christen im Verborgenen. Und du bist einer ihrer Nachfahren, stimmt’s? Äußerst interessant. Um die Regierungsbeamten bei ihren Patrouillen zu täuschen, sollen die Christen ihre Kruzifixe geschickt getarnt haben. Eine ihrer Methoden war es, einer Buddhastatue zu huldigen, auf deren Rückseite sie ein Kreuz eingekerbt hatten. Vielleicht hast du es mit der Trompete ja ähnlich gemacht und sie direkt unter meiner Nase versteckt. Unter diesem Sofa zum Beispiel.«
»Sagen Sie mir eines.«
Ich achte darauf, keine Miene zu verziehen. Meine Stimme klingt ruhig.
»Was haben Sie mit dem Hund vor dem Haus gemacht?«
»Ach, das beschäftigt dich? Geh doch runter und sieh nach. Ist aber kein schöner Anblick. Viel Blut.«
Ich will gelassen bleiben, aber im Nacken und an meinem Rücken bricht mir der Schweiß aus. Mich umfängt der edle Duft seines Eau de Cologne.
»Es gibt eine Methode, mit der man ein Lebewesen in Sekundenschnelle töten kann. Aber ich nehme mir gern ein Körperteil meiner Opfer als Andenken mit – ein kleiner Tick von mir. Diesmal habe ich …«
Der Mann greift in seine Jackentasche.
»Hahaha! Nur ein kleiner Scherz!«
Er hält ein längliches Stück Fleisch in der Hand. Abgepacktes Fleisch aus dem Supermarkt.
»Ich habe ihm das hier gegeben und ihn ruhiggestellt. Er schläft. Lebewesen ohne eigenes Ego zu töten langweilt mich, also bringe ich nur Menschen um.«
Der Mann lehnt sich vor. Sogar im Sitzen ist er groß.
»Ich werde dich jetzt foltern. So wie die versteckten Christen damals von der japanischen Regierung gefoltert wurden, bis sie ihre Religion aufgegeben haben. Ich frage mich, ab welchem abgetrennten Finger du …«
Ich ziehe die Schrankschublade neben mir auf, nehme die Pistole heraus und richte sie auf den Mann.
»Sieh an«, sagt er.
»Hauen Sie ab.«
»Die ist nicht echt.«
»Wollen Sie’s wirklich herausfinden …?«
Der Mann starrt auf meine Pistole. Staubpartikel schweben friedlich zwischen ihm und mir in der Luft. Er atmet ein Mal tief aus, als wäre er unheimlich genervt.
»Da haben wir den Salat«, sagt er. »Die Pistole ist bestimmt nicht echt, und selbst wenn, hättest du nicht den Mumm, auf mich zu schießen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du den Kopf verlierst und abdrückst, aber ich kann es natürlich nicht völlig ausschließen.«
»Hauen Sie ab«, sage ich.
»Hmm.«
Endlich steht der Mann auf. Ganz ohne Eile. Als müsste er lediglich kurz zur Tür, um ein Paket entgegenzunehmen, während im Fernsehen seine Lieblingsserie weiterläuft.
»Ich habe heute keine Waffe dabei. Und hätte ich eine, könnte ich sie sowieso nicht benutzen, weil ich nicht will, dass du durchdrehst und deine Knarre ohne Schalldämpfer abfeuerst. Ich will das hier ohne Komplikationen über die Bühne bringen.«
»Und wozu gehören Sie?«, frage ich, ohne nachzudenken. »Zu welcher der Gruppen, die die Trompete wollen, gehören Sie?«
»Damit hast du mir praktisch verraten, dass du sie doch hast. Bestimmt ist sie wirklich unterm Sofa.«
»Antworten Sie!«
»Hahaha!«
Der Mann dreht sich um und geht mit trägen Schritten auf die Tür zu.
»Die Antwort bringt dir nichts. Du bist jetzt in einer anderen Sphäre. Wenn jemand stirbt, weiß er nicht, warum er sterben musste. Er hat keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Das ist die Sphäre, in der du dich befindest, und du hast sie aus eigenem Antrieb betreten.«
Kurz vor der Tür kratzt sich der Mann am Hinterkopf und dreht sich noch einmal zu mir um.
»Also gut. Amüsieren wir uns ein wenig wie bei einem Spiel. Heute war das Kennenlernen. Wir lassen es langsam angehen. Das ist doch auch mal ganz nett, oder? Ich habe vorhin übrigens eine kleine Denksportübung gemacht. Ich habe ein Faible für Zahlen, musst du wissen. Mal sehen … Ja, doch, das kommt hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer Woche noch lebst, beträgt …«
Er dreht mir wieder den Rücken zu und setzt einen Fuß auf die Türschwelle. Wieder kommt trockene Luft von draußen herein und verweht den Geruch seines Eau de Cologne.
»Vier Prozent.«
Die Tür fällt ins Schloss. Ich senke meine Pistole und sacke auf dem Stuhl zusammen. Aus meinen Schultern und Armen weicht der letzte Rest Kraft. Meine Beine zittern. Als Student wollte ich mal ein Mensch werden, der sich von nichts aus der Fassung bringen lässt.
Jetzt weiß ich, das ist unmöglich. Der Typ hatte recht: Ich bin in einer Sphäre, die ich nie hätte betreten sollen.
Teil eins
Im Angesicht Gottes
Ich betrachte die schwarze Pistole. Auf einer Seite steht: U. S. 9mm M9-P. BERETTA 64440 PB. Ein Selbstlader. Keine Ahnung, ob sie echt ist. Als ich in diese heruntergekommene Wohnung am Fluss einzog, standen darin noch die Möbel des Vormieters. Die Pistole fand ich in einer Schrankschublade mit doppeltem Boden. Ich weiß nicht, wer hier vor mir gelebt hat. Bei der Übergabe sah sich mein Vermieter die schmutzige Wohnung kaum an. Bestimmt war mein Vorgänger ein einsamer Mann, der sich aus irgendeinem Grund hier verstecken musste und eine Pistole brauchte.
Plötzlich ekele ich mich vor der Kälte und Form der Waffe, die sich in meine Hand schmiegt, als wollte sie, dass ich noch fester zudrücke. Ich lege sie auf den Tisch. Sie wirkt verärgert, weil ich sie nicht benutzt habe. Ihr Metall scheint die Sphäre zu verkörpern, in der ich jetzt bin.
Ich ziehe meinen schwarzen Rucksack unterm Sofa hervor. Beim Gedanken an das, was sich darin befindet, spannen sich meine Finger an. Ich stopfe die Pistole hinein. Sie und die Trompete haben eine kalte Verwandtschaft, denke ich und spüre, wie ich immer weiter in die Sphäre dieser Gegenstände abrutsche. Ich vertraue ihnen mein Leben an, ohne bereit dafür zu sein.
Das Türschloss wurde sauber aufgebrochen. Ich setze einen Schritt aus meiner Wohnung und sehe mich um. Der Hausflur ist verlassen. Ich gehe die alte Holztreppe hinunter. Auf dem Hof sehe ich den Hund. Er ist noch immer an dem Baum mit dem einen abgebrochenen Ast angebunden. Er wird von einem meiner Nachbarn unerlaubt hier gehalten. Nachts verschwindet er. Wahrscheinlich holt ihn der Besitzer dann in seine Wohnung. Der Hund schläft.
Ich gehe auf die Straße, die am Fluss entlangläuft, und rufe ein Taxi. Fahren Sie einfach los, weise ich die Taxifahrerin an, die aufs Gaspedal tritt.
Ich drehe mich mehrmals um, sehe aber kein Auto, das uns folgt. Was wollte dieser Kerl von mir? Wird er mich wiederfinden?
»–––«
Die Fahrerin redet auf Deutsch mit mir.
»Kann es sein, dass –––? Ich –––«
Sie wirkt aufgeregt, aber ich verstehe nicht, was sie sagt. Zu viele deutsche Wörter, die ich nicht kenne.
»Sie ––– ich mache das! Fujiyama, der Film ––– wo? Wo wollen Sie hin?«
Vielleicht denkt sie, das hier sei eine Verfolgungsjagd, und will mir helfen. Oder sie macht einen Scherz über Verfolgungsjagden, um die Stimmung zu lockern. Die meisten Kölner, denen ich begegnet bin, waren hilfsbereit und freundlich.
»Zum Kölner Dom, bitte«, sage ich.
»In Ordnung. Gott wird Ihnen helfen!«
Endlich habe ich sie verstanden. Ich muss grinsen. Meiner Erfahrung nach hilft Gott niemandem und mir sowieso nicht. Die Chance auf seinen Beistand habe ich mir längst verspielt.
»––– Fujiyama! ––– also, wie gesagt, Fujiyama!«
Jetzt verstehe ich nur noch Fujiyama. Vielleicht denkt sie, damit läge sie bei einem Japaner immer richtig.
Der Kölner Dom kommt in Sicht. Zu Fuß brauche ich normalerweise eine Stunde bis hierher. Als ich der Fahrerin ihr Geld gebe, sagt sie zum Abschied: »Der Fujiyama wird Ihnen helfen.«
Sie hätte auch mit Sushi oder Pikachu ankommen können, denke ich. Warum gerade der Fuji? Vielleicht war sie mal dort. Pikachu hätte mich noch eher beschützen können. Beim Fuji sehe ich schwarz. Wie hätte der Kerl von vorhin wohl geguckt, wenn ein Pikachu auf meiner Schulter gesessen hätte, als er bei mir eingebrochen ist? Vielleicht hätte er gesagt: »Wer hätte ahnen können, dass du ein Pikachu besitzt? Das nenne ich mal einen echten Japaner.« Oder er hätte gesagt: »Das ist nicht echt«, worauf ich geantwortet hätte: »Wollen Sie’s wirklich herausfinden?«
Was denke ich mir da für Unsinn aus? Das muss die Erschöpfung sein. Ich setze einen Fuß auf den Domvorplatz.
Vor mir ragt der Kölner Dom in den Himmel. Er ist so hoch, dass ich mich regelrecht erschlagen fühle. Die Fassade ist bis ins kleinste Detail mit Ornamenten verziert, und die schiere Größe dieser gotischen Kathedrale gibt mir das Gefühl, mich an einen Ort fernab der Realität, mitten in eine monumentale Geschichte verirrt zu haben.
In der Silvesternacht 2015 kam es hier zu sexuellen Übergriffen auf Frauen durch eine Gruppe von Männern.
Laut der Polizei waren die Täter überwiegend »ausländischer Herkunft«. Die Verbrechen gaben der Debatte über Flüchtlings- und Migrationspolitik neuen Aufwind. Es kam zu Demonstrationen gegen die Aufnahme von Geflüchteten und anderen Einwanderern. Daraufhin löschte der Kölner Dom seine Lichter, um ein Zeichen gegen fremdenfeindliche Proteste zu setzen. Heute wimmelt es hier nur so vor Touristen aller Altersgruppen und aus allen möglichen Herkunftsländern, die sich lediglich durch ihre jeweilige Hautfarbe voneinander unterscheiden. Ihre Kleidung hat die Globalisierung wie selbstverständlich vereinheitlicht – überall Hosen, Röcke, Hemden und Jacken. Die Menschen lachen und reden miteinander, während sie sich im Gedränge vorwärtsbewegen. Es fällt schwer, sich die Verbrechen aus 2015 überhaupt noch vorzustellen.
Früher habe ich mir mal die Frage gestellt, ob Orte wohl ein Gedächtnis haben. Ob sie sich an alles erinnern, was an ihnen jemals passiert ist. Es gibt ein Foto von diesem Platz aus dem Zweiten Weltkrieg, das man sogar auf Ansichtskarten finden kann. Natürlich wurde auch hier gekämpft. Das Foto zeigt einen Soldaten, der mit seiner Waffe in der Hand im Schutt auf dem Bauch liegt. Im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. Es heißt, zu Kriegsende wurden die Domglocken geläutet und man konnte sie in der ganzen Stadt hören.
In einer Traube von Touristen entdecke ich eine schwarzhaarige Frau. Obwohl mir sofort klar ist, dass es sich nicht um Anh handelt, verkrampft sich mein Körper. Mein Kopf weiß, dass sie es gar nicht sein kann, aber mein Herz fängt trotzdem mit leichter Verzögerung an, wie wild zu pochen. Ich hole tief Luft. Was an dieser Frau erinnert mich überhaupt an Anh? Reines Wunschdenken. Ich hoffe auf das Unmögliche, um noch mehr zu leiden.
Die Frau, die ich im ersten Moment für Anh gehalten habe, geht jetzt direkt vor mir her. Oder verfolge ich sie etwa? Ich bleibe erschrocken stehen und hole noch einmal tief Luft. Bin ich ihr nur zufällig nachgelaufen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich außer Atem, obwohl ich ganz langsam gegangen bin. Ich betrete den Dom, ohne mich ein weiteres Mal nach der Frau umzusehen.
Stille und ein plötzlicher Temperaturabfall. Die Atmosphäre hat eine beruhigende Wirkung auf mich, obwohl ich mich schon lange keinen Christen mehr nennen kann. Ein anderer Teil meines Bewusstseins sträubt sich gegen diese innere Ruhe. Ich zwinge mich, die widersprüchlichen Gefühle auszuhalten und nicht gleich wieder zu gehen.
Der Dom war der Grund für meinen Besuch in Köln. Vor meinem Tod wollte ich zumindest ein Mal an den Orten gewesen sein, die ich schon immer hatte sehen wollen oder die für mein Leben eine besondere Bedeutung haben. Dazu gehört auch diese Kirche, die nach einem furchtbaren Krieg ihre Glocken läutete und viele Jahre später ihre Lichter löschte, um sich gegen Fremdenfeindlichkeit zur Wehr zu setzen. Noch wichtiger als die Kirche selbst war mir allerdings Gerhard Richters Domfenster. Üblicherweise zeigen Kirchenfenster Szenen aus der Bibel wie die Verkündigung des Herrn, die Geburt Christi, die Wunder Jesu, die Geschichte von Judas’ Verrat oder Jesus’ Kreuzigung und Auferstehung. Aber das Richter-Fenster, das 2007 fertiggestellt wurde, besteht nur aus zufällig angeordneten bunten Mosaiken.
Seit meiner Ankunft in Deutschland war ich schon unzählige Male hier. Ich mische mich trotzdem wieder unter die Touristen und schaue zum Fenster auf. Fast so, als wollte ich Anh aus meinem Kopf verbannen.
Die vielen, in perfektem Durcheinander angeordneten Farbquadrate strahlen wunderschön. Es heißt, ihre Anordnung wurde von einem Computerprogramm nach dem Zufallsprinzip vorgenommen. Dabei wurde genauestens berechnet, dass auch wirklich der höchstmögliche Grad an Willkür erreicht wird. Manche finden das Fenster zu modern, eine Kritik, die ich nicht nachvollziehen kann. Für mich transzendiert es Zeit und Geschichte. Es ist einfach atemberaubend.
Als ich es zum ersten Mal sah, gelangte ich zu einer neuen Überzeugung. Ein Schriftstück wie die Bibel entsteht, wenn Gottes Wille durch Jesus Christus an seine Jünger weitergegeben und von ihnen interpretiert wird. Aber Gottes ursprüngliche Worte müssten in ihrer Essenz auf uns Menschen eher wie die Daten wirken, auf deren Grundlage dieses Fenster entstanden ist.
Daten auf einer Musik-CD sind ein langes Muster aus Vertiefungen, das eigentlich nur aus AN und AUS beziehungsweise unzähligen Kombinationen aus Einsen und Nullen besteht. Musik wird in Binärcode umgewandelt, der dann in eine Disc eingeprägt und später mit einem Laser bestrahlt wird, um die Daten wieder auszulesen und die Musik abzuspielen. Auf ähnliche Weise wird alles Mögliche transformiert, übertragen und wiedergegeben, riesige Datenmengen werden als elektronische Signale durch dünne Kabel übertragen.
Ich weiß nicht, was Richter beabsichtigt hat. Aber mir kommt es vor, als stelle sein buntes Kirchenfenster die ursprüngliche Form von Gottes Botschaft dar. Nicht ihren Inhalt, lediglich ihre Form.
Eine Chinesin bestaunt wie ich das Fenster. Ich habe eine Schwäche für allein reisende Frauen. Sie hat nur einen ihrer Ärmel hochgekrempelt, den dafür mehrmals. Als ich merke, dass ich schon wieder an Anh denke, höre ich hinter mir einen dumpfen Knall und einen kurzen Fluch. Ein großer rothaariger Mann mittleren Alters scheint sich den Fuß gestoßen zu haben. Kurz füllt sich der Raum mit Geflüster in verschiedenen Sprachen.
Solche Situationen sind mir nicht neu. Ich glaube, Menschen bestrafen sich manchmal unbewusst selbst für irgendetwas. Der Besuch von Kirchen oder Tempeln löst bei vielen ein vages Schuldgefühl aus. Vielleicht ging es diesem Mann auch so. Mir kommen an solchen Orten oft blasphemische Ausdrücke in den Sinn, an die ich sonst nie denken würde. Vielleicht, weil ich weiß, dass sie hier tabu sind. Oder weil in mir das heimliche Verlangen entfesselt wird, einen Ort zu entweihen oder mich selbst zu geißeln. Es sind die fremd klingenden Stimmen im Kopf eines jeden Menschen, die sich in solchen Momenten unangenehm laut zu Wort melden.
Warum bin ich eigentlich hier? Der Mann, der vorhin in meiner Wohnung war, wusste, dass ich oft in dieser Gegend spazieren gehe. Kann es sein, dass etwas in mir die Gefahr regelrecht gesucht hat?
Ein Teil von etwas Großem wie dem Christentum oder einer anderen Weltreligion zu werden und über sein Leben nachzudenken ist beengend und befreiend zugleich, überlege ich. Mir ist es nie gelungen, ganz darin einzutauchen.
Wenn ich Gott gegenüberstehe, kommen mir immer Fragen.
Wie hast du dich während der Zeit der Christenverfolgung in Japan vom siebzehnten bis zum 19. Jahrhundert gefühlt, als du dabei zugesehen hast, wie deine Anhänger einer nach dem anderen gestorben sind?
Einem deiner frommen Diener ist damals die Jungfrau Maria erschienen. Angenommen, das war keine Sinnestäuschung, was hat deine Maria dann mit ihrem Erscheinen bezweckt?
Die ehemaligen Verstecke der Christen in Nagasaki und Amakusa und die Relikte aus jener Zeit wurden zum Weltkulturerbe erklärt. Ich frage mich, was du von der »fehlenden Geschichte« hältst, die eigentlich Teil dieser fortlaufenden Kette an Ereignissen ist. Ohne sie ist die Geschichte der versteckten Christen nicht vollständig.
Außerdem –––
»Nicht umdrehen.«
Die Stimme einer Frau. Ihr Japanisch klingt wie das einer Muttersprachlerin. Sie sitzt direkt hinter mir.
Mein Puls wird schneller, aber ein Teil von mir fühlt sich leichter als noch im Augenblick zuvor. Die Situation ist so surreal, dass sie eine düstere Komik entwickelt hat. Ich bekomme Lust, mich ins Verderben zu stürzen. Ich lächle. Irgendwo habe ich mal gehört, dass manche Selbstmörder kurz vor ihrem Tod noch einmal richtig fröhlich werden.
»Sorry. Sie sind bestimmt überrascht. Aber es ging nicht anders. Eigentlich wollte ich Ihnen einen Zettel schreiben, den ich dann in Ihren Rucksack gesteckt hätte. Aber Sie waren so in Gedanken, dass ich Angst hatte, Sie würden es gar nicht merken.«
Die Frau klingt entspannt. Ihr Japanisch ist so modern, dass es mir fast aufdringlich vorkommt.
»Ich habe gesagt, Sie sollen sich nicht umdrehen, aber das bedeutet nicht, dass Sie mich nicht sehen dürfen. Ich will nur nicht, dass die Typen hinter uns mitkriegen, dass jemand mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Also schön weiter geradeaus gucken und den Mund halten.«
Welche Typen hinter uns? Gehören die etwa zu dem Kerl, der in meiner Wohnung war?
»Sobald Sie den Dom verlassen, soll Ihnen der Rucksack geklaut werden. Es soll wie ein Taschendiebstahl aussehen. Also rennen Sie sofort los, wenn Sie draußen sind. Nehmen Sie ein Taxi zum Hotel Wasserturm und kommen Sie ins Zimmer 405. Sie können mir vertrauen. Ich kann Ihnen helfen. Ich sage es noch einmal. Hotel Wasserturm, Zimmer 405. Sie wissen schon, das Hotel in einem Turm. Wenn Sie mich verstanden haben, kratzen Sie sich bitte mit der rechten Hand am Hinterkopf.«
Ich kratze mich am Hinterkopf. Jemand Vertrauenswürdiges würde niemals auf diese Weise Kontakt aufnehmen.
»Ich kann das nicht einfach so hinnehmen«, sage ich daher. »Also, wer sind Sie?«
Endlich wieder Japanisch zu sprechen fühlt sich gut an. Dabei habe ich mein Heimatland fluchtartig verlassen, weil ich es dort nicht mehr ausgehalten habe.
»Ja, natürlich fragen Sie sich das. Aber ich kann es Ihnen hier nicht erklären. Es würde zu lang dauern. Sie können mir jedenfalls vertrauen. Ich nehme Ihnen die Trompete nicht weg. Ich will einen fairen Deal machen.«
Ein mir unbekannter Parfümduft liegt in der Luft, weich und süßlich.
»Einen Deal?«
»Die Trompete gegen Geld und meinen Körper.«
Meine Schultern und mein Rücken verkrampfen sich kurz, und ich atme langsam aus. Absurde Wirklichkeit. Ich weiß aber, dass solche Arten von Tauschgeschäften durchaus vorkommen, besonders bei ausländischen Geheimdiensten.
»Ich muss los. Zimmer 405 … Und ich verspreche Ihnen, dass ich schöner als die Frau bin, der Sie nachgelaufen sind.«
Während ich auf Jesus am Kreuz starre, verflüchtigt sich der Parfümduft. Ich hätte auch ein ganz normales Leben führen könne, denke ich. Mit großer Sicherheit sogar.
Beim Aufstehen ertappe ich mich, wie ich nach der Touristin von vorhin Ausschau halte, und schüttele ganz bewusst den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben. Ich verlasse betont ruhig die Kirche und renne dann los. Schwer zu sagen, ob ich verfolgt werde.
Ich sehe ein Taxi, hebe die Hand und merke im nächsten Augenblick, dass es dasselbe wie bei meiner Hinfahrt ist. Beim Einsteigen werde ich wieder mit »Fujiyama« begrüßt, als wäre das mein Name. Tatsächlich klingen Yamamine und Fujiyama ähnlich, aber das kann sie ja nicht wissen.
»–––! ––– Fujiyama. –––«
»Zum Connection Hotel, bitte.«
Während ich mich zu einem anderen Hotel bringen lasse, als es mir die Frau gesagt hat, überprüfe ich meinen Rucksack. Ich hatte das Gefühl, der Reißverschluss wäre vorhin geöffnet worden. In einer der Außentaschen finde ich einen schwarzen, kartenförmigen Gegenstand. Möglicherweise ein kleiner GPS-Tracker. Ich öffne das Fenster und werfe das Ding hinaus.
Modulation
Das Hotel hat noch Zimmer frei. Ich bekomme an der Rezeption einen Schlüssel.
Mein Zimmer ist klein, aber sauber. Ich blicke durch einen Spalt in den Vorhängen nach draußen. Niemand zu sehen. Auch während der Taxifahrt hatte ich nicht das Gefühl, verfolgt zu werden. Auf meinem Handy ist eine neue Textnachricht eingegangen. Dabei schreibt mir eigentlich niemand. Wahrscheinlich Spam, denke ich und erkenne sofort, dass ich recht hatte.
»Könnten Sie vorübergehend 20 Millionen Yen für mich aufbewahren? Ich habe Angst, sie bei mir zu haben!«
Ich bekomme täglich etwa hundert Nachrichten dieser Art und weiß nicht, was ich dagegen tun kann.
»Ich bin’s, Kenta. Ich warte im selben Hotel wie immer auf dich. Warum meldest du dich nicht?«
»Ich bin’s, Yuko. Ich warte im selben Hotel wie immer auf dich. Warum meldest du dich nicht?«
Wer immer mir diese Nachrichten schickt, scheint nicht zu wissen, ob ich auf Männer oder Frauen stehe. Absurderweise wartet gerade wirklich eine seltsame Frau in einem anderen Hotel auf mich. Ich muss grinsen. Ob wir es getan hätten, wenn ich hingefahren wäre? Wenn Anh mich jetzt sehen könnte, würde sie wohl sagen: »Du nennst dich progressiv und schwingst Reden über Frauenrechte, aber in Wirklichkeit bist du … Wie sagt man das auf Japanisch? In Wirklichkeit bist du bloß ein Lustmolch.« Ich würde mich dann kläglich rechtfertigen und behaupten, das eine habe nichts mit dem anderen zu tun. Beim Gedanken an dieses fiktive Gespräch breitet sich Wärme in meiner Brust aus. Im nächsten Moment schnürt es mir die Kehle zusammen, sodass ich kaum noch atmen kann. Mein Herz rast.
Ich gehe ins Bad, knie mich hin und will mich übergeben, aber ich habe heute noch nichts gegessen. Es kommt nichts hoch. Nur Schmerz, der sich in meiner Kehle einnistet. Ich spüre Tränen aufsteigen. Was ist mit mir los? Kommt es vom Versuch, mich zu übergeben? Anhs Tod ist doch schon lange her.
Ich kehre ins Zimmer zurück und hole, um mich abzulenken, den schwarz lackierten Holzkoffer aus meinem Rucksack. Er hat sich einen matten Glanz bewahrt, auch wenn hier und da die Farbe abgeblättert ist.
Die Gerüchte über dieses Instrument kenne ich schon lange. Man erzählte mir davon, als ich für meine Arbeit ehemalige japanische Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg interviewte. Ein Mann, den die Alliierten für ein Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht hatten, soll unter falschem Namen in das Musikkorps versetzt worden sein. Sein Können auf der Trompete sei mehr als überragend gewesen, ja geradezu teuflisch. Und der Klang seines Instruments soll einzigartig gewesen sein.
Militärkapellen spielten damals auf Zeremonien und Paraden im Inland, wurden aber hauptsächlich an der Front eingesetzt. Sie sollten den Soldaten Mut machen und dabei helfen, die einheimische Bevölkerung zu befrieden. Man richtete für die Menschen aus den besetzten Gebieten beeindruckende Konzerte aus, um ihr Bild von Japan aufzubessern. Für die Soldaten war das überlebenswichtig. Es gelang sogar, einige Einheimische als Spione anzuheuern. In einer Zeit ohne viel Unterhaltung hatten Orchesterkonzerte eine enorm ergreifende Wirkung. In einem inoffiziellen Schriftstück aus einer fragwürdigen Quelle wird ein kleines militärisches Manöver während des Zweiten Weltkriegs beschrieben. Das zahlenmäßig unterlegene japanische Heer tötete in den Bergen der Insel Luzon auf den Philippinen eine Vielzahl alliierter Soldaten. Der Erfolg dieser Operation wird besagtem Trompeter zugeschrieben. Über die Details wollten die ehemaligen Soldaten, mit denen ich für meine Recherche sprach, nicht reden. Aber ihnen traten Tränen in die Augen, als sie über die Musik des Trompeters sprachen. Viele beschrieben den Trompeter als »freimütig und offen«und »schön wie eine Frau«. Nach dem Manöver soll er den Verstand verloren haben. Es wurde auch behauptet, die Trompete habe einen Vorbesitzer gehabt, aber ob das stimmt, ist unklar. Instrumente des Musikkorps standen meist im Besitz des Militärs. Nicht selten zogen sie mit wechselnden Musikern von Krieg zu Krieg.
Was alles Weitere betrifft, sind die Informationen noch weniger zuverlässig. Es heißt, als der Trompeter anfing, den Verstand zu verlieren, habe sich auch die Trompete verändert. In entscheidenden Momenten sei ihr kein Ton mehr zu entlocken gewesen. Und es soll sich in ihrem Umfeld eine Tragödie ereignet haben. Beide Behauptungen gehören vermutlich ins Reich der Legenden.
Ich öffne die Verschlüsse des Trompetenkoffers und klappe ihn auf. Beim Berühren des hölzernen Kastens kribbeln meine Finger in einem Anflug von Angst und wohliger Spannung. Vor mir liegt die Trompete. Ihr silberner Metallglanz verzaubert mich. Verwinkelte, weiche Kurven, die immer verschlungener werden, je länger ich sie betrachte. Warum sind die Kurven dieses teuflischen Instruments so wunderbar sanft? Sie scheinen alles zu verzeihen. Selbst den Wahnsinn der Menschen. Selbst ihre schlimmsten Grausamkeiten. Ich lasse meinen Blick an den Kurven entlangwandern, bis er an einer Biegung zögert und zum Ausgangspunkt zurückkehrt.
Vielleicht dachten der Mann in meiner Wohnung und die Frau hinter mir im Dom, ich hätte mich wegen meiner politischen Einstellung, meiner Liebe für Frieden, Freiheit und Menschenrechte dazu berufen gefühlt, mit der Trompete abzuhauen und sie zu behalten, damit sie nicht in falsche Hände gerät.
Ich berühre sie. Ihre Kälte macht meine Finger glücklich. Ich drücke noch stärker gegen das abweisende Metall, das alles von sich stößt. Nach kurzem Zittern gewöhnen sich meine Fingerkuppen an das Gefühl, werden eins mit dem kalten Metall. Das Metall frisst sich in meinen Körper und durchdringt mich. Ich verliere mich.
Diese Leute haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, dass mich die Trompete mit Anh verbindet, wissen nicht, wie einsam ich bin. Meine Einsamkeit ist so irreparabel, dass ich es mir erlaube, manchmal mit der Trompete zu sprechen.
Aber das wissen sie nicht. Sie wissen nicht, dass ich mein progressives Denken längst eingestellt habe. Ich bin deshalb kein Konservativer, aber meine Ideologie ist tot. Ich bin ein progressives Wrack.
Hat es sich gut angefühlt?, frage ich die Trompete mit einem Lächeln. War es angenehm, so viele Soldaten in die Hölle zu schicken, alles um dich herum zu erobern? Ich streiche weiter über die Kurven des Instruments. Wie hat dir das ganze Blut gefallen? Menschen sind hässlich, oder? So weich und mit so viel Blut in den Adern. Wie gefielen dir ihre Todesschreie? Schreie am Ende ihrer elendigen Leben, die deinen schönen Klängen nicht das Wasser reichen können.
Du bist nicht wirklich verrückt geworden, oder? Du hast auch nach jenem Vorfall noch weitergespielt, nicht wahr?
Das leise Klingeln eines Telefons. Es ist das Hoteltelefon. Ich ignoriere es, aber das ungeduldige Geräusch bringt mich durcheinander. Es ist die Tonlage und dieser banale Drang abzunehmen, wann immer es klingelt. Sie nehmen meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch. Aber wenn ich noch auf so etwas Alltägliches reagiere, bin ich zumindest nicht komplett verrückt, denke ich und bin ein wenig beruhigt. Ich nehme zögernd ab. Aus dem Hörer erklingt die Stimme der Frau, die im Kölner Dom hinter mir saß.
»Warum sind Sie nicht hier?«
Ich schweige und wundere mich, dass ich gar nicht überrascht bin.
»Ich habe doch gesagt, dass ich einen Deal mit Ihnen machen möchte … Wenn Sie das Hotel nicht finden konnten, können wir uns auch in einem Café treffen.«
»Es tut mir leid, aber wir werden nicht ins Geschäft kommen.«
Dass ich mich zuerst entschuldige, ist vielleicht etwas typisch Japanisches. Es bedeutet nicht, dass ich es wirklich so meine. Wir Japaner entschuldigen uns oft einfach pro forma, ohne uns wirklich schuldig zu fühlen.
»Mir war nicht bewusst, dass Sie kein Interesse an Frauen haben.«
»Darum geht es auch nicht.«
Ein Teil von mir bedauert es tatsächlich, ihr Angebot ausgeschlagen zu haben. Aber ich bin es leid, nach dem Leben zu gieren.
»Entschuldigen Sie … Es scheint ernster um Sie zu stehen, als ich angenommen habe. Aber könnten Sie nicht noch einmal darüber nachdenken? Hören Sie sich wenigstens an, was ich zu sagen habe.«
»Nein«, antworte ich. Mir fällt auf, dass auch sie sich entschuldigt hat. »Sie haben mich angerufen, also wissen Sie, in welchem Hotel ich bin. Dass Sie nicht hier hereinplatzen, kann nur bedeuten, dass Sie und Ihre Kollegen nicht mit der Polizei in Berührung kommen wollen. Sie wollen diese Sache friedlich über die Bühne bringen. Für mich heißt das, dass ich jetzt zur Polizei gehe.«
»Ich habe eine Bitte.«
Ich höre, wie sich die Frau im Flüsterton mit jemandem im Hintergrund berät.
»Wissen Sie, dass Blasinstrumente mit der Zeit immer mehr Schaden nehmen? Es ist sowieso ein Wunder, dass diese Trompete in einem so guten Zustand gefunden wurde. Sie wurde vor schätzungsweise achtzig Jahren gebaut. Natürlich sind manche Trompeten auch nach hundert Jahren noch spielbar. Sie werden dann als Antiquitäten gehandelt. Aber dieses Instrument hat, seit es gefunden wurde, schon allerlei durchgemacht, bis es am Ende bei Ihnen gelandet ist, der es nun wirklich nicht adäquat aufbewahrt. Dass Sie diese Trompete behalten, bringt Ihr Leben in Gefahr, hören Sie?«
Sie klingt jetzt sachlicher. Ich weiß, dass sie mich nur aus der Reserve locken will, aber sie hat trotzdem mit allem, was sie sagt, recht.
»Wenn jemand Ihnen die Trompete wegnimmt und sie dann schon nicht mehr spielbar ist, wird man Sie zur Rechenschaft ziehen. Irgendwann überschreitet ein Instrument den Punkt, an dem es noch reparabel ist. Es ist nicht einmal gesagt, dass diese Trompete noch Töne von sich gibt, geschweige denn so klingt wie früher.«
Irreparabel. So wie ich.
»Bitte lassen Sie mich den Zustand der Trompete überprüfen. Gern auch, wenn Sie dabei sind. Und dann wäre da noch etwas anderes, auf das ich Sie hinweisen möchte … Ist Ihnen bewusst, dass Sie manchmal einfach so schief lächeln?«
»Wie bitte?«
»Sie lächeln schief. Manchmal wohl bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Merken Sie das gar nicht? Sie haben auf dem Vorplatz und im Dom ab und zu auf unheimliche Weise gelächelt. Sie können sich bestimmt denken, was ich meine. Es war so ähnlich wie jemand, der mitten in der Stadt murmelnd Selbstgespräche führt. Damit fangen Sie wahrscheinlich auch irgendwann an.«
Ich merke, dass ich schon wieder lächle.
»Ihnen fehlt es an Anspannung. Sie sind trotz Ihrer Lage merkwürdig fröhlich … So etwas ist gefährlich. Verstehen Sie das? Es kommt vor, dass sich Menschen in eine seltsame Sphäre verirren, in irre Heiterkeit versinken und sich am Ende selbst zugrunde richten.«
Ich sage ihr nicht, dass mir das längst bewusst ist.
»Sie sind gerade nicht imstande, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir können Sie behandeln lassen. Zumindest können wir Ihren geistigen Zustand überprüfen.«
»Die richtige Entscheidung?«, frage ich und finde das alles auf einmal nur noch lustig. Diese Frau hat keine Ahnung. »Und was bringt es mir, ›richtig‹ zu handeln?«
Stille am anderen Ende der Leitung. Ich merke, wie Heiterkeit in mir aufsteigt.
»Dass man sich auf eine bestimmte Weise verhalten soll, ist die Meinung anderer. Ich lebe längst in einem ganz anderen Kontext. Man will mir vielleicht richtige, vernünftige Entscheidungen aufzwingen, aber ich …«
Ich gerate ins Stocken. Aber ich …
Was will ich überhaupt?
»Tut mir leid, ich meinte ja nur …«, sagt die Frau.
Stopp. Ich halte mich innerlich zurück. Ich sollte jetzt das tun, was mich am besten aus dieser Situation rettet.
»Nein, mir tut es leid«, sage ich. Ob meine Worte aufrichtig klingen? »Sie haben ja recht … Aber mir ist das alles zu unsicher. Könnten wir uns irgendwo treffen, wo mehr Menschen sind?«
Wir werden uns niemals treffen.
»Ja, natürlich. Nennen Sie einfach einen Ort.«
»Kennen Sie das Café Jock auf der Großen Straße?«, frage ich. Ich werde ganz bestimmt nicht dort sein.
»Ja.«
»Treffen wir uns morgen um zehn Uhr vormittags dort. Nicht drinnen, sondern draußen auf der Terrasse.«
Du kannst bis in alle Ewigkeit auf mich warten.
»Morgen um zehn auf der Terrasse des Café Jock. Alles klar.«
»Aber ich kann nicht versprechen, dass es nach Ihrem Geschmack sein wird.«
Der Kaffee in dem Laden schmeckt wie Pisse. Er wird bestimmt nicht nach deinem Geschmack sein, so wie diese ganze Verabredung.
»Keine Sorge. Bis morgen also.«
Ich lege auf und gehe hinunter zur Rezeption.
»Könnten Sie mir ein anderes Zimmer geben?«
Der Rezeptionist ist ziemlich jung. Vielleicht ist er der Sohn des Besitzers. Dieses kleine Hotel scheint privat geführt zu sein. Zwischen dem Ende seines Ärmels und seiner verrutschten Armbanduhr sehe ich eine fein tätowierte Linie. Der junge Mann wirkt zuvorkommend.
»Entschuldigen Sie, aber ich werde verfolgt«, sage ich. »Meine Ex stalkt mich.«
Der Rezeptionist sieht mich fragend an, also fahre ich schnell fort: »Ich habe mein Zimmer noch nicht benutzt. Es ist sauber. Sie hätten keinen großen Aufwand. Ich hätte nur gern ein anderes.«
Vielleicht werde ich beschattet und sollte mich besser hier im Hotel verschanzen, denke ich.
»Ich kann Ihnen gern ein anderes Zimmer geben, aber ist es denn ernst mit dieser Stalkerin?«
»Ja, ziemlich. Könnten Sie behaupten, ich hätte ausgecheckt, falls jemand nach mir fragt? Vielleicht lässt sie auch einen männlichen Freund anrufen. Wenn sie nicht lockerlässt, rufen Sie die Polizei.«
Bei dem Wort »Polizei« atmet der Rezeptionist auf. Es zeigt ihm, dass ich nicht selbst ein Verbrecher bin.
»Ich wurde vorhin von einer Frau am Telefon gefragt, ob Sie hier übernachten. Sie meinte, sie sei eine Freundin von Ihnen, also habe ich ihr die Wahrheit gesagt und ihr Ihre Zimmernummer gegeben. Es tut mir wirklich leid. Aber ich dachte, die Frau wäre … Jedenfalls wollte ich Ihnen keine Umstände bereiten. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, wissen Sie …? Ich gebe Ihnen natürlich gern ein anderes Zimmer.«
Das löst das Rätsel, wie mich die Frau gefunden hat. Sie muss bei allen Hotels in Köln angerufen haben.
»Danke.«
»Leider ist nur noch das Zimmer neben Ihrem jetzigen frei. Ist das in Ordnung für Sie?«
»Ja, danke.«
»Leider ist die Lüftung dort schlecht. Das ist nicht gut für Ihre Trompete. Wäre das trotzdem in Ordnung?«
»Wie bitte?«
»Sie haben eine Trompete bei sich, die eine Menge Menschen getötet hat. Ihre Verfolger sind in diesem Moment in Ihrem Zimmer. Wenn Sie dorthin zurückkehren, werden sie Sie umbringen. Wissen Sie, wie diese Leute Menschen töten? Ich empfehle Ihnen, sich noch eine Weile hier mit mir zu unterhalten. Ist das in Ordnung für Sie?«
Halt, stopp. Das ist Japanisch. Dieser Rezeptionist kann doch kein Japanisch mit mir sprechen. Ist er etwa –––?
»Man wird Sie umbringen. So wie Anh. Mit ein klein wenig Kraft. Soll ich es noch einmal wiederholen? Mit ein klein wenig Kraft in der Hand. Deshalb, –––, –––«
Genau, er spricht Deutsch. Das kann ich gar nicht verstehen.
»–––, –––, oh, Verzeihung, sprechen Sie kein Deutsch?«
War das eine akustische Täuschung? Einbildung? Mein Kopf schmerzt. Es fühlt sich an, als ob sich der Stift auf dem Tresen ganz langsam in meine rechte Schläfe bohrt. Fühlt es sich nur so an, weil der Stift keine Kappe hat? Warum hat dieser Stift keine Kappe? Warum hat dieser Stift keine …? Ich blicke erneut in das Gesicht des Rezeptionisten und erschrecke. Es gibt keinen Grund, sich zu erschrecken. Er sieht ganz normal aus. Kein Grund, sich zu erschrecken.
»Alles okay?«
Er sieht mich an. Ich versuche, mich nicht noch einmal zu erschrecken. Halt, stopp, sage ich wieder zu mir selbst. Dieser Mann hat bloß etwas auf Deutsch zu mir gesagt. Er ist der Rezeptionist dieses Hotels und will mir freundlicherweise ein anderes Zimmer geben.
»Mir geht es gut. Danke.«
»Ein Glas Wasser?«
»Ja, bitte.«
Er verschwindet kurz im Hinterzimmer und kommt mit einem Glas Wasser zurück. Die Oberfläche bewegt sich. Das Wasser kämpft und windet sich, um seine Dichte zu erhöhen. Jemand hat das alles genau berechnet. Sobald ich das Wasser trinke, dehnt es sich so weit aus, dass es in meiner Kehle zum Stillstand kommt. Bravo. Diese Leute nehmen es genau. Sie machen keine Fehler. Diese Leute …? Welche Leute? Meine linke Schläfe pocht noch stärker. Ich muss das Wasser einfach, ohne nachzudenken, trinken. Es fließt durch meine Kehle. Mein Atem beruhigt sich. Ich trinke einen weiteren Schluck und atme noch einmal tief durch. Ich will die Gedanken vertreiben, die sich in mein Bewusstsein schleichen. Die Spannung in meinem Körper lockert sich ein wenig. Ich merke, wie eng es in meiner Brust geworden war.
»Alles in Ordnung?«
»Ja … Danke noch einmal.«
Ist mit mir wirklich alles in Ordnung? Mir fällt ein, dass ich seit zwei Tagen kaum geschlafen habe.
Ein Hund bellt. Ein Hund? Im Hotel? Das wundert mich. Er bellt angestrengt und ängstlich weiter, als rufe er jemanden. Dann wird das Gebell auf einmal lüstern. Der Hund leidet, ist aber glücklich. Jetzt sind es mehrere. Mehrere Hunde leiden, während sie sich lüstern aufeinander stürzen und –––.
Da ist jemand. Das war kein Hundegebell. Ich habe leise Schritte gehört. Ich öffne die Augen und finde mich im Dunkeln auf meinem Bett wieder. Das sind Schritte von mehreren Personen.
Jemand klopft an eine Tür. Nicht bei mir, sondern nebenan. Die Leute stehen vor dem Zimmer, das vorher meines war. Wie spät ist es? Es ist noch dunkel.
»Mister Yamamine. Verzeihen Sie die späte Störung, aber wir haben eine dringende Nachricht für Sie.«
Jemand redet im Flüsterton auf Englisch auf die Tür des Nachbarzimmers ein. Es ist eine mir unbekannte Männerstimme. Ich gehe barfuß über den Teppich zur Tür, wobei ich aufpasse, kein Geräusch zu machen. Die Tür hat keinen Spion, aber der Korridor auf der anderen Seite ist hell erleuchtet, und etwas von dem Licht dringt durch den Spalt in mein Zimmer. Auch durch die Ritzen an den Seiten fällt ein wenig Licht. Es ist eine alte Tür in einem in die Jahre gekommenen Hotel. Der Lichtstrahl, der unten durch den Türspalt fällt, wird in der Mitte unterbrochen. Ein Schatten. Draußen steht jemand.
»Mister Yamamine. Kommen Sie bitte zur Rezeption, wenn Sie wach sind und mich hören. Wir haben eine dringende Nachricht für Sie.«
Meine Kehle ist wie zugeschnürt, und mein Atem geht schwer. Ich rieche wieder das Eau de Cologne. Es ist derselbe weiche, elegante Duft, den der Mann aus meiner Wohnung verströmt hat. Er dringt durch die Ritzen in mein Zimmer.
Wie hat er mich hier gefunden? Mir ist niemand gefolgt. Trotzdem steht er vor meinem ursprünglichen Zimmer. Steckt er mit der Anruferin unter einer Decke? Während ich still verharre, versinkt mein Bewusstsein in immer größerem Chaos. Ich darf kein Geräusch machen. Diese Typen wissen nicht, dass ich im Zimmer nebenan bin.
»Mister Yamamine. Es ist dringend. Mister Yamamine.«
Was tun? Durchs Fenster steigen? Dann würden sie hören, wie ich es öffne. Das Hotel hat dünne Wände.
Ich schleiche durch die Dunkelheit zu meinem Rucksack, öffne ihn leise und nehme die Waffe heraus. Sie liegt kalt und schwer in meiner Hand, und als meine Finger sie umschließen, spannt sich mein Körper noch mehr an. Sie zu entsichern würde ein Geräusch machen, wenn auch nur ein minimales, was ich nicht riskieren will.
Mit einem dumpfen Knall öffnet sich die Tür zum Zimmer nebenan. Leise Schritte sagen mir, dass mehrere Leute eindringen. Ich muss an diese zweite Version von mir selbst denken, die nicht das Zimmer gewechselt hat. Ich werde umzingelt, man hält mir eine Waffe an den Kopf und sagt mir, ich würde sterben, wenn ich das Instrument nicht herausrücke. Ich lasse mich töten. Das hätte ich bis eben jedenfalls gedacht. Aber habe ich wirklich vor zu sterben? Ich ziehe mein Leben gerade unnötig in die Länge. Was hielte die Zukunft denn überhaupt noch für mich bereit?
Ich höre, wie im Nebenzimmer eine Tür geöffnet wird. Wahrscheinlich suchen sie im Bad oder im Schrank nach mir, weil sie mich nicht finden können. Ich presse mein Ohr gegen die Wand, verstehe aber nicht, was gesagt wird. Die Stimmen sind gedämpft und kaum hörbar, aber es scheint kein Englisch gesprochen zu werden. Vielleicht Deutsch. Ein lautes Geräusch wie von einem Aufprall lässt mich zusammenzucken. Wahrscheinlich hat einer von ihnen vor Wut gegen die Wand getreten.
Ich spüre deutlich, dass ich mich nicht umbringen lassen will. Warum nicht? Die Trompete will ich auch nicht herausrücken. Will ich dieses trostlose Leben wirklich weiterleben? In diesem Geisteszustand, der mir jegliche Hoffnung verwehrt? Ich hasse mich dafür, dass ich mich trotz allem noch ans Leben klammere. Ein Teil von mir versucht, wahnsinnig zu werden. Versucht, eine Sphäre zu betreten, in der mir meine Existenz egal ist. Das ist ein langsamer Selbstmord, ein schleppender Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.
Die Männer sind wieder gegangen, aber vielleicht kommen sie zurück. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um aus dem Fenster zu steigen, aber vielleicht hält einer von ihnen draußen Wache.
Ich beschließe zu warten. Wenn sie wiederkommen und beim nächsten Mal die richtige Tür finden, bleibt mir sowieso nur noch die Flucht durchs Fenster. Mein Geist beruhigt sich. Es ist, als setze sich der Umriss meines Körpers deutlich von der Dunkelheit ab. Die nächsten paar Minuten könnten über mein Leben entscheiden. Selbst die Möbel scheinen sich kleinzumachen, um nicht mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Die Gardine ist lediglich auf einer Seite geöffnet. Habe ich sie aufgezogen? Aber warum? Ich kann mich nicht erinnern.
Plötzlich klingelt das Telefon, und ich greife reflexartig zum Hörer. Während ich mich frage, ob das klug war, höre ich schon die Stimme des Rezeptionisten.
»Alles in Ordnung bei Ihnen?«
Eine warme Welle der Erleichterung durchflutet mich. Das Gefühl bereitet mir Unbehagen, und ich weiß nicht, warum.
»Ja …«
»Sagen Sie –«
Der Rezeptionist stockt.
»Wer sind Sie eigentlich?«
Was soll ich darauf antworten?
»Egal. Sie müssen es mir auch nicht sagen. Die Männer, die hinter Ihnen her sind, haben den Hintereingang aufgebrochen. Bei uns wird nur der Haupteingang videoüberwacht, aber ich habe sie von meinem Platz an der Rezeption aus hereinkommen sehen. Sie waren zu viert und sind jetzt wieder weg, aber … kann es wirklich sein, dass Sie keine Ahnung haben, wer diese Kerle sind?«
»Wie bitte?«
»Aha … Sie wissen es tatsächlich nicht.«
Der Rezeptionist scheint sich eine Zigarette anzuzünden. Ich höre das Klicken eines Feuerzeugs. Er atmet tief aus. Seine Stimme zittert leicht, als er weiterspricht.
»Wo soll ich anfangen … Ich habe früher in Berlin und auch in Belgien gelebt. Bis ich hier im Hotel meiner Eltern angefangen habe, habe ich einige krumme Dinger gedreht. Ich bin selbst kein Engel, also habe ich ein bisschen Ahnung von so etwas und kann Ihnen sagen, dass das ganz üble Typen sind. Böse Menschen, verstehen Sie? Übrigens haben sie Schweizerdeutsch miteinander gesprochen. Als Japaner hören Sie den Unterschied vielleicht nicht.«
»Das waren Schweizer?«
»Einem von ihnen bin ich schon mal begegnet, in einem Ausländerviertel in Belgien. In einer ranzigen Kneipe mit einem muslimischen Wirt, in der viel Alkohol getrunken wurde, obwohl der Islam das ja verbietet. So ein dämmriger Schuppen mit alten Dartscheiben und einem abgenutzten Billardtisch mit verbogenen Queues. Damals war ich Teil einer Gang. Wir haben diese Kneipe betreten, ohne Böses zu ahnen. Schon beim Hereinkommen meinte unser Boss: ›Nicht in die hintere Ecke schauen.‹ Er setzte dabei ein lässiges Grinsen auf, doch aus seinem Blick sprach der volle Ernst. ›Und bleibt unauffällig‹, fügte er noch hinzu. Er wies uns an, jeweils nur einen Drink zu bestellen. Danach wollte er so tun, als hätte er einen Anruf bekommen und müsste los, woraufhin wir ohne Eile den Laden verlassen sollten. Als ich ihn fragte, was denn das Problem sei, meinte er: ›B ist hier.‹«
Ein Mann namens B
»B?«
»Genau. Ich stand in meiner Gang ganz unten in der Hierarchie, aber selbst ich hatte schon von diesem B gehört. Es gibt Typen in der Unterwelt, deren Weg man auf keinen Fall kreuzen will. Ein Mensch mit einem anständigen Leben begegnet so jemandem gar nicht erst. Manche sind B aus dem einen oder anderen Grund dankbar, andere hassen ihn für etwas, das er getan hat, und wieder andere haben bloß höllische Angst vor ihm. Er ist schwer fassbar und unheimlich … Als wir mit unseren Drinks fertig waren, zog der Boss sein Handy hervor und tat so, als würde er telefonieren.
›Wir gehen‹, sagte er betont gelassen. Doch da stand B schon direkt hinter ihm. Wir hatten ihn nicht kommen sehen, weil wir es vermieden hatten, in seine Richtung zu schauen. Trotzdem hätten wir ihn bemerken müssen. Vielleicht lag es daran, dass es in dem Laden so dunkel war.«
Der Rezeptionist hält inne. Ich warte darauf, dass er weiterspricht. Wieder klickt sein Feuerzeug, und ich höre ihn ausatmen.
»›Du hast da was verloren‹, hat er gesagt. Als ich mich umdrehte, hatte B das Zigarettenetui von einem meiner Kumpels in der Hand. Der nahm es zurück und bedankte sich so natürlich wie möglich. Mehr ist nicht passiert. B wirkte bedrohlich, aber sonst war an der Situation nichts Ungewöhnliches. Das dachte ich zumindest. Am nächsten Tag war mein Kumpel tot.«
»Wie bitte?«
»Er wurde in seinem Hotelzimmer umgebracht. Nachdem man ihn gefoltert hatte. Das kann man nicht verstehen, oder? Ich begreife nicht, warum er sterben musste.«
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
»Ich fragte unseren Boss, was das zu bedeuten habe. Er meinte nur, wir hätten nie in jene Kneipe gehen dürfen. Was man nicht versteht, macht einem Angst. Wir wollten schnell weg aus Belgien. Der Plan war, getrennt abzureisen und uns in Berlin wiederzutreffen … Ich fuhr also allein zum Brüsseler Hauptbahnhof. Als ich mich dort auf eine Bank am Bahnsteig setzte, saß B neben mir.«
Der Rezeptionist klingt heiser.
»Ich war sprachlos. Das Ding ist, dass er sich nicht neben mich, sondern ich mich neben ihn gesetzt hatte … Als wäre ich ihm direkt in die Arme gelaufen. Manche Dinge übersieht man oder nimmt sie nicht bewusst wahr, obwohl man sie eigentlich doch sieht. Ich war einmal in Japan und kenne die Convenience Stores in Ihrem Land. Sie befinden sich häufig im Erdgeschoss normaler Wohngebäude. Und weil man so auf ihre grellen Lichter fixiert ist, bemerkt man die Wohnungen in den oberen Stockwerken gar nicht. Dabei sind sie die ganze Zeit in unserem Blickfeld, und wir nehmen sie auf einer unbewussten Ebene wahr. So ähnlich war es auch damals am Bahnhof.«
Ich frage ihn nicht, warum er glaubt, der unbewusste Teil seines Geistes habe ihn dazu gebracht, sich neben einen derart gefährlichen Mann zu setzen.
»Ich bemerkte B erst, als ich schon dabei war, mich hinzusetzen, oder ganz kurz davor. Ich bekam Angst und war wie erstarrt, aber gleichzeitig fühlte ich mich zu ihm hingezogen, fast so, als suchte ich bei ihm Schutz … Auf dem Bahnsteig war es neblig, und B sah mich nicht an. Aber er sprach mit mir. Er sagte: ›Mir ist ein neues Grimm’sches Märchen eingefallen.‹«
»Ein neues Grimm’sches Märchen?«
»Ich habe es auch nicht kapiert. Seit dem Tod meines Kumpels verstand ich so einiges nicht mehr. Also sagte ich nichts und ließ B weiterreden. ›Es waren einmal zwei Brüder. Der ältere war grausam, und der jüngere war gut. Der ältere Bruder hatte ein schönes blaues Mal in Form eines Schmetterlings auf seiner Wange, der jüngere hatte ein wunderschönes drittes Auge. Die beiden waren grundverschieden, doch sie verstanden sich gut. Eines Tages gingen sie gemeinsam auf Reisen, um nach einer neuen Arbeit zu suchen, wobei sie in einen Sturm gerieten und starben.‹ Damit hörte die Geschichte auf.«
»Was wollte er damit sagen?«
»Gute Frage. Er wollte wissen, was ich von der Geschichte halte. Während ich noch über meine Antwort nachdachte, kam mein Zug, und ich stieg ein. B folgte mir nicht und sah auch nicht in meine Richtung. Er blieb sitzen, als hätte er noch etwas anderes vor … Vielleicht denken Sie, ich bin übergeschnappt, aber in jenem Moment kam mir etwas Seltsames in den Sinn. Als B in der Kneipe zu meinem Kumpel sagte, er habe etwas verloren, streifte seine Hand beiläufig meine Schulter beziehungsweise die Jacke, die ich darüber trug. Im Zug fing ich auf einmal an, mir Gedanken über meine Schulter zu machen. Das ist völlig unlogisch, und vielleicht war ich bloß durcheinander, aber ich hatte das starke Gefühl, durch die Berührung mit B verbunden zu sein. Meine Jacke war schon alt, und möglicherweise tat ich es nur deshalb: Ich stieg bei einem längeren Halt aus und stopfte sie in einen Mülleimer auf dem Bahnsteig. Ich kann es nicht erklären, aber ich hatte das Gefühl, das sei besser so.«
Der Rezeptionist verstummt. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll, also warte ich, bis er weiterredet.
»Manchmal muss ich noch an jene dunkle Kneipe voller Zigarettenqualm denken und an den nebligen Bahnsteig in Brüssel, wo ich B zum zweiten Mal traf. Das alles kommt mir unwirklich vor, aber wir waren zweifellos in der Kneipe und haben sie wieder verlassen, wonach einer von uns gestorben ist. Ich habe B am Bahnhof wiedergetroffen, lebe aber noch. Mir kommt vieles aus jener Zeit nicht real vor. Sind Sie ihm schon einmal begegnet?«
»Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin diesem B begegnet. Er stand ganz plötzlich in meiner Wohnung. Er war redselig und ziemlich unheimlich.«
»Redselig? So war er also für Sie.«
»Für mich?«
»Als wir ihn trafen, wirkte er schwermütig. Aber dass er wie aus dem Nichts auftauchte, war gleich. Alles ging schnell.«
Ich denke über die Worte des Rezeptionisten nach.
»Jedenfalls sollten Sie Köln verlassen. Um acht Uhr früh ist auf der Straße vorm Hotel am meisten los, und man bekommt immer ein Taxi. Dann sollten Sie sich auf den Weg machen.«
»Verstehe, danke.«
»Ich will Ihnen helfen. Wissen Sie, ich war mal mit einer Japanerin zusammen, konnte sie aber nicht glücklich machen. Das ist Teil meiner Vergangenheit, mit der Sie eigentlich nichts zu tun haben sollten. Aber anscheinend gibt es ja doch Berührungspunkte. Das heißt, meine Geschichte ist nun mit Ihrer verbunden. Wobei das in Wirklichkeit wohl für alle Geschichten gilt.«
Anh hatte etwas Ähnliches gesagt. Und nicht nur sie.
»Meine letzten paar Tage waren seltsam. Neulich hat zum Beispiel rein zufällig ein alter Klassenkamerad in diesem Hotel übernachtet. Irgendwie gibt mir das alles ein ungutes Gefühl. Ich bin ziemlich abergläubisch. Sie sollten jedenfalls vorsichtig sein und diesen Ort so schnell wie möglich verlassen.«
Drei Optionen
Am nächsten Morgen will ich das Hotel, wie mir geraten wurde, um acht Uhr verlassen. Der Rezeptionist ist verschwunden. Stattdessen sitzt ein älterer Herr am Empfang.
Als ich ihn beiläufig nach dem jungen Mann von gestern frage, verzieht er langsam den Mund.
»Sie reden von meinem Sohn. Er brauchte ganz plötzlich eine Auszeit und hat die Stadt verlassen. Unfassbar, oder? Ich dachte, er hätte sein Leben seit Jahren wieder im Griff.«
Mir fällt keine Erwiderung ein. Komisch, dass er mir das überhaupt erzählt. Oder habe ich es mir nur eingebildet? Ich checke aus und steige in ein wartendes Taxi. Ich weise den Fahrer an, einfach loszufahren. Hier in Köln kann ich nicht bleiben. Aber wo soll ich dann hin? Am besten, ich verlasse Deutschland. Von hier aus wäre ich schneller in Amsterdam als in Paris. Aber es ist trotzdem keine Strecke, die ich mit einem Taxi zurücklegen kann. Wir biegen in eine schmale Gasse ein. Mir fällt auf, dass der Seitenspiegel einen Sprung hat.
»Verzeihung, aber warum sind Sie abgebogen?«
Der Fahrer schweigt.
»Hören Sie mal, was soll das?«
Jetzt zieht er das Tempo an. Ich verliere im Sitzen das Gleichgewicht.
»Was …?«
Ich drehe mich um. Hinter uns fährt ein schwarzer Luxusschlitten. Ich setze an, etwas zu sagen, als ich den Schweiß am Hals des Fahrers bemerke.
»–––«
Er redet auf Deutsch mit mir. Ich verstehe ihn nicht, aber mir ist klar, dass er Angst hat.
Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wurde er dazu gezwungen, mich irgendwohin zu bringen? Steckt er mit meinen Verfolgern unter einer Decke? Ich verstehe nichts mehr.
»–––! –––!«
Jetzt schreit der Fahrer etwas, und sein Wagen wird mit einem Mal langsamer. Wenn er anhält, bin ich geliefert. Die Straße ist menschenleer. Meine Verfolger werden mich schnappen.
»Warten Sie. Fahren Sie wohin, wo mehr Leute sind!«
Das Taxi hält an. Soll ich aussteigen? Am liebsten hätte ich den Fahrer angebrüllt, aber das hätte nichts gebracht. Kein Mensch in Sicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auszusteigen und loszurennen. Von hinten nähert sich der große Wagen. Werden sie auf mich schießen? Oder gehen sie nicht so weit? Ich biege um eine Ecke und sehe Passanten.
Vor mir ein Zaun. Ich versuche daran hochzuklettern, aber es klappt nicht. Meine Schuhe finden in dem Gitter keinen Halt. Dabei sieht er überwindbar aus. Auf einmal verbiegt sich der verrostete Teil der Maschen dieses regelmäßig geformten schwarzen Zauns auf seltsame Weise vor meinen Augen. Drahtzäune geben den Blick auf die andere Seite frei, während sie den Weg dorthin versperren. Das Gitter verschwimmt, verdoppelt und verdreifacht sich.
Mir wird schwindelig, und ich widerstehe dem Drang, mich auf den Boden zu setzen. Ein Passant sieht mich schief von der Seite an. Ich gebe den Zaun auf und renne die Straße entlang. Der Luxuswagen überholt mich und hält vor mir an. Ich drehe mich um und renne wieder zurück. Auf dieser Straße lässt es sich schwer wenden. Ein Mann steigt aus dem Auto und rennt mir lustlos hinterher. Ich wechsle die Seite und biege in eine Straße mit Wohnhäusern ein, die auf einer Seite von Bäumen gesäumt ist.
Ich fliehe, kommt es mir plötzlich in den Sinn. Ich bin auf der Flucht. Immer wieder halte ich mir diese Offensichtlichkeit vor Augen.
Aber etwas stimmt hier nicht. Ja, ich werde verfolgt, aber meine Verfolger scheinen es nicht ernst zu meinen. Ist es wegen der Passanten oder weil es irgendwo Überwachungskameras gibt? Keine Ahnung. Ich erreiche einen winzigen Park und biege in die nächste kleine Straße ein. Meine Verfolger sind nicht mehr zu sehen, aber vielleicht habe nur ich sie aus den Augen verloren, sie mich aber nicht. Meine Beine führen mich in immer verlassenere Gegenden, je mehr ich mich bemühe, die Männer abzuschütteln.
Schwer atmend irre ich die kühle Straße entlang. Sie hat Kopfsteinpflaster. Trockene Kälte kriecht mir von unten in die Knochen. Für uns Asiaten hat europäisches Kopfsteinpflaster etwas Hartes, Kaltes und Einsames. Es ist schön anzusehen, hat aber nicht die weiche Wärme von Asphalt. Eine Seite der kalten, hübschen Steinstraße scheint ganz langsam nach unten abzusacken. Das muss Einbildung sein, sage ich mir, aber es fällt mir schwer weiterzulaufen.
Warum kommt keiner? Sie haben mich bestimmt nicht verloren. Orten sie mich mit einem GPS-Tracker? Aber ich habe meine gesamte Kleidung und den Rucksack überprüft.