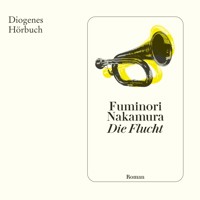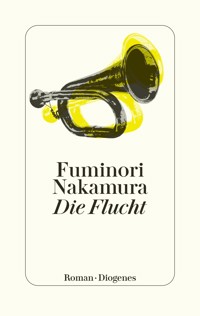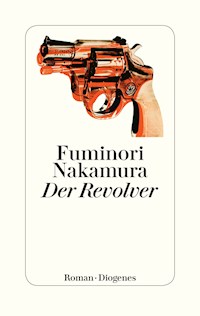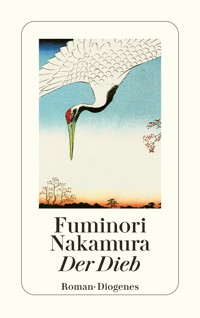10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die mächtige japanische Kuki-Familie folgt einer menschenverachtenden Tradition: Der jeweils jüngste Sohn wird dazu erzogen, das Böse über die Menschheit zu bringen. Und so erhält Fumihiro eine Ausbildung, deren Ziel Zerstörung und Unglück ist, so viel ein einzelner Mensch nur vermag. Doch er hat andere Pläne: Fumihiro liebt das Waisenmädchen Kaori und will sie beschützen – und damit wird sein eigener Vater zu seinem schlimmsten Feind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Fuminori Nakamura
Die Maske
Roman
Aus dem Japanischen von Thomas Eggenberg
Diogenes
Aus dem Tagebuch eines Kriminalbeamten
Während sich der große Fall einer überraschenden Lösung näherte, wurde die Tatsache kaum beachtet, dass in seinem Umfeld mehrere Menschen eines unnatürlichen Todes starben. Ob sie wirklich mit dem Fall zusammenhängen, ist noch immer unklar, und da das wichtigste Beweismittel nun verschwunden ist, werden wir die Wahrheit wohl nie erfahren.
Ich sollte nur gegen einen bestimmten Verdächtigen ermitteln, aber heute glaube ich, es handelte sich eigentlich um ein Paar, ein Mann und eine Frau. Auch wenn ich nur Teil eines Ermittlungsteams gewesen bin, frage ich mich, ob wir den Fall überzeugend aufgeklärt haben. Vielleicht bin ich die ganze Zeit über einem fatalen Irrglauben aufgesessen? Mir geht der Gedanke nicht aus dem Kopf, dass ausgerechnet ich durch einen Zufall der Wahrheit am nächsten gekommen bin. Der Wahrheit über eine ganze Serie von Ereignissen, die miteinander verbunden schienen, sich aber nicht miteinander verbinden wollten.
Wie das Paar zueinander stand, was für eine Art von Beziehung das war, kann ich nicht genau sagen; aber von Anfang an hatte ich eine Vermutung, die mich nicht mehr losließ. Würde der Mann mir anbieten, mir alles über die rätselhaften Ereignisse und über sein Leben zu erzählen, ich würde es zu gerne hören. Nicht, weil es mir um die Lösung des Falles geht, sondern aus menschlichem – oder besser: mitmenschlichem – Interesse.
Als Kriminalbeamter habe ich mich von Berufs wegen mit dem Leben anderer beschäftigt. Mein eigenes Leben trat dabei vollkommen in den Hintergrund. Ich habe meine Nase in fremde Angelegenheiten gesteckt und im Namen des Gesetzes dafür gesorgt, dass Menschen für ihre Vergehen bestraft werden. Es mag seltsam klingen, aber die Hauptrolle spielten immer die Verbrecher – gemessen an der Zeit, die ich über ihre Leben nachdachte. Sie gaben den Ton an, und ich war nicht mehr als ein Beobachter.
Wenn diese Geschichte Fiktion wäre, wäre ich nur ein Nebendarsteller, der ab und zu seinen kleinen Auftritt bekommt. Dennoch würde ich mich gerne noch etwas länger mit diesem Mann unterhalten, der in einer merkwürdigen Familie geboren und aufgezogen wurde und der, wenn mich mein Gefühl nicht trügt, schlussendlich den falschen Weg gewählt hat. Jetzt möchte ich erst recht alles über ihn erfahren.
Nicht um den Fall zu lösen, sondern aus menschlichem Interesse. Noch dazu als ein Mensch, der trotz seines Berufs immer eine gewisse Abneigung gegen die Gesellschaft hegte.
Teil 1Vergangenheit
1
»Was ich dir zu sagen habe, wird für dein Leben von großer Bedeutung sein.«
Ich war elf, als mein Vater mich in sein Arbeitszimmer rief. Er trug einen schwarzen Anzug und sank schwer in das weiche Ledersofa – er war ein alter Mann, und das Stehen machte ihn müde. Durch einen Spalt im Vorhang schien die untergehende Sonne. Im orangefarbenen Gegenlicht war Vaters Gesicht nur als Silhouette zu erkennen. Ich umklammerte ein ferngesteuertes rotes Auto, an dessen Rädern noch Dreck klebte, und fühlte mich klein und verloren in dem großen, kalten Raum. Es roch nach Alkohol, als Vater weitersprach.
»Es geht um deine Erziehung. Was nicht bedeutet, dass ich mir große Hoffnungen mache. Ich will ein Geschwür in diese Welt setzen. Unter meiner Obhut wirst du zu diesem Geschwür heranwachsen. Ein Stachel des Bösen, sozusagen.«
Ich konnte seine Gesichtszüge nicht sehen, aber es war unwahrscheinlich, dass er grinste oder sonst eine Miene verzog. Wie immer muss sein Blick starr und ausdruckslos gewesen sein.
»Meine anderen Kinder sind bereits erwachsen und geachtete Mitglieder der Gesellschaft. Und zwar deshalb, weil sie ungebeten in diese Welt kamen und ihren eigenen Weg gehen konnten. Dich aber habe ich mit einer bestimmten Absicht gezeugt. Als ich schon über sechzig war. Das hat in meiner, nein unserer Familie eine gewisse Tradition.«
Das Gegenlicht blendete mich noch immer.
»Mit ›Geschwür‹ meine ich etwas, das die Welt ins Unglück stürzt. Jeder soll sich wünschen, niemals in diese Welt hineingeboren worden zu sein, oder zumindest denken, dass es hier nichts Gutes mehr gibt.«
Es klopfte an die Tür. Auf Vaters Wink hin trat eine junge Hausangestellte ein. Ihre Augen waren groß und klar, der Nasenrücken schlank, die Lippen schmal. Vermutlich war sie genau sein Typ. Auf unserem Anwesen waren mindestens sieben von ihnen beschäftigt. Sie flüsterte ihm etwas zu, und er nickte. Sie solle sie hereinbringen, grummelte er. Die Hausangestellte ging leise aus dem Zimmer.
»Das jüngste Beispiel findet sich in der Taishō-Zeit, vor fast achtzig Jahren. Als unser Vorfahre die sechzig überschritten hatte, nahm er diesen Brauch wieder auf – den Brauch, der Welt ein Geschwür zu hinterlassen. Er schien zu spüren, dass sein Leben sich dem Ende näherte, die Welt aber nicht mit ihm enden würde. Das konnte er nicht akzeptieren. Schließlich hatte er immer alles bekommen, was er wollte, und war arrogant, so wie ich es auch bin. Wenn er denn sterben musste, sollte auch alles andere zugrunde gehen. Am 18. Juni 1915 brachte eine junge Frau sein Kind zur Welt. Ein Kind, das eine negative Kraft sein und überall Unglück säen sollte. Es sollte Menschen das Leben zur Hölle machen, so dass sie am Ende glaubten, das Leben hätte keinen Sinn. Und die Saat fiel auf fruchtbaren Boden. Auf dem Sterbebett, heißt es, hätte sich der alte Mann nicht mehr vor dem Tod gefürchtet. Er sei zuversichtlich gewesen, dass die vom Geschwür befallenen unglücklichen Menschen ihrerseits Unglück verbreiten und sich immer mehr Geschwüre bilden würden, wie endlos überquellender Schaum. So würde die Welt langsam, aber sicher für ihr eigenes Ende sorgen. Er war stolz darauf, eine Kreatur gezeugt zu haben, die auch nach seinem Tod, an seiner statt, das Leuchten der Welt in rabenschwarze Dunkelheit verwandeln würde. Noch bevor er starb, erfuhr der Alte vom Ausbruch des Pazifikkriegs. Sein Geschwür hatte damit nichts zu tun, beging aber als hochrangiger Offizier alle denkbaren Greueltaten – derart teuflisch, dass Gott die Augen verschloss.«
Die Tür öffnete sich, und ein Mädchen betrat den Raum, das ich noch nie gesehen hatte. Ich spürte einen kalten Luftzug. Sie kam auf dünnen Beinen näher, und die schräg einfallenden Lichtstrahlen ergossen sich über ihr Gesicht, färbten es orange, spiegelten sich in den großen Augen. Mir stockte der Atem, so überrascht, ja gebannt war ich von diesen Augen, die mit dem Licht zu verschmelzen schienen. Dennoch versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen, da auch mein Vater sie ignorierte.
»Mit dem Reichtum und der Macht, die uns über Generationen hinweg vererbt worden sind, sind uns keine Grenzen gesetzt. Und wenn wir spüren, dass die Zeit knapp wird, setzen wir ein solches Geschwür in die Welt. Das ist viel unterhaltsamer, als an den Tod zu denken. Natürlich kam es nicht in jeder Generation dazu. Aber hin und wieder erinnert sich jemand daran und lässt den Brauch wiederaufleben. Das habe ich getan. Vor einigen Jahren wollte eine religiöse Gruppe ein Atomkraftwerk unter ihre Kontrolle bringen. Als die Staatssicherheit das Vorhaben vereitelte, begingen sämtliche Sektenmitglieder Selbstmord. Bei der Radikalisierung dieser Gruppe spielte ein Student der Universität Tokio eine wichtige Rolle. Er war einer von uns, und zwar der Sohn jenes Offiziers aus der Taishō-Zeit.«
Das Mädchen war ungefähr gleich alt wie ich und trug ein weißes Kleid. Eine große Tasche in der Hand, schaute sie mich und meinen Vater fragend an. Wie benebelt nahm ich die zarte Schwellung ihrer Brüste wahr, und selbst als ich meinen Blick wieder auf Vaters verschattetes Gesicht richtete, sah ich noch immer das orange schimmernde Weiß ihres Kleides vor mir.
Der riesige ungeheizte Raum schien ihr unheimlich zu sein. An den Wänden hingen ausgestopfte Hirschköpfe. Die Geweihe ragten weit in den Raum, und wie als Beweis, dass diese Köpfe nicht mehr lebten, lag eine dünne Staubschicht auf ihnen. Außer dem Sofa, auf dem mein Vater saß, gab es einen wuchtigen schwarzen Tisch und altertümliche Regale, die mit Töpferwaren und Büchern aller Art überfüllt waren.
»Zunächst musst du dir gewisse Fähigkeiten aneignen.« Vaters Lektion war noch nicht zu Ende. »Du musst Macht haben in dieser Welt, denn wenn eine mächtige und zugleich fähige Person zum Geschwür wird, ist sie besonders gefährlich. Du seist sehr intelligent, habe ich gehört. Das verdankst du deiner bisherigen Erziehung. Die Unterschiede zwischen den Menschen sind nicht so groß wie die zwischen Mensch und Affe. Talent bedeutet lediglich, sich mehr als andere anstrengen zu können. Und das kannst du, weil du es gewohnt bist, dich anzustrengen; das heißt, du verfügst über Ausdauer und Willenskraft. Doch von jetzt an musst du auch lernen, Trägheit und Resignation zu widerstehen. Jeden Gedanken ans Aufgeben zu verbannen. Weiter musst du lernen, wie man geschickt kommuniziert, wie man das Spiel zwischenmenschlicher Beziehungen beherrscht. Vor einer Woche hat ein junger Mann auf offener Straße wahllos Leute attackiert. Ich wünsche mir nicht, dass du dich mit derlei Kleinkram begnügst. Unter meiner Obhut sollst du ein außergewöhnlicher Mensch werden. Und wenn du vierzehn bist, zeige ich dir die Hölle.«
Mein Vater rührte sich keinen Millimeter. Er musste weit über siebzig sein, und seine Beine waren spindeldürr. Das Mädchen, noch immer mit der Tasche in der Hand, stand still neben mir.
»Eine Hölle, nach der du dich von der Welt abwenden wirst, grausam und schockierend. Und dieses Mädchen hier wird dabei eine Hauptrolle spielen. Ich warte aber noch bis zu deiner Pubertät. Zu dieser Zeit wird deine Psyche sowieso allerlei Komplikationen verursachen. Du wirst geradezu besessen sein vom Bösen und das Bedürfnis haben, die Menschen um dich herum mit diesem Bösen in dir zu vergiften. Doch das ist nur der Anfang. Mit fünfzehn werde ich dir wieder die Hölle zeigen und noch einmal mit sechzehn. Mit achtzehn schließlich wirst du eine Wahrheit über dein Leben erfahren. All das ist bereits entschieden und wird sich nicht mehr ändern.«
Mein Vater bewegte sich ein wenig. Sein Gesicht tauchte kurz aus dem Schatten auf, und ich konnte sehen, wie vollkommen ausdruckslos es war. Dann verdunkelte es sich wieder.
»Dein Platz wird im Nervenzentrum dieses Landes sein oder aber auf einer Schlüsselposition in einer der Organisationen, die es bekämpfen. Dort wirst du Böses tun, bis diese Welt eines Tages, so hoffe ich, verenden wird. Dafür brauchst du Geld. Ich werde dafür sorgen, dass du mehr von meinem Vermögen bekommst als deine Geschwister.«
Er hielt inne und holte tief Luft. Noch immer ließ die untergehende Sonne die Augen des Mädchens im orangefarbenen Licht erstrahlen. Sie waren vor Furcht geweitet.
»Warum erzähle ich dir das alles? Es gibt drei Gründe: Erstens bin ich außerordentlich betrunken. Zweitens wirst du dich nicht lange an dieses Gespräch erinnern, weil du noch viel zu klein bist, in deinen kurzen Hosen und mit deinem Spielzeugauto in der Hand.«
Ich dachte, Vater würde jetzt lachen, aber er lachte nicht.
»Und drittens: Deine Mutter war eine gute Frau. Sie verbrachte ihre Nächte mit einem alten Mann wie mir und gebar dich. Sie verlor den Glauben nie. An das Gute, das ich in meinem Leben stets verachtete, oder nein, einfach nicht begreifen konnte. Ich bewundere das. Und es war meine Chance. Aber du wirst dieses Gespräch sowieso bald vergessen. Wer weiß, ob du überhaupt etwas verstanden hast. Es könnte genauso gut ein Traum sein.«
Vater erhob sich. Im Licht, das ihn vom Fenster her umflutete, wirkte sein Körper wie ein großes, schwarzes Nichts.
»Dieses Mädchen wird ab heute hier wohnen. Freundet euch an. Der Hölle zuliebe, die du eines Tages sehen wirst, dem Geschwür zuliebe, zu dem du heranwachsen wirst. Aber glücklich werdet ihr nie sein. Nie. Und jetzt geh schlafen. Dann wird dir alles wie ein Märchen erscheinen. Du bist ja noch ein Kind. Und etwas Einfältigeres als Kinder gibt es nicht.«
Abrupt drehte mein Vater sich um, nahm, als hätte er uns bereits vergessen, ein Buch aus dem Regal und öffnete die Tür, die in ein Hinterzimmer führte. Sie öffnete sich ohne jeden Laut – wie jede Tür, die er benutzte. Das Mädchen im weißen Kleid starrte unverwandt auf die Hirschköpfe mit den riesigen Geweihen.
Doch Vater irrte sich. Ich war bereits ein Geschwür. Das Spielzeugauto hatte ich nur mitgenommen, um ihn zu täuschen. In Wahrheit überlegte ich die ganze Zeit, wie ich ihn auslöschen könnte. Diese Pläne beschäftigten mich schon lange, jeden einzelnen Tag.
2
Wie viele Zimmer das Haus hatte, wusste ich damals nicht.
Hinter dem Haus war ein von dichtem Gehölz überwachsener Hügel, und im Garten gab es zwei Teiche, um die herum große Steinbrocken lagen. Der verwilderte Hügel war sich selbst überlassen, aber in den gepflegten Teichen schwammen Karpfen. Karpfen können alt werden, aber seltsamerweise lebten die Fische auf unserem Anwesen nie lange.
Neben den jungen Hausangestellten war da noch eine ruhige Frau mittleren Alters. Sie hieß Tanabe und trug die Hauptverantwortung für alles, was im Haus getan werden musste. Zuerst dachte ich, sie sei meine Mutter, doch das stimmte nicht. Ich hatte keine Ahnung, wo meine Mutter war. Nie verlor jemand ein Wort über sie, ob sie am Leben oder tot war.
Das Mädchen mit dem weißen Kleid hieß Kaori. Sie war von Vater aus dem Kinderheim geholt und adoptiert worden. Nicht einmal sie selbst wusste, wie ihr Familienname gewesen war, also bekam sie den gleichen wie ich, Kuki. Unser etwas düster und abweisend wirkendes Haus lag in der Gegend von Nagoya, Präfektur Aichi. Das Haus steht noch immer, aber keiner der Kukis lebt mehr dort.
Kaori und ich besuchten die örtliche Grundschule. Eigentlich hatte ich erwartet, wie meine Geschwister auf eine Privatschule zu gehen, doch Vater erlaubte es nicht. Um mit Leuten aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu kommen, sei eine öffentliche Schule besser, war sein Argument. Damit ich ein Geschwür werden könne, müsse ich mich unter alle Arten von Menschen mischen und lernen, mit ihnen umzugehen.
Den größten Teil meiner schulischen Ausbildung verdankte ich aber drei Hauslehrern. Ich erinnere mich kaum mehr an sie, bis auf einen. Er war noch jung, und obwohl er nur kurze Zeit bei uns blieb, brachte er ein wenig Abwechslung in meinen eintönigen Alltag.
Er war überaus kräftig gebaut. Hinter seinem Rücken sprachen die Hausangestellten und ich nur vom »Muskelmann«. Als er es merkte, fand er Gefallen daran und begann, sich selber »Muskelmann« zu nennen. Dabei war er überhaupt nicht kräftig und bewegte sich so schwerfällig, dass ich mich fragte, wozu all die Muskeln gut sein sollten. Oft war er taktlos, dann sagte er zum Beispiel zu einem Dienstmädchen, dessen Augen zu weit auseinanderstanden: »Wie praktisch, so ein 180-Grad-Blick!« Meistens lachte ich nur deshalb über seine Bemerkungen, weil von Kindern erwartet wird, dass sie so etwas lustig finden. Aber manchmal war mein Lachen auch echt, und ich schämte mich im Nachhinein dafür.
Meine Schulzeit war mehr oder weniger ereignislos. Ich hatte nicht viel mehr zu tun, als meine Traurigkeit vor den anderen zu verstecken. Niemand durfte erfahren, dass ich regelmäßig durchs Dickicht auf den Hügel hinter dem Haus kletterte und oben von den Felsen Eidechsen und anderes Getier hinunterschmiss; oder dass ich im Haus Haare und abgeschnittene Fingernägel vom Boden aufhob und in einer Schachtel aufbewahrte, im Glauben, zumindest ein Teil davon könnte meiner Mutter gehören. Doch auch ohne diese Absonderlichkeiten – einer, der in einem geradezu unverschämt protzigen Haus wohnte und immer nur lernte, hatte beste Chancen, der Klassendepp zu sein. Also versuchte ich, meine Umgebung mit Gelächter zu täuschen: He, seht mal, er ist zwar ein Kuki, aber er hat den gleichen Humor wie wir. Er ist gar kein Streber!
Unser Klassenlehrer zum Beispiel war so dick, dass es aussah, als könnte er jeden Augenblick platzen. Er hatte die Angewohnheit, dauernd zu sagen: »Um euch ein konkretes Beispiel zu geben«, und dann kam doch nie etwas Konkretes. Ich gab ihm den Spitznamen »Concrete Bomb«. Während des Unterrichts zählte ich, wie oft er den Satz vom konkreten Beispiel sagte, und verkündete am Ende der Stunde meinen Klassenkameraden das Resultat. »Um euch ein konkretes Beispiel zu geben, Nenner und Zähler sind wie Currysoße und Pfannkuchen« – er liebte solche Sätze und garnierte den ganzen Unterricht damit. Wenn er die Floskel mehr als vierzig Mal benutzte, würde sein immer dicker werdender Bauch explodieren. Mit dieser Vorstellung im Kopf verfolgten wir gespannt und aufgekratzt zugleich den Unterricht. Ich fühlte mich damals schrecklich, andere Menschen täuschen zu müssen, um meinen Schwermut vor ihnen zu verbergen, aber später wurde mir bewusst, dass es vielen anderen ähnlich ergangen war.
Kaori und ich waren in der gleichen Klasse. Hochgewachsen, wie sie war, und mit ihren großen Augen erregte sie überall Aufmerksamkeit. Concrete Bomb erzählte der Klasse die gutgemeinte Lüge, sie sei eine entfernte Verwandte von mir. An ihrem ersten Schultag bei uns machten wir Hochsprung. Als sie höher sprang als alle anderen Mädchen, ging ein Raunen durch die Reihen. Ich war allerdings weniger an ihren sportlichen Leistungen interessiert als an ihren weißen Beinen, die auf der blauen Matte aus den kurzen Turnhosen hervorsahen. Wie schämte ich mich für meine gierigen Blicke. Wenn Vater sagte, wir sollten uns anfreunden, musste ich mich in Wahrheit genau davor hüten. Ich versuchte wegzuschauen, aber ich war viel zu jung. Ehe ich mich’s versah, klebte mein Blick schon wieder an ihr.
Nach der Schule machten wir uns zusammen auf den Heimweg. Seit mein Vater den Fahrer entlassen hatte, ging ich die Strecke immer zu Fuß.
»Toll, wenn man so reich ist«, sagte Kaori.
»Nein, gar nicht toll.«
»Ich finde schon. Und du bist auch gut in der Schule, oder? Bei mir ist es hoffnungslos.«
Sie lachte ungezwungen, und ich konnte ihre Zähne sehen. Mir fiel auf, wie seltsam der kindliche Schulranzen an ihrer hochgeschossenen Gestalt aussah.
»Für den Reichtum kann ich ja nichts. Und in der Schule bin ich nur deshalb gut, weil ich zu Hause Unterricht bekomme. Das ist nichts Besonderes, wirklich nicht.«
Immer wenn ich meine Schauspielerei vergaß, hatte ich damals die Angewohnheit, selbst bei Kleinigkeiten zu widersprechen. Sie machte ein nachdenkliches Gesicht. Ich musste weiterreden, um keinen falschen Eindruck zu erwecken.
»Deswegen will ich erwachsen sein. Dann kann ich aus eigener Kraft etwas Großes vollbringen.«
Es klang nicht sehr überzeugend. Sie schaute mich verwundert an. Eine Weile liefen wir schweigend nebeneinander her, dann lachte sie auf einmal und sagte: »Aber du liebst es, dich über unseren Bombenlehrer lustig zu machen, oder etwa nicht?«
Ich hatte fünf ältere Geschwister, die ich noch nie gesehen hatte. Sie lebten in Tokio und waren nicht einmal gekommen, als ich geboren wurde. Mein Vater hieß Shōzō, aber weder mein ältester Bruder noch die anderen Geschwister hatten Namen, die seinem ähnlich waren. Mein erster Bruder war fünfundzwanzig Jahre älter als ich, der zweite Bruder dreiundzwanzig Jahre, meine erste Schwester achtzehn Jahre, der dritte Bruder fünfzehn Jahre und die zweite Schwester zwölf Jahre älter. Irgendwann erfuhr ich, dass jener Sektenanhänger, Student und Doktorand der Universität Tokio, auch einen Sohn hatte, im gleichen Alter wie ich. Ich fragte mich, ob er auch ein Geschwür sei, und stellte mir vor, dass ich den Jungen und alle meine Geschwister eines Tages vielleicht kennenlernen würde.
Als wir nach Hause kamen, stand der Muskelmann vor dem schattigen Eingangstor. Er blaffte mich an, ich sei zu spät, doch dann entdeckte er Kaori. Beflissen streckte er die Hand aus und stellte sich mit seinem Spitznamen vor. Ob ihr seine massige Erscheinung nicht ganz geheuer war oder sie abschreckte, wie er schwitzte, weiß ich nicht; jedenfalls zögerte sie, ihm die Hand zu geben.
»Zu spät? Aber ich hab doch noch fünf Minuten, oder?«
»Na ja, mich kümmert’s nicht, aber … meine Muckis«, grummelte er und ließ demonstrativ seine Brustmuskeln spielen.
Kaori staunte und stieß vor Entzücken einen Schrei aus. Und gewohnt taktlos fügte er hinzu: »Du und Fumihiro, vielleicht heiratet ihr mal.«
Ich war baff, aber Kaori schaute auf das im Halbdunkel liegende Haus und sagte: »Dann werde ich wie eine Prinzessin leben, nicht wahr?« Sie lachte übermütig. Von fern mag es wie eine glückliche Szene ausgesehen haben. Und wer weiß, vielleicht waren wir damals wirklich noch glücklich.
An einem der nächsten Abende rief mich Vater wieder zu sich. Es war das zweite Mal, nachdem er mir meine Zukunft eröffnet hatte. Bis dahin war ich ihm völlig gleichgültig gewesen. Ich nahm an, es würde wieder um das gleiche Thema gehen, und selbst wenn nicht – allein beim Gedanken, ihm gegenüberzustehen, wurde mir mulmig. Um mich zu beruhigen, nahm ich aus einer Schublade ein Bündel Aufkleber und hielt sie fest in meiner Hand.
Diesmal erwartete er mich in einem Raum, in dem nichts als ein langer Tisch mit sechs Stühlen und ein Fernseher standen. Der ehemals karminrote Teppich war ausgeblichen. Hier pflegte mein Vater zu essen, allein. Seiner Weisung gemäß aßen Kaori, ich und die Hausangestellten in einem anderen Raum.
Ich klopfte. Als ich keine Antwort hörte, öffnete ich vorsichtig die Tür. Mein Vater saß in einem der Stühle und schaute rauchend und mit ausdrucksloser Miene fern. Unmöglich herauszufinden, in welcher Stimmung er war. Auch diesmal roch es nach Alkohol. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er früher so viel getrunken hätte. Mit den unnatürlich schmalen Augen und der klobigen Nase wirkte sein Gesicht geradezu hässlich. Das halbe linke Ohr fehlte; ich hatte keine Ahnung, warum.
»Mein zweiter Sohn hat mit diesem Krieg zu tun«, sagte er plötzlich, ohne mich anzuschauen. Im Fernsehen wurde über einen Bürgerkrieg irgendwo in Afrika berichtet. Gerade nannte der Nachrichtensprecher die Zahl der Toten.
»Merk dir, was hier passiert. Sie sagen, es sei ein ethnischer Konflikt. Aber sie lügen. Man hetzt die Menschen absichtlich gegeneinander auf, und mein Sohn hat eine Konzession für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Ich kann mich nicht erinnern, ihn zu einem Geschwür erzogen zu haben, aber dennoch benimmt er sich wie eines. Ich muss mir etwas einfallen lassen.«
Vater drehte sich zu mir und bedeutete mir etwas. Ich verstand nicht, was er meinte. Dann zeigte er auf meine Hand mit den Aufklebern und sagte: »Leg die in den Aschenbecher. Und bring so etwas nie wieder hierher.«
Mir wurden die Knie weich, mein Herz begann, heftig zu schlagen. Ich tat wie geheißen, und Vater legte seine Zigarre obenauf. Sie glühte noch.
Die Aufkleber verfärbten sich schwarz und fingen in Sekundenschnelle Feuer. Kleine rote Flammen züngelten hoch, während im Fernsehen noch immer vom Krieg berichtet wurde. Reglos schaute ich in das flackernde Rot. Mir war nicht klar, was mein Vater damit erreichen wollte. Dachte er, mir würden diese Aufkleber etwas bedeuten? Oder störte ihn nur ihr billiger Glanz? Die Flammen wurden größer und größer, schwarzer Rauch stieg auf, und als es zu stinken begann, kippte Vater, ohne eine Miene zu verziehen, seinen Drink über das Feuer. Vermutlich nahm er den üblen Geruch, Indiz seiner Bösartigkeit, nicht mal wahr. Aus meinen Aufklebern war inmitten von Zigarrenstummeln ein Klumpen feuchter, schwarzer Asche geworden. Ich dachte an die Hölle, die Vater mir eines Tages zeigen wollte.
Doch die Aufkleber waren mir nicht wichtig. Ich tat nur so, um in den Augen meines Vaters wie ein Kind zu wirken. Ich wandte meinen Blick ab. Nein, er hatte mich nicht unter Kontrolle. Aber dann kam mir Kaori in den Sinn.
»Das reicht, geh«, sagte er mit leiser Stimme. »Was guckst du denn so? So benimmt sich doch kein Kind. Du musst deine Rolle noch üben, Dummkopf. Etwas Einfältigeres als Kinder gibt es nicht.«
Ich ging aus dem Zimmer und beschloss, zum Hügel hinter dem Haus zu gehen.
Ich holte eine Taschenlampe und verließ das Haus durch die Hintertür. Im Garten lief ich bis zu der Stelle mit dem Loch im Zaun. Die Bäume auf dem Hügel schwankten und knarzten im Wind, als bewegten sie sich aus eigener Kraft. Insekten streiften meine Wangen. Als ein Hund zu bellen begann, blieb ich stehen. Am Himmel leuchtete fahl der Mond, aber im Gehölz war es dunkel und kalt. Bisher war ich immer am späten Nachmittag auf den Hügel gestiegen, wenn die Sonne noch schien. Jetzt, in der Nacht, wurde mir angst und bange.
Meine früheste Erinnerung hat mit meinem Vater zu tun. Ich hatte gerade erst laufen gelernt, und die Hausangestellten versuchten, mich lachend einzufangen, während ich, ebenfalls lachend, vor ihnen floh, jeder Schritt beinahe ein Stolpern. Mir war, als schwebte ich in der Luft – vielleicht, weil ich noch keine richtige Kontrolle über meine Beine hatte; oder auch, weil ich stehend auf einmal so viel mehr sah. Auf einer Lehmwand entdeckte ich etwas wie einen grünen Schatten, rund und riesig. Ich wollte darauf zulaufen und prallte plötzlich gegen ein Hindernis. Als ich hochschaute, stand da mein Vater. Aus irgendeinem Grund wusste ich, dass es mein Vater sein musste. Seine Miene zeigte keine Regung. Mit dem Fuß schob er mich aus dem Weg, als wäre ihm ein Tritt zu mühsam gewesen.
Die Taschenlampe leuchtete mir den Weg durch das Gehölz. Das beruhigte mich ein wenig. Wenn ich so weit gekommen war, war es bis zum Loch nicht mehr weit. Es gab keinen Grund, warum ich mich vor meinem Hügel hätte fürchten sollen. Ich erinnerte mich an jenen Tag, als ich zufällig Vaters Kellerzimmer entdeckte. In unserem weitläufigen Haus gab es einen riesigen Keller, in dem sich über Jahrzehnte hinweg alte Möbel und allerlei Gerümpel angesammelt hatten. Ich war in der vierten Klasse der Grundschule, als ich mich zum ersten Mal dorthin verirrte. Von da an erkundete ich den Ort immer wieder. Natürlich erzählte ich niemandem davon. Eines Tages stieß ich auf eine Art Luke, die noch weiter in die Tiefe führte. Sie war versteckt unter ein paar alten Autoreifen. Das Tuch, auf dem die Reifen lagen, weckte meine Neugier. Es sah aus, als hätte es jemand besonders sorgsam dort drapiert. Als ich es wegzog, war da die Luke. Ich öffnete sie und sah vor mir eine schmale, steil abfallende Treppe, an deren Ende eine Tür zu erkennen war.
Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich spürte sofort, dass ich hier nichts zu suchen hatte, dass sich mein Leben für immer verändern würde, wenn ich auch nur einen Schritt weiterging. Die Türklinke glänzte. Ich hielt den Atem an und drückte sie nieder. Die Tür war nicht verschlossen.
Drinnen herrschte eine überwältigende, undurchdringliche Finsternis, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Sie schien sich wie ein Gewicht auf mich zu legen, den Eindringling. Ich musste an meinen Vater denken. Er war für mich die Verkörperung des Schreckens, und wann immer er mit mir sprach, wurden meine Hände, meine Füße, mein Herz und sogar meine Schläfen taub. Ich war für ihn ein Ding, das man mit dem Fuß umherschubsen konnte, und so wie ich ein Insekt zerquetschen würde, würde er mich zerquetschen, wenn ihm danach war. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich etwas weißlich Schimmerndes, das in der Schwärze zu schweben schien – ein Lichtschalter. Von der Helligkeit geblendet, kniff ich die Augen zusammen, und da sah ich plötzlich, in der Mitte des Raumes, ein Bett.
Mutter schläft. Das war, ich weiß nicht, warum, mein erster Gedanke. Aber in dem engen Raum war niemand, nur ein leeres Bett. Auf dem Bett lagen eine weiße Decke und ein Kissen, die Matratze war mit einem Laken bezogen. Das Bettzeug fühlte sich kühl an, aber wie bei der Türklinke hatte ich den Eindruck, dass nichts verstaubt war. Als ich näher ging, entdeckte ich im Bett vier Seile und auf Kissen und Decke verstreut eine unglaubliche Menge Haare.
Es war mir ein Rätsel, was das bedeuten sollte. Doch ich wusste, ich hatte etwas Außergewöhnliches entdeckt. Etwas, das meinem Vater gehörte und von dem er nie gewollt hätte, dass es jemand zu Gesicht bekommt. Ich getraute mich nicht, eines der Seile oder ein schwarzes Haarbüschel zu berühren. Von jenem Tag an verfolgte mich das Bett in dem pechschwarzen Raum bis in meine Träume. Manchmal hörte ich von dort unten die Stimme einer Frau, was eigentlich unmöglich war, denn der Raum war schallisoliert.
Vielleicht begann ich, auf den Hügel hinter dem Haus zu steigen, weil ich Vaters Finsternis bekämpfen wollte; weil ich mir, um mich zu schützen, meine eigene Finsternis schaffen wollte. Natürlich kam mir dieser Gedanke damals noch nicht.
Auch an jenem Tag, als meine Aufkleber zu Asche wurden und ich mit der Taschenlampe in der Hand auf den Hügel stieg, vermochte ich dieses Gefühl nicht in Worte zu fassen. Ich wusste nur, dass ich mich vor der Finsternis nicht fürchten durfte, und so kämpfte ich mich Schritt für Schritt voran. Endlich gelangte ich zu dem von einem Eisengitter bedeckten Loch im Fels. Ich hatte keine Ahnung, wozu es da war. Die Dunkelheit und das dichte Gehölz ließen mich erschauern, aber ich redete mir gut zu.
Ich folgte dem Zaun an der steil abfallenden Felswand, schob eine von Gestrüpp überwucherte Sperrholzplatte etwas zur Seite und langte nach dem kleinen Plastikkäfig, den ich das letzte Mal hier versteckt hatte. Darin befanden sich Eidechsen und Schnecken. Ich griff mir eine der Echsen, streckte den Arm durch den Zaun und ließ das Tier fallen. Ohne einen Laut wurde es von der Dunkelheit verschluckt. Ich konnte den Aufschlag nicht hören, stellte es mir aber vor. Dann nahm ich eine Schnecke und ließ auch sie fallen. Durch diese Opfer, dachte ich, würde meine eigene Finsternis tiefer und tiefer werden. Viel tiefer und vollkommener als die meines schrecklichen, unbegreiflichen Vaters.
3
Die Hausangestellten überhäuften Kaori mit Kleidern: eine blaue Jeans-Shorts, eine gelb gemusterte Strickjacke, ein weißer Rock, ein kurzer cremefarbener Mantel, ein rosa Sweatshirt mit hellblauen Streifen, ein dicker weißer Pullover. Kaori wollte diese teuren Klamotten gar nicht. Sie wollte lieber aussehen wie ihre Schulfreundinnen. Bis es jemand merkte, lief sie mit einer abgenutzten Tasche und einem kaputten Schirm herum. Wir waren im sechsten Jahr der Grundschule.
Ich beobachtete sie dauernd. Doch bevor sie es merkte, schaute ich schnell weg. Jeden Tag, wenn mein Privatlehrer gegangen war, kam sie in mein Zimmer und ließ sich ungeniert aufs Bett fallen. Mein Unbehagen schien sie nicht zu bemerken. »Lass uns Karten spielen«, sagte sie und begann, die Karten auszulegen. Während ich versuchte, nicht zu ihr zu schauen, und dann doch schaute, blieb mir fast der Atem weg.
Einmal fand sie ein Pornomagazin. Ich kam gerade von der Toilette zurück, und Kaori hatte meine Schreibtischschublade herausgezogen. Das Magazin war randvoll mit Fotos von nackten Frauen. Es hatte mich einige Mühe gekostet, an diesen Schatz heranzukommen. Kaori war vollkommen vertieft darin und stieß einen kleinen spitzen Schrei aus, als sie mich sah. Just an dem Tag hatte ich das Heft nur nachlässig versteckt, normalerweise lag es zwischen den Seiten eines Telefonbuchs zuunterst in der Schublade – unter einem Stapel schmaler Ordner, der Namensliste meiner Klasse sowie einem dicken, schweren Atlas.
Es war mir furchtbar peinlich, aber Kaori lachte nur und nannte mich einen Perversling. Plötzlich kam mir Iijima in den Sinn, der in der Schule neben mir saß. Ich schob dem armen Kerl die Schuld zu und log, ich hätte das Magazin von ihm ausgeliehen, in Wahrheit sei er der Perversling. Kaori zog die Augenbrauen hoch und zeigte auf eine der Frauen mit besonders großen Brüsten. Dann umschloss sie ihre eigene Brust mit den Händen.
»Du interessierst dich also für so was?«
»Nein.«
»Macht dich das an?«
»Nein.«
Kaori lächelte.
»Du hast nie versucht, den Mädchen unter die Röcke zu schauen wie Yazaki und die anderen. Deshalb dachte ich, du wärst ein anständiger Junge.«
Stimmt, das hatte ich nie; aber natürlich jedes Mal gierig hingesehen, wenn Yazaki und seine Kumpels es taten.
»Also, was ist? Willst du meinen mal hochheben?«
Wieder lachte sie und griff nach dem Saum ihres Rockes.
Es vergingen etwa drei Monate, da suchte Kaori wieder nach dem Pornomagazin und fand stattdessen die Schachtel mit Haaren und abgeschnittenen Fingernägeln. Als ich in mein Zimmer kam, saß sie plötzlich da, mit der geöffneten Schachtel in der Hand, und schaute verwundert auf den Inhalt. Sie trug einen weißen Pullover und weiße Jeans.
Die Schachtel war bis zum Rand gefüllt mit vertrockneten Haaren, die sich zu einem Knäuel verheddert hatten, sowie zusammengeschrumpelten Nagelschnipseln, zum Teil schwarzrot verfärbt, wie um zu beweisen, dass sie von Menschen stammten. Ich blieb wie angewurzelt in der Zimmertür stehen. In der Schachtel befanden sich nicht nur alte Haare und Nägel, sondern auch welche, die ich erst vor kurzem aufgehoben hatte.
Ich war selber überrascht, wie sehr mich der Anblick schockierte. Natürlich war es peinlich, dass jemand meinem Geheimnis auf die Spur gekommen war, und ausgerechnet Kaori. Aber es war weniger das Gefühl von Schmach oder Zorn. Ich riss Kaori die Schachtel aus der Hand und wollte sie in den Papierkorb werfen. Aber ich vermochte es nicht, und das gab mir den Rest. Völlig durcheinander, wusste ich kaum, wo ich hinschauen sollte. Da trafen sich unsere Blicke.
»Es ist nichts«, stammelte ich. Etwas anderes fiel mir nicht ein.
Ich schloss die Schachtel und legte sie in die Schreibtischschublade zurück. Als ich aus dem Zimmer gehen wollte, fragte Kaori: »Was ist das?«
»Nichts.«
»Aber …«
Mir war egal, was Kaori von mir dachte, ich wollte nur weg. Dann würde ich vielleicht auch eine plausible Ausrede finden. Doch Kaori rührte sich nicht vom Fleck und schaute mich unverwandt an.
»Das geht dich nichts an.«
»Schon, aber … was ist das?«
Kaori ließ nicht locker.
»Meine Mutter.«
Kaum hatte ich das gesagt, wusste ich, dass ich Kaori die ganze Geschichte erzählen würde.
»Ich hebe sie auf, weil welche von meiner Mutter dabei sein könnten. Ich weiß, das ist Quatsch, aber trotzdem.«
Ich hatte einen Kloß im Hals.
»Auch jetzt noch, obwohl es ja ganz unmöglich ist. Aber ich kann nicht anders. Wenn ich sie liegen lasse, habe ich vielleicht die eine Chance für immer verpasst.«
Kaori sah weg.
»Inzwischen hebe ich sogar das Zeugs von den Dienstmädchen auf. Das findest du bestimmt eklig, ich überhaupt nicht. Die meisten Hausangestellten wissen von meiner Macke. Es ist ihnen peinlich, also putzen sie jeden Tag das Haus.«
»Ganz sicher«, sagte Kaori plötzlich, »ganz sicher sind da welche von deiner Mutter drin. Du darfst die Schachtel auf keinen Fall wegwerfen, hörst du?«
Sie sagte es ernst, und der Ausdruck in ihrem Gesicht hatte etwas Kindliches, aber ich war ja selbst noch ein Kind. Ihr langes Haar war im Nacken zusammengebunden. Aus großen Augen schaute sie mich eindringlich an. Vielleicht war das der Augenblick, in dem ich mich in sie verliebte.
Nach der Grundschule besuchten Kaori und ich die örtliche Mittelschule. Wieder kamen wir in die gleiche Klasse, aber diesmal wurde ich den Verdacht nicht los, dass Vater es so arrangiert hatte. Kaori war damals nur wenig größer als der Durchschnitt; ich hingegen schoss geradezu in die Höhe.
Sie war immer noch sportlich, wenn sie auch ihre Klassenkameradinnen nicht mehr so weit hinter sich ließ wie in der Grundschule. Weil sie fröhlich war, hatte sie viele Freunde. Ich lernte nach wie vor mühelos und versteckte mich hinter Witzen und Blödeleien, was jedoch damals meinem Wesen entsprach. Die Schachtel warf ich nicht weg, aber es geschah immer seltener, dass ich mich nach Haaren und Nägeln bückte. Und ich ließ auch keine lebenden Tiere mehr vom Hügel hinter dem Haus in den Abgrund fallen. Die Schule langweilte mich, weil sich nur wiederholte, was ich im Privatunterricht schon gelernt hatte. Aber ich liebte es, mit meinen Sitznachbarn herumzualbern. Wie zu erwarten, wurde ich von den Lehrern oft zurechtgewiesen.
Die ganze Zeit über dachte ich nur an Kaori und träumte von unserer Zukunft. Wir würden heiraten, einen Job finden, es war mir ganz egal, was für einen. Wenn sie lieber zu Hause bleiben will – auch gut. Wenn wir Kinder hätten, würde ich ihnen vielleicht geben können, was mir selber fehlte. Für Kaoris Glück wollte ich ein ganz und gar aufrichtiger Mensch werden, und das böse Blut in meiner Familie würde mit meinem Leben versickern. Ich stellte mir vor, wie ich hart arbeiten würde, um uns ein kleines Häuschen kaufen zu können, am besten mit Blick aufs Meer; stellte mir vor, wie wir Hand in Hand in der Abenddämmerung am Strand entlangspazierten. Wenn wir streiten, würde ich mich entschuldigen, und sollte Kaori im Unrecht sein, würde ich einfach den Mund halten. Vielleicht würde ich mich selbst dann entschuldigen. Um Kaori zu heiraten, musste ich jedenfalls ein Mann werden, der gut genug für sie war. Was das bedeutete, wusste ich nicht genau. Also machte ich mit dem langweiligen Unterricht weiter. Ich begann, auf mein Äußeres zu achten, und dachte mir Geschichten aus, die Kaori zum Lachen bringen würden. Meine Düsterkeit verbannte ich in einen Winkel tief in meinem Inneren. Dadurch hatte ich auf einmal eine Unmenge Energie, die mit Wucht aus mir herausbrach und sich fast obsessiv auf Kaori richtete.
Fast jeden Abend stellte ich mir vor, mit ihr zu schlafen. Musste das nicht das höchste Glück auf Erden sein? Ihren nackten Körper anzusehen, sie überall zu berühren, in sie einzudringen. Es erschien mir wie ein Wunder. Dass die meisten Erwachsenen diese Freuden genossen, ging über meine Vorstellungskraft. Ich dachte, so etwas sei nur mir vergönnt. Wie in der Grundschule galten wir als Verwandte, aber anders als damals fühlte es sich auf einmal komisch an, zusammen nach Hause zu gehen. Kaori spielte jetzt nachmittags Volleyball, so dass wir zu unterschiedlichen Zeiten Schluss hatten. Doch nach wie vor kam sie fast jeden Tag in mein Zimmer.
Alles, was ich wollte, war direkt vor meinen Augen, doch ich durfte es nicht berühren. Dennoch war es mehr als genug, um einen Schuljungen wie mich in einen Rausch zu versetzen. Zuzusehen, wie ihr Körper weich und rund wurde, wie sich ihre Brüste wölbten, war schwer auszuhalten und machte mich zugleich glücklich. Ich vergaß alles um mich herum.
Kaoris Suche nach dem Pornoheft wurde zu einer Art Running Gag. Es war in meinem Bücherregal versteckt. Ich hatte den Band Sa–Su der Enzyklopädie aus dem Schuber genommen und stattdessen das Magazin hineingetan. Kaori fand es nie. Inzwischen blätterte ich aber nur noch selten darin, weil sich meine pubertären Phantasien einzig und allein um Kaori drehten.
»Aber es muss doch irgendwo sein … Ich werde es finden«, sagte Kaori und öffnete den Kleiderschrank. Sie hatte noch immer die Schuluniform an.
»Da ist nichts.«
»Interessierst du dich nicht mehr für Mädchen?«
»So hab ich das nicht gemeint. Aber wo nichts ist, kannst du nichts finden.«
So verging das Jahr, bevor ich vierzehn wurde und mein Vater mir die Hölle zeigen wollte.
Ich erinnere mich nicht mehr genau, wann das war. Ich weiß nur noch, dass es später Nachmittag war und Kaori und ich nach einem Regenschauer durch die Pfützen liefen.
»Fumihiro, du siehst deinem Vater überhaupt nicht ähnlich«, sagte Kaori plötzlich. Sie hatte mich schon die ganze Zeit so forschend angeschaut, was mir unbehaglich war.
»Wahrscheinlich nicht. Er sieht ja auch schrecklich aus.«
Ich wich ihrem Blick aus.
»Das kann man wohl sagen.«
Eine Weile gingen wir schweigend nebeneinander her. »Irgendwie ist das Gesicht deines Vaters nicht nur sein eigenes«, sagte Kaori nachdenklich. Sie sah wunderschön aus.
»Als ob er mehrere Gesichter hätte. Manchmal bekomme ich richtig Angst, wenn er mich anschaut. Als ob dann bei ihm etwas an die Oberfläche kommt, seine Ahnen, irgendwas, was früher passiert ist. Richtig unheimlich.«
Kaori senkte plötzlich den Blick. Einmal mehr fiel mir auf, wie lang ihre Wimpern waren. Wenn ich ihr Freund wäre, würde ich jetzt den Arm um sie legen, dachte ich. Aber in Wirklichkeit wagte ich es damals nicht einmal, ihre Fingerspitzen zu berühren.
»Du starrst Frau Yoshimi immer so an«, sagte Kaori eines Tages, kurz vor den Sommerferien. »Du magst sie, nicht wahr?«
Frau Yoshimi war unsere Musiklehrerin. Sie trug sehr figurbetonte Kleider, kein Wunder, dass sie bei uns Jungs hoch im Kurs stand. Doch wegen dieser Kleider hatten wir auch bereits entschieden, dass sie eine Schlampe sein musste.
»Stimmt doch gar nicht. Und überhaupt, wie kommst du denn jetzt auf einmal darauf?«
Ich musste den Kopf etwas senken, um Kaori in die Augen zu schauen.
»Mari ist traurig, weil sie nicht mit Frau Yoshimi konkurrieren kann. Sie sah aus, als würde sie gleich losheulen.«
Kaori grinste.
»Sag mal, was willst du eigentlich von mir?«
»Ich glaube, sie ist in dich verknallt. Wenn sie dich fragt, solltest du dich mit ihr verabreden.«
Mari war ein stilles Mädchen, das die ganze Zeit zeichnete. Beim Saubermachen des Klassenzimmers hatte ich ihr mal geholfen, den schweren Wassereimer zu schleppen.
»Nein, mach ich nicht. Tut mir leid.«
»Wieso denn nicht? Magst du ein anderes Mädchen?«
Kaori schaute mir in die Augen und lächelte. Ihr Gesicht im Sonnenlicht war bezaubernd. Aber mir fehlte die Gelassenheit, um ihren Blick zu erwidern.
Mit pochendem Herzen dachte ich an die Mädchenzeitschriften und Fernsehserien, für die Kaori schwärmte. Immer zerbrach die Liebe an blöden Missverständnissen, schwierigen Umständen oder am schlechten Timing. Ich hasste das. Unwillkürlich spannte sich mein ganzer Körper.
»Ich mag dich. Deswegen sag ich nicht ja.«
Ich war damals wohl ein bisschen komisch. Kaori wirkte erschrocken. Auch mich überraschten meine Worte, aber zurücknehmen konnte ich sie auch nicht mehr.
»Äh, ich meine nicht, dass ich jetzt mit dir ausgehen möchte … Ich wollte dir das später sagen, wenn wir älter sind. Bis dahin können wir ja vielleicht einfach so weitermachen wie bisher.«
»Wie bisher? Das geht nicht«, sagte Kaori seufzend. »Aber du bist sehr mutig.« Wenn ich sie möge, solle ich sie doch küssen, fuhr sie fort.
Ganz in der Nähe stand ein Schrein. Wir gingen hinüber, Hand in Hand, den Blick auf den Boden gerichtet. Auf der Sitzbank döste ein Betrunkener. Geduldig warteten wir, bis er sich verzog. Dann küssten wir uns, vorsichtig und scheu. Eine unbekannte Welt öffnete sich mir. Auf dem Heimweg hielten wir uns bei den feuchten Händen, bis das Eingangstor unseres Hauses in Sichtweite kam. Es war ein halbes Jahr vor meinem vierzehnten Geburtstag, an dem mein Vater mir die Hölle zeigen wollte.
4
Nachdem Kaori und ich uns geküsst hatten, passierten mehrere Dinge. Weit, weit weg von uns.
Der Bürgerkrieg in dem kleinen afrikanischen Land, für dessen Wiederaufbau Vaters zweiter Sohn – mit anderen Worten mein Bruder – eine Konzession besaß, ging so zu Ende, wie die westlichen Verbündeten es sich wünschten: Die japanische Regierung kündigte großzügige finanzielle Unterstützung an. Die Überlebenden der religiösen Sekte, die nach dem misslungenen Anschlag auf das Atomkraftwerk zum Massenselbstmord aufgerufen hatte, akzeptierten das Gerichtsurteil nicht. Während des Berufungsprozesses forderte eine Truppe zwielichtiger Leute lauthals die Todesstrafe für die verurteilten Sektenmitglieder. Ich schenkte diesen Ereignissen keine Beachtung. Mein Vater war in Tokio und würde eine Zeitlang nicht nach Hause zurückkehren. Kaori und ich lebten in unserer eigenen kleinen Welt.
Nach der Schule kam Kaori in mein Zimmer. Wir ließen Musik laufen, damit niemand sich fragte, warum es so ruhig war, und küssten uns. Wir verbrachten Stunden eng umschlungen, tauschten Zungenküsse, während ich durch die Kleidung die sanften Hügel ihrer Brüste streichelte. Wahrscheinlich waren wir dafür noch viel zu jung, aber es war mir egal, was andere dachten.
Es dauerte nicht lange, bis sich Kaori von mir ausziehen ließ und ich ihre Brustwarzen küsste. Von da an kam sie jeden Abend zu mir. Unter der Bettdecke erkundeten wir voller Neugier und Verlangen mit Händen und Lippen den nackten Körper des anderen. Nur weil Kaori Angst davor hatte, schliefen wir nicht miteinander, doch für mich war es auch so mehr als genug. Für mich unreifen Jungen war Sex schlicht überwältigend. Während die Nachrichten täglich den Rest der Welt in Unruhe versetzten, gab es für Kaori und mich nur mein kleines Zimmer. Ich weiß nicht, wie oft ich in ihrer Hand kam, sie küsste und zwischen ihren Beinen leckte. Schwitzend wälzten wir uns in meinem engen Bett und unterdrückten unsere Schreie. Wieder und wieder hauchte Kaori, wie schön es mit mir sei, dass ich ihr etwas gab, was ihr bisher gefehlt hatte. Und ich tat dasselbe. Sie hatte es nicht leicht gehabt, war von einem Kinderheim ins nächste geschickt worden, auch wenn ihre Fröhlichkeit darüber hinwegtäuschen mochte; jetzt streichelten ihre Finger meinen ganzen Körper, und ihre neugierige Zunge tastete sich bis zu meinem Penis vor, dann nahm sie ihn in den Mund. Sie musste es irgendwo gesehen oder gehört haben.
Kaori wollte mich. Mit ihrem ganzen Körper.
»Wenn du da bist, bin ich glücklich«, sagte sie und zeichnete mit ihren Händen meine Konturen nach. »Ich muss dich nur atmen hören, dein nachdenkliches Gesicht sehen.«