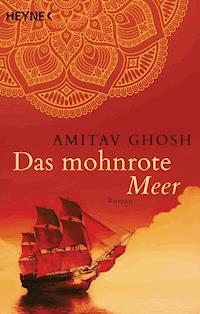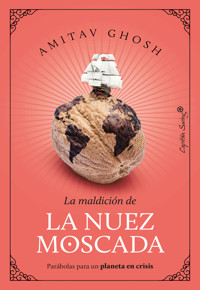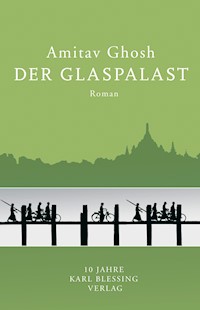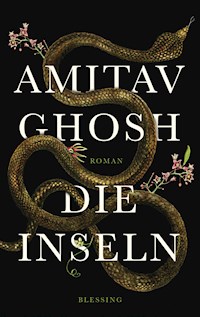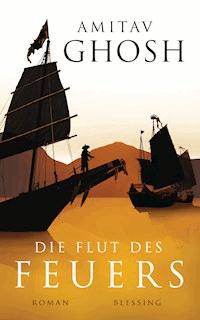
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ibis-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein schillerndes Epos über die Welt am Rande einer Zeitenwende.
1839: Nachdem China den vornehmlich von den Briten und deren Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm Großbritannien den Krieg. Die Hind ist eines der Schiffe, die bei einem Angriff zum Einsatz kommen sollen, und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An Bord ist unter anderem Kesri Singh, ein Kommandant der britisch-ostindischen Armee, der eine Kompanie Soldaten befehligt; außerdem Zachary Reid, ein verarmter junger Seemann, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, und Shirin Moddie, die in China die Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes, eines Opiumhändlers, an sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in Chinas verheerender Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch Großbritannien enden werden.
Eine vor Atmosphäre und Detailfreude flirrende, spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama über die Opiumkriege, die eine frühe Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1048
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
1839: Nachdem China den vornehmlich von den Briten und deren Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm Großbritannien den Krieg. Die Hind ist eines der Schiffe, die bei dem Angriff auf Kanton zum Einsatz kommen sollen, und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An Bord sind unter anderem Kesri Singh, ein Kommandant der britisch-ostindischen Armee, sowie Captain Mee, ein britischer Offizier mit gebrochenem Herzen und zweifelhaftem Ruf; außerdem Zachary Reid, ein junger Seemann, auf dem Weg nach oben, und Shirin Moddie, die in China die Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes, eines Opiumhändlers, an sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in Chinas verheerender Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch Großbritannien enden werden.
Eine vor Atmosphäre und Detailfreude flirrende, spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama über die Opiumkriege, die eine frühe Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
Der Autor
Amitav Ghosh, wurde 1956 in Kalkutta geboren und studierte Geschichte und Sozialanthropologie in Neu-Delhi. Nach seiner Promotion in Oxford unterrichtete er an verschiedenen Universitäten. Mit Der Glaspalast (Blessing, 2000) gelang dem schon vielfach ausgezeichneten Autor weltweit der große Durchbruch. Zuletzt erschienen seine Romane Das mohnrote Meer (2008) und Der rauchblaue Fluss bei Blessing (2012), die ersten beiden Teile der Ibis-Tilogie, die mit Die Flut des Feuers zu ihrem Abschluss kommt. Ghosh lebt in Indien und den USA.
AMITAV GHOSH
Die Flut des Feuers
Aus dem Englischen
von Barbara Heller
und Rudolf Hermstein
Blessing
ERSTES KAPITEL
Havildar Kesri Singh war der Typ Soldat, der gern an der Spitze der Kolonne ritt, besonders an einem Tag wie diesem, an dem sein Bataillon durch bereits unterworfenes Gebiet marschierte, und die einzige Aufgabe der Vorhut darin bestand, die Fahne des paltans zu tragen und für die Dorfbewohner, die sich am Straßenrand drängten, das beste Paradegesicht aufzusetzen.
Es waren einfache Leute, und Kesri wusste, auch ohne sie anzusehen, dass sie ihn mit großen Augen bestaunten. Sepoys der Ostindien-Kompanie waren kein alltäglicher Anblick in diesem entlegenen Teil Assams. Dass ein ganzer paltan des 25. Regiments der Bengal Native Infantry – der berühmten Pachisi – durch ihre Reisfelder marschierte, war vermutlich der größte tamasha, den die meisten hier in einem ganzen Jahr oder gar Jahrzehnt erleben würden.
Immer mehr Menschen liefen herbei – Bauern, alte Frauen, Kuhhirten, Kinder –, so eilig, als fürchteten sie, das Spektakel zu verpassen; dass es sich noch über Stunden hinziehen würde, konnten sie nicht wissen.
Unmittelbar hinter Kesri marschierte die sogenannte Rasad Guard, der Versorgungstrupp des paltans. Ihm folgte der Tross, mit über zweitausend Menschen weit zahlreicher als die sechshundert Sepoys, gleichsam eine Stadt auf Rädern, eine lange Karawane von Ochsenkarren, auf denen Leute aller Art reisten: Pandits und Milchfrauen, Krämer und Banjara-Getreidehändler, sogar eine Gruppe Basarmädchen. Auch Unmengen von Tieren gab es da: lärmende Schaf-, Ziegen- und Rinderherden ebenso wie einige Elefanten, die das Gepäck der Offiziere und das Mobiliar der Offiziersmesse trugen: schwankende Tische und Stühle, die Füße in der Luft, wie umgekippte Käfer. Sogar ein transportabler Tempel rollte auf einem Karren mit.
Erst nachdem all das vorbeigezogen war, ertönten rhythmische Trommelschläge, und eine Staubwolke stieg auf. Der Boden erzitterte im Takt der Trommeln, und die erste Reihe Sepoys tauchte auf, zehn Mann, Seite an Seite, an der Spitze eines langen, gewundenen Stroms dunkler topis und blitzender Bajonette. Die Dorfbewohner liefen davon, um dann im Schutz von Bäumen und Büschen die unter Pfeifen- und Trommelklängen vorbeiziehenden Sepoys zu bestaunen.
Kaum ein anderer tamasha konnte sich mit dem Spektakel der marschierenden Bengal Native Infantry messen. Allen im paltan war das bewusst – den Dandia-valas ebenso wie den Natch-Mädchen, Bangy-burdars, Syces, Khansamas, Bheri-valas und Bhistis –, ganz besonders aber Havildar Kesri Singh, der die Galionsfigur des Bataillons darstellte, wenn er an der Spitze der Kolonne ritt.
Nach Kesris Überzeugung gehörte es zum Kriegshandwerk, sich eindrucksvoll zu präsentieren, und er gab gerne zu, dass er vor allem wegen seines Äußeren so häufig ausersehen wurde, die Kolonne anzuführen. Man konnte es ihm kaum zum Vorwurf machen, dass er in den Jahren des Kriegsdienstes allerlei Narben davongetragen hatte, die seinem Aussehen zum Vorteil gereichten. Er hatte es sich nicht ausgesucht, dass der Hieb eines Schwertes seine Lippen dauerhaft um einiges voller erschienen ließ und einen Schmiss wie eine filigrane Tätowierung in die lederdunkle Haut seiner Wange gezeichnet hatte.
Nicht, dass Kesris Gesicht das imponierendste im ganzen paltan gewesen wäre. Mit seinem säbelkrummen Schnauzbart und der markanten Stirn konnte er zwar höchst Furcht einflößend aussehen, doch gab es andere, die ihn darin weit übertrafen. Niemandem aber stand die Uniform so gut wie ihm: Das schwarze Tuch der Hose umspannte seine Schenkel wie eine zweite Haut und ließ die mächtigen Muskeln hervortreten, die Epauletten auf seinen breiten Schultern wirkten eher wie Waffen denn wie Zierrat, und bei keinem kam der scharlachrote Waffenrock mit den leuchtend gelben Aufschlägen so gut zur Geltung wie bei ihm. Und nicht nur er selbst fand, dass die dunkle topi, hoch wie ein Bienenkorb, auf seinem Kopf besser saß als auf jedem anderen.
Dass er die Kolonne häufiger anführen durfte als irgendeiner der Sepoy-Afsars, rief bei den anderen Unteroffizieren des Bataillons einigen Unmut hervor. Ihre Klagen fochten ihn jedoch nicht über Gebühr an, denn auf die Meinungen Gleichrangiger gab er nicht viel. Die meisten waren stumpfe, schwerfällige Männer, und es erschien ihm nur natürlich, dass sie ihn beneideten.
Nur einen der Sepoys schätzte Kesri: Subedar Nirbhay Singh, den ranghöchsten Inder im Bataillon. Zwar war ein Subedar offiziell noch dem einfachsten englischen Soldaten untergeordnet, aber kraft seiner Persönlichkeit wie auch seines familiären Hintergrundes war Subedar Nirbhay Singhs Einfluss im paltan so groß, dass selbst Major Wilson, der Bataillonskommandant, sich ungern mit ihm anlegte.
Für die Inder im paltan war Subedar Nirbhay Singh nicht nur ihr ranghöchster Vorgesetzter, sondern als Spross einer Rajputenfamilie, die über drei Generationen den Kern des paltans gebildet hatte, auch ihr Patriarch. Sein Großvater war jener Daftardar gewesen, der dem Regiment nach seiner Gründung vor sechzig Jahren zu seinem Aufstieg verholfen hatte. Er hatte dort als erster Subedar gedient, und sein Rang war auf viele seiner Nachkommen übergegangen. Der jetzige Subedar hatte ihn von seinem älteren Bruder geerbt, der einige Jahre zuvor seinen Abschied genommen hatte: Subedar Bhairo Sing.
Die beiden entstammten einer Grundbesitzerfamilie am Rand der Stadt Ghazipur, nahe Benares. Da die meisten Sepoys des Bataillons aus dieser Gegend kamen und auch derselben Kaste angehörten, verfügten viele über Beziehungen zum Clan des Subedars; schon die Väter einiger von ihnen hatten unter seinem Vater und seinem Großvater gedient.
Kesri gehörte zu den wenigen im paltan, die diesen Vorteil nicht genossen. Sein Heimatdorf Nayanpur lag an der äußersten Peripherie des Rekrutierungsbereichs des Bataillons, und seine einzige Verbindung zur Familie des Subedars war seine jüngste Schwester Diti, die mit einem Neffen Nirbhay Singhs verheiratet war. Kesri war maßgeblich am Zustandekommen dieser Ehe beteiligt gewesen, und sie hatte bei seinem Aufstieg zum Havildar keine geringe Rolle gespielt.
Kesri war fünfunddreißig und hatte nach neunzehn Jahren im paltan noch zehn bis fünfzehn Jahre aktiven Dienst vor sich. Er rechnete fest damit, dass er mit Subedar Nirbhay Singhs Unterstützung demnächst zum Jamadar befördert werden würde. Und warum sollte er nicht irgendwann selbst Subedar des Bataillons werden? Er kannte nicht einen einzigen Sepoy-Afsar, der ihm an Intelligenz, Kraft und Erfahrung das Wasser hätte reichen können. Er hatte es verdient.
Zachary Reid hatte im Lauf der letzten Monate so viele Rückschläge erlebt, dass er an das bevorstehende Ende seines Martyriums erst glauben konnte, als er in der Calcutta Gazette den Bericht über die Untersuchung las, die ihn rehabilitiert hatte.
5. Juni 1839
… und dieser Rückblick auf die denkwürdigen Ereignisse der Woche wäre nicht vollständig, ohne der gerichtlichen Untersuchung Erwähnung zu tun, nach deren Abschluss Mr. Zachary Reid, ein einundzwanzigjähriger Seemann aus Baltimore, Maryland, von jeglicher Schuld an den bedauerlichen Vorfällen auf dem Schoner Ibis im September vergangenen Jahres freigesprochen wurde.
Diejenigen unter Ihnen, die die Calcutta Gazette regelmäßig lesen, brauchen wohl kaum daran erinnert zu werden, dass sich die Ibis mit zwei Sträflingen und einem Kontingent Kulis an Bord auf der Fahrt nach Mauritius befand, als auf dem Schiff Unruhen ausbrachen, die in der Ermordung des Obersardars der Auswanderer gipfelten, eines gewissen Bhairo Singh, ehemaliger Subedar der Bengal Native Infantry und Träger zahlreicher Tapferkeitsauszeichnungen.
Kurz nach dem Mord geriet die Ibis in einen schweren Sturm, nach dessen Abflauen sich herausstellte, dass eine Gruppe von fünf Männern auch Mr. John Crowle, den ersten Steuermann des Schiffs, umgebracht hatte und anschließend in einem Beiboot geflüchtet war. Rädelsführer war der Serang der Mannschaft, ein Ganove aus Arakan, und unter den fünfen befanden sich auch die beiden Sträflinge, einer von ihnen der frühere Raja von Raskhali, Nil Rattan Halder (welches Aufsehen der Prozess gegen den Raja und seine Verurteilung wegen Urkundenfälschung im vergangenen Jahr unter den Eingeborenen Kalkuttas erregten, dürfte den meisten europäischen Einwohnern der Stadt noch in frischer Erinnerung sein).
Nach dem Sturm wurde die havarierte Ibis von der Brigantine Amboyna ohne weitere Verluste an Menschenleben nach Port Louis eskortiert. Dort erhoben die Bewacher der Kulis sogleich Klage gegen Mr. Reid und beschuldigten ihn, den fünf Budmashs – unter ihnen der Mörder des Subedars, ein Kuli aus dem Bezirk Ghazipur – zur Flucht verholfen zu haben. Aufgrund der Schwere dieser Anschuldigung wurde entschieden, den Fall an die Behörden in Kalkutta zu verweisen. Mr. Reid wurde nach Indien zurückgeschickt und unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Zu seinem Unglück hatte er nach seiner Ankunft in Bengalen eine mehrmonatige Wartezeit zu erdulden, die vor allem dem schlechten Gesundheitszustand des Hauptzeugen Mr. Chillingworth zuzuschreiben war, des Kapitäns der Ibis. Mr. Chillingworths Reiseunfähigkeit war dem Vernehmen nach der Hauptgrund für die wiederholte Verschiebung der Untersuchung …
Nach einer dieser Verschiebungen hatte Zachary ernsthaft erwogen, einen Schlussstrich zu ziehen und sich aus dem Staub zu machen. Kalkutta zu verlassen wäre nicht weiter schwierig gewesen: Er war nicht in Haft und hätte ohne Weiteres auf einem der Schiffe im Hafen anheuern können. Da auf vielen dieser Schiffe Mannschaftsknappheit herrschte, hätte man ihn genommen, ohne groß Fragen zu stellen.
Doch Zachary hatte sich schriftlich verpflichtet, vor der Untersuchungskommission zu erscheinen; dieses Versprechen zu brechen, wäre einem Schuldeingeständnis gleichgekommen. Eine andere, ebenso gewichtige Überlegung galt seinem mühsam erworbenen Steuermannspatent, das er in der Hafenkommandantur in Kalkutta hatte abliefern müssen. Mit dem Patent hätte er alles verloren, was er sich seit dem Auslaufen der Ibis in Baltimore erarbeitet hatte, auch seine Beförderung vom Schiffszimmermann zum zweiten Steuermann. Wäre er nach Amerika zurückgekehrt, um sich neue Papiere zu beschaffen, hätte es ohne Weiteres geschehen können, dass man dort seine alten Unterlagen ausgegraben und erneut das Wort »schwarz« neben seinen Namen gestempelt hätte. Damit wäre ihm eine Heuer als Schiffsoffizier für immer versagt geblieben.
In Zacharys Natur gingen Ehrgeiz und Entschlossenheit mit einer gehörigen Portion Besonnenheit einher. Statt leichtfertig seiner Ungeduld nachzugeben, hatte er nach besten Kräften ausgeharrt, sich mit Gelegenheitsarbeiten auf den Schiffswerften von Kidderpur durchgeschlagen und in immer neuen verwanzten Absteigen geschlafen, während er auf den Beginn der Untersuchung wartete. Unermüdlich bestrebt, sich weiterzubilden, hatte er in seiner freien Zeit Bücher über Navigation und Seemannschaft gelesen.
Die Untersuchung des Ibis-Zwischenfalls begann mit einer gut besuchten öffentlichen Anhörung im Rathaus.
Den Vorsitz führte der renommierte Jurist Justice Kendalbushe, Richter am obersten Gerichtshof. Als Erster wurde kein anderer als Mr. Chillingworth in den Zeugenstand gerufen. Er äußerte sich ausführlich und detailliert zu Mr. Reids Gunsten und erklärte, ihn treffe keinerlei Schuld an den Problemen während der Reise; verantwortlich dafür sei ausschließlich Mr. Crowle, der verstorbene erste Steuermann des Schiffs. Dieser, so Mr. Chillingworth, sei von notorisch zänkischer und widerspenstiger Gemütsart gewesen und habe durch schwere Fehler in der Schiffsführung Unzufriedenheit unter den Kulis und der Mannschaft geweckt.
Als Nächster bezeugte Mr. Doughty, ehemals Angehöriger des Bengal River Pilots Service, wortgewandt Mr. Reids untadeligen Charakter. Mr. Reid sei genau der Typ des jungen Weißen, der im Osten so dringend gebraucht werde: ehrlich und fleißig, von fröhlichem Naturell und bescheidenem Sinn.
Der gute, bärbeißige alte Doughty! Während der langen Monate des Wartens war er der Einzige in Kalkutta gewesen, auf den sich Zachary hatte verlassen können. Einmal in der Woche, mitunter auch zweimal, hatte er ihn in die Hafenkommandantur begleitet, um sich zu vergewissern, dass Zacharys Fall nicht zu den Akten gelegt und vergessen wurde.
Der Kommission wurden sodann zwei eidesstattliche Erklärungen vorgelegt, die erste von Mr. Benjamin Burnham, dem Eigner der Ibis. Mr. Burnham ist den Lesern der Gazette als einer der führenden Kaufleute Kalkuttas und glühender Verfechter des Freihandels wohlbekannt.
Bevor Mr. Justice Kendalbushe die Erklärung verlas, teilte er mit, dass Mr. Burnham gegenwärtig in China weilt, sonst hätte er der Anhörung zweifellos beigewohnt. Offensichtlich hält ihn dort die Krise fest, Anfang des Jahres ausgelöst von den extremen Maßnahmen des neu ernannten Gouverneurs Lin. Da sich nach wie vor keine Lösung des Konflikts abzeichnet, wird sich Mr. Burnham voraussichtlich noch einige Zeit an den Gestaden des Reichs der Mitte aufhalten, um Charles Elliot, dem Repräsentanten und Bevollmächtigten Ihrer Majestät, mit seinem weisen Rat zur Seite zu stehen.
Mr. Burnham hob in seiner Erklärung eloquent Mr. Reids guten Charakter hervor und beschrieb Mr. Reid als aufrechten Arbeitsmann, reinlich und männlich, von gesunder Erscheinung und christlicher Moral. Nach Verlesen der Erklärung wies Richter Kendalbushe die Kommission darauf hin, dass dem Zeugnis Mr. Burnhams großes Gewicht beizumessen sei, da er seit Langem ein führendes Mitglied der Gemeinde und eine Säule der Kirche sei, bekannt für seine Wohltätigkeit ebenso wie für seine entschiedene Befürwortung des Freihandels. Nicht unerwähnt ließ Mr. Kendalbushe auch Mr. Burnhams Gattin, Mrs. Catherine Burnham, eine herausragende Gastgeberin in der Stadt und bekanntermaßen Unterstützerin diverser Besserungskampagnen.
Die zweite eidesstattliche Erklärung stammte von Mr. Burnhams Gumashta Babu Nob Kissin Pander, der sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in seiner Eigenschaft als Supercargo ebenfalls an Bord der Ibis befand. Auch er hält sich derzeit in China auf.
Seine Aussage bekräftigte Mr. Chillingworths Darstellung in jeder Hinsicht. Im Stil allerdings erschien sie höchst eigenartig mit ihrer Fülle ausgefallener Wendungen, wie sie sich bei den hiesigen Babus so großer Beliebtheit erfreuen. Mr. Burnhams Gumashta erwies sich als wahrer Chukker-batty, als er sich dazu verstieg, Mr. Reid als den »strahlenden Abgesandten« einer Gentu-Gottheit zu bezeichnen …
Zachary erinnerte sich, wie sein Gesicht geglüht hatte, als Mr. Kendalbushe diesen Satz vorlas. Fast war es, als hätte der so rätselhafte Babu Nob Kissin in seinem safranfarbenen Gewand selbst dort gestanden, die Arme vor dem Matronenbusen gekreuzt und mit dem mächtigen Kopf wackelnd.
Seit Zachary ihn kannte, hatte der Babu eine verblüffende Wandlung durchgemacht: Er hatte zunehmend weibliche Züge angenommen, besonders in seinem Verhalten Zachary gegenüber, den er wie eine in ihren Lieblingssohn vernarrte Mutter behandelte. Das verwirrte Zachary, aber er war auch dankbar dafür, denn der Babu, bei aller Verschrobenheit ein durchaus einfallsreicher Mann, war ihm mehrmals hilfreich zur Seite gesprungen.
Der Leser mag ermessen, mit welcher Spannung nach diesen Aussagen über den jungen Seefahrer Mr. Reids persönliches Erscheinen erwartet wurde. Und als er endlich in den Zeugenstand gerufen wurde, enttäuschte er die Erwartungen in keiner Weise: Mit seinem Elfenbeinteint, dem dunklen Haar und seiner kräftigen, wohlproportionierten Gestalt glich er eher einer griechischen als einer heidnischen Gottheit. Er wurde einer ausgedehnten Befragung unterzogen und gab seine Antworten ruhig und ohne zu zögern, was bei der Kommission einen außerordentlich günstigen Eindruck hinterließ.
Viele der Fragen galten dem Schicksal der fünf Männer, die in der Sturmnacht mit einem Beiboot von der Ibis geflohen waren. Auf die Frage, ob eine Möglichkeit bestehe, dass sie überlebt haben könnten, erwiderte Mr. Reid, er hege nicht den geringsten Zweifel, dass sie allesamt ertrunken seien. Zudem, sagte er, habe er mit eigenen Augen ihr gekentertes Boot gesehen, das man mit einem Leck im Boden weit draußen auf dem Meer gefunden habe; ein untrüglicher Beweis für ihren Tod, so Reid.
Reids Aussagen wurden von Kapitän Chillingworth in vollem Umfang bestätigt. Auch er meinte, es bestehe nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass auch nur einer der Entflohenen überlebt habe. Seine Worte sorgten für erhebliche Unruhe unter den Eingeborenen im Saal, darunter zahlreiche Verwandte des verstorbenen Raja einschließlich seines jungen Sohnes …
In diesem Moment hatte Zachary begriffen, weshalb der Gerichtssaal so voll war: Viele Freunde und Verwandte des Raja waren herbeigeströmt, in dem vergeblichen Wunsch, etwas zu erfahren, das ihre Hoffnung, er könnte noch am Leben sein, zu nähren vermochte. Doch Zachary hatte nichts Tröstendes zu bieten. Er war sich sicher, dass der Raja und die anderen vier ihre Flucht mit dem Leben bezahlt hatten.
Zu dem Mord an Subedar Bhairo Singh befragt, bestätigte Mr. Reid, dass er, wie viele andere, selbst dabei gewesen sei. Der Subedar sei getötet worden, während er auf Befehl des Kapitäns einem der Kulis sechzig Peitschenhiebe verabfolgt habe. Der Kuli, ein Mann von außergewöhnlicher Körperkraft, habe seine Fesseln gesprengt und den Subedar mit seiner eigenen Peitsche erdrosselt. Das Ganze sei blitzschnell vonstatten gegangen, vor Hunderten von Zeugen, und Kapitän Chillingworth habe sich gezwungen gesehen, den Kuli zum Tod durch den Strang zu verurteilen. Doch ehe das Urteil vollstreckt werden konnte, sei ein Sturm über die Ibis hereingebrochen.
Mr. Reids Aussagen zu diesem Punkt riefen erneut Unruhe in den Reihen der Eingeborenen hervor, unter denen sich offenbar auch etliche Verwandte des Subedars befanden …
Bhairo Singhs Angehörige hatten ihrer Empörung so lautstark Luft gemacht, dass sich alle Blicke auf sie gerichtet hatten. Es waren etwa ein Dutzend, großenteils ehemalige Sepoys wie jene, die auf der Ibis die Kulis bewacht hatten, so schloss Zachary aus ihrem Äußeren.
Er hatte sich oft darüber gewundert, welch geradezu fanatische Ergebenheit diese Männer Bhairo Singh gegenüber an den Tag legten. Hätten die Offiziere sie auf der Ibis nicht zurückgehalten, sie hätten seinen Mörder in Stücke gerissen. Ihre Mienen verrieten, dass sie noch immer nach Rache dürsteten.
Nach Abschluss der Anhörung zog sich die Kommission zur Beratung in einen Nebenraum zurück. Kurze Zeit später erschien Richter Kendalbushe wieder und verkündete, dass Mr. Zachary Reid von jeglicher Schuld freigesprochen worden sei. Das Urteil wurde von Teilen des Publikums mit Beifall begrüßt.
Nach seinen Plänen für die Zukunft befragt, soll Mr. Reid später geäußert haben, er beabsichtige, demnächst nach China aufzubrechen …
Damit hätte der Fall erledigt sein können …
Doch gerade als Zachary das Gebäude verlassen wollte, um seinen Freispruch mit Mr. Doughty zu feiern, trat ein Gerichtsdiener zu ihm und übergab ihm ein Bündel Rechnungen über diverse Ausgaben. Der größte Posten betraf seine Passage von Mauritius nach Indien; insgesamt ergab sich ein Betrag von fast hundert Rupien.
»Das kann ich nicht zahlen!«, rief Zachary. »Ich hab nicht mal fünf Rupien in der Tasche!«
»Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, Sir«, sagte der Mann alles andere als bedauernd, »dass Sie Ihr Steuermannspatent erst dann zurückerhalten, wenn alle Rechnungen beglichen sind.«
So wurde das geplante Freudenfest zur Trauerfeier. Nie hatte Zachary das Bier so bitter geschmeckt wie an diesem Abend.
»Was mache ich jetzt, Mr. Doughty? Wie soll ich ohne mein Patent hundert Rupien zusammenbekommen? Das sind fast fünfzig Silberdollar – bei dem, was ich hier in Kalkutta mit Gelegenheitsarbeiten verdiene, brauche ich über ein Jahr, um so viel zu sparen.«
Mr. Doughty kratzte sich nachdenklich an seiner Knollennase. Nach mehreren Schlucken Bier fragte er: »Sagen Sie mal, Reid, sind Sie nicht gelernter Schiffszimmermann?«
»Doch, Sir, ich hab meine Lehre auf der Gardiner-Werft in Baltimore gemacht, einer der Besten weltweit.«
»Meinen Sie, Sie kriegen mit Hammer und Säge noch was hin?«
»Mit Sicherheit.«
»Dann wüsste ich vielleicht eine Arbeit für Sie.«
Zachary spitzte die Ohren, als Mr. Doughty ihm sagte, worum es sich handelte: Für Arbeiten an einem Hausboot, das nach dem Prozess gegen den Raja von Raskhali Mr. Burnham zugefallen war, wurde ein Schiffszimmermann gesucht. Das budgerow lag derzeit nahe Mr. Burnhams Villa in Kalkutta vertäut und bedurfte nach langer Vernachlässigung dringend einer Überholung.
»Moment mal«, sagte Zachary. »Meinen Sie das budgerow, auf dem wir letztes Jahr mit dem Raja gespeist haben?«
»Genau das. Aber inzwischen ist es ein ziemliches Wrack. Wird kein Pappenstiel sein, den Kahn wieder auf Vordermann zu bringen. Mrs. Burnham hat mir vor ein paar Tagen deswegen ein Ohr abgeschwatzt. Hat gesagt, sie sucht einen Mystery dafür.«
»Einen Mystery? Was zum Teufel meinen Sie damit, Mr. Doughty?«
Mr. Doughty kicherte. »Immer noch keine Ahnung von Tuten und Blasen, was, Reid? Wird Zeit, dass Sie ein bisschen was von unserer indischen zaban lernen. Mysterys nennen wir hier Schreiner, Handwerker und so. Leute wie Sie. Wie sieht’s aus, hätten Sie Lust? Die Bezahlung ist gut, versteht sich – sollte reichen, um Ihre Schulden zu bezahlen.«
Zachary fiel ein Stein vom Herzen. »Und ob, Mr. Doughty! Und ob ich Lust habe – Sie können auf mich zählen!«
Am liebsten hätte er gleich am nächsten Morgen mit der Arbeit begonnen, doch wie sich herausstellte, war Mrs. Burnham mit den Vorbereitungen für eine Reise in die Berge beschäftigt. Ihre Tochter sollte auf ärztliches Anraten Kalkutta verlassen, und sie wollte das Mädchen in einen Luftkurort namens Hazaribagh bringen, wo ihre Eltern ein Anwesen besaßen. Dies wie auch ihre zahlreichen gesellschaftlichen Verpflichtungen und ihre Besserungsaktivitäten nahmen sie so in Beschlag, dass es Mr. Doughty erst nach mehreren Tagen gelang, zu ihr vorzudringen. Er sprach sie bei einem Vortrag an, den sie für einen unlängst in Kalkutta eingetroffenen englischen Arzt arrangiert hatte.
»Schauerlich war das, mein Junge.« Mr. Doughty wischte sich die Stirn. »Ein fettärschiger Quacksalber, der endlos über irgendeine grässliche Seuche geschwafelt hat. So was hab ich mein Lebtag noch nicht gehört. Da hätte man sich am liebsten selbst entmastet. Aber wenigstens hab ich Mrs. Burnham zu fassen gekriegt – sie will Sie morgen Vormittag sehen, in ihrem Haus. Meinen Sie, Sie können um zehn dort sein?«
»Klar kann ich das! Danke, Mr. Doughty!«
Für Shirin Modie in Bombay begann der Tag wie jeder andere. Später sollte sie es höchst merkwürdig finden, dass keinerlei Vorahnung oder Omen der Nachricht vorausgegangen war. Sie hatte ihr Leben lang viel auf Vorzeichen und Prophezeiungen gegeben; ihr Mann hatte sich oft darüber lustig gemacht und sie abergläubisch genannt. Doch sosehr sie ihr Gedächtnis auch anstrengte – sie erinnerte sich an nichts, was als Warnung vor dem, was dieser Morgen bringen sollte, hätte gelten können.
Am Abend sollten ihre Töchter Shernaz und Behroze mit ihren Kindern kommen. Das allwöchentliche Essen mit ihnen war, wenn Bahram in China weilte, Shirins einzige Zerstreuung, sonst gab es, von gelegentlichen Besuchen im Feuertempel am Ende der Straße abgesehen, nichts, was ihre Tage belebt hätte.
Shirin bewohnte die oberste Etage des Familiensitzes der Mistries in der Apollo Street, einer der verkehrsreichsten Straßen Bombays. Viele Jahre hatte ihr Vater, der angesehene Schiffbauer Seth Rustomjee Mistrie, dem Haushalt vorgestanden, und nach seinem Tod hatten ihre Brüder, die mit ihren Frauen und Kindern die unteren Stockwerke bevölkerten, den Familienbetrieb übernommen. Shirin war als einzige Tochter nach ihrer Heirat im Haus geblieben; ihre Schwestern waren, wie es der Brauch vorsah, zu ihren Ehemännern gezogen.
Im Mistrie-Haus herrschte reges Leben, von früh bis spät schwirrten die Stimmen von Khidmatgars, Bais, Khansamas, Ayahs und Chaukidars durch die Treppenaufgänge. Der ruhigste Teil des Gebäudes war die Wohnung, die Seth Rustomjee nach Shirins Verlobung für sie und Bahram vorgesehen hatte. Er hatte darauf bestanden, dass sich das Paar nach der Hochzeit unter seinem Dach einrichtete; Bahram war damals ein mittelloser junger Mann ohne familiäre Beziehungen in Bombay gewesen. Stets um das Wohl seiner Tochter besorgt, hatte der Seth sicherstellen wollen, dass es ihr auch nach ihrer Heirat keinen einzigen Tag an Annehmlichkeiten mangelte. Das war ihm gelungen – allerdings hatte er damit zugleich bewirkt, dass sie und ihr Mann in gewisser Weise von der Mistrie-Familie abhängig wurden.
Bahram hatte oft davon gesprochen, auszuziehen, doch Shirin hatte sich stets geweigert; die Vorstellung, während der langen Aufenthalte ihres Mannes in China ganz allein einen Haushalt führen zu müssen, hatte ihr Angst gemacht. Zudem hatte sie, solange ihre Eltern noch lebten, nirgendwo anders wohnen wollen als in dem Haus, in dem sie aufgewachsen war. Erst als es zu spät war, als ihre Töchter geheiratet hatten und ihre Eltern gestorben waren, hatte sie begonnen, sich dort ein wenig wie ein Eindringling zu fühlen. Nicht, dass die anderen ihr unfreundlich begegnet wären, ganz im Gegenteil: Sie zeigten sich geradezu übermäßig zuvorkommend, so als wäre sie ein Gast. Allen – und ganz besonders den Bediensteten – war jedoch bewusst, dass Shirin nicht in gleicher Weise Hausherrin war wie die Ehefrauen ihrer Brüder. Standen Entscheidungen über gemeinsam genutzte Bereiche wie Gärten oder Dachterrassen an, wurde sie nicht einbezogen, ihre Ansprüche auf die Benutzung der Kutschen wurden zurückgestellt oder gar übergangen, und wenn sich die Khidmatgars stritten, zogen ihre stets den Kürzeren.
Zuweilen fühlte sich Shirin, als würde sie in jener seltsamen Einsamkeit ertrinken, die das Leben in einem Haus mit sich bringt, in dem die Dienerschaft weit zahlreicher ist als die Herrschaft. Nicht zuletzt deshalb freute sie sich so auf die wöchentlichen Besuche ihrer Töchter und Enkelkinder. Schon Tage vorher machte sie viel Aufhebens um das Essen, kramte endlos in alten Rezepten und ließ die Gerichte vom Khansama probekochen.
An diesem Tag beschloss Shirin nach mehreren Gängen in die Küche, dem Menü noch etwas Besonderes hinzuzufügen: dar ni pori – Linsen, Mandeln und Pistazien im Teigmantel. Am Vormittag schickte sie einen Khidmatgar zu weiteren Besorgungen auf den Markt. Er blieb lange aus, und als er zurückkam, trug sein Gesicht einen sonderbaren Ausdruck. »Was ist los?«, fragte sie, doch er antwortete ausweichend und murmelte etwas von Vico, dem Zahlmeister ihres Mannes, den er unten mit ihren Brüdern habe sprechen sehen.
Das wunderte Shirin. Vico war ihrem Mann unentbehrlich, er war im vergangenen Jahr mit ihm nach China gereist und seitdem dort geblieben. Wenn er sich nun in Bombay aufhielt, wo war dann Bahram? Und weshalb sprach Vico mit ihren Brüdern, bevor er sie, Shirin, aufsuchte? Selbst wenn Bahram ihn in einer dringenden Angelegenheit vorausgeschickt hatte, so musste er ihm doch Briefe und Geschenke für sie mitgegeben haben.
Stirnrunzelnd sah sie den Khidmatgar an. Er stand seit vielen Jahren in ihren Diensten und kannte Vico gut. Eine Verwechslung war daher unwahrscheinlich, doch um sicherzugehen, fragte sie: »Bist du sicher, dass es Vico war?« Als der Mann nickte, überlief sie ein angstvoller Schauder. Schroff forderte sie ihn auf, wieder nach unten zu gehen.
»Sag Vico, er soll heraufkommen. Ich möchte ihn sofort sprechen.« Als sie an sich hinuntersah, merkte sie jedoch, dass sie noch gar nicht bereit war, Besuch zu empfangen. Sie rief nach einem Dienstmädchen und begab sich rasch in ihr Schlafzimmer. Als sie ihre almirah öffnete, fiel ihr Blick als Erstes auf den Sari, den sie bei Bahrams Abreise nach China getragen hatte. Mit zitternden Händen nahm sie ihn heraus und hielt ihn an ihre schmale, hagere Gestalt. Von der schweren, schimmernden gara-Seide ging ein grünlicher Glanz aus, der den ganzen Raum erhellte, auch ihr langes, spitzes Gesicht mit den großen Augen und ihre ergrauenden Schläfen.
Sie setzte sich aufs Bett und dachte an den Tag im letzten September, als Bahram nach Kanton abgereist war. Böse Vorzeichen hatten sie an diesem Morgen in Unruhe versetzt: Beim Ankleiden war ihr roter Hochzeitsarmreif zerbrochen, und in der Nacht war Bahrams Turban zu Boden gefallen. Voller Sorge hatte sie Bahram angefleht, an diesem Tag nicht zu fahren. Doch er hatte erklärt, es sei unumgänglich – warum, wusste sie nicht mehr genau.
Das Dienstmädchen kam herein – »Bibiji?« –, und sie besann sich, weshalb sie ins Schlafzimmer gegangen war. Sie nahm einen Sari aus der almirah, und als sie ihn anlegte, drangen aus dem Hof laute Stimmen herauf. Das war an sich nichts Ungewöhnliches, doch aus irgendeinem Grund beunruhigte es sie, und sie trug der Frau auf nachzusehen, was dort unten vor sich ging. Kurz darauf kam sie zurück und berichtete, einige Peons und Boten hätten mit chitthis in den Händen das Haus verlassen.
»Chitthis? Von wem? Warum?«
Das konnte das Dienstmädchen natürlich nicht wissen, und so fragte Shirin sie, ob Vico schon da sei.
»Nein, Bibiji, er ist noch unten und redet mit Ihren Brüdern. Sie sitzen in einem der daftars. Die Tür ist abgeschlossen.«
»So?«
Shirin zwang sich, still zu sitzen, während das Dienstmädchen ihr glänzendes hüftlanges Haar kämmte. Kaum fertig frisiert, vernahm sie von der Wohnungstür her Stimmen. In der Erwartung, Vico zu sehen, lief sie hinaus, doch als sie das Wohnzimmer betrat, fand sie dort zu ihrer Verwunderung ihre beiden Schwiegersöhne vor. Sie waren außer Atem und wirkten verstört; offensichtlich waren sie soeben aus ihren daftars herbeigeeilt.
Böse Ahnungen stiegen in Shirin auf, und sie vergaß die üblichen Höflichkeitsfloskeln. »Was macht ihr hier, mitten am Vormittag?«
Auch sie verzichteten für dieses Mal auf die Etikette: Sie fassten Shirin bei den Händen und führten sie zu einem Diwan.
»Was soll das?«, protestierte sie. »Was macht ihr denn?«
»Sasu-mai«, antworteten sie, »du musst jetzt stark sein. Wir müssen dir etwas sagen.«
Und da wusste sie es, tief in ihrem Innern. Doch sie schwieg, gönnte sich noch letzte Momente des Zweifels. Dann holte sie tief Luft. »Sagt es mir«, forderte sie die beiden auf. »Ich will es wissen. Geht es um euren Schwiegervater?«
Sie wandten den Blick ab, und das war ihr Bestätigung genug. Einen Moment lang war sie wie betäubt, dann kam ihr in den Sinn, was eine Witwe zu tun hatte, und sie schlug beinahe mechanisch ihre Handgelenke gegeneinander, sodass ihre gläsernen Armreife zerbrachen. Sie fielen zu Boden, und auf Shirins Haut erschienen winzige Blutstropfen. Flüchtig dachte sie daran, dass Bahram ihr die Reife vor vielen Jahren aus Kanton mitgebracht hatte. Doch die Erinnerung ließ keine Tränen aufsteigen, noch regte sich kein Gefühl in ihr. Sie schaute auf und sah Vico an der Tür stehen. Plötzlich wollte sie ihre Schwiegersöhne so schnell wie möglich loswerden.
»Habt ihr es Behroze und Shernaz schon gesagt?«, fragte sie.
Sie schüttelten den Kopf. »Wir sind zuerst hierhergekommen, Sasu-mai. Wir wissen nicht, was passiert ist. In den chitthis deiner Brüder stand nur, dass wir sofort kommen sollen. Sie meinten, du erfährst es besser von uns.«
Shirin nickte. »Ihr habt das Nötige getan. Alles Übrige wird Vico mir sagen. Ihr solltet jetzt zu euren Frauen nach Hause gehen. Für Behroze und Shernaz wird es noch schwerer sein als für mich. Ihr müsst stark sein für sie.«
»Ji, Sasu-mai.«
Sie gingen, und Vico kam herein, ein dickbäuchiger Mann mit vorquellenden Augen, wie immer europäisch gekleidet: Segeltuchhose und Jackett, ein Hemd mit Stehkragen und Krawatte. Den Hut hielt er in den Händen. Als er leise zu sprechen begann, unterbrach ihn Shirin. Sie hob die Hand und winkte ihre Dienstmädchen hinaus. »Geht«, sagte sie. »Ich möchte allein mit ihm reden.«
»Allein, Bibiji?«
»Ja, habt ihr nicht gehört? Allein.«
Sie entfernten sich, und Shirin bedeutete Vico, Platz zu nehmen, doch er schüttelte den Kopf.
»Was ist passiert, Vico?«, fragte sie. »Erzählen Sie mir alles.«
»Es war ein Unfall, Bibiji«, berichtete Vico. »Auf seinem Schiff, das der Seth so geliebt hat. Die Anahita lag nicht weit von Macao in der Nähe einer Insel namens Hongkong vor Anker. Wir waren erst an diesem Tag in Kanton an Bord gegangen. Alle legten sich früh schlafen, nur Sethji blieb noch auf. Er muss auf Deck spazieren gegangen sein. Es war dunkel, und wahrscheinlich ist er gestolpert und über Bord gefallen.«
Sie hörte aufmerksam zu und beobachtete Vico. Eine Art Entfremdung, die sie von früheren Trauerfällen her kannte, hatte sie erfasst. Dieser Zustand würde jedoch nicht lange währen, bald würde der Kummer sie übermannen, und ihr Gemüt würde sich für Tage verdüstern. Jetzt aber, solange sie noch klar zu denken vermochte, wollte sie genau wissen, was geschehen war.
»Er ist auf der Anahita spazieren gegangen?«
»Ja, Bibiji.«
Shirin runzelte die Stirn. Sie kannte die Anahita seit dem Tag, als das Schiff in der Werft ihres Vaters auf Kiel gelegt worden war. Sie selbst hatte es auf den Namen der zoroastrischen Gottheit des Wassers getauft, sie selbst hatte die Schnitzarbeiten an der Galionsfigur überwacht und auch das Innere ausgeschmückt.
»Wenn Sethji spazieren gegangen ist, muss er sich doch auf dem Achterdeck aufgehalten haben, oder?«
Vico nickte. »Ja, Bibiji, höchstwahrscheinlich. Dort ist er immer spazieren gegangen.«
»Aber wenn er vom Achterdeck gestürzt ist, dann hat es doch bestimmt jemand gehört. War denn keiner von den Laskaren auf Wache? Waren keine anderen Schiffe in der Nähe?«
»Doch, Bibiji, viele Schiffe waren in der Nähe, aber niemand hat etwas gehört.«
»Wo hat man ihn denn gefunden?«
»An einem Strand auf der Insel Hongkong, Bibiji. Dort ist sein Leichnam angespült worden.«
»Hat es eine Zeremonie gegeben? Ein Leichenbegängnis? Was habt ihr gemacht?«
Vico drehte seinen Hut in den Händen und antwortete: »Wir haben ein Leichenbegängnis abgehalten, Bibiji. Es waren viele Parsen in der Gegend, darunter ein Dastur, der hat die Sterberiten durchgeführt. Sethjis Freund, Mr. Zadig Karabedian, war zufällig auch in der Nähe. Er hat die Totenrede gehalten. Wir haben Sethji in Hongkong beerdigt.«
»Warum in Hongkong?«, fragte Shirin scharf. »Gibt es in Macao keinen Parsenfriedhof? Warum habt ihr ihn nicht dort beerdigt?«
»In Macao ging es nicht, Bibiji. Zu der Zeit gab es Unruhen auf dem Festland. Captain Elliot, der britische Bevollmächtigte, hatte alle britischen Untertanen angewiesen, sich von Macao fernzuhalten. Deshalb lag die Anahita in der Bucht von Hongkong vor Anker. Wir hatten keine Wahl, wir mussten Seth Bahram in Hongkong bestatten. Sie können Mr. Karabedian fragen, er kommt demnächst nach Bombay und wird Sie dann aufsuchen.«
Jetzt stieg der Kummer in Shirin hoch. Sie setzte sich.
»Wo liegt das Grab?«, fragte sie. »Ist es angemessen gekennzeichnet?«
»Ja, Bibiji. Hongkong ist dünn besiedelt, und das Inselinnere ist sehr hübsch. Das Grab liegt in einem schönen Tal. Seth Bahrams neuer Munshi hat die Stelle ausgesucht.«
»Ich wusste gar nicht, dass mein Mann einen neuen Munshi hatte.«
»Doch, Bibiji. Der Alte ist letztes Jahr auf der Fahrt nach Kanton gestorben, deswegen hat Seth Bahram einen neuen Sekretär eingestellt, einen Bengalen namens Anil Kumar Munshi. Ein gebildeter Mann.«
»Ist er mit Ihnen nach Bombay gekommen?«, fragte Shirin. »Können Sie ihn hierherbringen?«
»Nein, Bibiji, er ist nicht mit uns zurückgekommen. Er wollte in China bleiben, ein amerikanischer Kaufmann hat ihm eine Stelle angeboten. Soviel ich weiß, ist er noch dort.«
Ausländerenklave Kanton, 10. Juni 1839
Wenn ich nun dieses Tagebuch beginne, bedaure ich nur eines: dass ich nicht früher daran gedacht habe. Hätte ich nur schon letztes Jahr damit angefangen, als ich mit Seth Bahram nach Kanton kam! Dann hätten meine Aufzeichnungen mir helfen können, die Ereignisse zu schildern, die im März dieses Jahres zur Opiumkrise führten.
Doch wie auch immer: Ich habe meine Lektion gelernt und werde denselben Fehler nicht noch einmal machen. So begierig war ich darauf, mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen, dass ich, kaum hatte ich die Dschunke bestiegen, die mich von Macao nach Kanton bringen sollte, sogleich mein Notizbuch hervorholte. Das war jedoch ein Fehler, denn sofort war ich von Passagieren umringt, die wissen wollten, was ich da tat, und so ließ ich es wieder. Zudem machte ich mir klar, dass es unklug wäre, auf Englisch zu schreiben, wie ich es ursprünglich vorgehabt hatte. Ich schreibe besser auf Bangla; sollte das Tagebuch in falsche Hände geraten, wird es nicht so leicht zu entziffern sein.
Im Moment sitze ich in meinem neuen Logis im amerikanischen Hong, in dem sich Mr. Coolidge, mein neuer Arbeitgeber, eine Wohnung genommen hat. Den üppigen Lebensstil Seth Bahrams pflegt Mr. Coolidge nicht; seine Bediensteten hat er in ein Schlafquartier an der Rückseite des Hongs verbannt. Aber wir kommen ganz gut zurecht, und trotz der primitiven Unterbringung bin ich überglücklich, wieder in der Ausländerenklave von Kanton zu sein, jenem einzigartigen kleinen Vorposten, den wir Fanqui-town zu nennen pflegten!
Es mag seltsam erscheinen, sich so über einen Ort zu äußern, an dem man durch die vielen »Gwai-lo!«-, »Haak-gwai«- und »Achha!«-Rufe ständig daran erinnert wird, dass man dort fremd ist. Dennoch war es wie eine Heimkehr für mich, als ich in Kanton den Fuß an Land setzte. Vielleicht auch nur, weil ich so froh war, die Bucht von Hongkong mit ihrer Flotte englischer Handelsschiffe hinter mir gelassen zu haben. In letzter Zeit ist dort ein regelrechter Wald von Union Jacks emporgesprossen, und ich muss gestehen, dass mir eine Last von den Schultern fiel, als sie aus meinem Blickfeld verschwanden – mir ist einfach nicht wohl im Umkreis der britischen Flagge. Je weiter mich die Fähre nach China hineintrug, desto freier konnte ich atmen. Erst als ich bei der Ausländerenklave von Bord ging, hatte ich das Gefühl, endlich sicher zu sein vor dem alles erfassenden Blick und den alles an sich reißenden Händen Britannias.
Gestern Nachmittag habe ich meine alten Lieblingsplätze in Fanqui-town aufgesucht. Es ist verblüffend, wie sehr sich die Atmosphäre hier in der kurzen Zeit meiner Abwesenheit verändert hat. Von den Ausländern sind nur noch die Amerikaner da, und die geschlossenen Fensterläden der leer stehenden Faktoreien sind ein steter Hinweis darauf, dass hier nichts mehr so ist, wie es vor der Opiumkrise war. Die britische Faktorei wirkt ganz besonders trostlos. Es mutet seltsam an, dieses Gebäude, einst das stattlichste und betriebsamste in Fanqui-town, verriegelt und verrammelt zu sehen, die Veranden verwaist. Nicht einmal die Zeiger der Uhr an der Kapelle bewegen sich mehr. Sie stehen auf der Zwölf, wie im Gebet vereint.
Verlassen sind auch die beiden Faktoreien der parsischen Seths aus Bombay, der Achha und der Fungtai Hong. Am Fungtai verweilte ich einen Moment – wie könnte ich auch daran vorbeigehen, da er doch so viele Erinnerungen birgt! Ich hatte erwartet, dass Seth Bahrams Haus mittlerweile wieder vermietet sei, aber dem ist nicht so: Die Fensterläden seines daftars sind nach wie vor geschlossen, der Eingang ist bewacht. Gegen Zahlung einiger Münzen durfte ich eintreten und mich umsehen.
Die Räume sind, von einer feinen Staubschicht auf Böden und Möbeln abgesehen, noch genauso, wie wir sie verlassen haben. Meine Schritte hallten in den leeren Korridoren gespenstisch wider – ich erinnerte mich daran, wie es dort früher stets von Menschen gewimmelt hatte und aus der Küche masala-Düfte heraufgeweht waren, wie das Haus ganz von Seth Bahrams Geist erfüllt gewesen war. Jetzt spürte ich seine Abwesenheit schmerzlich und konnte nicht anders, als in den zweiten Stock hinaufzusteigen und einen Blick in das Büro zu werfen, in dem ich so viele lange Stunden mit dem Seth verbracht, Briefe abgeschrieben und Diktate aufgenommen habe. Auch hier hat sich nichts verändert. Der große Stein, den ihm sein Komprador einst zum Geschenk gemacht hat, ist noch an seinem Platz, ebenso der kunstvoll geschnitzte Schreibtisch. Seth Bahrams Sessel steht nach wie vor am Fenster, so wie während seiner letzten Wochen in Kanton. Hier war es fast, als befände sich der Seth selbst in diesem abgedunkelten Raum voller Schatten und blickte, Opium rauchend zurückgelehnt, auf den Maidan hinaus – als hielte er Ausschau nach Gespenstern, wie Vico einmal gesagt hatte.
Ein seltsamer Schauder überlief mich bei der Vorstellung, und ich ging rasch wieder hinunter und in den Sonnenschein hinaus. Ich entschloss mich zu einem Besuch in Comptons Druckerei und bog in die Old China Street ein. Auch sie, einst eine geschäftige Durchgangsstraße, wirkte verschlafen und verlassen. Erst als ich in die Thirteen Hong Street kam, an der Ausländerenklave und Stadt aufeinandertreffen, schien wieder alles normal. Hier herrschte wie immer dichtes Gewühl. Ein mächtiger Strom von Menschen schob sich in beiden Richtungen durch die Straße, und im Nu hatte er mich bis zu Comptons Druckerei mitgeführt. Auf mein Klopfen hin öffnete Compton selbst. In seinem graubraunen Gewand, mit dem zu einem akkuraten Knoten gewundenen Zopf und der runden schwarzen Kappe sah er genauso aus wie früher.
Er begrüßte mich mit einem breiten Lächeln und sagte auf Englisch: »Ah Nil! Wie geht es Ihnen?«
Zu seiner Überraschung antwortete ich auf Kantonesisch und sprach ihn mit seinem chinesischen Namen an: »Jou-sahn, Liang sin-saang! Nei hou ma?«
»Hai-ah!«, rief er. »Was höre ich da?«
Ich sagte ihm, dass mein Kantonesisch gute Fortschritte mache, und bat ihn, möglichst nicht Englisch mit mir zu sprechen. Er war entzückt und zog mich unter lauten »Hou-leng! Hou-leng!«-Rufen ins Innere des Hauses.
Auch die Druckerei hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Die Regale, einst mit Papier und Druckerschwärze angefüllt, sind leer, der durchdringende Geruch nach Öl und Metall ist dem Duft von Räucherwerk gewichen, die Tische, auf denen sich früher schmutzige Korrekturbögen stapelten, sind sauber.
Ich sah mich erstaunt um. »Mat-yeh aa?«
Compton zuckte resigniert mit den Schultern und klärte mich darüber auf, dass die Druckerpresse seit der Vertreibung der Briten aus Kanton stillstehe. Für eine englischsprachige Druckerei gebe es nun wenig zu tun in der Stadt – keine Zeitungen, keine Mitteilungsblätter, keine Bekanntmachungen.
»Aber jetzt habe ich eine andere Arbeit«, sagte Compton.
»Was für eine?«, fragte ich, und er erzählte, dass er für seinen früheren Lehrer Zhong Lou-si tätig sei, dem ich während der Opiumkrise mehrmals begegnet war (»Lehrer Chang« hatte ich ihn damals genannt, weil ich es nicht besser wusste). Zhong scheint inzwischen ein Mihn-daaih zu sein, ein »Großgesichtmann«, also eine bedeutende Persönlichkeit. Kommissar Lin, der Yum-chai, hat ihn beauftragt, Informationen über die Ausländer zu sammeln, über ihre Herkunftsländer, ihre Handelstätigkeit und vieles andere mehr.
Zu diesem Zweck hat Zhong Lou-si laut Compton ein Übersetzungsbüro eröffnet, in dem er Mitarbeiter beschäftigt, die sich mit Fremdsprachen und Orten in Übersee bestens auskennen. Compton hat er als einen der Ersten engagiert. Seine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, die englischen Zeitungen zu sichten, die in der Region erscheinen: The Canton Press, The Chinese Repository, The Singapore Journal und andere. Zhong Lou-sis Leute bringen sie ihm, und er durchsucht sie nach Beiträgen, die für den Yum-chai oder Zhong Lou-si von Interesse sein könnten.
Besonders aufmerksam verfolgt Compton natürlich den daaih-yin, den »großen Rauch«, und als ich kam, studierte er gerade einen Artikel im Chinese Repository über die Opiumproduktion in Indien. Das traf sich gut, denn viele Wörter darin – arkati, maund, tola, seer, chittak, ryot, carcanna und dergleichen – kannte er nicht. Er hatte sie in seinem englischen Wörterbuch nicht gefunden und wusste nun nicht weiter. Auch waren ihm viele der Orte, die in dem Bericht erwähnt wurden, unbekannt – Chhapra, Patna, Ghazipur, Monghyr, Benares und andere. Nur von Kalkutta, in Kanton Galigada genannt, hatte er schon gehört.
Ich erklärte ihm alles ausführlich, und er bedankte sich überschwänglich: »Mh-goi-saai, mh-goi-saai!«
Ich erwiderte, ich sei froh, ihm behilflich sein zu können, so könne ich mich wenigstens ein klein wenig für die vielen Freundlichkeiten revanchieren, die er und seine Familie mir erwiesen hätten, und auch dafür, dass ich bei meinem früheren Aufenthalt in diesem Jahr so viel Zeit in seiner Druckerei hätte verbringen dürfen. Es war wunderbar, wieder dort zu sein; Compton ist vielleicht der einzige meiner Bekannten, der genauso in Wörter vernarrt ist wie ich.
Der Vortrupp, so hatte man Kesri vor dem Abmarsch gesagt, würde fünf Stunden bis zum nächsten Lagerplatz brauchen. Ein Kundschaftertrupp war vorausgeschickt worden, um ein geeignetes Gelände am Ufer des Brahmaputra ausfindig zu machen. Kesri wusste, dass es bei seiner Ankunft bereits abgesteckt sein würde, mit gesonderten Bereichen für Offiziere, Sepoys, Latrinen, Lagerbasar und Tross.
Tatsächlich blähte Kesris Pferd nach fünf Stunden die Nüstern, als witterte es Wasser. Die Straße führte über einen Hügelkamm, und am Fuß eines sanften Abhangs kam der Brahmaputra in Sicht, so breit, dass man das jenseitige Ufer nur noch als einen verschwommenen grünen Strich wahrnehmen konnte. Auf einem hellbraunen Sandkliff am Wasser waren die Fahnen und Feldzeichen des Lagers aufgepflanzt.
Ein Sandstreifen zog sich den Fluss entlang, so weit das Auge reichte. In der Ferne erblickte Kesri jetzt eine rasch anwachsende Staubwolke, die sich dem Lager aus der entgegengesetzten Richtung näherte, an ihrer Spitze ein kleiner Trupp Berittener, deren Stander sie als Daak-Sowars oder Meldereiter auswiesen.
Es war lange her, seit zuletzt Briefe beim Bataillon eingetroffen waren. Fast ein Jahr hatte Kesri nichts mehr von seiner Familie gehört. Ungeduldig wie kaum ein anderer hatte er auf Nachricht gewartet, und nun freute er sich, als Erster Post zu bekommen.
Doch es sollte nicht sein: Kaum hatte einer der Meldereiter die Bataillonsfahne erspäht, scherte er aus und steuerte geradewegs auf die Kolonne zu. Als einzigem Berittenen der Vorhut oblag es Kesri, die Meldung entgegenzunehmen. Er übergab den Stander, den er trug, seinem Hintermann und galoppierte los.
Als der Reiter ihn herankommen sah, zügelte er sein Pferd und nahm das Tuch von seinem Gesicht. Da erkannte Kesri, dass es sich um einen Bekannten handelte, einen dem Stab des Feldzugs zugeordneten Risaldar. Kesri verlor keine Zeit und kam sogleich auf das zu sprechen, was ihm auf der Seele brannte.
»Ist Post für das Bataillon gekommen?«
»Ja, drei Taschen voll, die warten im Lager auf Sie.«
Der Risaldar schwang eine Kuriertasche von seiner Schulter und händigte sie Kesri aus.
»Aber das hier ist dringend, es muss sofort zu Ihrem Com’dant-Sahib.«
Kesri nickte und wendete sein Pferd.
Major Wilson, der Bataillonskommandant, ritt für gewöhnlich mit den anderen englischen Offizieren in der Mitte der Kolonne. Eine gute Meile trennte ihn dann von der Nachhut, wenn nicht mehr, denn gegen Ende eines Tagesmarsches legten die Offiziere oft eine Pause ein, um sich im Reiten oder Jagen zu messen. Manchmal saßen sie auch nur plaudernd im Schatten eines Baumes, während ihre Diener Tee und Kaffee für sie aufbrühten. So konnten sie sicher sein, dass ihre Zelte bereits aufgeschlagen waren, wenn sie ins Lager einritten.
Es würde eine Weile dauern, die Offiziere zu finden, Kesri würde den ganzen Tross entlangreiten müssen, gegen den Strom. Kaum hatte er sein Pferd gewendet, kam ihm ein Zug mit Sicheln ausgerüsteter Ghaskatas entgegen, deren Aufgabe es war, Futter für die Hunderte von Tieren zu beschaffen, die der Tross mitführte. Ihnen folgten die Männer, die das Lager einrichteten: Khalasis für das Aufschlagen der Zelte, Fahnen tragende Thudni-valas, Kulis mit dem Kochgeschirr, Dandia-Träger mit ihren Schulterjochen und natürlich der Reinigungstrupp: Mehtars und Bangy-Burdars. Nach ihnen kamen eine Schar Dhobis und Dhobins und eine lange Reihe mit Wäschebündeln bepackter Esel.
Als Kesri an den Dhobis vorbei war und zu den Ochsenkarren der Basar-Mädchen aufschloss, verlangsamte er sein Tempo. Mit ihrer Gebieterin Gulabi verband ihn eine lange Freundschaft, und sie würde es ihm verübeln, wenn er nicht auf einen Plausch bei ihr haltmachte. Doch ehe er sein Pferd zügeln konnte, schnappte eine Hand wie eine Klaue nach seinem Stiefel.
»Kesri! Sunn!«
Es war Pagla-Baba, ein Bettelmönch, Maskottchen des Bataillons. Wie andere seinesgleichen hatte er ein geradezu unheimliches Gespür dafür, was in den Köpfen der Menschen vorging.
»Ka bhaiyil – was gibt’s, Pagla-Baba?«
»Hamaar baat sun – höre meine Worte, Kesri: Ich prophezeie dir, dass du heute Nachricht von deinen Verwandten erhalten wirst.«
»Bhagwaan banwale rahas – Gott segne dich!«, rief Kesri dankbar.
Nun hatte er es noch eiliger, endlich ins Lager zurückzukommen, und vergaß Gulabi. Er gab seinem Pferd die Sporen und trabte an dem Abschnitt der Karawane entlang, der den Notabeln des Trosses vorbehalten war, den brahmanischen Geistlichen, dem Munshi, dem Basar-Chaudhuri mit seinen Rechnungsbüchern, dem Kayasth Dubash, der für die Offiziere dolmetschte, und dem Baniya-Modi, dem Zahlmeister und Geldverleiher des Bataillons, der Kredite an die Sepoys vergab und Überweisungen an ihre Familien tätigte. All diese Männer saßen paan kauend im selben Wagen.
Der Munshi war für die Post zuständig, ihm oblag es, sie an die Sepoys zu verteilen. Kesri hielt im Vorbeireiten bei ihm an und sagte ihm, dass daak eingetroffen sei und er, Kesri, darauf hoffen durfte endlich von seiner Familie zu hören.
»Halten Sie die chitthi für mich bereit«, sagte er. »Wir treffen uns im Lager, sobald es mir möglich ist.«
Das Gedränge auf der Straße hatte sich inzwischen ein wenig gelichtet, sodass Kesri die bailis mit den schweren Waffen – zerlegte Haubitzen, Mörser, Feldgeschütze – und die dazugehörigen Kanoniere, eine Abteilung Golondauzes und Geschützlaskaren, im Galopp passieren konnte. Als nächste kamen die burmesischen Kriegsgefangenen und der Verpflegungstrain mit Wagenladungen von Vorräten für die Offiziersküche: Kisten mit Dosen und Flaschen, Bier- und Whiskyfässer, zahlreiche mit Wein gefüllte Glasballons. Dicht dahinter folgte das Lazarett, eine lange Reihe leinwandüberspannter Ochsenkarren mit Kranken und Verwundeten.
Nachdem Kesri sie hinter sich gelassen hatte, geriet er mitten in die wimmelnden Herden der Ziegen, Schafe und Ochsen hinein, die für den Tisch der Offiziere bestimmt waren. Die Bheri-valas versuchten, ihm einen Weg zu bahnen, doch mit wenig Erfolg. Statt untätig zu warten, bis die Tiere vorbeigezogen waren, bog Kesri auf einen Streifen verwildertes Brachland ab.
Diese Entscheidung erwies sich als Glücksfall, denn kurz darauf entdeckte er die englischen Offiziere des Bataillons, etwa ein Dutzend an der Zahl. Sie waren aus der Kolonne ausgeschert und ritten auf den sandigen Hügelkamm zu, der den Fluss von der Straße trennte.
Auch sie hatten ihn gesehen und zügelten ihre Pferde. Einer von ihnen, Captain Neville Mee, der Bataillonsadjutant, ritt ihm entgegen, die anderen warteten im Schatten eines Baumes.
»Ist das eine Kuriertasche, Havildar?«
»Ja, Mee-Sah’b.«
»Die können Sie mir geben, Havildar. Danke.«
Der Adjutant nahm die Tasche an sich und sagte: »Warten Sie hier, könnte sein, dass wir Sie noch brauchen.«
Kesri sah Captain Mee nach, als er davontrabte und die Tasche dem Kommandanten übergab. Major Wilson öffnete sie, nahm einige Schriftstücke heraus und klopfte Mee auf den Rücken, wie um ihn zu beglückwünschen. Gleich darauf schüttelten ihm auch die anderen Offiziere die Hand und riefen: »Sie Glückspilz!«
Das machte Kesri neugierig. War Captain Mee befördert worden? Er hatte wahrhaftig lange genug darauf gewartet; fast zehn Jahre waren seit dem letzten Mal vergangen.
Mee war Kesris »Butcha« – sein Kind –, zumindest im Sprachgebrauch der Bengal Native Infantry: Kesri war Mees erste Ordonnanz gewesen, nachdem Mee frisch von der Militärakademie der Ostindien-Kompanie im englischen Addiscombe als achtzehnjähriger Fähnrich in das Bataillon eingetreten war. Selbst kaum älter als Mee, hatte Kesri zu diesem Zeitpunkt bereits drei Jahre als Sepoy gedient und genug Gefechte miterlebt, um sich als Veteranen zu betrachten. Er hatte Mee »erzogen«, hatte ihn mit den Gepflogenheiten des Bataillons vertraut gemacht, ihm die Griffe des Kushti-Ringens beigebracht, ihn gepflegt, wenn er krank war, und ihn nach wilden Spiel- und Saufgelagen im Offiziersclub wieder in Schuss gebracht.
Viele Sepoys taten dies und noch mehr für ihre Butchas; stiegen die Offiziere jedoch in der Hierarchie auf, gerieten solche Dienste oft in Vergessenheit. Nicht so bei Kesri und Mee: Ihre Beziehung hatte sich mit den Jahren weiter gefestigt.
Mee war ein hochgewachsener, breitschultriger Mann mit dunklem Teint, einem kantigen Kinn und Geheimratsecken. Sein joviales Auftreten täuschte über seine scharfe Zunge und sein hitziges Temperament hinweg. Als jungen Offizier hatte ihn seine Streitsucht nicht selten in Schwierigkeiten gebracht und ihm den Ruf eines regelrechten »Kaptán Marpit – Captain Raufbold« eingetragen. Die Zeit hatte seine Ecken und Kanten nicht abgeschliffen; eher schienen seine Reizbarkeit und Grobheit mit den Jahren noch zugenommen zu haben.
Doch auf seine Art war Captain Mee ein hervorragender Offizier, furchtlos im Gefecht und überaus fair im Umgang mit den Sepoys. Besonders Kesri hatte allen Grund, ihm dankbar zu sein. Captain Mee hatte bald gemerkt, dass Kesri insgeheim den Wunsch hegte, Englisch zu lernen. Er hatte ihn ermutigt und gefördert, bis Kesri alle anderen Inder im Bataillon, selbst die Dolmetscher, an Wortgewandtheit übertraf. Er und der Captain verstanden einander daher bestens, und ihre Beziehung ging weit über militärische Belange hinaus. Wollte Mee eine Frau für die Nacht, ließ er sich von Kesri beraten, welche Mädchen aus Gulabis Truppe nichts taugten und welche ihren Preis wert waren. Brauchte er Geld – was häufig vorkam, weil in seiner Börse, wie er selbst zugab, stets Ebbe herrschte –, bat er Kesri und nicht die Bankiers von Palmer & Co. oder den Baniya-Modi um ein Darlehen.
Dass Offiziere Schulden hatten, war nicht ungewöhnlich, denn viele von ihnen tranken und spielten gern. Captain Mee aber hatte mehr Schulden als die meisten anderen, einhundertfünfzig Sicca-Rupien allein bei Kesri. Viele hätten an seiner Stelle in die Regimentskasse gegriffen oder sich um einen Posten bemüht, auf dem man zu Geld kommen konnte. Doch so ein Mensch war Mee nicht. Obgleich wild und aufbrausend, war er doch von untadeliger Integrität.
So gut Kesri und Captain Mee einander auch kannten, wussten doch beide, dass ihre Beziehung auf einem System von Regeln beruhte, an die es sich zu halten galt. Kesri hätte niemals gewagt, den Adjutanten zu fragen, wozu seine Offizierskameraden den Captain beglückwünscht hatten. Doch Mee schnitt das Thema von sich aus an, als er herangeritten kam.
»Auf ein Wort, Havildar. Es ist chup-chup, also hängen Sie’s nicht an die große Glocke, ja?«
»Ja, Sir.«
»Die Depesche, die Sie eben gebracht haben … die war für mich. Ich werde nach Fort William in Kalkutta beordert. Das Oberkommando stellt ein Expeditionskorps für einen Einsatz in Übersee auf; ich habe Wind davon bekommen und mich dafür gemeldet. Ich werde eine Kompanie Sepoy-Freiwillige befehligen, und man hat mich gebeten, einen Unteroffizier meiner Wahl mitzubringen, deswegen erzähle ich Ihnen das alles. Der Einzige, der mir da einfällt, sind Sie, Havildar. Was meinen Sie? Hätten Sie vielleicht Lust mitzukommen?«
Sich freiwillig für einen Auslandseinsatz zu melden wäre Kesri an diesem Tag nie in den Sinn gekommen. Nach acht Monaten Garnisonsdienst auf einem fernen Stützpunkt an der Grenze zwischen Assam und Burma fühlte er sich ausgelaugt und freute sich auf ein wenig Ruhe. Aus Neugier fragte er jedoch: »Wo soll es denn hingehen, Sir?«
»Weiß ich noch nicht«, antwortete der Adjutant. »Die Sache ist noch in der Planung. Aber die Prämien sind gut, wie ich höre.«
Einen Moment lang war Kesri versucht, sich als Balamtir zu verpflichten. »Wirklich, Sir?«
»Ekdum!« Mee lächelte. »Ich bin dem Constable lange genug davongelaufen – das könnte jetzt die letzte Chance sein, meine Schulden zu tilgen. Mit battas und sonstigen Zulagen verdiene ich vierhundertfünfzehn Rupien! Dazu kommen noch die Prämien, ich müsste also in der Lage sein, alles zurückzuzahlen, auch Ihnen. Also, was sagen Sie, Havildar? Hätten Sie Lust auf ein Auslandsabenteuer?«
Da kam Kesri zu einem Entschluss. »Nein, Sir, zu erschöpft im Moment. Tut mir leid.«
Der Captain verzog enttäuscht den Mund. »Schade, Havildar, ich hatte auf Sie gezählt. Aber überlegen Sie sich’s, noch ist Zeit.«
Zachary machte sich vorsorglich schon frühzeitig auf den Weg zu dem Gespräch mit Mrs. Burnham.
Bethel, das Anwesen der Burnhams, befand sich in Garden Reach, einem weit außerhalb von Kalkutta gelegenen Vorort am Ufer des Hugli, südlich der Werften von Kidderpur. Viele der vermögendsten britischen Kaufleute besaßen dort luxuriöse Landsitze.
Die Burnham-Residenz war eine der prunkvollsten, ein weitläufiges Gebäude auf einem Grundstück, das sich über fast einen Hektar Ufergelände erstreckte. Zachary war zweimal als Dinnergast dort gewesen; beide Male war er von einem prächtig livrierten Chobdar empfangen und beim Betreten des glitzernden Spiegelsaals mit lauter Stimme angekündigt worden.
Damals war sein Stern noch im Aufgehen gewesen: Er war kurz zuvor zum zweiten Steuermann der Ibis befördert worden und nannte eine ganze Truhe voll feiner Kleidung sein eigen. Seit damals war es mit ihm jedoch steil bergab gegangen; das Ausmaß seines gesellschaftlichen Abstiegs wurde ihm in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, als er das Tor des Burnham-Anwesens erreichte. Man geleitete ihn zu einem Dienstboteneingang und übergab ihn dort einigen verschleierten Dienstmädchen, die ihn durch eine Reihe enger Flure und Treppenaufgänge bis an die Tür von Mrs. Burnhams Nähzimmer brachten, einem sonnendurchfluteten kleinen Raum mit Nähkästen auf den Tischen und Stickereien an den Wänden.
An einem der Tische saß Mrs. Burnham, in schlichten weißen Baumwollstoff gekleidet, auf dem Kopf eine Spitzenhaube. Sie hielt einen Stickrahmen in der Hand und blickte nicht auf, als Zachary gemeldet wurde.
»Ah, der Mystery? Schick ihn rein.«
Mrs. Burnham war eine hochgewachsene, üppige Person mit rötlich-braunem Haar und gleichgültig-gelassener Miene. Bei ihren früheren Begegnungen hatte sie kaum ein Wort an Zachary gerichtet, was ihm nicht unlieb gewesen war, denn ihre kühl-gelangweilte Art hatte ihn dermaßen eingeschüchtert, dass er möglicherweise um eine Antwort verlegen gewesen wäre.
Ohne ihre Haltung zu verändern oder ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, sagte sie nun: »Guten Morgen, Mr. …?«
»Reid, Ma’am. Guten Morgen.«
Zachary machte mit halb ausgestreckter Hand einen Schritt auf sie zu, trat aber, da sie noch immer nicht von ihrer Stickarbeit aufsah, schleunigst wieder den Rückzug an. Er begriff jetzt, weshalb sie ihn in ihrem Nähzimmer empfing und nicht in einem der zahlreichen Empfangsräume im Erdgeschoss: Sie wollte ihm unmissverständlich klarmachen, dass seine Stellung im Hause die eines Bediensteten war, nicht die eines Gastes, und dass er sich entsprechend zu verhalten hatte.
»Sie sind ausgebildeter Mystery, wie ich höre, Mr. Reid?«
»Ja, Ma’am. Ich habe auf der Gardiner’s Werft in Baltimore gelernt.«
Mrs. Burnhams Augen blieben auf ihre Stickarbeit gesenkt. »Ich nehme an, Mr. Doughty hat Ihnen erklärt, um was für eine Arbeit es sich handelt. Trauen Sie sich zu, das budgerow zu unserer Zufriedenheit zu überholen?«
»Ja, Ma’am. Ich werde mein Bestes tun.«
Da blickte sie auf und musterte ihn stirnrunzelnd. »Sie scheinen mir ziemlich jung für einen erfahrenen Mystery, Mr. Reid. Aber Mr. Doughty ist voll des Lobes über Sie, und ich bin geneigt, seinen Worten Glauben zu schenken. Er hat mir auch von Ihren finanziellen Nöten berichtet und mir den Eindruck vermittelt, dass Sie unserer Mildtätigkeit würdig sind.«
»Mr. Doughty ist sehr freundlich, Ma’am.«
Mrs. Burnham ignorierte seine Worte und fuhr fort: »Mein Mann und ich sind stets bestrebt, uns der armen Weißen in diesem Land anzunehmen. Leider gibt es viel zu viele davon. Sie wagen sich aus dem Abendland fort, um ihr Glück zu machen, und geraten dann in Schwierigkeiten. Mr. Burnham betrachtet es als unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zu verhindern, dass diese unglücklichen Geschöpfe dem Ansehen der Herrenrasse Schaden zufügen. Wir sind stets bemüht, uns jenen gegenüber, die dessen bedürfen, großzügig zu zeigen. Deshalb bin ich geneigt, Ihnen die Stelle anzubieten.«
»Vielen Dank, Ma’am, Sie werden es nicht bereuen.«
Nun runzelte sie die Stirn noch stärker, als wollte sie ihm bedeuten, dass sein Dank verfrüht sei.
»Darf ich fragen, Mr. Reid«, fuhr sie fort, »wo Sie zu wohnen gedenken, wenn ich Sie für diese Arbeit engagiere?«
Die Frage überraschte Zachary, und er stotterte: »Wieso, Ma’am … Ich … ich habe ein Zimmer im Kidderpur …«
»Es tut mir leid«, sagte sie scharf, »aber das geht nicht. Diese Pensionen in Kidderpur sind ja wahre Brutstätten von Krankheit, Frevel und Laster. Das kann ich beim besten Willen nicht zulassen. Das budgerow muss nachts bewacht werden, und ich kann keinen meiner Chaukidars entbehren.«
Damit wollte sie offenbar andeuten, so schloss Zachary aus ihren Worten, dass er auf dem Hausboot wohnen sollte. Er konnte sein Glück kaum fassen. Den verwanzten Absteigen in Kidderpur zu entkommen, war mehr als er zu hoffen gewagt hatte.
»Ich würde sehr gern auf das budgerow ziehen, Ma’am.« Er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie erpicht er darauf war. »Ich meine, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Da legte Mrs. Burnham den Stickrahmen endlich beiseite, doch nur um Zachary einer Musterung zu unterziehen, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb.
»Dass wir uns recht verstehen, Mr. Reid«, sagte sie mit zunehmend schneidender Stimme. »Dies ist ein ehrenwertes Haus, in dem gewisse Wertmaßstäbe hochgehalten werden. Solange Sie auf diesem Anwesen leben, wird von Ihnen erwartet, dass Sie zu jeder Zeit den äußersten Anstand wahren. Unter keinen Umständen wird es Ihnen gestattet sein, Besuch zu empfangen, weder männlichen noch weiblichen. Haben wir uns verstanden?«
»Ja, Ma’am, vollkommen.«
Wieder legte sie die Stirn in Falten. »Ich werde demnächst eine Weile nicht hier sein«, sagte sie. »Ich muss meine Tochter auf den Landsitz meiner Eltern in Hazaribagh bringen. Ich verlasse mich darauf, dass während meiner Abwesenheit hier kein Schlendrian einkehrt.«
»Natürlich, Ma’am.«
»Falls doch, seien Sie versichert, dass es mir zu Ohren kommt. Ich weiß, dass Sie zur See gefahren sind, und das bereitet mir offen gestanden erhebliche Sorgen. Ihnen ist sicher bewusst, welch beklagenswerten Ruf sich Seeleute in den Augen achtbarer Leute erworben haben.«
»Ja, Ma’am.«