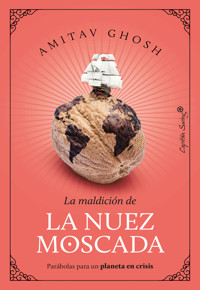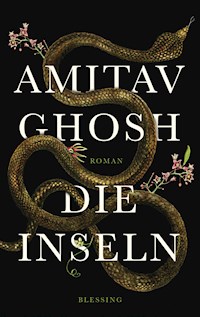
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Deen Datta, Antiquar in Brooklyn, bei einem Besuch in seiner alten Heimat Kalkutta auf eine bengalische Sage um eine Schlangengöttin stößt, lernt er die beiden jungen Männer Tipu und Rafi kennen. Tipu wird bei dem Besuch eines Schreins für die Schlangengöttin von einer Kobra gebissen. Er hat daraufhin seltsame Visionen, Deen wiederum meint, seinen Willen zu verlieren. Ein paar Monate später trifft er Rafi in Venedig wieder: Deen ist als Übersetzer hier, Rafi einer von Hunderten Klimaflüchtlingen. Er wollte gemeinsam mit Tipu noch Europa, doch hat ihn unterwegs verloren.
Deen und Rafi machen sich mithilfe einer Gruppe Aktivisten daran, ihn zu finden – und kommen dabei auch der geheimnisvollen bengalischen Legende auf die Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Amitav Ghosh nimmt uns in seinem neuen, epischen Roman mit in eine Welt, die aufgrund von Naturkatastrophen in Bewegung geraten ist, wo Menschen und Tiere auf der Flucht vor Überschwemmungen, Waldbränden, Stürmen und der Erwärmung der Ozeane in eine ungewisse Zukunft aufbrechen müssen, und in der alte Mythen und Legenden eine neue Bedeutung bekommen.
Da ist Rafi, ein junger Mann aus Westbengalen, der auf dem langen Weg nach Europa seinen Freund Tipu verloren hat und nun in Venedig festsitzt; da ist Piya, eine Meeresbiologin und Umweltaktivistin, die die Routen von Delfinen und Walen auf der Suche nach neuen Lebensräumen begleitet und dokumentiert. Und da ist Deen Datta, ein Sammler seltener Bücher und Schriften, den die Stürme des Lebens aus seinem stillen Alltag als Antiquar in Brooklyn vertrieben und auf eine Reise über Indien, Los Angeles bis nach Italien geschickt haben.
In Vendig, auf dieser uralten Insel an der Küste des Mittelmeers, seit jeher Zuflucht für Menschen aus aller Welt, Umschlagplatz für Waren und Geschichten, Schicksale und Hoffnungen, treffen die Wege von Rafi, Tipu, Piya und Deen aufeinander. Und keiner von ihnen ahnt, dass sie durch eine uralte bengalische Legende verbunden sind, deren Geheimnis und Ursprung genau hier, in der Lagunenstadt verborgen liegen.
Der Autor
Amitav Ghosh wurde 1956 in Kalkutta geboren und studierte Geschichte und Sozialanthropologie in Neu-Delhi. Nach seiner Promotion in Oxford unterrichtete er an verschiedenen Universitäten. Mit Der Glaspalast (Blessing, 2000) gelang dem schon vielfach ausgezeichneten Autor weltweit der große Durchbruch. Darauf folgte Hunger der Gezeiten (Blessing. Zuletzt erschienen seine Romantrilogie Das mohnrote Meer (2008), Der rauchblaue Fluss (2012) und Die Flut des Feuers (2016) bei Blessing sowie den Essay Die große Verblendung (2017). Ghosh lebt in Indien und den USA.
AMITAV GHOSH
DIE
INSELN
Roman
Aus dem Englischen
von Barbara Heller und Rudolf Hermstein
Blessing
Originaltitel: Gun Island
Originalverlag: John Murray, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Amitav Ghosh
Copyright © 2019 by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie
nach einem Entwurf von Ahlawat Gunjan;
Umschlagillustration: Nirupa Rao
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-24102-5V001
www.blessing-verlag.de
Für
Anna Nadotti
und
Irene Bignardi
Erster Teil
Der Gewehrhändler
Kalkutta
Das Seltsamste an dieser seltsamen Reise war, dass ein Wort den Anstoß dazu gab – und nicht einmal ein besonders klangvolles, sondern ein ganz normales, alltägliches, von Kairo bis Kalkutta weitverbreitetes Wort: bundook. In vielen Sprachen, einschließlich meiner eigenen, des Bengali oder Bangla, bedeutet bundook »Gewehr«. Auch im Englischen ist das Wort bekannt. Wie in der Kolonialzeit üblich, fand es Eingang ins Oxford English Dictionary, wo es mit rifle übersetzt wird.
Doch an dem Tag, als die Reise begann, war weit und breit kein Gewehr zu sehen. Das Wort bezog sich auch gar nicht auf eine Waffe, und genau deshalb weckte es mein Interesse: Das Gewehr war Teil eines Namens – Bonduki Sadagar –, den man mit »Gewehrhändler« übersetzen könnte.
Der Gewehrhändler trat nicht in Brooklyn, wo ich wohne und arbeite, in mein Leben, sondern in der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin: in Kalkutta (oder Kolkata, wie es heute offiziell heißt). In jenem Jahr, wie in vielen anderen, verbrachte ich dort einen großen Teil des Winters, vordergründig zu geschäftlichen Zwecken. Meine Arbeit – ich handle mit seltenen Büchern und asiatischen Antiquitäten – erfordert es, dass ich mich häufig vor Ort umsehe, und da ich in dem Haus, das meine Geschwister und ich von unseren Eltern geerbt haben, eine kleine Wohnung besitze, ist die Stadt zu einer zweiten Operationsbasis für mich geworden.
Doch nicht nur die Arbeit führte mich Jahr für Jahr wieder dorthin. Kolkata war mitunter auch ein Refugium für mich, die Stadt bot mir Zuflucht vor der Eiseskälte des Winters in Brooklyn und auch vor der Einsamkeit eines trotz wachsenden beruflichen Erfolgs immer desolateren Privatlebens. Und es war nie so desolat gewesen wie in jenem Jahr, als eine vielversprechende Beziehung ein jähes Ende fand: Eine Frau, mit der ich lange zusammen gewesen war, hatte ohne Angabe von Gründen Schluss gemacht und sämtliche Wege der Kommunikation mit mir blockiert. Dieses »Ghosting« erlebte ich zum ersten Mal, eine ebenso demütigende wie schmerzhafte Erfahrung.
Plötzlich – ich ging bereits auf die sechzig zu – war ich so allein wie nie zuvor. Ich flog deshalb früher als sonst nach Kalkutta, schloss mich der alljährlichen Wanderungsbewegung an, wenn es in nördlichen Breiten kalt wird und Scharen von »Auslands-Kalkuttanern« sich aufmachen, um in der Stadt zu überwintern. Ich wusste, dass ich dort viele Freunde und Verwandte treffen würde und dass die Wochen in einem Wirbel von Essenseinladungen, Dinnerpartys und Hochzeitsfeiern nur so vorüberfliegen würden. Dabei lag mir der Gedanke wohl nicht ganz fern, dass ich vielleicht eine Frau kennenlernen würde, mit der ich mein Leben teilen konnte (bei vielen Männern meines Alters war es tatsächlich so gekommen).
Aber natürlich ergab sich nichts dergleichen, obwohl ich keine Gelegenheit ausließ, unter die Leute zu gehen, und nicht wenigen geschiedenen Frauen, Witwen oder anderweitig alleinstehenden Frauen passenden Alters vorgestellt wurde. Einige Male glomm sogar ein Hoffnungsfunke in mir auf … doch alsbald musste ich wie schon so oft feststellen, dass kaum eine Berufsbezeichnung weniger anziehend auf Frauen wirkt als »Antiquar«.
So verstrichen die Monate in einer einzigen Folge von Enttäuschungen, und meine Rückkehr stand bereits kurz bevor, als ich den für mich letzten der gesellschaftlichen Anlässe in dieser Saison wahrnahm: die Hochzeit der Tochter eines Cousins.
Ich war gerade eingetroffen – die Feier fand in einem verstaubten Klub aus der Kolonialzeit statt –, als mich Kanai Dutt ansprach, ein entfernter Verwandter.
Ich hatte Kanai Jahre nicht gesehen, was ich jedoch nicht unbedingt bedauerte. Er war schon immer ein aalglatter, eitler Besserwisser gewesen, der mit seiner Zungenfertigkeit und seinem guten Aussehen Frauen umgarnte und es zu etwas brachte. Er lebte vorwiegend in Delhi und hatte sich in der Treibhausatmosphäre dieser Stadt einen Platz als Liebling der Medien erobert. Es war keineswegs ungewöhnlich, dass man ihn, kaum hatte man den Fernseher eingeschaltet, in einer Talkrunde sitzen und über irgendetwas schwadronieren sah. Er kannte Gott und die Welt, wie man so schön sagt, und war häufig Thema in Zeitungen, Zeitschriften und sogar Büchern.
Am meisten ärgerte mich an Kanai, dass es ihm immer irgendwie gelang, mich aus dem Konzept zu bringen. So auch jetzt, als er mich Dinu nannte (diesen Spitznamen meiner Kindheit hatte ich zugunsten des amerikanischer klingenden »Deen« längst abgelegt).
»Sag mal, Dinu«, begann er nach einem flüchtigen Händedruck, »stimmt es, dass du dich als Experte für bengalisches Volkstum etabliert hast?«
Der offenkundige Sarkasmus dieser Frage irritierte mich. »Na ja«, stotterte ich, »vor langer Zeit habe ich mal auf dem Gebiet geforscht. Das habe ich aber aufgegeben, als ich die akademische Welt verlassen habe und Buchhändler geworden bin.«
»Aber du hast promoviert, oder?«, fragte er mit kaum verhohlenem Spott. »Genau genommen bist du also ein Experte.«
»So würde ich es nicht gerade nennen …«
Er unterbrach mich ohne ein Wort der Entschuldigung. »Dann sag mir, du Experte: Hast du irgendwann mal von einer Figur namens Bonduki Sadagar gehört?«
Er hatte mich offenbar überrumpeln wollen, und das war ihm auch gelungen. Der Name Bonduki Sadagar sagte mir gar nichts, und ich war versucht anzunehmen, Kanai hätte ihn erfunden.
»Was meinst du mit ›einer Figur‹?«, fragte ich. »Irgendeinen Volkshelden?«
»Ja, wie Dokkhin Rai oder Chand Sadagar …«
Er nannte noch weitere bekannte Gestalten aus der bengalischen Folklore: Satya Pir, Lakhindar und andere. Sie sind nicht wirklich Götter, aber auch keine sterblichen Heiligen. Wie die wandernden Schlickflächen des Bengal-Deltas treten sie dort auf, wo Flüsse sich in viele Mündungsarme verzweigen. Bisweilen erinnern Schreine an sie, und fast immer ranken sich Legenden um ihre Namen. Und da Bengalen ein maritimes Land ist, spielt die Seefahrt darin oft eine große Rolle. Die berühmteste dieser Legenden ist die eines Kaufmanns namens Chand – Chand Sadagar –, von dem es heißt, er sei übers Meer geflohen, um der Verfolgung durch Manasa Devi zu entgehen, der Göttin, die über die Schlangen und alle anderen giftigen Tiere gebietet.
Es gab in meiner Kindheit eine Zeit, in der dieser Kaufmann Chand und seine Erzfeindin Manasa Devi ebenso Teil meiner Traumwelt waren wie später Batman und Superman, nachdem ich Englisch gelernt und angefangen hatte, Comics zu lesen. Damals gab es in Indien noch kein Fernsehen, und wer Kinder unterhalten wollte, musste ihnen Geschichten erzählen. Waren die Erzähler Bengalen, kamen sie früher oder später unweigerlich auf die Legende vom Kaufmann und der Göttin zurück, die von ihm angebetet werden wollte.
Der Reiz der Geschichte liegt, ähnlich wie bei der Odyssee, wohl darin, dass ein listenreicher menschlicher Protagonist es mit Mächten aufnimmt, irdischen und göttlichen, die ihm haushoch überlegen sind. Im Gegensatz zu dem griechischen Epos endet die Legende vom Kaufmann Chand jedoch nicht damit, dass er zu Heim und Herd zurückkehrt: Sein Sohn Lakhindar wird in der Hochzeitsnacht von einer Kobra getötet, dessen tugendhafte Braut Behula fordert seine Seele von der Unterwelt zurück und führt den Kampf zwischen dem Kaufmann und Manasa Devi einer halbherzigen Lösung zu.
Ich weiß nicht mehr, wann ich die Geschichte zum ersten Mal hörte und wer sie mir erzählt hat, aber durch die ständige Wiederholung sank sie so tief in mein Unterbewusstsein, dass sie mir gar nicht mehr präsent war. Manchen Geschichten wohnt jedoch ebenso wie bestimmten Lebensformen eine besondere Lebenskraft inne, durch die sie andere, ähnlich geartete überdauern, und da die Legende von dem Kaufmann und Manasa Devi sehr alt ist, besitzt sie, so vermute ich, genug von dieser Kraft, um lange Ruheperioden zu überstehen. Wie auch immer – als ich, ein Student von Anfang zwanzig und noch neu in Amerika, nach einem Thema für eine wissenschaftliche Arbeit suchte, taute sie im Permafrost meines Gedächtnisses wieder auf und beanspruchte von Neuem meine ganze Aufmerksamkeit.
Ich las dann einige der bengalischen Versepen über den Kaufmann (es gibt deren viele) und merkte dabei, dass der Rang der Legende in der Kultur Ostindiens eine seltsame Ähnlichkeit mit dem aufwies, was ich darüber im Kopf hatte. Die Geschichte lässt sich bis zu den Wurzeln des kollektiven Gedächtnisses Bengalens zurückverfolgen. Wahrscheinlich entstand sie unter den autochthonen Völkern der Region und geht auf reale historische Figuren und Ereignisse zurück (bis heute gibt es in Assam, Westbengalen und Bangladesch zahlreiche archäologische Stätten, die in der volkstümlichen Überlieferung mit dem Kaufmann und seiner Familie verknüpft sind). Und auch im kollektiven Gedächtnis scheint die Legende Lebenszyklen zu durchlaufen: Manchmal versinkt sie in einem Jahrhunderte währenden Schlaf, um dann plötzlich in Form einer Welle erneuten Erzählens wieder zum Leben zu erwachen. Dabei tauchen die bekannten Figuren zum Teil unter neuen Namen auf, und auch die Handlung kann leicht verändert sein.
Einige dieser Epen gelten als Klassiker der bengalischen Literatur, und eines davon machte ich zum Thema meiner Arbeit: ein sechshundertseitiges Gedicht in frühem Bengali. Die Entstehung des Textes war üblicherweise auf das 14. Jahrhundert datiert worden, aber natürlich reizt einen aufstrebenden Wissenschaftler nichts so sehr wie eine weithin akzeptierte Theorie, und so argumentierte ich aufgrund interner Evidenzen (etwa der Erwähnung von Kartoffeln), dass das Gedicht erst viel später seine endgültige Form erhalten haben müsse. Vermutlich sei es von anderen Autoren vollendet worden, im 17. Jahrhundert, so meine These, lange nachdem die Portugiesen Pflanzen aus der Neuen Welt in Asien eingeführt hatten.
Davon ausgehend postulierte ich, dass die Lebenszyklen der Geschichte – ihr regelmäßiges Wiedererwachen nach langen Ruheperioden – mit Zeiten des Umbruchs und der Zerrüttung einhergingen wie etwa dem 17. Jahrhundert in jenen Teilen Indiens, in denen die Europäer ihre ersten Kolonien gründeten.
Dieser letzte Teil meiner Arbeit war es wohl, der meine Prüfer am meisten beeindruckte (und erst recht die Redaktion der Zeitschrift, die den Artikel, in dem ich meine Thesen zusammenfasste, später veröffentlichte). Rückblickend erstaunt mich nicht so sehr die jugendliche Anmaßung, der diese Thesen entsprangen, als vielmehr meine Betriebsblindheit, die mich nicht erkennen ließ, dass meine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Legende genauso auf ihre Entwicklung in meiner eigenen Erinnerung zutreffen konnten. Ich kam gar nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob die Geschichte nicht vielleicht deshalb wieder in meinem Kopf aufgetaucht war, weil ich selbst damals die bewegtesten Jahre meines Lebens durchmachte, eine Zeit, in der ich mich von einem zweifachen Schock erholen musste: dem Tod der Frau, in die ich verliebt gewesen war, und meiner anschließenden Übersiedlung – dank eines Stipendiums, das genau im richtigen Moment kam – aus dem konfliktgeschüttelten Kalkutta meiner Jugend in eine beschauliche kleine Universitätsstadt im Mittleren Westen der USA. Als ich diese Phase endlich hinter mir hatte, war ich entschlossen, mich nie wieder solchen Turbulenzen auszusetzen. Ich scheute keine Mühen, um ein unauffälliges, ereignisloses Dasein zu führen, und das gelang mir so gut, dass ich an jenem Tag auf der Hochzeitsfeier in Kolkata, als der Sadagar in Gestalt des Gewehrhändlers wieder in mein Leben trat, gar nicht auf den Gedanken kam, dass die sorgfältig geplante ruhige Gelassenheit meines Lebens erneut ein Ende finden könnte.
»Bist du sicher, dass das der richtige Name ist?«, fragte ich Kanai abweisend. »Vielleicht hast du dich ja verhört.«
Doch er blieb dabei: Er habe den Begriff »Gewehrhändler« (bonduki sadagar) bewusst gebraucht. »Du weißt doch sicher«, sagte er in seiner aufreizend überheblichen Art, »dass die Figur eines Kaufmanns immer wieder in unserer Folklore auftaucht, unter vielen verschiedenen Namen. Manchmal sind die Geschichten mit bestimmten Orten verknüpft, und das gilt meiner Meinung nach auch für die Legende vom Bonduki Sadagar. Es ist eine lokale Sage.«
»Wieso?«
»Weil sie«, sagte Kanai, »mit einem Schrein – einem dhaam – in den Sundarbans verbunden ist.«
»In den Sundarbans!« Der Gedanke, dass sich in einem von Tigern heimgesuchten Mangrovenwald ein Schrein verbergen könnte, war so abwegig, dass ich laut auflachte. »Wieso sollte man in einem Sumpf einen dhaam bauen?«
»Vielleicht«, erwiderte Kanai kühl, »weil jeder Kaufmann, der Bengalen jemals per Schiff verlassen hat, durch die Sundarbans musste, anders kommt man nicht ans Meer. Die Sundarbans bilden die Grenze, an der Handel und Wildnis einander direkt ins Auge blicken; genau dort wird der Krieg zwischen Profit und Natur geführt. Kann es einen besseren Ort für einen Schrein geben, der Manasa Devi geweiht ist, als einen von Schlangen wimmelnden Wald?«
»Hat überhaupt mal jemand diesen Schrein gesehen?«, fragte ich.
»Ich selbst war nicht dort«, antwortete Kanai, »aber meine Tante Nilima.«
»Deine Tante? Du meinst Nilima Bose?«
»Genau. Sie war es, die mir vom Bonduki Sadagar und dem dhaam erzählt hat. Sie hat gehört, dass du in Kolkata bist – ich soll dir ausrichten, dass sie sich über einen Besuch von dir freuen würde. Sie ist inzwischen Ende achtzig und bettlägerig, aber geistig so frisch wie eh und je. Sie möchte mit dir über den Schrein sprechen, er wird dich interessieren, meint sie.«
Ich zögerte. »Ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme. Ich fliege demnächst nach New York zurück.«
Er zuckte mit den Schultern. »Deine Entscheidung.« Er holte einen Kugelschreiber hervor, kritzelte einen Namen und eine Telefonnummer auf eine Karte und gab sie mir.
Ich warf einen Blick darauf, doch da stand nicht, wie ich erwartet hatte, der Name seiner Tante.
»Piya Roy?«, fragte ich. »Wer ist das?«
»Eine Freundin, eine Amerikanerin aus Bengalen. Sie arbeitet an einer Uni irgendwo in Oregon. Im Winter ist sie immer hier, wie du, dann wohnt sie meistens bei meiner Tante. Da ist sie jetzt auch, und wenn du dich entschließt hinzufahren, arrangiert sie alles Nötige. Ruf sie an, es könnte sich lohnen. Piya ist eine interessante Frau.«
Der Name von Kanais Tante verlieh dem, was bisher ziemlich abenteuerlich geklungen hatte, mehr Gewicht. Was von Nilima Bose kam, konnte man nicht spöttisch abtun. Von Politikern umworben, von Gutmenschen verehrt, gern gesehen bei Spendern und Sponsoren und von der Presse gefeiert, war sie ein Mensch, dessen Glaubwürdigkeit über jeden Zweifel erhaben war.
In eine reiche Juristendynastie in Kalkutta hineingeboren, hatte Nilima Anfang der Fünfzigerjahre gegen den Widerstand ihrer Familie einen armen Schullehrer geheiratet. Nach der Hochzeit war sie mit ihm in eine Kleinstadt am Rand der Sundarbans gezogen. Einige Jahre später hatte sie eine Frauengruppe gegründet, aus der dann der Badabon Trust hervorgegangen war, eine von Indiens angesehensten Wohltätigkeitsorganisationen. Der Trust betrieb mittlerweile ein ausgedehntes Netz kostenloser Krankenhäuser, Schulen, Beratungsstellen und Werkstätten.
In den letzten Jahren hatte ich Nilimas Aktivitäten hauptsächlich über eine Chatgruppe für Mitglieder der erweiterten Familie verfolgt. Meine persönliche Bekanntschaft mit ihr ging auf meine Teenagerzeit zurück, als sich unsere Wege auf einigen Familientreffen gekreuzt hatten. Das letzte lag sehr lange zurück, und so war ich überrascht – und nicht wenig geschmeichelt –, dass Nilima sich an mich erinnerte. Es wäre also unhöflich gewesen, sagte ich mir, nicht wenigstens die Nummer anzurufen, die Kanai mir gegeben hatte.
Das tat ich am nächsten Morgen, und es meldete sich eine unverkennbar amerikanisch klingende Stimme. Piya hatte meinen Anruf offensichtlich erwartet, denn ihre ersten Worte waren: »Hallo, ist dort Mr. Datta?«
»Ja, aber nennen Sie mich bitte Deen, von Dinanath.«
»Und ich bin Piya, von Piyali.« Es klang energisch, aber auch freundlich. »Kanai hat mir gesagt, dass Sie vielleicht anrufen. Nilima-di hat nach Ihnen gefragt. Meinen Sie denn, Sie könnten sie besuchen?«
Etwas in ihrer Stimme – eine Direktheit, gepaart mit einem gewissen Ernst – faszinierte mich. Ich musste an Kanais Worte denken – »Piya ist eine interessante Frau« – und war plötzlich sehr neugierig auf sie. Ich vergaß die Ausreden, die ich mir zurechtgelegt hatte, und sagte: »Ja, ich komme sehr gern. Es müsste allerdings bald sein, ich fliege in ein paar Tagen in die USA zurück.«
»Bleiben Sie dran, ich rede kurz mit Nilima-di.«
Es dauerte ein paar Minuten, bis sie sich wieder meldete. »Ginge es gleich heute Vormittag?«
Ich hatte schon allerhand Pläne für den Vormittag gemacht, die mir aber mit einem Mal nicht mehr wichtig erschienen.
»Ja«, sagte ich, »in einer Stunde kann ich da sein, wenn das okay ist.«
Piya gab mir die Adresse von Nilimas Familiensitz in Ballygunge Place, einem der vornehmsten Viertel Kolkatas. Ich war viele Jahre nicht mehr dort gewesen, erinnerte mich aber gut daran, weil meine Eltern mich als Kind öfter dorthin mitgenommen hatten.
Als ich aus dem Ola Cab, das mich nach Ballygunge Place gebracht hatte, ausstieg, sah ich, dass der alte Bau verschwunden war. Wie so viele der herrschaftlichen Villen in Kalkutta war er abgerissen und durch ein modernes Apartmenthaus ersetzt worden, groß genug, um alle zu beherbergen, die einen Anspruch auf den Stammsitz der Familie hatten.
Das neue Gebäude war ungewöhnlich elegant, der Aufzug, in dem ich nach oben fuhr, mit schicken »Designer«-Elementen versehen, ebenso die Wohnungstüren, an denen ich vorbeikam. Mit einer Ausnahme: An Nilimas Tür gab es nur ein Schild mit der Aufschrift »NILIMABOSE, BADABONTRUST«.
Auf mein Klingeln öffnete eine schlanke kleine Frau mit kurz geschnittenen, an Stirn und Schläfen bereits leicht ergrauten Haaren. Ihre Kleidung – Jeans und T-Shirt – betonte das Knabenhafte ihrer Figur. Alles an ihr war knapp und nüchtern, nur ihre Augen waren groß, was durch den Kontrast zwischen dem Weiß und dem seidig dunklen Teint der Frau noch hervorgehoben wurde. Sie war weder geschminkt, noch trug sie irgendwelchen Schmuck, nur ein kleiner Einstich verriet, dass sie einmal ein Nasenpiercing gehabt hatte.
»Hallo, Deen«, sagte sie, als wir uns die Hand gaben. »Ich bin Piya. Kommen Sie rein, Nilima erwartet Sie schon.«
Beim Eintreten sah ich, dass die Wohnung in zwei Bereiche aufgeteilt war. Im Vorderen, dem Büro des Trusts, saßen ein Dutzend ernst wirkende junge Männer und Frauen in ihre Arbeit vertieft vor hellen Bildschirmen und blickten kaum auf, als wir nach hinten zu Nilimas Wohnbereich durchgingen.
Piya öffnete eine Tür und führte mich in ein aufgeräumtes, sonniges Zimmer. Nilima lag an mehrere Kissen gelehnt und mit einem Laken halb zugedeckt auf einem behaglich aussehenden Bett. Sie war schon immer klein gewesen, schien aber, seit ich sie zuletzt gesehen hatte, noch weiter geschrumpft zu sein. Doch ihr rundes Gesicht mit den Grübchen und den blitzenden Augen hinter der Stahlbrille hatte ich noch genau so in Erinnerung.
Piya rückte einen Stuhl für mich an das Bett. »Ich lasse euch jetzt allein«, sagte sie und drückte liebevoll Nilimas Hand. »Übernimm dich nicht, Nilima-di.«
»Nein, Liebes«, antwortete Nilima auf Englisch, »versprochen.«
Ein zärtliches Lächeln erschien auf ihrem Gesicht. Sie wechselte ins Bengali. »So ein liebes Mädchen«, sagte sie. »Und so stark. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Piya täte.«
Nilimas Bengali hatte den robusten Klang eines ländlichen Dialekts angenommen, desjenigen der Sundarbans vermutlich. Ihr Englisch dagegen wies noch die glatten Silben ihrer aristokratischen Erziehung auf.
»Piya leitet den Trust jetzt«, fuhr sie fort. »Es war ein Glückstag für uns, als sie in die Sundarbans kam.«
»Ist sie oft dort?«, fragte ich.
»O ja, wenn sie in Indien ist, hält sie sich überwiegend in den Sundarbans auf.«
Ihre meeresbiologischen Forschungen, erklärte Nilima, hätten Piya vor über zwanzig Jahren in die Sundarbans geführt. Nilima hatte ihr eine Bleibe verschafft und sie bei ihrer Arbeit unterstützt, und in den folgenden Jahren hatte sie sich immer stärker für den Trust engagiert.
»Sie verbringt jeden Urlaub bei uns«, sagte Nilima. »Ob im Sommer oder im Winter, sie kommt, wann immer sie kann.«
»Ja?« Ich bemühte mich, nicht über Gebühr neugierig zu erscheinen. »Sie hat keine Familie?«
Nilima warf mir einen verschmitzten Blick zu. »Sie ist nicht verheiratet, wenn du das meinst«, sagte sie, worauf ich die Augen niederschlug und eine unbeteiligte Miene aufsetzte.
»Aber sie hat so etwas Ähnliches wie eine Familie. Sie hat Frau und Sohn eines Fischers in den Sundarbans adoptiert, der für sie gearbeitet hat und dabei ums Leben gekommen ist. Piya hat seiner Frau Moyna in jeder Weise geholfen, den Jungen großzuziehen.« Sie stockte. »Sie hat es jedenfalls versucht …«
Nilima seufzte und schüttelte dann den Kopf, wie um sich in Erinnerung zu rufen, weshalb sie mich hergebeten hatte. »Aber ich rede und rede hier«, sagte sie, »dabei hast du so wenig Zeit.«
Ich war so begierig darauf, mehr über Piya zu erfahren, dass es mich offen gestanden überhaupt nicht gestört hätte, wenn sie weitererzählt hätte. Da ich ihr das aber nicht gut sagen konnte, nahm ich das kleine Aufnahmegerät aus meiner Jackentasche, das ich meist bei mir habe, wenn ich auf Antiquitätensuche bin.
»Willst du unser Gespräch aufnehmen?«, fragte Nilima überrascht.
»Das ist so eine Angewohnheit von mir«, antwortete ich. »Ich bin ein zwanghafter Notizenmacher und Archivar. Bitte beachte das Gerät nicht, es ist nicht wichtig.«
Nilima wusste noch genau, wann sie zum ersten Mal von dem Gewehrhändler gehört hatte. Sie hatte das Datum damals in einem Kontobuch mit der Aufschrift »Katastrophenhilfe Zyklon 1970« vermerkt. Vor Kurzem hatte man das Buch für sie aus dem Archiv des Badabon Trusts geholt. Sie schlug es auf und zeigte mir den Eintrag. »Bonduki Sadagar dhaam – der Schrein des Gewehrhändlers« stand in bengalischer Schrift oben auf der Seite und darunter das Datum: 20. November 1970.
Acht Tage zuvor, am 12. November 1970, um genau zu sein, war ein Zyklon der Kategorie 4 durch das Bengal-Delta gefegt und auf den indischen Bundesstaat Westbengalen wie auch auf das frühere Ostpakistan getroffen (das ein Jahr später unter dem Namen Bangladesch zu einem unabhängigen Staat wurde). Wirbelstürme hatten damals in dieser Region noch keine Namen, der von 1970 wurde erst später »Bhola-Zyklon« genannt.
Nach der Zahl der Opfer war er die größte Naturkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Konservativen Schätzungen zufolge verloren dreihunderttausend Menschen ihr Leben, die tatsächliche Zahl könnte sich auf eine halbe Million belaufen. Die meisten Opfer gab es in Ostpakistan, wo seit Langem politische Spannungen schwelten. Die unzureichende Reaktion Westpakistans auf die Katastrophe trug entscheidend zum Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges bei, der zur Gründung Bangladeschs führte.
In Westbengalen fingen die Sundarbans die Wucht des Wirbelsturms ab. Die Insel Lusibari, auf der Nilima und ihr Mann lebten, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen: Die Sturmflut riss ein großes Stück der Insel samt den Häusern und allem anderen fort.
Doch die Schäden dort waren noch harmlos im Vergleich zu den Verheerungen auf den Inseln und in den Ansiedlungen weiter südlich. Nilima erfuhr erst Tage später durch Horen Naskar davon, einen jungen Fischer, den sie kannte. In seinem Boot draußen auf dem Meer hatte er die Verwüstungen mit eigenen Augen beobachtet.
Auf Horens Bericht hin hatte Nilima eine Gruppe von Freiwilligen zusammengestellt, um Hilfsgüter zu sammeln und zu verteilen. Mit Horen am Steuer eines gecharterten Bootes hatten sie und ihr Team die Sachen in einige der küstennahen Dörfer gebracht.
Bei jeder ihrer Fahrten boten sich ihnen grauenvolle Bilder: von der Sturmflut ausgelöschte Ortschaften, Inseln, auf denen kein Baum mehr belaubt war, im Wasser schwimmende, von Tieren angefressene Leichen, Dörfer, deren Einwohner fast alle umgekommen waren. Ein nicht abreißender Strom von Flüchtlingen aus Ostpakistan verschlimmerte die Lage noch. Schon in den Monaten zuvor waren Menschen vor den politischen Unruhen dort über die Grenze nach Indien geflohen. Jetzt schwoll der Strom zu einer Sintflut an und spülte noch mehr hungrige Menschen in eine Region, in der bereits hoffnungslose Nahrungsknappheit herrschte.
Eines Morgens steuerte Horen das Boot in einen Teil der Sundarbans, in dem der mächtige Raimangal River entlang der Grenze zwischen den beiden Ländern verlief. Normalerweise mied Nilima diesen Flussabschnitt, denn er war berüchtigt für die Schmuggler, die sich häufig dort aufhielten, und die Strömung war so stark, dass immer wieder Boote über die Grenze abgetrieben wurden.
Mit einiger Mühe gelang es Horen, das Boot dicht am indischen Ufer zu halten, und nach einer Weile sahen sie einen Sandstrand, auf dem einmal ein Dorf gestanden hatte. Jetzt war bis auf ein paar schiefe Pfähle nichts mehr davon übrig; die Sturmflut im Gefolge des Zyklons hatte auch noch die letzte Behausung fortgeschwemmt.
Nilima entdeckte einige Menschen am Ufer und bat Horen anzulegen. Dem Augenschein nach mussten viele der Dorfbewohner getötet oder verletzt worden sein, doch als sie nachfragte, erhielt sie eine unerwartete Antwort: Niemand war zu Schaden gekommen, die Bewohner hatten sogar ihre Habseligkeiten und Lebensmittelvorräte retten können.
Nilima fragte, welchem Umstand das Dorf sein Glück verdanke, und wieder überraschte sie die Antwort: Das Wunder sei Manasa Devi zuzuschreiben, der Schlangengöttin, Hüterin eines nahe gelegenen Schreins.
Als sich kurz vor dem Sturm der Himmel verdunkelte, hatte die Glocke in dem Schrein zu läuten begonnen. Die Dorfbewohner hatten zusammengerafft, was sie an Nahrung und Besitztümern nur tragen konnten, und sich dorthin geflüchtet. Und der Schrein hatte sie nicht nur mit seinen Mauern vor dem Wirbelsturm geschützt, er hatte ihnen auch weiterhin Zuflucht gewährt und sie aus seiner Quelle mit frischem Wasser versorgt – eine Seltenheit in den Sundarbans.
Nilima hatte gebeten, man möge ihr den Schrein zeigen, und die Dorfbewohner hatten sie hingeführt. Er lag ein gutes Stück vom Strand entfernt auf einer leichten Anhöhe, inmitten einer sandigen Lichtung in dichtem Mangrovenwald.
An den Bau selbst entsann sich Nilima nur noch dunkel – Hunderte von Menschen waren dort umhergelaufen und hatten überall ihr Hab und Gut aufgetürmt. Sie hatte nur noch hohe Mauern und ein gewölbtes Dach in Form eines umgedrehten Bootes in Erinnerung, das sie an die berühmten Tempel von Bishnupur denken ließ.
Sie hatte sich erkundigt, ob es so etwas wie einen Wächter des Schreins gebe, mit dem sie sprechen könne. Nach einer Weile trat ein Muslim mittleren Alters mit angegrautem Bart und einer Kappe auf dem Kopf aus dem Inneren des Baus. Nilima erfuhr, dass er ein majhi war, ein Flussschiffer, und dass er vom anderen Ufer des Raimangal River stammte. In seiner Jugend hatte er gelegentlich für die Leute gearbeitet, die den Schrein betreuten, eine Familie hinduistischer gayans oder Balladensänger, die das Epos, das die Legende des Schreins erzählte, lebendig erhalten und über viele Generationen mündlich weitergegeben hatte. Doch mit den Jahren war sie auf ein einziges Mitglied geschrumpft, und dieser Letzte hatte den Schiffer gebeten, sich nach seinem Tod um den Schrein zu kümmern. Das war vor langer Zeit gewesen, ein Jahrzehnt vor der Teilung des Indischen Subkontinents im Jahr 1947. Seitdem lebte der Schiffer dort mit seiner Frau und seinem Sohn.
Nilima fragte ihn, ob es nicht seltsam für ihn sei, als Muslim einen Schrein für eine Hindu-Gottheit zu hüten. Der dhaam werde von allen verehrt, antwortete er, unabhängig von ihrer Religion. Die Hindus glaubten, Manasa Devi wache über den Schrein, die Muslime dagegen hielten ihn für einen Aufenthaltsort von Dschinns, den ein muslimischer pir oder Heiliger namens Ilyas hüte.
Wer den Schrein gebaut habe und wann?
Der Schiffer zögerte. Er kenne die Legende nicht genau, sagte er, und könne sich nur bruchstückhaft daran erinnern.
»Gibt es das Epos nicht in schriftlicher Form?«, fragte Nilima. Nein, erwiderte der Schiffer, der Gewehrhändler habe ausdrücklich gewünscht, dass es niemals niedergeschrieben und nur von Mund zu Mund weitergegeben werde. Leider hatte der Mann es nie auswendig gelernt; nur an wenige Verse erinnerte er sich noch.
Nilima ließ nicht locker, der Mann trug ein paar Zeilen vor, und die Worte prägten sich Nilima ein, vielleicht weil sie ihr wie ein Nonsensgedicht vorkamen (ein Genre, das sie sehr mochte).
Kolkataey tokhon na chhilo lok na makan
Banglar patani tokhon nagar-e-jahan
Kalkutta hatte damals weder Menschen noch Häuser
Bengalens großer Hafen war eine Weltstadt.
Nilima warf mir einen Blick zu und lachte, ein wenig verlegen, als sei es ihr peinlich, mir etwas so Albernes vorzutragen.
»Das ergibt keinen Sinn, nicht wahr?«, sagte sie.
»Auf Anhieb nicht«, erwiderte ich. »Aber erzähl weiter.«
Nilima hatte dem Schiffer noch mehr Fragen gestellt, doch er war immer wortkarger geworden. Er hatte sich einerseits auf seine Unkenntnis berufen, andererseits aber nachdrücklich erklärt, kaum jemand sei imstande, den Sinn der Legende zu erfassen. Doch Nilima war hartnäckig geblieben und hatte schließlich erreicht, dass er die Geschichte in groben Zügen preisgab. Wie sich zeigte, war sie der Legende vom Kaufmann Chand sehr ähnlich.
Wie von Chand hieß es auch von dem Gewehrhändler, er sei ein reicher Kaufmann gewesen, der Manasa Devi erzürnt habe, weil er sich weigerte, sie anzubeten. Von Schlangen drangsaliert und von Dürren, Hungersnöten, Stürmen und anderem Unheil heimgesucht, war er vor dem Zorn der Göttin übers Meer geflohen, um schließlich in einem Land Zuflucht zu suchen, in dem es keine Schlangen gab: auf der »Gewehrinsel« – Bonduk dwip.
Nilima hielt inne und fragte mich, ob ich einmal von einem Ort dieses Namens gehört hätte.
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Das muss ein Märchenland sein, wie in den Volkssagen.«
Nilima nickte. Es gebe noch mehr solche Orte in der Geschichte, sagte sie, aber die Namen habe sie vergessen.
Doch selbst auf der Gewehrinsel war der Kaufmann nicht vor Manasa Devi sicher. Eines Tages trat sie ihm aus den Seiten eines Buches entgegen und warnte ihn: Sie habe ihre Augen überall. In jener Nacht suchte er Schutz in einem Raum mit Wänden aus Eisen, doch auch dort stellte sie ihm nach: Ein winziges giftiges Tier kroch durch einen Spalt herein und biss ihn. Der Kaufmann überlebte knapp und floh mit dem Schiff von der Gewehrinsel, wurde jedoch erneut von Piraten gefangen genommen und in ein Verlies geworfen. Auf der Fahrt zu einem Ort namens Ketteninsel (Shikol-dwip), wo ihn die Seeräuber verkaufen wollten, erschien ihm Manasa Devi von Neuem. Wenn er sie anbete und in Bengalen einen Schrein für sie errichte, so versprach sie ihm, werde sie ihn freigeben und ihn reich machen.
Endlich fügte sich der Kaufmann und schwor, er werde einen Tempel für die Göttin bauen, wenn sie ihm helfe, in seine Heimat zurückzufinden. Und so gab sie ihn frei und wirkte ein Wunder: Allerlei Kreaturen des Meeres und der Luft bedrängten das Schiff, und während die Piraten sie abwehrten, brachten die Gefangenen es in ihre Gewalt und nahmen die Reichtümer der Freibeuter an sich. Der Anteil des Kaufmanns erlaubte es ihm, nach Bengalen zurückzukehren, nicht ohne unterwegs einträgliche Geschäfte zu machen. Er brachte ein so riesiges Vermögen und eine so erstaunliche Geschichte mit nach Hause, dass er den Beinamen Bonduki Sadagar – Gewehrhändler – erhielt. So kam der Schrein zu seinem Namen.
»Mehr habe ich nicht erfahren«, sagte Nilima achselzuckend. »Als ich sagte, dass die Zeilen aus dem Gedicht keinerlei Sinn ergaben, schien der Schiffer nicht weiter überrascht. ›Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Die Legende ist voller Geheimnisse, und wenn man ihre Bedeutung nicht kennt, versteht man sie nicht.‹ Dann sagte er noch: ›Aber irgendwann, wenn die Zeit reif ist, wird einer sie verstehen, und wer weiß? Vielleicht tut sich für ihn eine Welt auf, die wir anderen nicht sehen können.‹«
Nilima lächelte mich selbstironisch an. »Irgendetwas an der Geschichte – was, weiß ich nicht – ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie ließ mich nicht los, und ich wollte mehr darüber wissen. Aber es gab immer so viel zu tun, und schließlich dachte ich nicht mehr daran – bis vor Kurzem, als ich etwas über den großen Zyklon von 1970 las. Da war plötzlich alles wieder da.«
»Du warst aber nur dieses eine Mal bei dem Tempel?«, fragte ich.
»Ja, das war das einzige Mal. Einmal habe ich ihn noch von Weitem gesehen, aber da hatte ich keine Zeit, dort Station zu machen. Das ist ungefähr zehn Jahre her. Der dhaam ist wohl noch da, aber wie lange noch? Immer mehr Inseln in den Sundarbans werden vom Meer verschluckt, sie verschwinden vor unseren Augen. Deshalb sollte man den Tempel dokumentieren, finde ich. Möglicherweise ist er ein bedeutendes Kulturdenkmal.«
»Hast du dich an die archäologische Abteilung des Kultusministeriums gewandt?«, fragte ich, um mich hilfsbereit zu zeigen.
»Ich habe dorthin geschrieben, aber sie haben keinerlei Interesse gezeigt.«
Sie warf mir einen kurzen Blick zu, dann lächelte sie, und ihre Grübchen vertieften sich. »Da habe ich an dich gedacht.«
»An mich?«, fragte ich verblüfft. »Wieso an mich?«
»Du hast doch eine Leidenschaft für Antikes.«
»Ja, aber nicht für so etwas. Ich handle hauptsächlich mit alten Büchern und Handschriften. Ich bin oft in Bibliotheken, Museen, alten Palästen und so weiter, aber mit etwas so Entlegenem habe ich mich nie befasst.«
»Möchtest du dir den Schrein nicht wenigstens einmal ansehen?«
Ich wollte nicht unhöflich erscheinen, nur deshalb sagte ich nicht gleich Nein. Jetzt dorthin zu fahren war unmöglich: Ich musste Ende der Woche nach New York zurück, mein Terminkalender für die nächsten Tage war voll mit Verabredungen, und vor allem hatte ich für Sümpfe und Mangroven nicht viel übrig.
Ich versuchte mich mit einer Ausrede aus der Affäre zu ziehen: »Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe«, murmelte ich. »Mein Flug geht demnächst …«
Doch Nilima war eine Frau, die nicht so schnell aufgab.
»Es dauert nicht lange«, beharrte sie. »Du könntest an einem Tag hin und zurück. Ich kann das gern für dich arrangieren.«
Ich überlegte noch, wie ich höflich ablehnen konnte, als keine andere als Piya wieder ins Zimmer trat.
Sofort spannte Nilima sie für ihren Plan ein. »Es dauert nicht lange, den Schrein zu besichtigen, sag ihm das, Piya. Er hat Angst, er verpasst seinen Rückflug nach Amerika.«
Piya fragte mich, wann mein Flug gehe. Ich sagte es ihr, und sie beruhigte mich. »Keine Sorge, Sie werden rechtzeitig zurück sein.«
»Sind Sie sicher?«
»So sicher, wie man nur sein kann.« Entschuldigend fügte sie hinzu: »Ich würde Sie ja gern begleiten, aber das geht leider nicht, ich muss zu einer Tagung nach Bhubaneswar und komme erst nächste Woche zurück. Aber wenn Sie sich entschließen hinzufahren, sorge ich dafür, dass Sie in guten Händen sind.«
Ihr Lächeln brachte mich dazu, den Vorschlag noch einmal zu überdenken. »Ich überleg’s mir«, sagte ich.
Ich nahm meine Sachen und verabschiedete mich von Nilima. Piya führte mich nach nebenan und stellte mich einer matronenhaft wirkenden Frau mit einer markanten Stirn vor. Sie trug Schwesterntracht, einen blau-weißen Sari.
»Das ist Moyna Mondal«, sagte Piya, »Nilimas Lieblingspflegerin.« Sie legte ihr den Arm um die Schultern und drückte sie an sich. »Moyna und ich sind im Lauf der Jahre so etwas wie Schwestern geworden. Wenn Sie sich entschließen zu fahren, wird sie alles arrangieren. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, es wird schnell und einfach gehen.«
Es klang so aufmunternd, dass ich versucht war, Ja zu sagen. Aber irgendetwas hielt mich zurück.
»Ich habe noch einiges zu regeln«, sagte ich. »Ist es okay, wenn ich Ihnen morgen Bescheid gebe?«
»Natürlich, lassen Sie sich Zeit.«
Cinta
Ich war ziemlich durcheinander, als ich Nilimas Wohnung verließ. Alles Vernünftige, Praktische und Vorsichtige in mir war strikt dagegen, zu dem Schrein zu fahren. Ich war schon immer ein nervöser Reisender gewesen, und vor dem Gedanken, meinen Flug zu verpassen, graute mir. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dort etwas vorzufinden, was von besonderem beruflichem Interesse für mich sein konnte. Sofern der Schrein je etwas von Wert beherbergt hatte, war es mit Sicherheit längst nicht mehr da.
Aber dann dachte ich an Piya – irgendetwas an ihr erinnerte mich an Durga, meine erste Liebe. Es war weniger ihr Äußeres als vielmehr ihr Auftreten, ihr Blick. Auch der Idealismus und die Zielstrebigkeit, die ich an ihr wahrnahm, erinnerten mich an Durga.
Mir war bewusst, dass ich, hätte Piya mich begleiten können, gern gefahren wäre. Das erschreckte mich und steigerte meine Verwirrung noch. Einige Monate zuvor hatte meine Therapeutin in Brooklyn gemeint, ich befände mich in einer besonders sensiblen Phase und neigte dazu, mir in aussichtslosen Beziehungen etwas vorzumachen. Sie hatte mich besonders davor gewarnt, mich auf Frauen zu fixieren, die unerreichbar waren oder angesichts meiner Situation nicht zu mir passten. »Sie sollten nicht das nächste Scheitern programmieren.«
Noch auf dem ganzen Heimweg klangen mir ihre Worte in den Ohren.
Bis zum Abend hatte ich mich mehr oder weniger entschlossen, nicht zu fahren. Doch dann lud mich eine meiner Schwestern zum Essen ein, und als ich ihre Wohnung betrat, fand ich dort ihre gesamte Großfamilie vor dem Fernseher versammelt. Und was schauten sie so gebannt? Eine (absurd modernisierte) Version der Legende von Manasa Devi und dem Kaufmann! Das sei im Moment die beliebteste Sendung im Regionalfernsehen, erfuhr ich. Offenbar befand sich die Legende in einer ihrer wiederkehrenden Phasen der Neubelebung, nicht nur in meinem Kopf, sondern in der Kultur überhaupt.
Dieser Gedanke beunruhigte mich.
Als ich später in meiner Wohnung meine Sachen verstaute, fiel mein Blick auf das Aufnahmegerät. Ich wollte das Gespräch mit Nilima löschen, drückte aber die falsche Taste, und die Aufnahme wurde abgespielt. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, bis Nilima sagte:
Kalkutta hatte damals weder Menschen noch Häuser
Bengalens großer Hafen war eine Weltstadt
Da horchte ich auf. Ich drückte die Pausentaste und hörte mir die Passage mehrmals an.
Die Zeilen ergaben zunächst keinen Sinn, doch dann merkte ich, dass sie in Versmaß und Rhythmus einem bestimmten Genre bengalischer Volksdichtung entsprachen, das bekanntermaßen wertvolle historische Erkenntnisse vermittelt. Interessant erschien mir auch, dass dieser Vers die Antwort des Schiffers auf Nilimas Frage gewesen war, wann der Schrein errichtet worden sei. Konnte er ein Hinweis auf einen bestimmten Zeitpunkt oder einen Zeitraum gewesen sein?
Natürlich sind Gedichte dieser Art oft bewusst kryptisch formuliert. Hier aber gab die erste Zeile weiter keine Rätsel auf. Gemeint war vermutlich, dass der Schrein des Kaufmanns zu einer Zeit errichtet wurde, als es Kalkutta noch nicht gab, also vor Gründung der Stadt im Jahr 1690.
Doch was bedeutete die zweite, rätselhaftere Zeile?
Die Worte »Bengalens großer Hafen« bezogen sich zweifellos auf Kalkuttas Vorgängerin als wichtigstes städtisches Zentrum Bengalens. Und welches das war, stand außer Frage: Dhaka (die heutige Hauptstadt von Bangladesch).
Andererseits ergab der Ausdruck »Weltstadt« in diesem Zusammenhang keinen Sinn. Das persische oder Urdu nagar-e-jahan war mir noch nie im Zusammenhang mit Dhaka begegnet. Wie war es in den Vers gelangt?
Der Gedanke kam mir, dass die zweite Zeile womöglich wie die erste ein versteckter Hinweis auf einen bestimmten Zeitpunkt war.
Wie es sich trifft, hat meine Familie ihre Wurzeln in jenem Teil des Bengal-Deltas, der heute zu Bangladesch gehört. Nach der Teilung des Subkontinents kamen meine Eltern und Großeltern nach Indien. Davor aber hatten sie lange in Dhaka gelebt, und als ich mir jetzt in Erinnerung zu rufen versuchte, was meine älteren Verwandten von Dhaka erzählt hatten, schoss mir etwas durch den Kopf. Ich klappte meinen Laptop auf und begann zu recherchieren.
In Sekundenschnelle hatte ich ein Ergebnis.
Ich erfuhr Folgendes: Dhaka war die Hauptstadt Bengalens, als die Region eine Provinz des Mogulreichs war. Unter der Herrschaft von Kaiser Jahangir (dem »Eroberer der Welt«), dem vierten Mogulherrscher, und noch Jahre später hieß die Stadt ihm zu Ehren Jahangir-nagar.
Konnte es sein, dass nagar-e-jahan ein Wortspiel war, eine versteckte Anspielung auf das Dhaka des 17. Jahrhunderts?
Wenn dem so war, dann folgte daraus, dass der Schrein irgendwann zwischen 1605, dem Jahr der Thronbesteigung Jahangirs, und 1690, dem Jahr der Gründung Kalkuttas durch die Briten, errichtet worden war.
Nachdem mir dieser Gedanke gekommen war, fügten sich nach und nach auch andere Aspekte ins Bild. So etwa der offenkundig persische Einfluss in dem Vers: Das 17. Jahrhundert war eine Epoche, in der das Bengalische viele Wörter und Ausdrücke aus dem Persischen, dem Arabischen und im Übrigen auch aus dem Niederländischen und dem Portugiesischen übernahm.
Für eine Datierung zwischen 1605 und 1690 sprach auch ein anderes Detail in Nilimas Geschichte: Der Schrein hatte sie an die Tempel von Bishnupur erinnert, und genau in dieser Periode erlebte die Architektur Bishnupurs (die islamische und hinduistische Elemente aufs Schönste vereint) in ganz Bengalen eine Blüte.
Nicht weniger spannend war das wiederkehrende Thema des Gewehrs (oder bundook, ein Wort, das über das Persische und das Arabische ins Bengali gelangte). Die Moguln waren ja Herrscher eines berühmten »Schießpulverimperiums«. Wie bei ihren Zeitgenossen, den türkischen Osmanen und den persischen Safawiden, gründete sich auch ihre Macht großenteils auf den Einsatz von Feuerwaffen. War der Schrein des Gewehrhändlers womöglich eine volkstümliche Reminiszenz an diese Epoche?
Das war eine interessante Möglichkeit, für die sich aber, so fand ich, die Umstände und Risiken einer Fahrt in die Sundarbans nicht lohnten.
Nachdem ich mir das klargemacht hatte, richteten sich meine Gedanken wieder auf mein Leben in Brooklyn. Nicht ganz zufällig stellte sich mir die Frage, ob der Akku meines amerikanischen Handys inzwischen nicht fast leer war. In Indien benutzte ich ein anderes Mobiltelefon mit einer indischen SIM-Karte, sodass mein Brooklyner Handy seit mehreren Wochen unbenutzt auf meinem Schreibtisch gelegen hatte.
Ich schaltete es ein – der Akku war tatsächlich fast leer. Nach einigem Herumkramen fand ich das Ladegerät und schloss es an. Ich sah meine Apps durch: Keine Menschenseele, zumindest kein fühlendes Wesen (nur Bots), hatte mich, seit ich in Indien war, zu erreichen versucht.
Während ich mir noch mit einem leisen Gefühl der Kränkung, das eine solche Feststellung mit sich bringen muss, Gedanken darüber machte, leuchtete das Display plötzlich auf, wie fast erloschene Glut, die wieder aufflammt. Gleich darauf ertönte ein so durchdringendes Trillern, dass eine streunende Katze, die unter meinem Fenster kläglich miaut hatte, die Flucht ergriff.
Vor Schreck ließ ich es ein paarmal klingeln und schaute nur wie erstarrt auf das Display. Und noch verblüffter war ich, als ich die italienische Nummer und den Namen einer alten Freundin – oder besser Mentorin – sah, der Professoressa Giacinta Schiavon. Ich wusste, dass Cinta, wie sie von ihren Freunden genannt wurde, im vergangenen Jahr krank gewesen war, hatte aber seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ob ihr Zustand sich verschlechtert hatte?
Doch Cintas volltönende Stimme klang so frisch und munter wie eh und je. »Caro! Come stai?«
»Gut, Cinta«, antwortete ich überrascht. »Und dir? Was macht die Gesundheit?«
»Oh, alles bestens, tutto a posto.«
»Das freut mich. Wo bist du?«
»In Venedig, am Flughafen.«
»Wohin unterwegs?«, fragte ich.
»Nach Heidelberg, zu einem Kongress«, sagte sie und fügte noch hinzu: »Ich halte den Hauptvortrag.«
Eine überflüssige Erklärung: Cinta war der Star jeder Tagung, die das Glück hatte, sie als Rednerin zu gewinnen. Auf ihrem Fachgebiet, der Geschichte Venedigs, war sie unerreicht. Sie hatte bei Koryphäen wie Fernand Braudel und S.D. Goitein studiert und sprach fließend alle wichtigen Sprachen des Mittelmeerraums. Nur wenige Wissenschaftler konnten ihr an Wissen und Renommee das Wasser reichen, und so war es anrührend und auch ein wenig amüsant, dass der Ruhm diesem etwas absurden Anflug von Eitelkeit, einer ihrer liebenswertesten Eigenschaften, keinen Abbruch tat.
»Und du?«, fragte sie. »Dove sei?«
»In Kalkutta«, antwortete ich. »In meinem Zimmer. Erinnerst du dich daran?«
»Certo, caro!«, sagte sie, leiser jetzt. »Wie könnte ich das vergessen? Hast du noch diese – wie hieß das noch mal – ›Holländerin‹?«
»Holländische Ehefrau.«
Ich erinnerte mich, wie sie gelächelt hatte, als ich ihr diese Bezeichnung für die unter Bengalen so geschätzten Seitenschläferkissen nannte. »Ich musste sie entsorgen, es waren Motten drin. Jetzt bin ich ganz allein.«
»Aber es geht dir gut?«
Der besorgte Unterton in ihrer Frage machte mich stutzig. »Ja, warum fragst du?«
»Ich weiß nicht, caro – ich hatte gerade so einen Traum.«
»Im Flughafen?«, fragte ich ungläubig.
»Beh! Aber so seltsam ist das gar nicht. Mein Flug hat Verspätung wegen irgendeiner Überschwemmung, und ich sitze hier in einer schönen Lounge, in einem tiefen Sessel. Gut aussehende junge camerieri bringen mir Gläser mit Prosecco, während ich warte. Du verstehst?«
»Ja.«
Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie Cinta hereinrauschte und alle Blicke auf sich zog – eine hochgewachsene, breitschultrige Frau mit blitzenden schwarzen Augen und einer wallenden weißen Lockenmähne, einer Frisur, die die Filmstars ihrer Jugend berühmt gemacht hatten. Wer Cinta kannte, der wusste, dass sogleich sämtliche camerieri herbeieilen würden, um ihr einen Prosecco anzubieten, sobald sie sich in einem Sessel niederließ.
»Ich bin eingedöst, caro, und da ist ein Bild vor mir aufgetaucht – ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder eine Erinnerung. So ist das, wenn man älter wird, man kann Träume nicht mehr von Erinnerungen unterscheiden.«
»Was hast du denn in deinem Traum gesehen?«
»Dich – du standest vor einem Zelt, einem großen, einer Art Zirkuszelt. Drinnen waren viele Leute, die sich irgendein spettacolo angeschaut haben, was genau, weiß ich nicht. Hast du eine Idee, was das gewesen sein kann?«
Ich kratzte mich am Kopf. »Ja, ich glaube, ich erinnere mich da an etwas, von damals vielleicht, als du das erste Mal in Kalkutta warst. Wie lange ist das her?«
»Zwanzig Jahre? Fünfundzwanzig?«
»Sehr lange jedenfalls«, sagte ich. »Wir waren im Indian Museum in der Chowringhee Road, und danach wolltest du im Maidan spazieren gehen. Weißt du noch? Diese große Parkanlage im Stadtzentrum. Da stand ein riesiges Zelt, in dem ein Jatra aufgeführt wurde, eine Art Tanztheater. Du wolltest dir das ansehen, und wir sind am Eingang stehen geblieben, damit du reinschauen konntest.«
»Ah, sì! Ich erinnere mich.«
Ich fand es seltsam, dass sie sich im Flughafen von Venedig an einen so flüchtigen, banalen Moment erinnerte. »Wir haben nur ein paar Minuten da gestanden«, sagte ich. »Wie kommt es, dass dir nach all den Jahren ausgerechnet das wieder einfällt?«
»È vero.« Sie schien sich selbst zu wundern. »Ich weiß auch nicht, warum das wichtig war. Wie auch immer – ich habe dich hoffentlich nicht geweckt?«
»Nein, nein. Ich freue mich wirklich, deine Stimme zu hören.«
»Ja, ganz meinerseits«, sagte sie hastig. Der Traum schien sie so stark zu beschäftigen, dass sie es eilig hatte aufzulegen. »Ciao caro, ciao! Bis bald. Tanti baci!«
Dieser unerwartete Anruf hatte mich ein wenig aus der Fassung gebracht. Ich legte mich aufs Bett und dachte daran zurück, wie Cinta und ich vor Jahrzehnten im Maidan spazieren gegangen waren. Doch sosehr ich mich auch anstrengte – ich erinnerte mich an nichts, was von Interesse gewesen, nichts, was irgendwie denkwürdig für sie gewesen wäre.
Da kam mir eine Idee. Als passionierter Notizenmacher und Tagebuchschreiber musste ich mir an jenem Tag einen Vermerk gemacht haben, und der würde nicht schwer zu finden sein, denn das betreffende Tagebuch lag griffbereit in einer rostigen Blechkiste, in der ich Unterlagen, Aufzeichnungen, Kalender und anderes mehr aufbewahrte.
In einer Staubwolke zog ich die Kiste unter dem Bett hervor. Die Scharniere quietschten, und winzige Käfer huschten über den Boden, als ich den Deckel aufklappte. Der Inhalt lag unter einer feinen Staubschicht, so wohlgeordnet und beschriftet, wie ich ihn zurückgelassen hatte.
Und da war es! Auf der Seite für den Tag, an dem Cinta in Kalkutta eingetroffen war, fanden sich ihre Flugdaten (ich hatte sie vom Flughafen abgeholt), und auf der nächsten Seite stand: »Rundgang durch die Altstadt, dann Indian Museum. Dachte, sie will die lichterglänzende Park Street sehen, aber die interessierte sie nicht. Wollte in den Maidan. Ein Jatra wurde dort aufgeführt, und das große Plakat weckte Cintas Interesse: eine Frauenfigur, um deren Körper sich Schlangen wanden – Manasa Devi.«
Da kam die Erinnerung zurück.
Ich hatte Cinta im Jahr zuvor in den USA kennengelernt. Ich war damals Ende zwanzig, Cinta ungefähr zehn Jahre älter. Ich hatte gerade eine Anstellung in der Bibliothek der Midwestern University gefunden, an der ich promoviert hatte. (Ich hatte mich natürlich auf alle möglichen akademischen Posten beworben, jedoch erfolglos; in Amerika schien es keine große Nachfrage nach Experten für bengalische Volkskunst der frühen Neuzeit zu geben.)
Schon damals war Cinta eine in vieler Hinsicht bemerkenswerte Frau gewesen. Ebenso attraktiv wie brillant, war sie bereits eine angesehene Historikerin, die eine richtungweisende Arbeit über die Inquisition in Venedig veröffentlicht hatte. Doch nicht ihr Buch hatte sie weithin bekannt gemacht, vielmehr verdankte sie ihren Ruhm (oder ihre traurige Berühmtheit) einer privaten Tragödie, die sich im vollen Licht der Öffentlichkeit zugetragen hatte.
Mit Mitte zwanzig hatte Cinta eine Affäre mit einem sehr viel älteren Mann gehabt, dem Herausgeber einer bedeutenden italienischen Zeitung. Ihretwegen verließ er seine Frau, und sie bekamen ein Kind. Die Beziehung war nach allem, was man hörte, sehr glücklich, und während Cinta ihre Tochter Lucia großzog, schrieb sie ihr erstes Buch.
Es erschien, als Lucia zwölf war, und wenig später wurde Cinta zu einer Tagung nach Salzburg eingeladen. Sie und ihr Mann wollten den Anlass zu einem Familienurlaub nutzen, und Cinta reiste per Flugzeug voraus. Ihr Mann, ein Liebhaber schneller Autos, folgte einige Tage später mit der gemeinsamen Tochter. Doch auf der Fahrt durch die Dolomiten versagten die Bremsen seines Maserati, und die beiden stürzten einen steilen Abhang hinab.
Der Unfallhergang und der Umstand, dass ein berühmter Journalist dabei den Tod gefunden hatte, hätten schon allein genügt, um in Italien Aufsehen zu erregen. Das darauffolgende Rätselraten aber und der Verdacht eines Verbrechens brachten die Geschichte weltweit in die Schlagzeilen.
Cintas Mann hatte in dem Jahr eine Serie von Enthüllungsberichten über die Mafia veröffentlicht. Nach seinem Tod machten Gerüchte die Runde, er könnte einem Mordanschlag zum Opfer gefallen sein. Die Angelegenheit beschäftigte schließlich auch das italienische Parlament, und es wurde eine Untersuchung des Falls angeordnet. Cinta geriet in einen Strudel unerwünschter Publicity, und um den Paparazzi zu entgehen, reiste sie zu einem Sabbatjahr nach Amerika.
In der Bibliothek hatten viele die Geschichte in Boulevardblättern und Klatschzeitschriften verfolgt. Die wenigsten wussten jedoch, wo Cinta Zuflucht gefunden hatte, und so war die Überraschung groß, als wir erfuhren, dass sie sich irgendwo nicht weit von uns im Mittleren Westen aufhielt und sich mit der Bitte, unsere Sammlung seltener Bücher einsehen zu dürfen, an den Leiter unserer Bibliothek gewandt hatte. (Die Sammlung enthielt unter anderem bedeutende historische Dokumente, die ein kurz vor dem Krieg eingewanderter italienischer Wissenschaftler der Universität vermacht hatte.)
Die Erlaubnis wurde bereitwillig erteilt, und an dem Tag, als Cinta zum ersten Mal in der Bibliothek erschien, gab es wohl keinen Mitarbeiter, der nicht irgendeinen Grund gefunden hätte, einen Blick in den Raum mit der Sammlung seltener Bücher zu werfen, um sie hinter ihrem wuchtigen Lesepult thronen zu sehen. Und sie bot in der Tat einen sehenswerten Anblick mit ihrer dunklen, aber eleganten Kleidung und der unbestimmbaren Melancholie, die sie umgab.
Der Raum, in dem sich die seltenen Bücher und die Sondersammlungen befanden, wurde oft mit der Leichenhalle eines Krankenhauses verglichen (dass man in beiden Handschuhe tragen musste, gab Anlass zu allerhand plumpen Witzeleien). Es herrschte Grabesstille dort, und nur gelegentlich traf man den einen oder anderen ungepflegten Doktoranden an. Unter den Angestellten war keine Tätigkeit unbeliebter als das Herbeischaffen von Büchern oder Dokumenten für die Benutzer, und da ich ganz unten in der Hierarchie rangierte, fiel diese Aufgabe mir zu.
So kam es, dass ich in den zwei Wochen, die Cinta in der Bibliothek verbrachte, der Laufbursche war, der ihr das angeforderte Material brachte, und ich tat es mit Feuereifer, schon allein um des Vergnügens willen, sie mit ihrer klangvollen, rauchigen Stimme »Grazie mille«