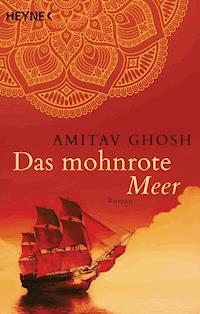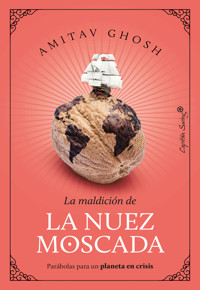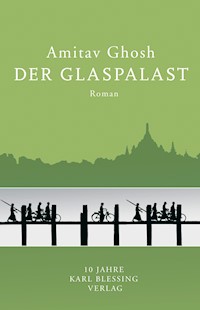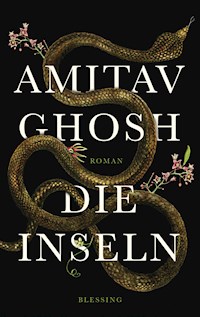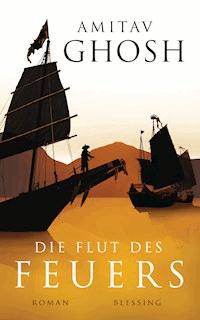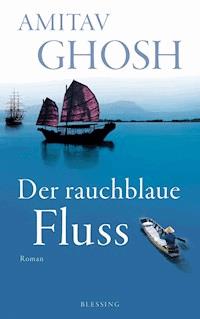
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ibis-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein monumentaler Roman über Ruhm und Leid in einer frühen Ära der Globalisierung
Kanton 1838. Über den sagenumwobenen Perlfluss gelangen Glückssucher und Abenteurer aus aller Welt in die chinesische Hafenstadt: Für den jungen Maler Robin Chinnery ist die pulsierende Metropole der ideale Zufluchtsort, um den Heiratsplänen, die seine Mutter für ihn hat, zu entkommen. Der britische Botaniker Fitcher Penrose ist in Begleitung seiner jungen Assistentin Paulette unterwegs nach Kanton, um dort nach einer geheimnisvollen Kamelienart zu suchen, der wahre Zauberkräfte zugesprochen werden. Und der indische Kaufmann Bahram Modi erhofft sich mit der größten Ladung Opium, die er je von Kalkutta nach Kanton transportiert hat, das Geschäft seines Lebens. Es sieht so aus, als würden die Dinge gut für ihn anlaufen, denn man beruft ihn in die Kantoner Handelskammer. Doch dann beginnen die autoritätseinflößenden Mandarine den ausländischen Kaufleuten auf den Leib zu rücken, denn der chinesische Kaiser will den Handel mit Opium verbieten. Und plötzlich stehen alle Zeichen auf Krieg ...
Ein schillerndes Epos, ein entlarvender Blick auf die Ursprünge unseres Wirtschaftssystems und eine Verbeugung vor der chinesischen Kulturgeschichte, betörend und spannend zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 899
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
AMITAV GHOSH
Der rauchblaue Fluss
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Heller
und Rudolf Hermstein
Karl Blessing Verlag
Titel der Originalausgabe: River of Smoke
Originalverlag: John Murray
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Amitav Ghosh
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung und Illustrationen: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
nach einer Idee von John Murray Publishers
Karte Vor- und Nachsatz: © Historic-Maps
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-09663-2
www.blessing-verlag.de
Für meine Mutter
zu ihrem Achtzigsten
Inhalt
Erster Teil
Inseln
Zweiter Teil
Kanton
Dritter Teil
Kommissar Lin
Dank
Glossar
Erster Teil
Inseln
Erstes Kapitel
Ditis Schrein verbarg sich in einer Felswand, in einem entlegenen Zipfel von Mauritius, wo die West- und die Südküste der Insel aufeinanderstoßen und den windgepeitschten Bergstock Morne Brabant hervorbringen. Der Ort war eine geologische Besonderheit – eine Höhle, von Wind und Wasser in den Kalkstein gegraben; etwas Ähnliches gab es nirgendwo sonst auf dem Berg. Später sollte Diti behaupten, dass nicht der Zufall, sondern das Schicksal sie dorthin geführt habe –, denn man konnte sich nicht vorstellen, dass der Ort tatsächlich existierte, solange man ihn nicht betreten hatte.
Die Colver-Farm lag am anderen Ende der Bucht, und im hohen Alter, als ihre Knie schon steif von der Arthrose waren, konnte Diti die Höhle nur noch aufsuchen, wenn sie in ihrem pus-pus, einer Art Sänfte, hinaufgetragen wurde. Der Besuch des Schreins war deshalb stets eine regelrechte Expedition, an der etliche männliche Mitglieder der Familie Colver teilnehmen mussten, vor allem die jüngeren und kräftigeren.
Den ganzen Clan zu versammeln – La Famie Colver, wie sie auf Kreolisch hieß – war nicht leicht, da seine Angehörigen weit verstreut lebten, sowohl auf der Insel als auch im Ausland. Einmal im Jahr aber, im Hochsommer, während der großen Ferien, die dem Neujahrsfest vorausgingen, konnte man sich darauf verlassen, dass sich jeder bemühen würde zu kommen. Die Famie fing Mitte Dezember an zu mobilisieren, und zu Beginn der Feiertage war der ganze Clan auf den Beinen. Begleitet von ganzen Trupps aus Schwagern, Schwägerinnen, Schwiegervätern, Schwiegermüttern und anderen angeheirateten Verwandten, bewegten sich die Colver’schen Schlachtreihen in einer gigantischen Zangenbewegung konzentrisch auf die Farm zu: Einige kamen auf Ochsenkarren über das neblige Hochland, aus Curepipe und Quatre Bornes, andere reisten per Schiff an, aus Port Louis und Mahébourg, dicht an der Küste entlang, bis der nebelverhangene Nippel des Morne in Sicht kam.
Vieles hing vom Wetter ab, denn man konnte den windumtosten Berg nur an einem schönen Tag besteigen. Wenn die Bedingungen günstig schienen, begannen die Vorbereitungen dazu schon am Vorabend. Das Festmahl, das auf die puja folgte, war stets der am ungeduldigsten erwartete Teil der Pilgerfahrt, und schon die Vorbereitungen waren von großer Begeisterung und freudiger Erwartung begleitet: Der mit einem Blechdach gedeckte Bungalow hallte wider von Hackmessern, Mörsern und Nudelhölzern, während masalas gemahlen, Chutneys abgeschmeckt und Berge von Gemüse zu Füllungen für parathas und daalpuris verarbeitet wurden. Wenn die Speisen in Blechbehältern und Vorratsschränken verstaut waren, gingen alle frühzeitig ins Bett.
Bei Tagesanbruch sorgte Diti höchstpersönlich dafür, dass alle sich schrubbten und badeten und keinem auch nur der kleinste Bissen zwischen die Zähne kam, denn wie alle Pilgerfahrten musste auch diese mit einem äußerlich wie innerlich reinen Körper unternommen werden. Diti stand stets als Erste auf, tappte, den Stock in der Hand, über den Holzfußboden des Bungalows und posaunte einen Weckruf, in der eigenartigen Mischung aus Bhojpuri und Kreol, die zu ihrem persönlichen Idiom geworden war: »Revey-té! É Banwari; éMukhpyari! Revey-té na! Haglé ba?«
Bis die ganze Sippe aus dem Bett und auf den Beinen war, erhellte die Sonne bereits die Wolken, die den Gipfel des Morne verhüllten. Diti übernahm die Führung in einer Pferdekutsche, und die Prozession rumpelte aus der Farm hinaus, durch die Tore und den Hügel hinab zu der Landbrücke, die den Berg mit dem Rest der Insel verband. Weiter kamen die Fahrzeuge nicht, deshalb stiegen hier alle aus. Diti nahm in ihrem pus-pus Platz, und die jüngeren Männer wechselten sich an den Stangen ab und trugen so den Sessel durch das dichte Grün der unteren Hänge bergan.
Unmittelbar vor dem letzten, steilsten Teil des Anstiegs tat sich eine willkommene Lichtung auf, und hier blieben alle stehen, nicht nur, um Atem zu schöpfen, sondern auch, um lautstark die großartige Aussicht auf den Dschungel und den Berg zu bewundern, der zwischen zwei sandgesäumten, fein geschwungenen Küstenlinien aufragte.
Diti war als Einzige nicht von der Aussicht beeindruckt. Nach wenigen Minuten schon fuhr sie einen nach dem anderen an: »Levé té! Wir sind nicht hier, um die soly vi zu bestaunen und den ganzen Tag patati-patata zu machen. Paditu! Chal!«
Sich zu beklagen, dass man gidigidi im Kopf sei oder die Füße fatigé seien, war zwecklos, damit erntete man höchstens ein erbostes: »Bus to fana! Auf die Füße!«
Es war nicht schwer, die Schar der Pilger zum Weitergehen zu bewegen, denn inzwischen konnten sie das Mahl nach der puja kaum noch erwarten, am wenigsten die Kinder. Erneut übernahm Ditis pus-pus die Führung, an den Stangen die kräftigsten Männer: Auf knirschenden Kieselsteinen stapften sie einen steilen Weg bergan und umrundeten einen Felsvorsprung. Und dann, ganz plötzlich, kam die andere Flanke des Berges in Sicht, die lotrecht ins Meer abfiel. Jäh drang das Donnern der Brandung über die Kante des Felsens an ihre Ohren, und der Wind fuhr ihnen ins Gesicht. Dies war die gefährlichste Etappe des Aufstiegs, denn hier waren die Böen und Aufwinde am stärksten. Niemand durfte hier verweilen, niemand innehalten beim Anblick des sie umgebenden Horizonts, der wie ein Reif zwischen Meer und Himmel kreiselte. Trödler bekamen den Dorn von Ditis Stock zu spüren: »Garatwa – weitergehen …«
Noch ein paar Schritte, und sie erreichten die geschützte Felsplatte, die die Schwelle zu Ditis Schrein bildete. Diese eigentümliche natürliche Formation, von der Familie chowkey genannt, hätte auch von einem Architekten nicht sinnreicher erdacht werden können: Das Plateau war breit und beinahe eben und lag im Schutz eines Felsüberhangs, der eine Art Decke oder Dach bildete. Man kam sich vor wie auf einer schattigen Veranda, und wie um dieses Bild zu vervollständigen, gab es sogar eine Art Balustrade – aus den knorrigen Büschen und Bäumen, die sich an den Rand der Felsplatte klammerten. Doch um über die Kante zu schauen, hinab auf die am Fuß der Felswand schäumende Brandung, brauchte man einen stabilen Magen und starke Nerven: Die Brecher dort unten waren bis von der Antarktis herangerollt, und selbst an einem ruhigen, klaren Tag schien das Wasser gegen den Berg anzurennen, als wollte es diesen Flecken Land wegspülen, der sich seinem Strom nach Norden dreist in den Weg stellte.
Doch so wunderbar war diese Laune der Natur, dass die Besucher sich nur niederzusetzen brauchten, um die Wellen aus ihrem Blickfeld zu verbannen – denn dieselben knorrigen Pflanzen, die den Rand der Felsplatte schützten, verbargen auch den Ozean vor denen, die dort saßen. Die Felsveranda war also der perfekte Ort für eine Zusammenkunft, und aus dem Ausland angereiste Verwandte ließen sich oft zu der irrtümlichen Annahme verleiten, damit habe auch der Name chowkey zu tun – denn ein chowk, also ein Basar, war schließlich auch ein Platz, auf dem Menschen zusammenkamen. Und hatte die Höhle mit ihren Begrenzungen ringsum nicht auch etwas von einem chowkey, also einem Gefängnis? Aber auf derlei Gedanken konnte nur ein Hindi sprechender etranzer kommen: Die Insulaner wussten alle, dass im Kreol das Wort »chowkey« auch die runde Scheibe bezeichnet, auf der rotis ausgerollt werden (das Ding, das in der Heimat als »chakki« bekannt ist). Und da war er, Ditis chowkey, genau in der Mitte der Felsplatte, geschaffen nicht von Menschenhand, sondern von Wind und Erde: nichts anderes als ein riesiger, von den Elementen zu einem oben abgeflachten Pilz geschliffener Felsblock. Wenige Augenblicke nach der Ankunft der Pilger arbeiteten die Frauen dort bereits emsig, rollten daalpuris und parathas hauchdünn aus und stopften sie mit den köstlichen Füllungen, die sie am Abend zuvor zubereitet hatten: fein geriebene Mischungen aus den schmackhaftesten Gemüsesorten der Insel– violettem arwi und grünen Moringafrüchten, cambaré-beti und welkem songe.
Von diesem Abschnitt von Ditis Leben gibt es mehrere Fotos, darunter auch zwei wunderschöne Daguerreotypien. Auf einer davon, die am chowkey aufgenommen wurde, sieht man Diti im Vordergrund: Sie sitzt noch in ihrem pus-pus, der auf dem Boden steht. Sie trägt einen Sari, doch anders als die anderen Frauen auf dem Bild hat sie ihren ghungta vom Kopf gleiten lassen und ihr Haar freigelegt, das bestürzend weiß ist. Der Saum des Saris hängt über ihrer Schulter, beschwert von einem großen Schlüsselbund, dem Symbol ihrer fortbestehenden Autorität in Familienangelegenheiten. Ihr Gesicht ist dunkel und rund und von tiefen Furchen durchzogen: Die Daguerreotypie ist so detailgenau, dass der Betrachter förmlich meint, die Struktur ihrer Haut spüren zu können, ähnlich der von verknittertem, zähem, wettergegerbtem Leder. Sie hat die Hände friedlich im Schoß gefaltet, aber ihre Körperhaltung strahlt keineswegs Ruhe aus: Sie presst die Lippen fest aufeinander und blinzelt grimmig in die Kamera. Das eine Auge ist vom Star getrübt, doch das andere scharf und durchdringend, und die Pupille ist von charakteristischer dunkler Färbung.
Über ihrer Schulter sieht man den Eingang ins Innere des Schreins, lediglich ein schräger Spalt in der Felswand, so schmal, dass man dahinter unmöglich eine Höhle vermuten würde. Daneben ist ein dickbäuchiger Mann in einem dhoti zu erkennen, der versucht, eine Schar Kinder in einer Reihe aufzustellen, damit sie Diti nach drinnen folgen können.
Auch das war fester Bestandteil des Rituals: Diti hatte dafür zu sorgen, dass die Jüngsten als Erste die puja ausführten, um noch vor den anderen essen zu können. Mit einem Stock in der einen und einem Bund Kerzen in der anderen Hand führte sie all die jungen Colvers – chutkas und chutkis, laikas und laikis – geradewegs durch die saalartige Höhle in das Allerheiligste. Die ausgehungerten Kinder folgten ihr eilig und beachteten kaum die mit Zeichnungen und Graffiti verzierten Wände der äußeren Kammer. Sie rannten zu dem Teil des Schreins, den Diti ihren »puja-Raum« nannte: einen kleinen, am hinteren Ende versteckten Hohlraum im Gestein. Er bildete das Herzstück des Schreins, den Andachtsraum mit einer Ansammlung von Gottheiten, im Mittelpunkt eine der weniger bekannten Gottheiten des Hindu-Pantheons, wie in einem Tempel: Marut, der Gott des Windes und Vater von Hanuman. Hier zelebrierten sie im Licht einer flackernden Lampe rasch ihre puja, murmelten ihre Mantras und sprachen leise ihre Gebete. Nachdem sie Hände voll Blumen geopfert und große Mengen von prickelndem prasad verschlungen hatten, rannten die Kinder zum chowkey zurück, wo sie mit Atab!-Atab!-Rufen empfangen wurden – obwohl es keinen Tisch gab, von dem man essen konnte, sondern nur Bananenblätter, und keine Stühle, auf denen man sitzen konnte, sondern nur Decken und Matten.
Diese Mahlzeiten waren stets vegetarisch und zwangsläufig äußerst einfach, denn die Speisen wurden mit simpelsten Gerätschaften auf offenen Feuern gegart: Die Grundlage bildeten parathas und daalpuris, und dazu aß man bajis von pipengaye, ourougails von Tomaten und Erdnüssen, Chutneys von Tamarinden und Früchten, außerdem vielleicht den einen oder anderen achar aus Limonen oder bilimbi und womöglich sogar einen heißen mazavaroo aus Chilis und Limonen – und natürlich dahi und Ghee aus der Milch der Colver’schen Kühe. Es waren die schlichtesten Festmahle, doch wenn sie aufgegessen waren, lehnten alle hilflos an den Felswänden und klagten, dass sie sich zu sehr vollgestopft hätten, dass es in ihren Eingeweiden grolle und wie schlecht es sei, so viel zu essen, manzé zisk’araze.
Jahre später, als die Felswand unter dem Anprall eines Zyklons zerbröckelte und der Schrein bei einem Bergrutsch ins Meer gespült wurde, erinnerten sich die Kinder, die an den Pilgerfahrten teilgenommen hatten, vor allem an diese Leckereien: die parathas und daalpuris, die ourougails, mazavaroos, dahi und Ghee.
Erst wenn das Festmahl verdaut war und die Gaslampen angezündet wurden, wanderten die Kinder allmählich wieder in die äußere Kammer des Schreins, um die bemalten Wände der Höhle zu bestaunen, die Ditis »Erinnerungstempel« genannt wurde: Deetiji-ka-smriti-mandir.
Jedes Kind in der Famie wusste, wie Diti malen gelernt hatte: Sie war von ihrer Großmutter unterrichtet worden, als sie noch ein chutki von einem Kind war, in der Heimat, in Industan, in dem gaon, in dem sie geboren war. Das Dorf hieß Nayanpur und lag im nördlichen Bihar, oberhalb der Mündung zweier großer Flüsse, des Ganges und des Karamnasa. Die Häuser dort sahen ganz anders aus als die auf der Insel – keine Blechdächer und kaum irgendwo Metall oder Holz. Man wohnte in Lehmhütten, mit Stroh gedeckt und mit Kuhdung verputzt.
Die meisten Menschen in Nayanpur ließen ihre Wände kahl, doch Ditis Familie war anders: Als junger Mann hatte ihr Großvater als Silahdar in Darbhjanga gearbeitet, rund sechzig Meilen weiter östlich. Während er dort Dienst tat, hatte er in eine Rajputenfamilie aus einem Nachbardorf eingeheiratet, und seine Frau hatte ihn begleitet, als er nach Nayanpur heimkehrte, um sich dort niederzulassen.
In der alten Heimat war jede Stadt und jedes Dorf stolz auf bestimmte Dinge, mehr noch als auf Mauritius: Manche waren berühmt für ihre Keramik, andere für das Aroma ihres khoobi-ki-lai, manche für die Beschränktheit ihrer Bewohner, andere für die außergewöhnliche Qualität ihres Reises. Madhubani, das Dorf von Ditis Großmutter, war berühmt für seine wunderschön verzierten Häuser und herrlichen Wandmalereien. Als sie nach Nayanpur zog, brachte sie die Geheimnisse und Traditionen von Madhubani mit: Sie unterwies ihre Töchter und Enkelinnen darin, Wände mit Reismehl zu tünchen und aus Früchten, Blumen und farbiger Erde leuchtende Farben herzustellen.
Jedes Mädchen in Ditis Familie hatte ein Spezialgebiet, und ihres war die Abbildung gewöhnlicher Sterblicher, die zu Füßen der devas, devis und Dämonen herumtollten. Die Figürchen, die ihrer Hand entsprangen, hatten oft die Züge von Menschen in ihrer Umgebung: Sie waren ein privates Pantheon derer, die sie am meisten liebte und fürchtete. Sie zeichnete gern ihre Silhouetten, meist im Profil, und stattete jede mit einem charakteristischen Merkmal aus. So war ihr ältester Bruder, Kesri Sing, der als Sepoy in der Armee der Ostindien-Kompanie diente, stets an einem Symbol des Soldaten zu erkennen, meist einem rauchenden Gewehr.
Als sie heiratete und ihr Dorf verließ, merkte Diti, dass die Kunst, die sie von ihrer Großmutter gelernt hatte, im Haus ihres Mannes nicht willkommen war: Dessen Wände waren nie auch nur mit einem einzigen Pinselstrich Farbe verschönert worden. Doch selbst ihre Schwiegereltern konnten sie nicht davon abhalten, auf Blätter und Lumpen zu zeichnen und ihren puja-Raum nach Belieben zu gestalten: Die kleine Gebetsnische wurde zum Aufbewahrungsort ihrer Träume und Visionen. In den neun langen Jahren ihrer Ehe war das Zeichnen nicht nur ein Trost, sondern auch ihre wichtigste Gedächtnisstütze: Des Lesens und Schreibens unkundig, konnte sie nur auf diese Weise ihre Erinnerungen festhalten.
Diese Gewohnheiten behielt sie bei, als sie in jenes andere Leben an der Seite Kaluas entkam, der ihr zweiter Mann werden sollte. Erst als sie ihre Schiffsreise nach Mauritius angetreten hatte, entdeckte sie, dass sie von Kalua schwanger war – und man erzählte sich, dass dieses Kind, ihr Sohn Girin, sie zu dem Ort, der ihr Schrein werden sollte, geführt hatte.
Damals war Diti ein Kuli und arbeitete auf einer frisch gerodeten Plantage am anderen Ende der Bucht, der Baie du Morne. Ihr Herr war ein Franzose, ein ehemaliger Soldat, der in den Napoleonischen Kriegen verwundet worden und seitdem krank an Körper und Geist war: Er hatte Diti und acht ihrer Schiffsgenossen von der Ibis an diesen südwestlichsten Zipfel der Insel gebracht, damit sie hier ihre Zeit als Kontraktarbeiter ableisteten.
Es war damals der abgelegenste und am dünnsten besiedelte Teil von Mauritius, deshalb waren Grund und Boden dort besonders billig zu haben: Da die Gegend auf dem Landweg so gut wie gar nicht zu erreichen war, mussten alle Vorräte per Schiff angeliefert werden, und manchmal waren die Lebensmittel deswegen so knapp, dass die Kulis im Dschungel auf Nahrungssuche gehen mussten. Nirgends war der Wald reicher als am Morne, doch nur selten, wenn überhaupt, wagte es irgendjemand, dessen Hänge zu erklimmen, denn der Berg war ein verrufener Ort, an dem der Überlieferung nach schon Hunderte, womöglich Tausende von Menschen ihr Leben gelassen hatten. In den Zeiten der Sklaverei war der Morne dank seiner Unzugänglichkeit zu einem attraktiven Zufluchtsort für entflohene Sklaven geworden, die sich in großer Zahl dort niederließen. Diese Ansiedlung von Flüchtlingen – oder marrons, wie sie im Kreol hießen –, hatte bis kurz nach 1834 bestanden, als die Sklaverei auf Mauritius verboten wurde. Da sie nichts von der neuen Gesetzeslage wussten, führten die marrons ihr gewohntes Leben auf dem Morne weiter – bis zu dem Tag, als ein Trupp Soldaten am Horizont auftauchte und auf sie zumarschierte. Dass die Soldaten Boten der Freiheit sein könnten, kam ihnen nicht in den Sinn; sie hielten sie für einen Stoßtrupp und sprangen von den Felsen in den Tod.
Diese Tragödie hatte sich wenige Jahre bevor Diti und ihre Schiffsgeschwister von der Ibis über die Bucht auf die Plantage gebracht wurden zugetragen, und die Landschaft war noch gesättigt von der Erinnerung daran. Wenn oben auf dem Berg der Wind heulte, sagten die Kulis, das sei das Wehklagen der Toten, und die Angst, die es hervorrief, war so groß, dass niemand aus freien Stücken diesen Berg erklommen hätte.
Diti fürchtete sich nicht weniger vor dem Morne als die anderen, doch im Gegensatz zu ihnen musste sie ein einjähriges Kind ernähren, und wenn es keinen Reis gab, wollte es nichts anderes essen als zerdrückte Bananen. Da diese in den Wäldern des Morne im Überfluss wuchsen, nahm Diti gelegentlich all ihren Mut zusammen und wagte es, mit ihrem Sohn in einem Tuch auf dem Rücken, die Landbrücke zu überqueren. So kam es, dass sie eines Tages von einem schnell aufziehenden Unwetter auf dem Berg festgehalten wurde. Als sie den Wetterwechsel bemerkte, hatte die steigende Flut bereits die Landbrücke überschwemmt, und da es keinen anderen Rückweg zur Plantage gab, folgte Diti einem alten Weg, in der Hoffnung, er werde sie an einen geschützten Ort führen. Auf diesem von den marrons angelegten verwachsenen Pfad stieg sie bergauf, unrundete den Gipfel und gelangte zu der Felsplatte, die später der chowkey der Famie werden sollte.
Im ersten Moment dachte sie, die äußere Plattform biete ihr schon das Höchstmaß an Schutz, auf das sie hoffen konnte: Hier hätte sie gewartet, bis das Unwetter vorüber war, ohne zu ahnen, dass es sich dabei lediglich um den Vorplatz eines noch sichereren Unterschlupfs handelte. Der Familienlegende zufolge entdeckte Girin den Spalt, der später zum Eingang des Schreins wurde. Diti hatte ihn auf den Boden gesetzt, um sich nach einer Stelle umzusehen, wo sie die zuvor gesammelten Bananen aufbewahren konnte. Sie ließ ihn nur einen Moment aus den Augen, doch Girin konnte schon sehr gut krabbeln, und als sie sich umdrehte, war er verschwunden.
Sie stieß einen Schrei aus, weil sie glaubte, er sei über die Abbruchkante in die Tiefe gestürzt, doch dann hörte sie seine von den Felswänden widerhallende Stimme. Sie schaute sich um, und als sie ihn nirgends sah, trat sie an den Spalt, betastete die Felskanten mit den Fingern und schob dann die Hand in die Öffnung. Es war kühl da drinnen, wo sich der Spalt offenbar verbreiterte, und so stieg sie hinein und stolperte fast augenblicklich über ihren kleinen Sohn.
Sobald sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannte sie, dass sie sich in einer Höhle befand, die früher einmal bewohnt gewesen war: Brennholzstapel reihten sich an den Wänden, und sie sah mehrere Feuersteine. Der Boden war mit Spelzen übersät, und beinahe hätte sie sich an den Scherben einer zerbrochenen Kalebasse die Füße zerschnitten. In einer Ecke fanden sich sogar Häufchen vertrockneter menschlicher Exkremente, so alt, dass sie geruchlos geworden waren. Es war seltsam, dass etwas, was anderswo Abscheu hervorgerufen hätte, hier beruhigend wirkte, als Beweis dafür, dass die Höhle früher einmal Menschen beherbergt hatte und nicht etwa Geister, Kobolde oder Dämonen.
Als das Unwetter losbrach und der Sturm pfiff und heulte, schichtete sie etwas Holz auf und steckte es mit den Feuersteinen in Brand. Nun entdeckte sie da und dort Bilder, mit Kohlestückchen auf die kreideweißen Wände gezeichnet; manche davon sahen aus wie Strichmännchen von Kinderhand. Als Girin wegen des tobenden Sturms laut zu weinen anfing, brachten die alten Bilder Diti auf den Gedanken, selbst etwas an die Wand zu zeichnen.
»Schau«, sagte sie zu ihrem Sohn, »er ist hier bei uns, dein Vater. Hab keine Angst, er ist an unserer Seite …«
Und so zeichnete sie das erste ihrer Bilder: eine überlebensgroße Darstellung von Kalua.
In späteren Jahren fragten ihre Kinder und Enkel oft, warum so wenig von ihr selbst, von ihren eigenen Erlebnissen auf der Plantage an den Wänden des Schreins zu sehen sei und so viel von ihrem Mann und seinen Kameraden, den anderen Flüchtlingen. Ihre Antwort war: »Ekut, für mich war das Bild eures Großvaters nicht wie die Gestalt eines ero auf einem Gemälde; es war real, es war die vérité. Immer wenn ich es schaffte, hier heraufzukommen, dann, um mit ihm zusammen zu sein. Mein eigenes Leben musste ich jede sekonn jedes Tages ertragen: Wenn ich hier war, war ich bei ihm …«
Mit diesem ersten, überlebensgroßen Bild begannen stets die Besichtigungen des Schreins. Wie im wahren Leben, war Kalua auch hier größer und mächtiger als irgendjemand sonst, so schwarz wie Krishna selbst. Im Profil dominierte er, einen langot um die Hüfte geknotet, die Wand wie ein alles bezwingender Pharao. Unter seinen Füßen stand, in einer dekorativen Kartusche von anderer Hand eingraviert, der Name, den man ihm im Lager der Kontraktarbeiter in Kalkutta verpasst hatte – »Maddow Colver«.
Wie alle Pilgerfahrten liefen auch die Besuche der Famie in Ditis Schrein nach einem vorgeschriebenen Ritual ab: Tradition und Gebräuche diktierten sowohl die Richtung des Rundgangs als auch die Reihenfolge, in der die Bilder betrachtet und verehrt werden mussten. Auf das Bild des Gründervaters folgte eines, das die Famie unter dem Titel »Die Trennung« (Biraha) kannte: Es stand nichts darunter, aber jeder Colver wusste, dass es so hieß, und selbst den kleinsten chutkas und chutkis war bekannt, dass es einen Wendepunkt in der Geschichte ihrer Familie zeigte – den Augenblick, in dem Diti von ihrem Mann getrennt wurde.
Das geschah, wie alle wussten, als Diti und Kalua auf der Ibis mit Dutzenden anderer Kontraktarbeiter von Indien nach Mauritius unterwegs waren. Die Reise hatte von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden, und das Unglück erreichte seinen Höhepunkt, als Kalua wegen eines bloßen Aktes der Selbstverteidigung zum Tode verurteilt wurde. Doch bevor die Strafe vollstreckt werden konnte, kam ein Sturm auf, der Schoner geriet in Seenot, und Kalua konnte zusammen mit vier anderen Flüchtlingen in einem Rettungsboot fliehen.
Die Geschichte von der glücklichen Flucht des Patriarchen von Bord der Ibis wurde bei den Colvers oft erzählt: Sie war für sie das, was die Geschichte der wachsamen Gänse für das alte Rom gewesen war – ein Augenblick, in dem das Schicksal sich mit der Natur verbündete, um sie darauf hinzuweisen, dass ihr Los kein gewöhnliches war. Ditis Zeichnung hielt den Augenblick fest, bevor die tobenden Wogen das Boot der Flüchtlinge vom Mutterschiff wegrissen: Die Ibis war wie ein mythologischer Vogel dargestellt, mit einem großen schnabelförmigen Bugspriet und zwei riesigen ausgebreiteten Segeltuchschwingen. Das Beiboot mit den Flüchtlingen war rechts, nur etwa einen Fuß entfernt, durch zwei stilisierte hohe Wogen von der Ibis getrennt. Als Kontrast zur Vogelform des Schoners erinnerte die Gestalt des Bootes an einen halb untergetauchten Fisch; seine Größe dagegen war – vielleicht um seine gewichtige Rolle zu betonen – stark übertrieben, hatte es doch fast dieselben Maße wie das Mutterschiff. Auf jedem der beiden Wasserfahrzeuge befand sich nur ein kleines Grüppchen Menschen, vier an Bord des Schoners, fünf in dem Boot.
Wiederholung ist die Methode, die das Wundersame alltäglich macht: Obwohl die Geschichte in ihren Grundzügen allen wohlbekannt war, stellten sie Diti immer wieder dieselben Fragen, wenn sie die Prozession zu dem Schrein anführte.
»Kisa?«, riefen die chutkas und chutkis und zeigten auf diese oder jene Figur: »Kisisa?«
Doch auch dafür hatte Diti ein festes Ritual, und egal, wie viel Spektakel die Kinder machten, sie begann immer auf dieselbe Weise: Sie hob den Stock und zeigte auf die kleinste der fünf Gestalten in dem Rettungsboot.
»Vwala! Seht ihr den da mit den drei Augenbrauen? Das ist Jodu, der Laskar – er ist mit eurer Tantinn Paulette aufgewachsen und wie ein Bruder für sie. Und der da drüben, mit dem Turban auf dem Kopf, das ist Serang Ali – ein Meister-Seemann, wenn es so etwas gibt, und so gerissen wie ein gran-koko. Und die beiden da, das sind Verurteilte, die auf Mauritius ihre Strafe verbüßen sollten – der links war der Sohn von einem Seth, einem großen Geschäftsmann aus Bombay, aber seine Mutter war Chinesin, deshalb wurde er Chini genannt, obwohl er Ah Fatt hieß. Und der andere, das ist kein anderer als euer Nil-mawsa, der Onkel, der so gern Geschichten erzählt.«
Dann erst bewegte sich die Spitze ihres Stockes zur turmhohen Gestalt von Maddow Colver, der aufrecht mitten im Boot stand. Als Einziger der fünf Flüchtlinge war er mit abgewandtem Gesicht dargestellt, als wollte er seiner Frau und seinem ungeborenen Kind auf der Ibis Adieu sagen, also ihr selbst, die mit einem unförmigen Bauch dargestellt war.
»Da, vwala! Das da bin ich auf dem Deck der Ibis mit eurer Tantinn Paulette auf der einen und Babu Nob Kissin auf der anderen Seite. Und da hinten ist Malum Zikri – Zachary Reid, der zweite Steuermann.«
Die Platzierung von Ditis Abbild war einer der kuriosesten Aspekte der Komposition: Im Gegensatz zu den anderen, die alle mit beiden Beinen auf den Planken ihres Schiffs standen, schwebte Diti ein ganzes Stück über dem Deck. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, sodass es schien, als schaute sie über Zacharys Schulter in den stürmischen Himmel hinauf. Mehr als jedes andere Detail des Bildes bewirkte Ditis Kopfhaltung, dass das Bild seltsam statisch wirkte, als ob sich die Szene ganz langsam und planmäßig aufgebaut hätte.
Doch jede Andeutung in diese Richtung quittierte Diti augenblicklich mit einem schroffen Tadel: »Bon-dyé«, rief sie dann aus, »bist du ein fol dogla oder was? Mach dich nicht lächerlich: Die ganze Sache hat von Anfang bis Ende nur ein paar minits gedauert, und die ganze Zeit war es eine einzige jaldi-jaldi, ein hoffnungsloses golmal, tus in dezord. Glaub mir, es war ein mirak, dass die fünf entkommen sind – und das alles wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Serang Ali. Er war es, der die Flucht geplant hat, er und kein anderer; wir hatten alles ihm zu verdanken. Die Laskaren waren natürlich alle eingeweiht, aber es war so sorgfältig vorbereitet, dass der Kapitän es ihnen nicht anlasten konnte. Es war ein wunderbarer Plan, wie ihn nur ein burrburrya wie der Serang ausklügeln konnte: Sie haben gewartet, bis der Sturm die Wachen in ihre Quartiere unter Deck getrieben hatte. Dann haben sie sie eingesperrt, indem sie die Luken dicht machten. Der Serang setzte den Zeitpunkt des Ausbruchs während einer Wachablösung fest, als alle Offiziere unter Deck waren. Ah Fatt, der Chini, der am schnellsten auf den Beinen war, hatte die Aufgabe, die Luke der Offizierskajüte zu verschließen, stattdessen schickte er aber den ersten Steuermann mit einem sandokann zwischen den Rippen zur Hölle; als das herauskam, war das Boot schon auf und davon. Mich hat Jodu rausgelassen, und als ich an Deck kam, hab ich vreman gedacht, ich hätte mein Augenlicht verloren. Es war so dunkel, dass nichts vizib war, außer wenn es blitzte – und toulétan der Regen, der wie Hagel runterprasselte, und der Donner, krawumm, krawumm, krawumm, als sollten wir alle taub werden. Ich hatte nur die Aufgabe, euren Großvater von dem Mast abzuschneiden, an den sie ihn gefesselt hatten, aber bei dem Regen und dem Wind, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie difisil das war …«
Dieser Beschreibung zufolge hätte man meinen können, dass die Szene nach nur wenigen Minuten hektischer Aktivität zu Ende gewesen war, und doch behauptete Diti jedes Mal fast im selben Atemzug, es sei ihr vorgekommen, als hätte die Trennung ein oder zwei Stunden gedauert. Und das war nicht das einzige Paradox dieser Nacht. Paulette bestätigte später, dass sie an Ditis Seite war, von dem Moment, als Kalua ins Boot hinabgelassen wurde, bis zu der Sekunde, als Zachary sie wieder unter Deck brachte; während dieser ganzen Zeit, schwor sie, hätten Ditis Füße das Deck der Ibis nicht verlassen, auch nicht für einen einzigen Augenblick. Doch ihre Worte konnten nichts ausrichten gegen Ditis Bestimmtheit, wenn sie schilderte, was in diesen wenigen Minuten geschah: Nie wich sie auch nur einen Fingerbreit von ihrer Behauptung ab, sie habe sich deshalb auf diese Weise porträtiert, weil sie von einer Kraft, keiner anderen als der des Sturms selbst, hochgewirbelt und in den Himmel emporgetragen worden sei.
Niemand, der Diti davon erzählen hörte, konnte bezweifeln, dass sie selbst wirklich überzeugt war, der Wind habe sie hochgehoben, sodass sie hinabschauen und alles sehen konnte, was sich unten ereignete – nicht in Angst oder Panik, sondern in aller Seelenruhe. Es war, als hätte der tufaan sie zu seiner Vertrauten erwählt, den Gang der Zeit angehalten und ihr sein eigenes Auge geliehen; einen Moment lang konnte sie alles sehen, was sich in diesem stürmischen Wirbel befand: Sie sah die Ibis, direkt unter sich, und die vier Gestalten, die sich im Schutz der Kajütstreppe auf dem Achterdeck zusammendrängten, eine von ihnen sie selbst; etwas weiter östlich nahm sie eine Inselgruppe wahr, die von vielen tiefen Kanälen durchzogen war; sie sah Fischerboote, die in den großen und kleinen Buchten der Inseln Zuflucht gesucht hatten, und andere, seltsam fremde Wasserfahrzeuge, die durch die Kanäle glitten. Auf die gleiche Weise, wie eine Mutter oder ein Vater den Blick des Kindes auf etwas Interessantes lenkt, drehte der Sturm dann sanft ihren Kopf, um ihr ein Boot zu zeigen, das in seinen Wogen gefangen war: das fliehende Beiboot der Ibis. Sie sah, dass die Flüchtlinge sich die Stille im Auge des Sturms zunutze gemacht hatten, um in fliegender Hast über das Wasser zur nächstgelegenen Insel zu gelangen; sie sah sie aus dem Boot springen, und dann sah sie zu ihrer größten Verwunderung, dass sie das Boot umdrehten und es hinausstießen, sodass es von der Strömung fortgetragen werden konnte …
Dies alles – diese Folge von Visionen und Bildern – war ihr, so versicherte Diti später, innerhalb weniger Sekunden zuteil geworden. Und eines war klar: Wenn sie die Wahrheit sagte, dann konnten die Visionen nicht länger gedauert haben – denn das Auge des Sturms hatte nicht nur den Flüchtenden, sondern auch den Wachen und Maistrys eine kurze Pause gewährt. Als der Wind nachließ, hämmerten sie gegen die zugenagelte Luke ihres Verschlags; sie würden nur ein paar Minuten brauchen, um durchzubrechen, und dann würden sie herausstürzen …
»Zikri-Malum hat uns gerettet«, fügte Diti an diesem Punkt stets hinzu. »Ohne ihn wäre es eine gran kalamité geworden – unvorstellbar, was die Silahdars und Aufseher uns dreien angetan hätten, wenn sie uns auf Deck angetroffen hätten. Aber der Malum hat uns Beine gemacht und uns ins Zwischendeck zurückgestoßen, zu den anderen Kontraktarbeitern. Dank ihm waren wir verschwunden, als die Wachen und Aufseher auf Deck gerannt kamen …«
Was danach geschah, konnten sie – Diti, Paulette und die anderen im Zwischendeck – nur vermuten: In der kurzen Zeit, bis das Auge des Sturms vorübergezogen war und der Wind wieder zurückkehrte, war es, als hätte ein weiterer Orkan die Ibis erfasst, denn man hörte Dutzende von Füßen hierhin und dorthin über das Deck poltern. Ganz plötzlich kam dann der Taifun wieder über sie, und man hörte nichts mehr außer dem beängstigenden Heulen des Sturms und dem Prasseln des Regens.
Erst viel später erfuhren die Kontraktarbeiter, dass man Malum Zikri die Schuld an allem gegeben hatte, was vorgefallen war – an der Flucht der Sträflinge, der Desertion des Serangs und des Laskars, der Befreiung von Kalua und sogar dem Mord am ersten Steuermann. All dies wurde ihm zur Last gelegt.
Die Kontraktarbeiter im Zwischendeck unten wussten nichts von all dem, was sich über ihnen abspielte, und als sie endlich wieder herausgelassen wurden, sagte man ihnen nur, die fünf Flüchtlinge seien tot. Das Beiboot sei kieloben und mit einem Loch im Boden aufgefunden worden, erzählten ihnen die Maistrys, es bestehe also kein Zweifel, dass sie das Schicksal ereilt hatte, das sie verdienten. Und Malum Zikri sei hinter Schloss und Riegel, denn der Kapitän sei gezwungen worden, den aufgebrachten Aufsehern zu versprechen, dass er ihn bei der Ankunft in Port Louis den Behörden übergeben werde.
»Dyé-koné, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Neuigkeit auf uns wirkte und was für einen gran kankann sie auslöste, denn die Laskaren beklagten den Tod von Serang Ali, die Kontraktarbeiter trauerten um Kalua, und Paulette weinte um Jodu, der wie ein Bruder für sie war, und auch um Zikri Malum, weil sie ihr Herz an ihn gehängt hatte. Ich war die Einzige, das könnt ihr mir glauben, deren Auge trocken blieb, weil ich es besser wusste. ›Hör zu‹, flüsterte ich eurer Tantinn Paulette zu, ›keine Sorge, sie sind wohlauf, die fünf; sie haben das Boot selbst ins Meer zurückgestoßen, damit man sie für tot hält und sie schnell vergisst. Und auch um Malum Zikri brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weißt du, er hat sicher Vorkehrungen für dich getroffen – vertrau ihm einfach.‹ Und tatsächlich, einen oder zwei Tage später hat Mamdu-Tindal, einer der Laskaren, eurer Tantinn Paulette ein Bündel mit Kleidern des Malum gegeben und ihr ins Ohr geflüstert: ›Wenn wir im Hafen sind, zieh das an, und wir bringen dich irgendwie an Land.‹ Ich war als Einzige nicht überrascht, denn es war, als ereignete sich alles so, wie ich es gesehen hatte, als der Sturm mich in die Höhe getragen und mir gezeigt hatte, was unten geschah …«
Es fehlte nie an Skeptikern, die Ditis Bericht von jener Nacht anzweifelten. Die meisten ihrer Zuhörer waren auf der Insel aufgewachsen und konnten sich einer gewissen Vertrautheit mit Zyklonen rühmen, aber kein Einziger von ihnen hatte sich jemals vorgestellt – oder konnte glauben –, dass es möglich sei, die Welt durch das Auge eines Sturms zu betrachten. War es möglich, dass sie sich das alles in der Rückschau nur eingebildet hatte? Hatte sie vielleicht einen Anfall erlitten oder war einer Halluzination aufgesessen? Dass sie tatsächlich gesehen hatte, was sie beschrieb, erschien selbst denjenigen unter ihnen, die sie am meisten respektierten, zweifelhaft.
Doch Diti blieb felsenfest dabei: Glaubten sie etwa nicht an Sterne, Planeten und die Linien in ihren Handflächen? Glaubten sie nicht, dass jedes dieser Zeichen Schicksalhaftes offenbaren konnte, jedenfalls für Menschen, die sich darauf verstanden, ihre Geheimnisse zu enträtseln? Warum glaubten sie dann nicht auch an den Wind? Sterne und Planeten wanderten schließlich auf vorgezeichneten Bahnen – der Wind aber, niemand wisse, wohin der Wind wehen wird. Der Wind sei die Kraft der Veränderung, der Umwandlung, das habe sie an jenem Tag begriffen, sie, Diti, die immer daran geglaubt habe, dass ihr destenn in den Sternen und Planeten liege; sie habe begriffen, dass der Wind es war, der beschlossen hatte, dass es ihr Karma sei, nach Mauritius zu gelangen, in ein anderes Leben; der Wind sei es gewesen, der einen Sturm herabgeschickt hatte, um ihren Mann zu befreien …
Und hier wandte sie sich dem Bild »Die Trennung« zu und zeigte auf seinen vielleicht faszinierendsten Aspekt: den Sturm selbst. Sie hatte ihn so gezeichnet, dass er den oberen Teil des Bildes in ganzer Breite einnahm: Er war als gigantische Schlange dargestellt, die sich in immer kleiner werdenden Kreisen von außen nach innen ringelte und im Zentrum in einem riesigen Auge endete.
»Seht selbst«, sagte sie dann zu den Skeptikern, »ist das kein Beweis? Hätte ich nicht gesehen, was ich sah, wie hätte ich mir jemals vorstellen können, dass ein tufaan ein Auge haben kann?«
Zweites Kapitel
Die Colvers waren auch nicht leichtgläubiger als andere Leute, und hätten keine plausiblen Gründe dagegengesprochen, wären es die meisten von ihnen zufrieden gewesen, »Die Trennung« lediglich als ein ungewöhnliches Familienandenken zu betrachten. Nil fiel es zu, der Famie klarzumachen, dass Ditis Darstellung der »Trennung« zumindest in einem Punkt wahrhaft visionär war: Sie hatte den Sturm mit einem Auge in der Mitte dargestellt. Das verriet ein Wissen um das Wesen von Wirbelstürmen, das für die damalige Zeit nicht nur ungewöhnlich, sondern geradezu revolutionär war, denn erst 1838, im Jahr jenes Wirbelsturms, stellte zum ersten Mal ein Wissenschaftler die Hypothese auf, Zyklone könnten aus Winden bestehen, die um ein stilles Zentrum rotieren – mit anderen Worten, um ein Auge.
Zu dem Zeitpunkt, als Nil zum ersten Mal den Morne bestieg, war die Ansicht, dass Stürme um ein Auge herum rotieren, schon fast ein Gemeinplatz, doch diese Idee hatte bei Nil einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass er sich sehr deutlich an seine erste Begegnung mit diesem Phänomen etwa zehn Jahre zuvor erinnerte. Er hatte in einer Zeitschrift davon gelesen und war überrascht und fasziniert von dem Bild gewesen, das es heraufbeschwor – von einem gigantischen Auge am Ende eines großen, rotierenden Fernrohrs, das alles, worüber es hinwegzog, untersuchte, manche Dinge auf den Kopf stellte und andere unbehelligt ließ, nach neuen Möglichkeiten Ausschau hielt, Neuanfänge bewirkte, Schicksale umschrieb und Menschen zusammenwarf, die einander sonst nie begegnet wären.
In der Rückschau gab dieses Bild seiner eigenen Erfahrung des Sturms Sinn und Form, und doch hatte er damals keinerlei Vorstellung von seiner Bedeutung gehabt. Wie war es dann aber möglich, dass Diti, einer des Lesens und Schreibens unkundigen, verängstigten jungen Frau, diese Einsicht gewährt worden war? Dies obendrein zu einer Zeit, als nur eine Handvoll der fortschrittlichsten Wissenschaftler von dem Phänomen wusste? Es war ein Mysterium, das stand für Nil außer Zweifel. Deshalb hatte er, wenn er zuhörte, wie Diti die Geschichte erzählte, das Gefühl, dass Ditis Stimme ihn ins Auge des Sturms zurücktrug.
»Und jetzt schreien mir der Serang und die anderen in die Ohren: Alo-alo! Alé-alé! Und euer Großvater, der Himmel weiß, wie groß er ist, wie schwer und byin-bati. Er geht an die Reling, und ich knie vor ihm nieder: ›Nehmt mich mit, nehmt mich mit‹, flehe ich ihn an, aber er stößt mich weg: ›Nein, nein! Du musst an dein Kind denken; du kannst nicht mit!‹ Und dann klettern sie alle in das Boot – und um uns herum tobt der tufaan, er tobt und tobt; ein Wimpernschlag, und das Boot legt ab. Im nächsten Moment ist es verschwunden …«
Nil spürte fast die Planken des Bootes, die unter seinen Füßen bebten, den Regen, der ihm ins Gesicht peitschte: Es war alles so real, dass er dankbar war, als ihn die Kinder am Ärmel zupften und in den Schrein zurückholten: »Was war dann, Nil-mawsa? Hattest du keine Angst?«
»Nein, damals nicht. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, bekomme ich Angst, aber als es passierte, war dafür keine Zeit. Der Sturm blies so heftig, dass wir uns mit aller Kraft im Boot festhalten mussten; es schien, als würde es jeden Moment mit uns allen fortgeweht werden. Aber wunderbarerweise geschah das nicht: Als wir am wenigsten damit rechneten, war plötzlich das Auge des Sturms über uns, und das Toben ließ nach. In dieser kurzen Zeitspanne ruderten wir an Land. Kaum hatten wir Sand unter den Füßen, wollten wir das Boot hochheben und in Sicherheit bringen. Doch Serang Ali hinderte uns daran: Nein, sagte er, es sei besser, ein paar Planken aus dem Boden zu schlagen, das Boot umzudrehen und es ins tiefe Wasser hinauszustoßen! Wir trauten unseren Ohren nicht, es hörte sich an wie schierer Wahnsinn wie sollten wir ohne Boot jemals wieder von der Insel wegkommen? Aber der Serang ließ sich nicht beirren: Boote gebe es genug auf der Insel, sagte er, und es sei zu riskant, das Beiboot mit seiner verräterischen Bemalung zu behalten. Wenn man es fand, würde sich herumsprechen, dass wir am Leben waren, und man würde uns verfolgen bis ans Ende unserer Tage. Viel besser sei es, wenn alle Welt uns für tot hielt man würde uns abschreiben, und wir könnten ein neues Leben anfangen. Und er hatte natürlich recht es war das Beste, was wir tun konnten.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!