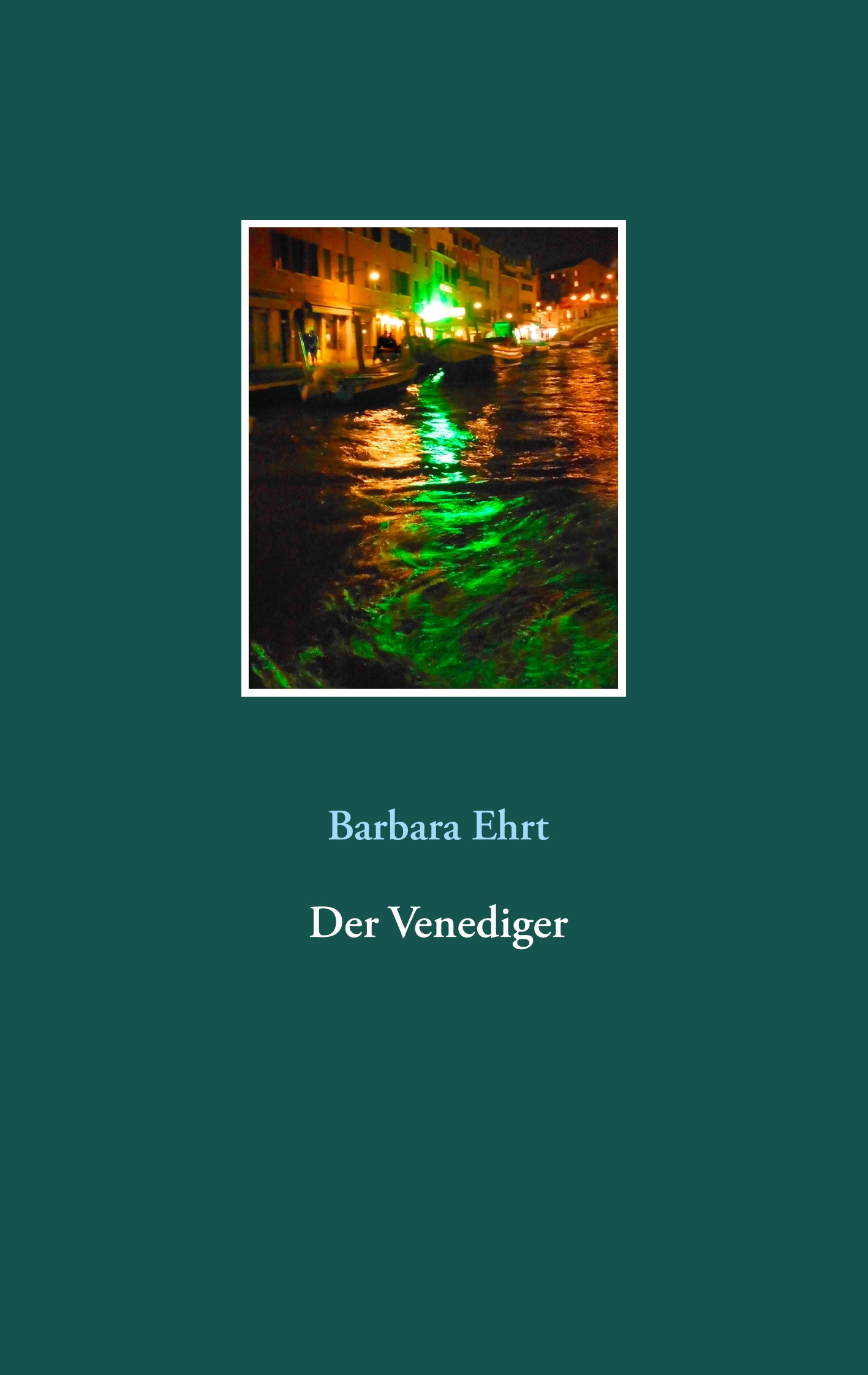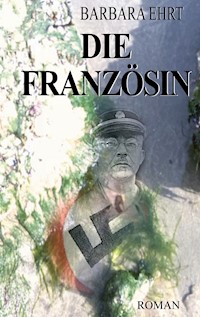
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Amanda Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Charlotte, eine junge Französin, wird 1944 in Marseille von deutschen Soldaten gefangen genommen und gelangt auf Umwegen als Zwangsarbeiterin ins Lagerbordell der Munitionsfabrik Werk Tanne in Clausthal-Zellerfeld. Fred, ihr deutscher Verlobter, wird zur Wehrmacht eingezogen und gerät auf dem Stützpunkt Pointe du Hoc an der Normandie-Küste ins Gemetzel des sogenannten D-Day. Die Ruinen der Munitionsfabrik stehen seit Jahrzehnten leer, sie gehören zu den lost places: verlassene Orte, verfallene Gebäude mit einer schaurigen Vorgeschichte. Als im Jahr 1998 auf dem mit Sprengstoff verseuchten Werksgelände ein Toter gefunden wird, kehren die dunklen Schatten der NS-Herrschaft in den Harz zurück. Amanda, die junge Psychologin aus Goslar, wird mitten ins Geschehen hineingezogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Charlotte, eine junge Französin, wird 1944 in Marseille von deutschen Soldaten gefangen genommen und gelangt auf Umwegen als Zwangsarbeiterin ins berüchtigte „Werk Tanne“ nach Clausthal-Zellerfeld. Fred, ihr deutscher Verlobter, wird zur Wehrmacht eingezogen und landet an der Normandie-Küste im Stützpunkt („Widerstandsnest“) Pointe du Hoc. Er erlebt die Schlacht des D-Day mit und desertiert. Im Mittelpunkt der Handlung steht die NS-Munitionsfabrik „Werk Tanne“ in Clausthal-Zellerfeld, seit Jahrzehnten leerstehende Ruinen, sogenannte lost places: verlassene Orte, verfallene Gebäude mit einer schaurigen Vorgeschichte.
Als im Jahr 1998 auf dem mit Sprengstoff verseuchten Werksgelände ein Toter gefunden wird, kehren die dunklen Schatten der NS-Herrschaft in den Harz zurück.
Autorin
Barbara Ehrt lebt im Harz, sie ist Mitglied im Freien Deutschen Autorenverband (FDA) und im Verband Deutscher Schriftsteller (VS-Verdi)
Weitere VeröffentlichungenDie Harzfrau ISBN: 9783750411616 Der Venediger ISBN: 978375930314 Die Tote im alten Schacht ISBN: 9783751935135 Skurriles zwischen Himmel und Harz (E-Book) ISBN: 978-3-7380-9530-2 Das Herz des Kaisers Eine kleine Geschichte des Harzes Ein zwölfter Kaiser im Huldigungssaal? (Unser Harz, 2014) Die Kapelle St. Ulrich in der Goslar Pfalz (Unser Harz, 2019)
...dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamith...Todesfuge, Paul Celan
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
1
Clausthal-Zellerfeld, Juni 1998
An einem warmen Tag im Juni zwängten sich zwei Spaziergängerinnen durch ein Loch in einem drei Meter hohen Maschendrahtzaun, der mit Stacheldrahtaufsetzern versehen war. Die Umzäunung schirmte die Ruinen einer ehemaligen Munitionsfabrik ab, die während der NS-Zeit Sprengstoff produziert hatte. Der Zutritt zu dem über 100 Hektar großen Grundstück war verboten und die beiden Frauen mussten sich die Stelle mit dem Schlupfloch gut einprägen, um den Fluchtweg zu finden, falls eine Kontrolle kam.
Man konnte sich auf dem unübersichtlichen Gelände leicht verirren und es war nicht ungefährlich. Unter den über hundert halbeingestürzten Fabrikhallen, die in den Jahrzehnten des Leerstands unter wucherndem Gestrüpp verschwunden waren, gab es Hohlräume und Löcher. Den Frauen war ein wenig unbehaglich zumute.
„Los komm, da drüben ist die gepflasterte Straße, die verläuft einmal ums ganze Werk herum und dort hinten stehen die meisten Gebäude. Was ist, hast du Angst?“ Die ältere der beiden, eine dunkelhaarige, schlanke Frau, sah sie ablehnend an. „Ich mach da lieber nicht mit!“ Das sportlich aussehende, junge Mädchen mit Kurzhaarschnitt in Jeans und Männerhemd, versuchte sie zu beschwichtigen.
„Ach, das sind doch nur leere Fabrikhallen, wir gehen ein paar Meter und dann kehren wir um. Wovor solltest du dich fürchten, die Hitlerzeit liegt doch weit zurück!“ Ein unschuldiger blauer Himmel kolorierte die Mauerfragmente einer Vergangenheit, in der Morden und Töten zum normalen Alltag gehört hatte. „Sieh mal da, die erste Halle!“
Die Mitvierzigerin ging zögerlich weiter, vor einer Ruine blieben sie stehen. Beide machten ein paar Fotos. „Komisch, ich wusste überhaupt nicht, dass es hier so etwas gibt.“
Die ältere der beiden hatte das Gelände zum ersten Mal betreten, die Jüngere kannte sich aus und genoss sichtlich die spannende Durchführung einer Zuwiderhandlung.
„Die Clausthaler möchten die Zeugnisse ihrer unrühmlichen Vergangenheit am liebsten vergessen. Es gibt noch nicht mal eine Gedenktafel, aber ich habe einen Lehrer, der macht mit uns Projektarbeit zum Dritten Reich und ich habe sogar ein Referat über das Werk `Tanne´ gehalten!“
„Und die Leute hier haben davon nichts gewusst?“
„Doch, na klar, das war ein großes Fabrikgelände, da haben auch viele Leute aus Clausthal gearbeitet, nicht nur die Zwangsarbeiter. Aber für die gefährlichen Sachen wurden immer die Russen und Polen oder andere Ausländer eingesetzt. Mit denen ist man nicht zimperlich gewesen und alle haben das mitgekriegt, obwohl sie jetzt so tun, als hätte es keiner gewusst.“
„Und woher weißt du das alles?“
„Na, sag ich doch, der Lehrer! Und jetzt, man stelle sich vor, sind sogar zwei Bücher zu diesem Thema erschienen. Deshalb wollte ich doch unbedingt hierher! Ich hab mir beide gekauft, also, wenn du sie dir ausleihen möchtest?“
Inzwischen standen sie im Schatten einer besonders schaurig aussehenden, großen Werkshalle und tauschten ihre Kommentare nur noch flüsternd aus. Zögernd wagten sie sich bis an den Eingang heran, denn ein Teil der Halle war bereits unter der Last großer Fichten und Birken auf dem Dach eingesunken. Sie fotografierten eifrig die zerborstenen Fensterrahmen, die halb ausgehängten Türen und die mit Bäumen bewachsenen, pittoresken Dächer aus Stahlbeton.
„Und was wurde hier produziert?“
Ihre Frage riss die Jüngere aus düsteren Überlegungen.
„Na, Sprengstoff, ach, wie heißt der bloß, ein ganz seltsamer Name...“
„Nitroglycerin?“ „Nein, äh, ich hab´s gleich, TNT, also Moment: Trinitrotoluol, genauso steht´s in den Büchern!“
„Wie heißt das: Tri- Trini... noch nie gehört. Und wozu sollte das sein?“
„Für Bomben, Tellerminen, Granaten, Munition, ach, sogar die Füllung für Hitlers V1-Raketen sollte hier hergestellt werden.“
„Hat es da nicht dauernd geknallt, Sprengstoff ist doch hochexplosiv!“
„Soweit ich weiß, wurden deshalb alle Produktionshallen doppelwandig gebaut, eine Wand aus Beton und eine aus Backstein, falls die eine weg krachte, konnte die andere immer noch das Dach stützen. Und es gab immer eine zweite Ersatzhalle, falls eine in die Luft flog, ging´s in der anderen weiter. Und alles schön in sicherem Abstand.“
„Wie lange ist das her, dass die das alles gebaut haben?“
„Ich glaube, schon vor dem Krieg war alles fertig. Ich weiß das nur, weil ich das Referat gehalten hab. Du musst dir vorstellen, Werk `Tanne´ war eine gut funktionierende Industriestadt. Es gab Bürogebäude, Werkshallen, Pumpmaschinen, einen Güterbahnhof, Lokschuppen, Tischlereien, Aufenthaltsräume, Bunker, Tunnel und sogar unterirdische Labore. Ach ja, und der Zaun war elektrisch!“
Sie schüttelte sich.
„Aber jetzt doch wohl nicht mehr?“
„Nee, natürlich nicht, dann wären wir doch schon tot umgefallen. Etliche Gebäude sind gleich nach Kriegsende von der Militärregierung weggesprengt worden und sämtliches Inventar, also zum Beispiel gusseiserne Kessel, Maschinenteile, Elektrokabel, wurde beschlagnahmt und als Reparationsgüter gen Osten oder Süden verschoben. Clausthal stand zuerst unter amerikanischer und dann unter britischer Militärverwaltung. Hitler hat schon vor dem Krieg, als er noch behauptet hat, er wolle den Weltfrieden, da hat er schon mehrere Munitionsfabriken errichten lassen, die werden in dem einen Buch „Schläferwerke“ genannt, die sollten bei Kriegsbeginn sofort voll einsatzfähig sein. In den abgelegenen Wäldern des Harzes konnte man solche Einrichtungen gut versteckt halten. Im Krieg gegen Russland und Polen haben sie dann die Leute weggefangen und in der Rüstungsindustrie schuften lassen.“
Sie schwiegen eine Weile.
„Warum stehen überall Bäume auf den Dächern?“
„Die hat man schon 1939 angepflanzt, damit die Hallen von oben nicht zu sehen waren.“
„Und es gibt nirgendwo Tafeln mit Erläuterungen?“
„Nein, das Betreten des Geländes ist ja nicht erlaubt, wegen der Einsturzgefahr und hier liegt immer noch das ganze Gift in der Erde.“
Zwischen den umgestürzten Betonbrocken einer riesigen Werkshalle stand ein verlassener weißer Campingstuhl aus Plastik, daneben ein verrosteter Grill.
„Wer hat denn hier gegrillt?“
„Das stammt vielleicht noch von den Leuten, die nach dem Krieg hier gewohnt haben. Als man noch nicht wusste, wie verseucht der Boden ist, da wurden die Häuser vermietet und einige Gebäude als Abstellräume genutzt. Jetzt ist das alles Sperrgebiet.“
Die jüngere schaute ihre ältere Begleiterin besorgt an. „Ich hoffe, ich hab dir nicht den Tag verdorben?“ „Nein, das nicht, aber lass uns langsam zurückgehen, ich finde es hier unheimlich, man hört nicht mal die Vögel zwitschern. Das ist ein Ort mit schlechten Schwingungen, genauso gespenstisch wie diese alten Inka-Städte, wo der Urwald alles zugewuchert hat.“
Wie bei allen als „lost places“ bezeichneten Orten hatte die Natur sich auch das Werk „Tanne“ zurückerobert. Gebüsch, Gestrüpp und umgestürzte Baumstämme versperrten den Weg, Fichten mit kahlen, dürren Stämmen waren in die Höhe geschossen und auf dem Kopfsteinpflaster der ehemaligen Zufahrtsstraße hatte sich eine schmierige, grüne Haut aus Moos gebildet.
„Die bewachsenen Dächer sind wirklich kurios. Wie lange wird es wohl dauern, bis die irgendwann unter dem Gewicht des Holzes zusammenbrechen?“
„Keine Ahnung, aber sieh mal, da drüben, das ist doch nicht aus der Kriegszeit, oder? Türen stehen offen, Scheiben kaputt.“
Durch eine eingestürzte Wand waren Personaltoiletten mit Waschbecken, Duschen und gelbbraun gemusterten Wandfliesen zu sehen. Daneben befand sich eine Garage mit abgebrochenem Tor.
„Da liegt Maschendraht, der sieht ganz neu aus!“ Zu irgendeinem Zweck lagen zwei ungebrauchte, dicke Rollen von grünem Zaundraht in einer Ecke, vielleicht wurden damit die Löcher ausgebessert, die immer wieder von Schaulustigen aufgeschnitten wurden, um das Gelände zu betreten. An der Decke baumelte ein verrosteter Flaschenzug, eine Eisenstange stand angelehnt im Türrahmen, alte Stromkabel hingen aus der Wand.
Neugierig näherten sie sich einer riesigen Werkshalle, deren Eisentore ausgehängt waren, wagten aber nicht, einzutreten, denn das Innere der Halle lag in einem unheimlichen Halbdunkel verborgen. Die beiden Frauen bemerkten nicht, dass sie schon eine Weile beobachtet wurden. In der Werkshalle wartete jemand darauf, dass die Eindringlinge endlich verschwanden.
„Ach, komm, weg hier! Ich hab Angst, dass irgendwas einstürzt! Außerdem stinkt es nach Schwefel.“ Die ältere der beiden Frauen fühlte sich nicht wohl, sie zog die andere am Ärmel mit sich. Die Person in der Werkshalle atmete erleichtert auf.
Die Jüngere blieb gleich wieder stehen, sie bewunderte ein Gebäude, das von einer noch immer dekorativen Trockenmauer aus Natursteinen umgeben war.
„Sieht aus wie die ehemalige Verwaltung. Die haben sich richtig Mühe gegeben, nach außen hin einen harmlosen Eindruck zu machen. War bestimmt im Krieg ein Superjob, hier in der Verwaltung zu arbeiten! Und die armen Zwangsarbeiter mussten malochen.“ „Haben die auch hier gewohnt?“
„Nein, in Lagern in der Umgebung. Sie wurden streng bewacht und jeden Tag hierher gebracht.“
„Wie schrecklich! Ob die Geister dieser Menschen hier noch sind?“
„Meine Güte, du kommst auf Ideen!“
„Ich würde gern nochmal zurückgehen, die große Halle hat´s mir angetan, los, komm.“
„Nein, ich bleibe hier!“ Die Ältere blieb verärgert stehen, konnte aber die Mutigere nicht davon abbringen, zurückzugehen.
Die Person in der Halle überlegte fieberhaft, wie man sie daran hindern konnte, das Gebäude zu betreten.
Die Ältere schrie auf, lief hinter der Freundin her und umklammerte deren Arm.
„Hörst du das?“
Sie lauschten angestrengt, von irgendwoher war ein Klopfen zu vernehmen, doch es war schwer auszumachen, ob es aus der Werkshalle kam, deren Seitenwände noch intakt waren. Überdeutlich war es jetzt zu hören, Metall auf Stein. Unwillkürlich senkten sie die Stimmen, die Ältere flüsterte aggressiv:
„Du mit deinen Einfällen, ich wollte überhaupt nicht hierher! Sind wir noch weit vom Zaunloch entfernt?“
„Ich denke schon.“
„Oh Gott, da, da war es wieder! Ich glaube, es kommt direkt da drüben aus der Halle!“
„Sollen wir mal reingehen und nachsehen?“
„Nein, bist du verrückt! Lass uns ganz schnell zum Zaun zurück laufen, es fängt langsam an, dunkel zu werden und der Regen wird stärker!“
„Aber wenn das ein Hilferuf ist?“
„Du kannst ja später die Polizei anrufen, ich bleibe erst wieder stehen, wenn wir draußen sind!“
Sie packte die jüngere, zog sie weiter und beide kehrten auf den Hauptweg zurück. Es war inzwischen so dämmrig geworden, dass die Umrisse im nachlassenden Licht verschwanden. Sie rannten los, kletterten über umgestürzte Bäume, stolperten über Betonreste, versanken in feuchten Mooskissen und zwischen tropfenden Farnwedeln, bis sie endlich ganz durchnässt den Zaun erreicht hatten. Außer Atem schlüpften sie durch die Öffnung und hasteten zum Auto, dass am Pfauenteich geparkt war, an der Stelle, wo man die Toten begrub.
„Warte, warte, fahr noch nicht los, wenn doch.. also, ich finde, wir sollten etwas tun!“
Nach kurzer Beratung beschlossen sie, zu einer Telefonzelle zu fahren. Im Zentrum von Clausthal angelangt, wählte die jüngere den Notruf der Polizei, beschrieb kurz das Erlebte und beendete dann rasch das Gespräch.
„Du, ich hab ein ganz schlechtes Gewissen, hätten wir nicht wenigstens mal nachsehen sollen?“
Die Ältere blieb stur.
„Ach, sei still, wir sind Frauen! Niemand kann von uns verlangen, dass wir die Heldinnen spielen! Lass uns abhauen, sonst kriegen die uns noch wegen Hausfriedensbruchs dran!“
Der vielversprechende Ausflug endete mit einem Missklang.
Zwei Tage später
„Hast du schon gehört, was passiert ist?“ Die dickliche kleine Frau in engen Jeans zerrte an der Leine ihres strubbeligen, kleinen Mischlingshundes und schob sich dichter an eine Frau im grellbunten Fitnessdress heran, die ihre Dehnübungen unterbrach, um den neuesten Klatsch zu erfahren.
„Nee, was denn?“
„Man hat einen Toten gefunden, da oben im Werk „Tanne“!“
„Wirklich? Das ist ja gruselig, Unfall oder Mord?“
„Mord, aber ich habe das nur zufällig aufgeschnappt, als mein Sohn telefoniert hat. Der ist ja beim THW und kriegt so einiges mit.“ „Ist das Technische Hilfswerk denn immer noch auf dem Werksgelände?“
„Klar, sie dürfen da ihre Sachen unterstellen, Fahrzeuge, Material und so. Manchmal wird da auch gefeiert, hört ja keiner, wenn da die Sau raus gelassen wird.“ Die Hundebesitzerin stieß ein rauchiges Lachen aus senkte ihre tiefe Stimme. „Sie wissen aber nicht, wer der Tote ist. Vielleicht einer von diesen okkulten Satanisten, die gern in dunklen Ruinen herumspuken, die schneiden da immer Löcher in den Zaun und schon sind sie drin. Eigentlich ist es doch verboten, aber so ein riesiges Gebiet kann ja keiner kontrollieren.“
„Was genau ist denn passiert?“
Die verschwitzte Joggerin hatte ihre Dehnübungen wieder aufgenommen, streckte sich nach allen Seiten und trippelte dann sportlich mit den Füßen auf der Stelle.
„Es ging wohl ein Anruf bei der Polizei ein, gestern Abend, aber da war der schon tot.“
„Wer?“ „Keine Ahnung, irgendein Mann eben, mehr weiß ich auch nicht.“
2
Der Ermittler aus Braunschweig war froh, dass ihn ab morgen ein erfahrener, älterer Kollege unterstützen würde, er sah schon die Zeitungsmeldungen vor sich: `Hitlers Munitionsfabrik im Harz als Mord-Kulisse´. Der Druck der Öffentlichkeit bei einem so makabren Mordfall würde groß sein, zu groß, um im Alleingang vorzugehen.
Wenn es sich allerdings um einfach zu klärende Fälle handelte, war Mark ein bekennender Einzelgänger. Er fluchte leise, denn fast wäre er ausgerutscht und in der Dunkelheit hingefallen.
Mit eingezogenem Kopf folgte er einem Beamten aus Clausthal-Zellerfeld, dessen Stablampe das glitschige Kopfsteinpflaster der ehemaligen Werksstraße im Werk „Tanne“ beleuchtete. Marks Laune war genauso schlecht wie die Sicht mitten in der regnerischen Nacht. Bald mussten sie den immerhin festen Boden der Straße verlassen und sich zwischen Gebüsch und nasser Erde hindurch kämpfen, bei Nieselregen von oben und Matsch von unten. In einigen Metern Entfernung winkte ein anderer Polizist aufgeregt mit einer Lampe, um ihnen die Richtung anzuzeigen.
Mark schickte den ersten Beamten zurück zum Eingangstor und verharrte einen Moment im Halbdunkel, um die beiden Männer von der Spurensicherung zu beobachten, die den von Scheinwerfern hell beleuchteten Tatort untersuchten. Das Gebrumm des Generators war das einzige Geräusch in der Stille des dunklen Waldes. Marks Haare und T-Shirt fühlten sich sehr feucht an, er wandte sich dem Kollegen mit der Taschenlampe zu. „Na, was ist passiert? Haben Sie den Toten gefunden?“
Der ebenfalls durchnässte Polizist holte redselig aus. „Nö, das nicht, jedenfalls nicht sofort, also, ich wollte gerade Feierabend machen, da kam der Anruf, eine weibliche Person, sie hätte auf dem Gelände der Rüstungsfabrik ein Klopfen gehört. Ist immer dasselbe, die Leute müssen auf dem Gelände herumspuken, obwohl sie wissen, dass es verboten ist. Na, die Frau befürchtete wohl, da könne ein Notfall dahinter stecken und wollte nicht verantwortlich sein, wenn es da einen Unfall gäbe, und vielleicht würde die Person, die geklopft hat, ja auch Hilfe brauchen. Da fragt man sich doch, ob die Frau den nicht selber umgelegt hat? Sie hat versucht, die Stelle zu beschreiben, wo er liegt, aber Sie sehen ja selbst, das war völlig sinnlos, es gibt hier so viele Hallen. Also habe ich den Roy mitgenommen und bin los.“
„Wer ist Roy?“
„Na, unser Spürhund, also eigentlich hab ich ihn selber ausgebildet, wir haben ja hier oben keine Hundestaffel. Aber wie soll man denn im Dunkeln einen Ort finden, den keiner richtig beschreiben kann? Außerdem ist es gefährlich, die alten Bunkeranlagen sind brüchig, da fällt man rein und ist weg!“
„Und da haben Sie ihn dann entdeckt, den Toten?“
„Ja, Roy ist immer aufgeregter geworden und hat mich trotz des Regens in genau diese Halle geführt!“
Der Beamte schwieg und sah Mark Lob heischend an, doch der überlegte gerade, dass er sich robuste Schuhe kaufen müsste.
„Also, der Tote, der Anblick, das hat einen ziemlich umgehauen, werden Sie ja gleich sehen. Habe aber nichts angefasst, da brauchte nicht überprüft zu werden, ob der noch lebt, bei dem Zustand, hab´ dann über Funk alles weitergegeben.“
Ratlos senkte er den Kopf.
„Ausgerechnet heute, wo unser Kommissariatsleiter mal einen Tag frei gehabt hat! Ist doch sonst nichts los hier oben, mal ein Einbruch oder eine Schlägerei, wir haben wenig mit Mord zu tun, eigentlich gar nichts.“
Mark suchte die Decke des Gebäudes nach Rissen ab.
„Besteht hier eigentlich Einsturzgefahr?“ Er drängte sich, ohne die Antwort abzuwarten, an dem Mann vorbei.
Auf einem länglichen Betonklotz lag ein Toter, dessen Beine rechts und links mit Steinen daran gehindert wurden, seitlich wegzurutschen, die Arme hingen schlaff herab, das Gesicht oder was davon übrig war, hatte jemand mit einem Stück Stoff zugedeckt. Mark trat einen Schritt vor und schrak entsetzt zurück. Der ganze Körper war schwärzlich verkohlt. Ärgerlich fuhr ihn einer der Kollegen von der Spurensicherung an.
„Mensch, Vorsicht, bleib doch stehen, wir sind noch nicht so weit! Der Boden ist ganz aufgeweicht, du legst hier neue Spuren. Der Beamte mit seinem Hund hat schon das wenige an Spuren zermatscht, das es wegen des Regens sowieso kaum noch gibt.“
Mark blickte verlegen auf seine Füße.
„Wie lange braucht ihr noch?“
Undeutlich kam es unter dem Mundschutz hervor.
„Halbe Stunde. Die Säure hat alles zerfressen.“ „Säure? Keine Verbrennungen?“
„Nein, Schwefelsäure, die Verätzungen sehen ähnlich aus wie Verbrennungen.“
Mark wich vorsichtig einen Meter zurück und bemühte sich, Leiche, Fundort, Haltung, jedes Detail genauestens einzuprägen. Dabei schrieb er im Geist schon an seinem Bericht: wahrscheinlich männliche Leiche, ca. 1,80 groß, schlank, große Teile des Körpers wohl mit Säure übergossen, genaues Alter bisher unbekannt. Jemand hatte dem Toten ein Tüchlein oder einen Stofffetzen aufs Gesicht gelegt, ein Ritual? Man hörte ja so einiges über den Harz, Hexenwahn, alte Kultstätten…
Sollte er es mit einem Ritualmord zu tun haben, musste er unbedingt den Kriminalhistoriker aus Hannover hinzuziehen, der sich mit alten Bräuchen auskannte. Die Stimme des Kollegen von der Spurensicherung holte ihn in die Gegenwart zurück. In seinem weißen Overall stand er dicht vor ihm, hatte den Mundschutz abgestreift und starrte ihn schlecht gelaunt an.
„Man hat ihm erst nach dem Tod die Kehle durchgeschnitten, dann ist er so langsam ausgeblutet und dann kam post mortem die Säure. Im Mund ist so ein schwacher Geruch nach Bittermandeln, wie gesagt, nur sehr schwach, wegen der stinkenden Säure kaum wahrnehmbar, das könnte, ich sage: könnte, auf Zyanid hindeuten. Hier, wirf mal einen Blick aufs Gesicht oder was davon noch übrig ist.“
Vorsichtig hob er das schwärzlich verklebte Tuch mit einer Pinzette an und wartete lauernd auf die entsetzte Reaktion des Kollegen. Mark drehte sich sofort wieder weg. „Mein Gott, warum macht man denn sowas?“ Der Rechtsmediziner lachte bissig. „Vermutlich, damit ihr auch was zu tun habt, die Identifizierung könnte schwierig werden.“ Die Verätzungen ließen kaum mehr Rückschlüsse auf das Aussehen der Person zu, die zerstörten Lippen gaben den Blick frei auf ein vergilbtes Gebiss. Mark verwünschte schon jetzt den Moment, in dem er sich das unbekleidete Opfer auf dem Seziertisch würde ansehen müssen.
Am nächsten Abend saß er allein in einer Clausthaler Kneipe. Er brauchte vor dem Einschlafen noch einen Absakker, die Auseinandersetzungen mit dem Gerichtsmediziner, den Kollegen der Oberharzer Polizeiwache und vermeintlichen Zeugen, die überhaupt nichts gesehen und gehört hatten, war anstrengend und erfolglos gewesen. Die einzige echte Zeugin, die Anruferin, konnte nicht ermittelt werden. Nach zahlreichen Telefonaten mit Vorgesetzten in halb Niedersachsen waren sie jetzt offiziell für den Fall zuständig, er und ein Kollege. Der Verdacht auf eine Blausäurevergiftung als Todesursache hatte sich bestätigt, viel mehr wussten sie nicht.
Mark kam sich in der Kneipe ziemlich verloren vor, um ihn herum wurde gelacht und geschwatzt, alle schienen sich zu kennen, nur er saß allein am Tisch. Als würden ihn die anderen Gäste gar nicht interessieren, richtete er seine Aufmerksamkeit auf den perlenden Schaum in seinem Bierglas und dachte an den Tatort. Schwefelsäure. Warum hatte man den Körper des Mannes mit Säure zerstört und die entstellten Züge danach mit einem Tüchlein abgedeckt? Mark schüttelte sich, nein, er würde nur ungern in die NS-Vergangenheit eintauchen wollen, eine Beziehungstat mit dem Versuch, eine falsche Spur zu legen, wäre ihm lieber.
Sein Kollege Rolf, ein älterer Ermittlungsbeamter aus Braunschweig, der kurz vor seiner Pensionierung stand, hielt es auch für sehr unwahrscheinlich, dass die Tat mit der Clausthaler Nazi-Vergangenheit in einem Zusammenhang stand, er riet dringend zur Vorsicht mit Spekulationen. Rolf war am Morgen eingetroffen und sie hatten sich gemeinsam am Tatort umgesehen, anschließend hatten sie in der Mensa zu Mittag gegessen und sich später in der Oberharzer Polizeiwache mit den anderen Beamten ausgetauscht. Am Abend hatte der Kollege leider kein Interesse gezeigt, noch auf ein Bier mit in die Kneipe zu gehen.
Mark setzte seine Grübeleien fort. Der Mann war also zuerst mit Zyanid vergiftet worden, jedenfalls befand sich eine zerbissene Kapsel in seinem Mund, alles Weitere, die Verätzungen und der Kehlkopfschnitt, wurden ihm erst nach Eintritt des Todes zugefügt. Hatte er das Gift freiwillig genommen? Ganz bestimmt hatte er sich danach nicht den Kehlkopf durchtrennt und mit Säure überschüttet. Wollte jemand durch den Schnitt und die Säure falsche Spuren legen? Oder hatte der Täter bezweifelt, dass der Mann wirklich tot war und wollte sein Werk vollenden? Jedenfalls würden sie einige Zeit mit dem Fall zu tun haben.
Er nahm einen großen Schluck aus dem Bierglas, entfernte mit dem Handrücken den Schaum von der Oberlippe und lehnte sich zurück. Wäre schön, wenn man die Ermittlungsarbeit durch einen netten Flirt aufhellen könnte. Er blickte sich unauffällig in dem schummrigen Lokal um. An der Theke aus dunkelbraunem Holz unterhielten sich zwei viel zu junge Mädchen, sonst saßen nur Männer an den Tischen. Es war allseits bekannt, dass an der Technischen Universität in Clausthal ein großer Männerüberschuss herrschte, Studienfächer wie Bergbau, Hüttenwesen und Maschinenbau zogen nun mal eher männliche Bewerber an. Und die kamen sogar aus chinesischen, arabischen und afrikanischen Ländern, hoppla, wäre das eventuell auch eine Spur, Eifersucht, rassistisch motivierte Rache?
Als er sich gerade mit der Identität des Toten befassen wollte, betrat eine Frau das Lokal. Sie ließ den Regenschirm zuschnappen und sah sich suchend um. Mark blieb die Luft weg. Sie war ziemlich groß, trug knallenge schwarze Hosen und unter ihrem ebenso engen, vom Regen durchnässten T-Shirt zeichneten sich, schön füllig und groß, ihre Brüste ab, das pechschwarze Haar trug sie straff zurückgekämmt.
Die Frau fiel nicht nur ihm auf, das erkannte er an den Blicken anderer Männer, meistens Studenten, die sich plötzlich interessiert der Tür zugewandt hatten. Aber sein Vorteil war: er saß allein an dem einzigen noch freien Tisch - und auf den steuerte sie zu und fragte, ob da noch was frei wäre.
Nachdem sie sich gesetzt hatte, lud er sie zu einem Getränk ein und weil er sich dauernd verbieten musste, auf ihre Brüste zu starren, fiel er ihr vor lauter Nervosität ständig ins Wort, bis keiner mehr was zu sagen wagte.
Bemüht, im Gespräch zu bleiben, fragte er sie nach ihrem Namen – Ingrid – und nach Hobbies, Lieblingsmusik, nach Filmen und Büchern. Sie schwärmte von der Gruppe „Gotwind“, die er nur vom Hörensagen kannte und deren Kassetten er schon mal in der Asservatenkammer gesehen hatte. Ihm gefielen deutsche Liedermacher, die sagten ihr aber nicht viel.
Sie gab ihm ohne zu zögern ihre Telefonnummer und nachdem er sie notiert hatte, schwiegen sie eine Weile in beglücktem Einverständnis. Als er sie gerade fragen wollte, ob sie sich am folgenden Abend wiedertreffen könnten, hatte sie auf die Uhr gesehen und erschrocken ausgerufen, dass sie leider sofort weg müsse.
Sie hatte sich ein schwarzes Tuch über die Schultern geworfen, war aufgesprungen und zur Tür hinausgestürmt (übrigens ohne ihr zweites Bier bezahlt zu haben). Enttäuscht beobachtete Mark, wie sie schnellen Schrittes mit ihren langen Beinen in der Dunkelheit verschwand. Er tröstete sich damit, dass er ihre Nummer hatte.
Club der Himmelsleute
„Amanda, du wirst es schon nicht bereuen, und bisher hat man dich noch nie im Stich gelassen, oder?“
Ich streckte die Hände nach einem mit einer trüben Flüssigkeit gefüllten Glas aus und ließ mich in einen der smaragdgrünen Sessel fallen, einer Farbe, die so typisch war für das Interieur im Club der Himmelsleute. Ich versuchte mich zu entspannen und benutzte eine alte Atemtechnik, um diesen Zustand zu erreichen.
„Nun gut, was also soll ich tun? Natürlich geht es wie immer um die Not der Weltleute.
„Es geht um eine kleine Reise in die Zeit des Nationalsozialismus und um die Ausläufer des Bösen, die noch immer aus dieser untergegangenen Welt heraus wuchern und Menschen zu verschlingen drohen. Das spricht dich doch an, oder?“
Seine Art zu Lächeln trieb mir die Röte ins Gesicht. Warum musste ausgerechnet er mein Mentor sein?
„Alles spricht mich an, was dazu führt, den Weltleuten zu helfen, über ihren Tellerrand hinaus zu blicken! Wie werde ich handeln, bewusst, unbewusst, namenlos, anonym?“
„Du wirst von hier aus gelenkt. Deine Wahrnehmung bleibt einigermaßen `normal´, das heißt, du folgst unseren Instruktionen und interagierst, wie wir es für richtig halten, bist dir dessen aber nicht bewusst. Es mag vorkommen, dass du dich sehr weit von deinen Überzeugungen entfernen musst, um mit den Menschen mitzugehen. Sie würden dich sonst mit all deiner politischen Korrektheit und all der Liebe in deinem Herzen nicht in ihre düsteren Abgründe hineinlassen, das verstehst du doch, Amanda? Bist du einverstanden, willigst du ein?“
„Solange man mich nicht in einer Rettungskapsel aus irgendeiner engen Höhle bergen muss…“ Er sah mich nur verständnislos an, Humor war nicht seine Stärke.
„Ja, ist ja gut, ich willige ein, darf ich hinterher erfahren, worum es ging?“
„Das kann ich dir noch nicht sagen, es hängt vom Ausgang der ganzen Geschichte ab. Wie du weißt, gibt es Unwägbarkeiten, die auch wir nicht immer lückenlos kontrollieren können. Warte einfach ab, wir werden später entscheiden, was für dich am besten ist.“
Ich zog hinter seinem Rücken eine Grimasse und folgte W. nach draußen. Selten dauerte ein Aufenthalt im Club länger als einige Minuten.
3
Amanda
Ich heiße Amanda und wohne im Harz, genau genommen in Goslar. Dort befinden sich auch meine Praxisräume, in denen ich gerade sitze und aus dem Fenster schaue. Allerdings gibt es außer einer weiß getünchten Wand, die zum Haus gegenüber gehört, nicht viel zu sehen. Mir war wichtig, dass die Räume am Stadtrand liegen, dass meine Klienten immer einen Parkplatz finden und neugierige Nachbarn nicht allzu viel beobachten können.
Nachdem ich mich eine Weile als fest angestellte Psychotherapeutin in einer Reha-Klinik durchgeschlagen hatte, fand ich es verlockend, eine eigene Praxis zu haben. Es war aber noch kein Jahr vergangen, da sehnte ich mich nach dem monatlichen Festgehalt auf meinem Konto zurück, inklusive Kranken- und Rentenversicherung. Frei zu praktizieren ist ganz schön, die Verantwortung für die Patienten allein zu tragen und den gesamten Papierkram nebenbei erledigen zu müssen, ist eine andere Sache.
Meine Tochter Johanna hatte die Entscheidung sehr begrüßt, es war ihr lieber, wenn ihre alles und jeden analysierende Mutter freiberuflich unterwegs war, dann konnte man sie hin und wieder als Au-pair-Oma nach Frankreich holen. Johanna oder Jeanne, wie sie jetzt genannt wurde, lebte in Frankreich, genaugenommen in der Normandie, und trotz der Entfernung tauschten wir uns regelmäßig telefonisch aus. Unsere Beziehung ist ziemlich harmonisch, lustig, stressfrei und mein Kind zeigt - oh Wunder! - trotz ihrer manchmal leicht verrückten Mutter keinerlei Verhaltensauffälligkeiten.
Sie Johanna zu nennen, obwohl der Name keineswegs im Trend lag, war übrigens nicht meine Idee gewesen. Meine katholische Mutter hatte meine jugendliche Wehrlosigkeit ausgenutzt, um ihre hochverehrte Heldin Jeanne d´Arc in unsere Familie zu implantieren. Schon als ich geboren wurde, hatte sie sich mit dem Namen Amanda durchgesetzt und damit meinem amerikanischen Vater gehuldigt. Amanda heißt in den USA jedes fünfte Mädchen, in Deutschland war ich immer die einzige und erntete bei sämtlichen Vorstellungsrunden erstauntes Gekicher. Klothilde hätte schlimmer nicht sein können... Meinem Vater nach Amerika zu folgen, war aber für meine Mutter nicht in Frage gekommen, außerdem hatte sie ihn sowieso bald vergessen, nur durch mich wurde sie regelmäßig an ihn erinnert.
Früh schwanger zu werden und das Kind allein großzuziehen scheint bei uns inzwischen schon in der dritten Generation ein unausweichliches Schicksal zu sein. So war es bei Mutter und mir und auch Johanna teilte uns kurz nach ihrem siebzehnten Geburtstag mit, dass ihre Periode ausgeblieben war. Ich hätte ihr nicht erlauben sollen, den Schüleraustausch mitzumachen!
Die Goslarer Gymnasiasten verbringen einmal im Jahr ihre Ferien in französischen oder englischen Partnerstädten und werden von den französischen Schülern erwidert, die freundschaftlichen Kontakte gehen oft über die kurze Ferienzeit hinaus, manche halten lebenslang.
Johanna wollte natürlich unbedingt nach Frankreich fahren, sie war sechzehn, als sie sich in Dominique verliebte, einen jungen Deutschlehrer aus Arcachon, der gerade mit seinen Schülern in Goslar weilte. Sie ging mit ihm aus und mit ihm ins Bett, wurde schwanger und wollte ihn heiraten. Es gab an den Schule hier und dort einigen Ärger, aber es gab auch ein Happyend. Sie bekamen das Kind, ich verlor meine Tochter an das Nachbarland.
Wie lange hatte ich sie nicht gesehen?
Ich rechnete nach. Seit drei Jahren lebte sie in Frankreich, zwei davon in Paris, und ja, genau, den letzten Besuch hatte ich ihr abgestattet, als sie mich beim Umzug nach Rouen um Hilfe gebeten hatte. Ich kann mich noch gut an die vierzehn turbulenten Tage zwischen tapezierenden, hämmernden und Wände streichenden jungen Helfern erinnern, die mit Brot und Wein bei Laune gehalten wurden und die nie Anzeichen von Ermüdung zeigten, während ich beinahe im Stehen einschlief.
Meine Anwesenheit diente einzig der Aufgabe, mein damals zweijähriges Enkelkind, das überall im Weg war, von den verlockenden Farbeimern, Tapetenrollen und Leimtöpfen fernzuhalten, damit das gut organisierte Handwerker-Team nicht gestört wurde.
Jeanne sprang eifrig zwischen ihnen herum, gab Anweisungen, stellte Regale auf, füllte die fertigen Zimmer mit Mobiliar und ich verbrachte die Tage mit ausufernden Spaziergängen zu allen Spielplätzen entlang der Seine.
René, mein zierliches, schwarzhaariges Enkelkind, platzte vor Energie und ich musste immer wieder hinter ihm her rennen, um ihn am Flussufer einzufangen. Da er eigentlich nie sitzen wollte, sprang ich mit einer ausgestreckten Hand griffbereit herum und schob mit der anderen Hand die „Poussette“, die praktische, faltbare Kinderkarre. Abends, so spät wie möglich, kehrte ich erschöpft in die Wohnung zurück. Nachdem ich wieder in Deutschland war, lag ich zwei Wochen mit Grippe im Bett und schwor mir, mich nie wieder als Oma missbrauchen zu lassen.
Überraschenderweise hatte ich heute eine Einladung von Jeanne in meinem Briefkasten gefunden. Meine erster Gedanke war: brauchte sie mich, waren sie schon wieder umgezogen, musste renoviert werden? Dann rief sie mich an. Sie erkundigte sich oberflächlich nach meinem Befinden und lud mich in die Normandie ein, dann sprudelte sie los.
„Mama, stell dir vor, Henry hat uns das Haus in Étretat überschrieben! Du kennst es ja, ist das nicht fantastisch??!! Das ganze Grundstück ist inzwischen ein Vermögen wert, aber natürlich würden wir es niemals hergeben, aber es gehört jetzt uns, ist das nicht süß von Henry? Dominique ist auch ganz begeistert! Komm doch einfach ein paar Tage her und vergiss für eine Weile den ganzen Scheiß mit deiner Arbeit!“
Henry ist Dominiques Vater, also der Schwiegervater meiner Tochter, und ein Arbeitstier. Mit Fleiß und Glück hat er es zu einigem Vermögen gebracht. Aber mit Henry wollte ich so wenig wie möglich zusammentreffen. Beiläufig fragte ich:
„Kommen Marthe und Henry denn auch?“
„Ja, natürlich, es ist doch sein fünfzigster Geburtstag, aber spielt das eine Rolle für dich? Ich weiß, es ist etwas eng und manchmal stressig, aber wir haben das doch letztes Mal auch ganz gut hingekriegt, oder?“
Als ich schwieg, fügte sie bemüht unbefangen hinzu: „Das ist vielleicht in den nächsten Jahren die letzte Gelegenheit, mit Henry und Marthe zu feiern. Marthe ist mit ihrem Lungenemphysem sehr eingeschränkt und Henry hat ständig etwas mit dem Magen, sie ziehen die komfortable Wohnung in Paris dem Landleben vor.“
Als hätte Johanna geahnt, wie sehr ich mich nach Abwechslung sehnte! Tatsächlich war es verlockend, durch eine kleine Reise vom Grübeln abgelenkt zu werden.
Nachdenklich lehnte ich mich in meinem Bürostuhl zurück. Étretat ist ein ehemaliges Fischerdorf, in dem sich ein großer Teil der Pariser Stadtbevölkerung in teure Immobilien eingekauft hatte. Die verlockende Schönheit der schroff aus dem Meer ragenden Felsen der Atlantikküste, das harmonisch-wilde Wechselspiel von Ebbe und Flut und die höchst reizvollen, alabasterfarbenen Klippen, die einen wunderbaren Kontrast zu dem grünen Weideland bilden, würden genau das richtige sein.
Ohne Zögern hätte ich ja gesagt, wenn da nicht die Geschichte mit Henry gewesen wäre. Trotz meiner Bedenken beschloss ich, die Einladung erst einmal anzunehmen.
Wenn ich Zeit habe, bin ich gern in Clausthal-Zellerfeld. Dort gibt es ein sehr interessantes Bergbaumuseum und außerdem stöbere ich im Archiv des Oberbergamtes und benutze die Universitätsbibliothek, um mir Fachbücher zur Kulturgeschichte des Harzes auszuleihen. Die Historie des Harzes ist nämlich mein Hobby und wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich mich für das Fach Geschichte entscheiden.
Aber als ich 1978 mit Johanna schwanger war, faszinierte mich die Psychoanalyse und ich stellte mir vor, eines Tages eine berühmte Psychotherapeutin zu werden. Dazu benötigte ich ein Fundament und da mein Notendurchschnitt recht gut war, bewarb ich mich in Göttingen für das Fach Psychologie und wurde angenommen.
Es war nicht leicht gewesen, mit einem kleinen Kind das Abitur zu schaffen und ohne die Hilfe meiner Mutter wäre es mir auch nicht geglückt. Meine Tochter ist mehr bei ihrer Großmutter als bei mir aufgewachsen, beiden Frauen gegenüber habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihnen so viel zugemutet habe. Keine von beiden hat mir jemals einen Vorwurf gemacht.
Ich saß im Auto und war auf dem Weg von Clausthal-Zellerfeld nach Goslar, es war schon dunkel und ich freute mich schon auf das Lesen von ein paar interessanten Büchern, die sich auf dem Rücksitz meines Wagens stapelten.
Die Straße nach Goslar führt am Gasthaus `Auerhahn´ und im Bärental durch zwei sehr enge Kurven. Schon als ich am `Auerhahn´ vorbeikam, spürte ich diesen seltsamen Sog, der mich aus der Realität in eine andere Dimension hinüberziehen wollte. Vor der Einmündung zum Kalten Tal, wo ein besonders düsteres Waldstück beginnt, verstärkte sich der Sog, etwas schien auf mich zu warten und mich hineinziehen zu wollen in eine dieser Visionen, die mir zwar nicht fremd sind, aber dennoch ein gewisses Unbehagen auslösen.
Die Fichten rechts und links der Straße zeichneten sich pechschwarz gezackt gegen den Himmel ab, als ich den Bärental-Parkplatz befuhr, auf dem man sich bei Dunkelheit sehr verloren vorkommt.
Ich rutschte tiefer in den Autositz und blockierte vorsichtshalber die Türschlösser. Es ist jedoch nicht die Angst, die mir am meisten zu schaffen macht, sondern die Ungewissheit. Mein Verstand schaltet sich ab, Urinstinkte erwachen und aktivieren meine Fluchtbereitschaft, denn ich weiß ja nie, was passieren wird. Es ist ziemlich unangenehm, auf einem leeren Parkplatz mitten im Wald im Dunkeln zu sitzen und aus dem Fenster zu starren.
Auf einmal kann ich etwas sehen, eine dunkle, schmale Gestalt im langen Gewand, eine Frau? Sie wird vom Standlicht des Autos beleuchtet und kommt näher, bedeutet mir mit einer Drehbewegung der Hand, das Licht auszuschalten. Ich mache es und sehe gar nichts mehr. Zwei Sekunden später steht sie neben dem Auto. Ich sehe in ein freundliches Gesicht dicht an der Scheibe, sie lächelt mich an und haucht gegen das Glas und malt mit einem Finger eine Spirale. Dann dreht sie sich um und verschwindet im Wald. Im selben Moment ist der Zauber vorbei, ich fühle es, ich kann nachhause fahren. Aber sie wird irgendwann wiederkommen.
Ein paar Tage später passierte es erneut. Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und saß abends ganz allein vor dem Fernseher. Ich überlegte, was mich diesmal erwarten würde und welch trauriges Schicksal sich die Mentoren vom Club der Himmelsleute ausgesucht hatten, in das ich eingreifen sollte.
Vielleicht verwundert es, dass ich so unbekümmert mit diesen Zeitsprüngen umgehe, es gelingt mir nur, weil ich glücklicherweise immer ohne Probleme in die Normalität zurückkehren kann.
Ich glaube fest an die Normalität, jeden Morgen geht die Sonne auf, Ecken sind eckig, Kreise sind rund, Entfernungen und Gewichte bleiben gleich und es wird nicht plötzlich um zwölf Uhr mittags dunkel und wir befinden uns nach dem Aufwachen nicht an einem anderen Ort als vor dem Einschlafen. Ja, ich liebe die Normalität, die angenehme, regelmäßige Wiederkehr des Vertrauten. Nur darum finde ich mich in den fremdartigen Zeitsprüngen zurecht, die ja auch nur einen kleinen Teil meines Lebens ausmachen.
Nachdem ich noch eine Weile gegrübelt hatte, begab ich mich ins Badezimmer, um mich für die Reise in die Nacht herzurichten, denn Schlafen ist ja auch ein Ausflug in unbekanntes Terrain. Als ich dann im Bett lag, dauerte es nicht lange und ich war eingeschlafen.
Ich bin wach und doch nicht wach. Draußen ist es dunkel, die Uhr zeigt vier Uhr dreißig. Etwas drängt mich, aufzustehen und mich anzuziehen. Ich streife Jeans und T-Shirt gleich über mein Nachthemd, ziehe den Mantel an, dann die Schuhe, alles ohne Licht. Ich stecke den Schlüssel ein, verlasse die Wohnung und steige leise die Treppe hinab. Schließe die Haustür ohne einen Laut.
Die aus Sparsamkeitsgründen eingeführte Nachtabschaltung bewirkt, dass es draußen stockfinster ist. Außer mir ist kein Mensch unterwegs. Angst habe ich nicht, eine tief in mir sitzende Unruhe löscht alle anderen Empfindungen aus, sie ist stark genug, die Sorge um mein kleines, unwichtiges Leben zu überdecken.
Ohne den Weg zu kennen, bewege ich mich langsam vorwärts, habe bald Häuser und Straßen hinter mir gelassen und den Waldrand erreicht. Wo bin ich jetzt? Ich höre ein Käuzchen und andere Geräusche der Nacht, die man nur hört, wenn man von Wäldern umgeben ist. Ein paar Meter entfernt steht reglos eine Gestalt, in der Finsternis kaum zu erkennen.
Wieder dieselbe Frau, die sich in Bewegung setzt, sobald sie mich sieht und geradewegs auf mich zukommt. Viel mehr als die Augen sind von ihrem Gesicht nicht zu erkennen und als sie die meinen treffen, dreht sie sich abrupt weg und bedeutet mir mit einer Armbewegung, ihr zu folgen.
Ohne Angst folge ich ihr auf einem schmalen Pfad, der tiefer hinein führt ins Dunkel des Waldes, wir gehen hintereinander zwischen hohen, kahlen Fichtenstämmen hindurch, bis die kalkweißen Wände eines Gebäudes zwischen den Baumstämmen zu sehen sind. Sie bleibt stehen, hebt mahnend eine Hand und ein erneutes Winken zieht mich fort, wir verlassen den Wald.
Der Eingang des verfallen wirkenden Gebäudes liegt feindselig verschlossen vor uns, die mit einem Scherengitter gesicherte Glastür wirkt unüberwindlich. Die Frau ergreift meine Hand, ihre Handflächen sind trocken und warm und halten einen Schlüssel. Sie bedeutet mir nickend, das Gitter aufzuschließen und berührt anschließend mit den Fingern ein beleuchtetes Tastenfeld dahinter, sofort schiebt sich das Glas einer Eingangstür geräuschlos zu Seite.
Wir treten ein, der ausladende Empfangsbereich wird nur von einem Notlicht erhellt und wirkt verlassen. Trotz des spärlichen Lichtes kann ich das Gesicht der Frau nicht sehen, ich erkenne nur ein dunkles Augenpaar. Wir stehen vor einem Fahrstuhl.
Mit großer Selbstverständlichkeit betätigt sie einen Knopf und als die Türen sich öffnen, gibt sie mir mit einem Blick zu verstehen, dass ich eintreten soll. Sie selbst bleibt draußen, der Fahrstuhl bewegt sich mit einem Seufzen nach unten. Die Zahlen zeigen an, dass ich zwei Stockwerke in die Tiefe gefahren bin, und ich erkenne einen nur schwach beleuchteten Gang.