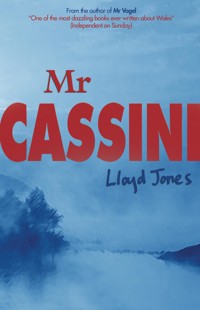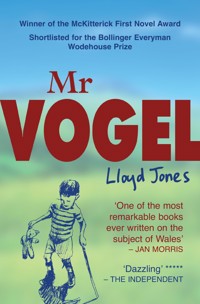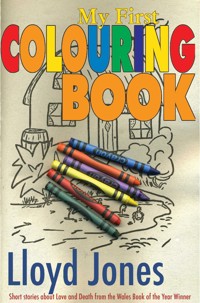9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ergreifende Geschichte über eine Frau auf der Suche nach ihrem Kind und ihrer Identität. Dies ist die Geschichte von Ines, einer jungen Afrikanerin, die eine beschwerliche Reise durch die Festung Europa unternimmt. Ihr Ziel ist Berlin, doch niemand kennt ihren wahren Namen, ihre Herkunft oder ihre Vergangenheit. Auf ihrem Weg begegnet sie Menschen, die sie für eine Hure halten, die sie übers Meer schmuggeln und die sie beraubt. Sie stiehlt die Identität einer anderen Frau und spinnt sich in die Lebenslügen derjenigen ein, denen sie begegnet. Nach und nach entfaltet sich Ines' Geschichte wie in einem Kriminalroman. Wir erfahren von dem Straßenkünstler, der sich in sie verliebt, dem blinden Mann, dem sie den Haushalt führt, und schließlich dem Kommissar, der erkennt, dass die Wahrheit viele Gesichter hat. Die Frau im blauen Mantel ist eine eindringliche Erzählung über Hilfsbereitschaft, Täuschung und die Suche nach der eigenen Identität in einer Welt voller Hindernisse und Vorurteile.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Lloyd Jones
Die Frau im blauen Mantel
Roman
Aus dem Englischen von Grete Osterwald
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Für Anne
Erster TeilWas sie sagten
Eins
Die Hotelangestellte
Ich war mit ihr im ersten Hotel am Arabischen Meer. Das waren zwei Jahre. Dann drei Jahre in dem Hotel in Tunesien. Im ersten Hotel schliefen wir im selben Zimmer. Ich wusste ihren Namen, aber mehr nicht. Ich wusste nicht, wann sie Geburtstag hatte. Ich wusste nicht, wie alt sie war. Ich wusste nicht, woher in Afrika sie kam. Wenn wir von zu Hause sprachen, sprachen wir von irgendwo in der Vergangenheit. Vielleicht kommen wir aus verschiedenen Ländern, aber die Welt, in die wir hineingeboren wurden, bestand aus demselben Müll und blendenden Licht. Dieselben Fallen warteten auf uns. Später fand ich zu Gott, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn ich Ihnen erzähle, wie es für mich begann, wissen Sie es auch von ihr. Ich erinnere mich an den Moment, als ich geboren wurde. Wenn ich das sage, schauen die meisten Leute weg oder lächeln in sich hinein. Ich weiß, sie mögen es nicht glauben. Darum sag ich es nicht so oft oder so laut. Aber jetzt will ich es erzählen, weil es Ihnen vielleicht hilft, sie besser zu verstehen. Ich kann Ihnen Folgendes erzählen. Ganz am Anfang war die Luft kalt, aber bald verschwand das alles. Die Luft brach auf und huschte weg. Schwarze Gesichter mit rot unterlaufenen Augen fielen aus großer Höhe herab. Mein erster Geschmack von der Welt war jemandes Finger, der in meinem Mund steckte. Das erste Gefühl ein Dehnen meiner Lippen. Ich wurde für die Welt zurechtgemacht, verstehen Sie? Meine erste Wahrnehmung von anderen ist, hochgehoben und wie ein Stoffballen auf Risse oder Flecken untersucht zu werden. Irgendwann, mit der Zeit, war ich in der Lage, zurückzublicken auf diese Welt, in die ich hineingeboren wurde. Es zeigte sich, dass es am Fuß eines Müllbergs war. Ewig klettere ich immer nur durch und über all den Schrott, erst, um in die Schule zu gehen, und später zum Schönheitswettbewerb am Depot, vorsichtig, um mich nicht dreckig zu machen. Ich gewinne diesen Wettbewerb, dann den des Bezirks und den regionalen. Der letzte brachte mir einen Platz in der Personalschulung des Four Seasons Hotels am Arabischen Meer ein. Dort war es, dass ich sie kennenlernte.
Im Four Seasons entdecke ich statt Müll eine klimatisierte Empfangshalle. Es gibt Palmen. Diese Bäume sind anders, als ich es kenne. Die Palmen, meine ich. Sie sehen weniger wie Bäume aus, eher wie Sachen, die einer aufgestellt hat, um das Auge zu erfreuen. Sogar das Meer mit seiner ganzen blauen Leichtigkeit scheint nur für die Augenfreude da zu sein. Es macht Spaß, darin zu spielen. Das wird klar, wenn man die europäischen Gäste und jene Schwarzen sieht, die es sich leisten können.
Wir teilten ein Zimmer. Wir schliefen zwei Meter voneinander entfernt. Sie wurde mir wie eine Schwester, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie sie mit zweitem Vornamen oder mit Nachnamen oder wie ihr Geburtsort hieß. Der Name ihres Vaters war Justice. Der ihrer Mutter Mary. Sonst kann ich Ihnen nichts darüber sagen, woher sie kam. Im Four Seasons spielte das keine Rolle. Zu zeigen, dass du irgendwoher kamst, war nicht gut. Man muss seine Vergangenheit loslassen, um Hotelpersonal zu werden. Gutes Personal muss das Auge erfreuen, wie die Palmen und das Meer. Wir sollten keinen Raum einnehmen, einfach nur da sein, wenn ein Gast uns brauchte. Im Four Seasons lernten wir, wie man das Waschbecken schrubbt, das erste Blatt Klopapier zu einer Rosette formt und einen Papierstreifen zur Bescheinigung anerkannter Hygienestandards über den Toilettendeckel spannt. Wir lernten, wie man die Ecke der Bettdecke aufschlägt und einen Gast, der zu viel getrunken hat oder fast ertrunken wäre, wiederbelebt. Wir lernten, wie man einen Gast aufrecht hinsetzt und ihm mit Gottes Hilfe den Rücken klopft, wenn ihm ein Krümel oder eine Erdnuss in die falsche Kehle gekommen ist.
Was sonst? Ich kann Ihnen von dem neuen Appetit erzählen, der sie wie eine Geisteskrankheit überkam. Sie vergaß, dass sie Personal war. Ja. Manchmal dachte ich, sie ist unter einem Zauberbann. Da steht sie, Personal und in Uniform, an dem für Gäste reservierten Strand, unter den Palmen, nimmt den kostbaren Schatten ein und schaut zu, wie ein großer weißer Mann ins Meer geht. Schaut zu, wie das Meer an seinem Körper immer höher steigt, bis er verschwindet. Der Riss im Ozean wird überspült. Sie wartet. Wartet noch etwas länger. Sie fragt sich, ob sie den Chefpagen rufen soll. Dabei hält sie die ganze Zeit die Luft an. So etwas hat sie noch nie erlebt, bis der Vermisste wieder auftaucht – irgendwo an einer anderen Stelle. Er bricht aus einem anderen Riss in der Welt hervor, und das alles aus eigener Kraft. Dies, sagte sie mir, war der Moment, in dem sie beschloss, dass sie schwimmen lernen wollte. Ja. Da kam ihr die Idee zum ersten Mal.
Nach achtzehn Monaten – ich merke gerade, ich habe zwei Jahre gesagt. Das ist falsch. Ich erinnere mich jetzt. Es waren achtzehn Monate, danach wurden wir in ein größeres Hotel gebracht. Nach Tunesien. Der Riss in der Welt wurde einfach noch breiter. Das Hotel lag wieder am Meer. Zum ersten Mal in unserem Leben war es möglich, nach Europa zu schauen. Nicht dass dort irgendwas zu sehen war. Darum ging es nicht. Nein. Du findest deinen Weg auch zu einem Ort, den du nicht sehen kannst.
Zum ersten Mal hatten wir Geld. Ein Gehalt, und dazu noch Trinkgeld. Mehr, als eine von uns je verdient hatte. An unserem freien Tag gingen wir immer auf den Markt. Einmal kaufte sie einen rot-grünen Papagei. Er stammte von einem italienischen Ingenieur, der in der Müllgasse hinter der Prostituiertenbar tot aufgefunden worden war. Der Ingenieur hatte ihm beigebracht, am laufenden Band Benvenuto in Italia zu sagen. Dank einem Papagei ist das mein ganzes Italienisch. Benvenuto in Italia. Benvenuto in Italia. Wir hatten jetzt unsere eigenen Zimmer, aber ich hörte den Papagei durch die Wand. Benvenuto in Italia. Immerfort, die ganze Nacht hindurch. Es war unmöglich zu schlafen. Ein anderes Mädchen sagte, sie solle ein Tuch über den Käfig werfen. Sie tat es, und es funktionierte. Der Papagei war still. Morgens, nachdem sie geduscht, sich angezogen, die Zähne geputzt und ihr Bett gemacht hat, nachdem sie mit allem fertig ist, lüftet sie das Tuch: Der Papagei reißt ein Auge auf, dann das andere, dann seinen Schnabel – Benvenuto in Italia.
Am nächsten freien Tag ging ich mit ihr auf den Markt. Wir wechselten uns ab, den Papagei zu tragen, und brachten ihn dorthin zurück, wo sie ihn gekauft hatte. Der Mann tat so, als hätte er den Papagei noch nie gesehen, und breitete seine Waren weiter auf einem Holzgestell aus. Sie versuchte, den Papagei einem kleinen Jungen zu geben. Er bekam große Augen. Ich dachte, sein Kopf würde explodieren. Er rannte weg. Der Papagei blickte durch die Gitterstäbe, ausnahmsweise einmal still, so jämmerlich, dass ich schon fürchtete, sie würde ihm verzeihen. Aber nein. Im Teehaus flirtete der Inhaber mit ihr, aber als sie ihm den Papagei schenken wollte, wich er, beide Hände in der Luft, zurück. Auf der Straße blieb ein Mann stehen und steckte seinen Finger in den Käfig. Er alberte mit dem Papagei herum. Aber dann war es das Gleiche. Alle freuten sich, ihn anzuschauen, zu bewundern, aber niemand wollte die Verantwortung. Allmählich glaubte sie, dieser Papagei würde für immer an ihr hängenbleiben.
Ich nahm ihr den Käfig ab, und wir stiegen in einen Bus. Die Passagiere warteten darauf, dass der Fahrer mit seinen Zigaretten wiederkam. Ich schwenkte den Käfig den Gang entlang über den Köpfen der Fahrgäste. Manche sanken ans Fenster, verschränkten die Arme und schlossen die Augen. Einer nach dem anderen schüttelte den Kopf. Wieder auf dem Markt, redeten Leute mit dem Papagei, hielten ihm einen Finger zum Knabbern durchs Gitter, krächzten zurück. Der Papagei legte den Kopf auf die Seite und schielte sie seltsam an, worüber alle lachten. Aber niemand wollte einen Papagei besitzen. Sie fragte mich, ob ich glaube, mit ihr stimme etwas nicht. Wie konnte es sein, dass sie als Einzige auf die Idee gekommen war, einen Papagei haben zu wollen?
Wir kehrten ins Hotel zurück. Es war noch nicht ganz dunkel. Vom Pool her hörten wir es planschen. Ein paar Kinder. An den Bars draußen saßen Gäste. Sie nahm mir den Papagei ab und lief auf das menschenleere Ende des Strandes zu. Ich folgte ihr, weil ich nun schon so weit gegangen und ihr die ganze Zeit gefolgt war und im Moment auch gar nicht wusste, was ich sonst mit mir anfangen sollte. Unten im Sand schleuderte sie ihre Sandalen von den Füßen. Sie stellte den Käfig ab und zog eins der Ruderboote ins Wasser. Hätte sie mich um Rat gefragt, hätte ich ihr gesagt, dass sie so etwas nicht tun darf. Jetzt bereue ich, nichts gesagt zu haben. Ich war müde. Ich hatte genug von dem Problem. Ich wünschte nur noch, die Sache wäre erledigt. Als sie das Ruderboot hinausschob, blickte der Papagei sie augenrollend an, als hätte er ihren Entschluss wohl verstanden, sich aber entschieden, seine Würde über die Angst zu stellen.
In der Nacht frischte der Wind auf. Ich blieb im Bett. Trotzdem kann ich sagen, was geschah, weil sie es mir erzählt hat. Auch sie wurde von den klatschenden Wellen am Strand geweckt, döste aber wieder ein, ohne einen Gedanken an den Papagei. Beim zweiten Wachwerden war es noch früh. Kein Mensch war auf, als sie über das Hotelgelände ging. Sie fand das Ruderboot oben auf den Strand gezogen. Der Käfig war verschwunden. Etwas höher noch fand sie den klammen Körper des Papageis auf einer Schicht glimmender Palmblätter. Der Strandwart harkte den Sand. Als sie ihn nach dem Käfig fragte, schaute er weg. Sie dachte, sie würde eine Lüge hören. Stattdessen sagt er, sie soll mitkommen. Sie gehen zum Schuppen. Er schlägt den Perlenvorhang zurück. Auf der Ablage sieht sie die dünnen Gitterstäbe. Den Käfig selbst gab es nicht mehr. Die Stäbe sind abgeschnitten worden. Sie nimmt einen – hält ihn an seinem hölzernen Griff, drückt das angespitzte Ende in den fleischigen Teil ihrer Hand. Also ja, sie nahm das Stechmesser als Gegenleistung für den Käfig. Das ist die Geschichte mit dem Messer.
Einmal sagte sie mir, sobald du weißt, dass du klug bist, wirst du von alleine immer klüger. Mir ist das noch nicht passiert. Was nicht heißt, dass es nicht passieren wird. Wenn in der Bibel von Ewigkeit die Rede ist, sehe ich eine lange Reihe Überraschungen. Es ist nicht gesagt, dass ich genau diese Überraschung nicht eines Tages doch erleben werde. Ich sage nur, ich warte noch. Aber sie kam zuerst dran, als sie zur Leiterin des Zimmerpersonals befördert wurde. Jetzt durfte sie den Neuen sagen, sie dufteten wie frische Frühlingsblumen. Sie hätten sie sehen sollen! Wie sie sich plötzlich durchs Hotel bewegt! Sie wechselt die Obstschale an der Rezeption, ohne abzuwarten, dass man sie darum bittet. Sie ruft den dickleibigen Weißen, die durch die Empfangshalle zum Pool watscheln, Have a good day! hinterher, wie sie es gelernt hat. Wenn ein Gast sich für ein vom Boden aufgehobenes Handtuch bedankt, lächelt sie und sagt You’re welcome, und wenn man ihr sagt, sie klinge ganz wie eine Amerikanerin, lächelt sie aus Respekt. Die Touristen lösen einander ab. Die ganze Welt muss aus Touristen bestehen. Wie kommt es, dass ich nicht als Touristin geboren bin? Nach fünf Jahren im Hotel könnte ich eine sein, weil ich weiß, was Spaß machen würde und über was man sich zu beschweren hat.
Weiße sehen nie weißer aus, als wenn sie in der Mittagssonne ins Meer waten. Die Frauen waten und setzen sich dann hin wie in der Badewanne. Die Männer tauchen unter, und dann schwimmen sie wie wild. Die Frauen nehmen ihre Handtücher vom Sand auf, während ihre Männer sich noch weiter aufs Meer hinauskämpfen. Dann halten die Männer an, als wären sie, wo immer sie hinwollten, unerwartet angekommen. Also halten sie und bleiben mit dem Gesicht zum Himmel liegen. Wenn eine Welle unter ihnen durchzieht, schwappen sie hoch wie Essensreste, dann bringt die Welle sie wieder runter. Ich habe mich immer gefragt, ob diese Wellen vom Hotel angestellt waren. Ich fragte mich, ob sie nicht auch, zusammen mit den Palmen, einen Hotelfachkurs gemacht hatten. «Schau, wie sanft das Meer sie runterbringt», sagte sie. Schau – und ich schaute. «Siehst du», sagte sie. «Es gibt nichts zu befürchten.»
Einer der schwimmenden Männer hieß Jermayne. Er ertappte sie, als sie den Weißen beim Spielen im Meer zusah. Nicht diesmal, sondern ein andermal. Ich war nicht dabei. Aber sie hat es mir erzählt. Ich hatte ihn noch nicht mit eigenen Augen gesehen, darum hat sie mir von Jermayne erzählt. Er war ein Schwarzer. Ja, er hatte die gleiche Haut wie sie und ich, aber er war nicht in dieser Haut aufgewachsen. Das konnte man leicht sehen. Er hatte so eine Art.
Ich erinnere mich, dass ich sie früher einmal gefragt hatte – damals, in dem anderen Hotel am Arabischen Meer. Wir lagen auf unseren Betten und grübelten über Sachen für unsere Wunschlisten, als ich sagte: «Was ist mit der Liebe?» Jeder Mensch braucht Liebe. Das steht auch in der Bibel, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich sagte: «Möchtest du nicht einem Mann beiwohnen?» Sie prustete vor Lachen. Jetzt, unter den Hotelpalmen, fragte ich sie wieder. Diesmal wandte sie den Blick von mir ab. Sie konzentrierte sich – als gäbe es so viele Möglichkeiten, die Frage zu beantworten, dass sie sich nicht entscheiden konnte.
Aber ich merke, für diesen Mann interessiert sie sich. Wenn ich sie mit ihm zusammen sehe, lasse ich alles stehen und liegen und beobachte sie. Sie fängt an, mit ihrem Haar zu spielen. Jetzt setzt sie ein Lächeln auf, das ich noch nie an ihr gesehen habe. Wenn ich ihr später beschrieb, was ich gesehen hatte, sagte sie, mein Wunschdenken habe mich blind gemacht. Sie sagte, Jermayne habe angeboten, ihr das Schwimmen beizubringen. «Oh, wie gut», sagte ich. «Dann musst du wohl ertrinken.» Sehen Sie, wie negativ ich klinge. Ich weiß nicht, warum das so ist. Warum hatte ich beschlossen, dass ich Jermayne nicht mochte? Vielleicht habe ich, statt klug zu werden, eine andere Art Wissen entwickelt.
Vielleicht lag es an seinem Selbstvertrauen. Vielleicht an seinem ungelebten Schwarzsein. Vielleicht mochte ich ihn einfach nicht. Muss es einen Grund geben? Dann – ich sage das jetzt, aber heben Sie es sich für den richtigen Moment auf. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Nein. Was soll das heißen, ich «dachte»? Es war so. Ich sah ihn mit einer Frau. Sie gingen eilig durch die Empfangshalle. Aber danach sah ich die Frau nicht wieder. Ich entschied, sie müsse irgendein Gast gewesen und zufällig mit ihm in den Aufzug gestiegen sein, denn am nächsten Tag saß Jermayne allein im Frühstücksraum.
Wenn ich sie zusammen sah, meine Freundin und ihn, waren da zwei Jermaynes. Einer war bei ihr – der, den sie sehen konnte. Aber zugleich war da ein anderer Jermayne. Der stand direkt daneben, schaute zu und lächelte in sich hinein, als wüsste er schon vor ihr, was sie dachte. Er sah ihr Widerstreben, in den Pool zu gehen, wenn Gäste im Wasser waren. Er las sie wie ein offenes Buch. Er musste sie drängen – sie wehrte lachend ab, behauptete, sie wolle lieber nicht nass werden. Das Gleiche an der Pool-Bar. Vor Jermayne hatte sie nie mit einem Hotelgast etwas getrunken. Nie und nimmer – nein, nein, nein. Und der Barmann wusste es, die Sterne wussten es, die Nacht wusste es, die Palmen standen fassungslos im Hintergrund, und die an den Beckenrand spritzenden Tröpfchen riefen jedem die Stille und die Vorschriften in Erinnerung. Sie sagte, Jermayne gebe ihr ein gutes Gefühl dabei. Das Gefühl wurde immer besser. Sie war keine Trinkerin. Er musste erklären, was ein Outrigger ist – das Boot und das Getränk –, und nach diesem Cocktail, sagte sie, schweiften ihre Gedanken ab zu dem Papagei und der Nacht draußen auf dem Ruderboot und kehrten erst zurück, als Jermayne anfing, von sich zu erzählen, wie er groß geworden war. Ein amerikanischer Vater, eine deutsche Mutter. Er war in Hamburg aufgewachsen, aber jetzt lebte er in Berlin. Er hatte sein eigenes Geschäft, irgendwas mit Computern.
Als sie vom Hocker kletterte, nahm er ihre Hand, dann beugte er sich über sie und hauchte ihr einen Kuss hinters Ohr. Eine Gruppe von Touristen am anderen Ende der Bar kreischte vor Lachen. Sie blickte sich um, ob jemand es gesehen hätte. Nein, niemand – nur Jermayne, ja, er hatte ihren Blick gesehen, die Furcht vor Ärger, vor Schande in ihren Augen. Er lächelte. Er sagte ihr, sie solle sich entspannen. Sie sei in Sicherheit. Er würde sie nicht verletzen oder etwas tun, was ihr Ärger bringen könnte. So einer bin ich nicht – das hat er ihr gesagt. Er sagte: Jetzt hör zu – und sie tat es.
Am nächsten Tag – es war nach ihrer Schicht – sah ich die beiden zum künstlichen Riff hinausrudern. Ich sah sie das Boot an den Strand ziehen und auf die Meeresseite gehen. Das war ihre erste Schwimmstunde. Ich habe nichts davon gesehen. Dies ist nur, was sie mir erzählt hat, aber erst viel später, Monate nach den Ereignissen, auf die ich hinauswill.
Ihre erste Schwimmstunde beginnt damit, dass Jermayne bis zu den Hüften ins Meer watet. Er schaut sich nach ihr um. Sie hat sich nicht vom Sand bewegt. Er sagt ihr, es gibt nichts zu befürchten. Wenn er einen Hai sieht, packt er das Biest am Schwanz und hält es fest, bis sie ans Ufer zurückgerannt ist. Sie fürchtet sich, aber sie geht ins Wasser. Die ganze Zeit wendet sie die Augen nicht von ihm ab. Sie hat das Gefühl, wenn sie es täte, fiele sie in einen Abgrund. So begeben sie sich langsam tiefer ins Meer. Sie begibt sich auch tiefer in sein Vertrauen – das stimmt auch. Der Rest ist einfach. Sie tat, was er ihr sagte. Sie legte sich aufs Wasser. Sie verwandelte sich in ein schwimmendes Palmblatt. Sie fühlte seine breite Hand unter ihrem Bauch. Dann begann sie von selbst zu schwimmen. Hin und wieder berührte ihr Bauch Jermaynes sichere Hand. Und auf einmal, sagte sie, war es bloß die Vorstellung von seiner Hand, die sie über Wasser hielt. Ich habe meinen Kopf nie ins Meer getunkt, sodass ich nur weiß, was sie darüber sagte, wie es ihr in die Augen und in die Nasenlöcher strömte. Ich dachte, das werde ich niemals tun. Nie und nimmer werde ich dem Meer erlauben, in mich einzudringen. Aber sie hatte es nur falsch gemacht. Das war der Punkt – das wollte sie mich wissenlassen: Sie hatte vergessen, die Luft anzuhalten.
Jermayne machte ihr Mut. Er brachte ihr bei, wie ein Essensrest zu schwimmen. Aber richtig lernte sie es bei einem Holländer. Der sagte nie «vertrau mir». Und wenn, dann hätte sie nicht auf ihn gehört. Er sagte «So geht das …» und führte den Froschbeinschlag oder Kraulen vor. Ich selbst habe die Züge nicht gelernt, nur die Wörter. Froschbeinschlag. Das gefällt mir. Mit dem Wort «kraulen» bin ich mir nicht mehr sicher, besonders wenn ich auf das Meer, weit wie eine Wüste, hinausschaue. Sie versuchte, mir diese Sachen zu zeigen, indem sie sich flach aufs Bett legte. Da übte sie ihre Züge, wenn Gäste im Pool waren. Ich musste so tun, als wäre das Bett das Meer. Aber ich wollte nicht schwimmen. Im Übrigen gehört das, was ich eben gesagt habe, eigentlich nicht hierher.
Ich wollte nur dies sagen. Bei Jermayne drehte sich alles darum, dass sie ihm vertraute. Und sie tat es. Vieles von dem, was Sie jetzt von mir hören, hat sie mir erzählt. Ich war nicht dabei. Wie sollte ich? Aber das hat sie gesagt: Als er sie fragte, ob sie sich manchmal einsam fühlt, musste sie erst nachdenken. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass sie sich einsam fühlen könnte. Ich wundere mich oft über diese Art von Zauberei. Woher kommt so ein Gefühl? Vielleicht ist es besser, wenn wir das Wort für unsere Bedürfnisse nicht kennen. Egal, sie sitzen draußen an der Pool-Bar. Alle anderen haben sich ins Hotel zurückgezogen. Sie sind allein. Mag sein, dass der Barmann noch da ist. Ich weiß es nicht. Nachdem er sie gefragt hat, ob sie sich manchmal einsam fühlt, berührt er ihre Hand, streicht ihr über den Arm, dann über den Hals. Er fragt, ob er in ihr Zimmer kommen darf. «Nein», sagt sie. Sie hat die Aufsicht über das Zimmerpersonal. Sie würde gefeuert werden. «Also dann», sagt er, «komm du in mein Zimmer. Komm und wohne mir bei.» Sie blickt sich um, dass auch niemand etwas mitbekommen hat. «Vertrau mir», sagt er.
In Jermaynes Zimmer gab es einen peinlichen Moment – vielleicht auch andere, die ich vergessen habe, aber dieser hat sich mir eingeprägt. Irgendwann fragt er, ob sie auf die Toilette möchte. Sie ist überrascht, wieso er fragt. Warum tut er das? Weiß er, wann sie pinkeln muss? Dann merkt sie, warum er gefragt hat. Weil sie wie angewurzelt dagestanden und ins Badezimmer, auf das weiße Waschbecken gestarrt hatte. Es war die Verwunderung, in einem Gästezimmer zu sein, ohne sich mit Putzzeug auf die Kloschüssel zu stürzen und einen Papierstreifen zur hygienischen Freigabe über den Deckel zu spannen. Oder die Türknäufe einzusprühen, damit es im Zimmer gut roch, oder die Kissen aufzuschütteln und die Ecke der Bettdecke zurückzuschlagen.
Sie blieb über Nacht – also, nicht ganz, weil der Lärm der Generatoren sie weckte. Der Strom war ausgefallen. Sie stieg aus dem Bett, zog sich an und kehrte ungesehen in den Wohntrakt des Personals zurück. Ich weiß, dass sie auch die nächste und die Nacht danach mit ihm verbrachte. Dann flog Jermayne nach Deutschland zurück. Er sagte, er würde sie anrufen. Ich glaubte das nicht. Aber ich hatte ihn unterschätzt. Manchmal sah ich sie am Telefon in der Empfangshalle, und dann wusste ich, es war Jermayne, der von Übersee anrief. Einen Monat später kam er wieder, kürzer jetzt, und in dieser Zeit muss es passiert sein, dass sie schwanger wurde. Ich war die Einzige, die es erfuhr. Zunächst, muss ich sagen, denn auf Dauer lässt eine Schwangerschaft sich nicht verbergen.
Jermayne kam noch zweimal wieder. Das letzte Mal zur Geburt. Das Hotel hatte ihr freigegeben. Jermayne mietete eine Wohnung in einem schönen Viertel hinter dem Markt, am anderen Ende der Stadt. Ich habe sie einmal besucht. Es war schön dort, ruhig. Es gab keine Fliegen. Er bestand darauf, dass sie mit ihm dortblieb. Für kurze Zeit lebten sie wie Mann und Frau. Einmal rief sie mich im Hotel an. Sie sagte, sie wolle nur meine Stimme hören, um sicher zu sein, dass wir noch in derselben Welt lebten. Sie bekam Besuch von einem Arzt. Sie war noch nie beim Arzt gewesen. Er maß ihr den Blutdruck, den Puls und fühlte mit seinen Fingern, wo eine Hebamme es täte. Jermayne war dabei und hielt ihr die Hand. Sie hörte zu, wie er dem Doktor Fragen stellte. Viele, viele Fragen. Bis er beruhigt war, dass es ein gesundes Baby würde. Noch nie hatte jemand solche Fürsorge an sie verschwendet. Als ihre Fruchtblase platzte, wartete ein Taxi, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Dieser Jermayne dachte wirklich an alles.
Sie hatten nicht darüber gesprochen, was danach werden sollte. Ich war sicher, Jermayne würde sie mit nach Deutschland nehmen. Dort könnte sie ein neues Leben anfangen. Sie wollte es. Das spürte ich. Sie hoffte, das sei es, was Jermayne im Sinn hatte. Sie hat nie gefragt. Sie wollte ihm keine Überraschung aufbürden. Natürlich hoffte sie, es würde keine Überraschung sein, sie wäre Teil der Pläne, die sie in seinem Hinterkopf ablaufen sah. Er war die ganze Zeit bei ihr, sogar während der Entbindung, und schon davor hatte er mit ihr geatmet, ihr die Hand gehalten.
Viele Stunden später wird ihr ein kleiner Junge an die Brust gedrückt. Und da ist Jermayne mit einem Blumenstrauß. Es gibt Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Jermayne hat an alles gedacht. Manche Formulare sind in einer anderen Sprache, Deutsch, wie sie sieht. Sie geht die Sachen mit Jermayne durch. Er erklärt, es sei, wie wenn man etwas in Besitz nimmt. Man muss unterschreiben. Wie wenn man sich für ein Hotelzimmer einträgt. Also tat sie es, sie unterschrieb die Formulare an den Stellen, auf die er zeigte. Nach zwei Tagen im Krankenhaus fuhr ein Taxi sie wieder zu Jermaynes Wohnung. Er war Babykleidung einkaufen gegangen. Er brachte sie und das Baby ins Bett. Nachts lag das Baby zwischen ihnen. Einmal bat sie Jermayne, zu ihr zu kommen und sich neben sie zu legen. Sie wollte seine Hand auf ihrem Körper spüren, wie damals, als er sie schwimmen lehrte. Er drehte seinen Kopf auf dem Kissen. Das Scheinwerferlicht eines Autos fiel durchs Fenster, und in diesem kurzen Augenblick sah sie seine geschlossenen Lider.
Er besteht darauf, dass sie im Bett bleibt. Sie muss sich erholen. Sie sagt ihm, es sei nichts gebrochen. Aber er hört nicht. Jermayne macht alles, wie Jermayne es macht. Er hört nicht, was er nicht hören will.
Eines Morgens wird sie von der rauschenden Dusche geweckt. Es ist sehr früh, trotzdem kommt Jermayne fertig angezogen aus dem Bad. Sein Gesicht verzieht sich leicht, als er sie im Bett sitzen sieht. Er setzt ein Lächeln auf. Ja. Ein schönes Lächeln. Ein Lächeln, das die Welt beruhigt. Er legt seinen Finger vor die Lippen, macht pssst, damit sie still ist. Sie wollen das Baby nicht wecken. Er hockt sich auf die Bettkante. Beugt sich nach unten, um sich die Schnürsenkel zu binden. Sie beobachtet ihn dabei, will etwas sagen, ihn fragen, was er verloren zu haben glaubt, weil er jetzt von einer Ecke der Wohnung in die andere läuft. Da, er hat es gefunden. Eine Babytrage. Sie sieht die Trage zum ersten Mal. Jetzt nähert sich Jermayne von der anderen Seite und nimmt das Baby hoch. Er drückt ihm seine Nase in den Bauch. Das macht er immer. Sie mag es, wenn er das macht. Jermayne wird ein guter Vater sein, ein liebender Vater.
Das Baby strampelt; die Augen sind noch fest zugekniffen, als es den Mund aufmacht und die ersten Laute von sich gibt. Endlich können sie reden. Er sagt, es sei Zeit, das Baby an die Luft zu bringen. Er wolle mit ihm raus, bevor die Sonne aufgegangen ist, nicht später. Dann wäre es zu heiß. Er betont, wie wichtig es ist, ein Baby an die frische Luft zu gewöhnen. Darum will er ein bisschen mit ihm spazieren gehen. Nicht weit. Er will es nicht überanstrengen. Nur bis zu den Grünanlagen am Ende der Straße und wieder zurück. Er streckt ihr das Baby entgegen. «Gib Mami einen Abschiedskuss», sagt er. Sie küsst es auf die Wange. Dann legt sie sich aufs Kopfkissen zurück, beide Hände auf dem Bauch, die Augen geschlossen. Dann fasst sie mit einer Hand neben sich. Wie seltsam, dieser leere Platz. Was für eine Stille plötzlich in der Wohnung. Es fühlt sich ungut an. Sie versucht, ihre Augen geschlossen zu halten, aber irgendetwas stimmt nicht. Es gibt nichts, wovon sie sich erholen müsste, keine Müdigkeit, die sie umfallen ließe. Also steht sie auf. Sie geht ans Fenster. Vielleicht sieht sie Jermayne mit dem Baby, und tatsächlich. Da sind sie – oder vielmehr Jermaynes Kopf von oben. Da steht auch ein Taxi. Die hintere Tür öffnet sich, und eine Frau steigt aus. Jermayne gibt ihr das Baby, und die Frau nimmt es in die Arme, wiegt es, schaut ihm lange ins Gesicht, bis sie ihr eigenes über das Bündel senkt. Jermayne hält die Wagentür auf. Er blickt einmal hoch, zum Fenster der Wohnung. Jetzt steigt die Frau mit dem Baby hinten ein, gefolgt von Jermayne, die Tür geht zu, und das Taxi fährt los, die Straße hinunter.
Den Rest weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie die langen Stunden des Wartens auf Jermaynes Rückkehr zugebracht hat. Ich weiß nicht, was für Gedanken ihr durch den Kopf gegangen sind. Aber zum zweiten Mal in meinem Leben kommt ein Anruf für mich. Ich höre die ganze Geschichte, und als sie von der Sache mit der fremden Frau im Taxi spricht, weiß ich, wer die Frau ist; es ist dieselbe, die ich ein paar Monate zuvor mit Jermayne gesehen hatte. Sie durchquerten gemeinsam die Empfangshalle. Die Frau ging vor ihm in den Aufzug. Im Moment war ich ziemlich sicher, dass sie zusammengehörten. In einem Hotel lernst du schnell erkennen, wer allein ist und wer ein Paar und wer unglücklich ist. Und wenn du ihre Laken wechselst, weißt du noch mehr. Ich habe die Frau nie wiedergesehen. Und wie gesagt, beim Frühstück war nur Jermayne da.
Aber sobald ich von der Frau höre, die aus dem Taxi steigt, sehe ich sie vor mir, wie sie Jermayne einen halben Schritt voraus zum Aufzug eilt, und ich sehe ihn mit der Hand gestikulieren, dass er ihr den Vortritt lässt, und ich sehe, als wäre es heute, die Frau ihre Geldbörse öffnen und schließen, und im letzten Moment, als die Aufzugtür zugeht, sehe ich, wie sie sich zu Jermayne umdreht. Dieses Wissen steckt in meinem Mund. Vielleicht werde ich es eines Tages ausspucken und es ihr erzählen. Aber als sie von der Frau spricht, die aus dem Taxi steigt, beiße ich mir auf die Zunge, und zugleich spüre ich, wie mich von Kopf bis Fuß eine prickelnde Hitze überzieht. Das ist mein Kreuz, das ich zu tragen habe. Aber wissen Sie, was ich mir sagte? Wenn ich es ihr erzähle, verliere ich eine Freundin. Denn wenn ich es täte, würde sie glauben, eine Freundin verloren zu haben. Eine Freundin hätte ihr so etwas erzählt. Warum ich es damals nicht gleich gesagt habe, würde sie wissen wollen. Und was sollte ich ihr sagen? Heute weiß ich es. Ich hätte sagen sollen, weil ich mir so sehr wünschte, dass sie glücklich ist.
Es dauerte noch zwei Tage, bis ich freihatte. Ich ging quer durch die Stadt zu der Wohnung. Es war sehr heiß. Niemand sonst war draußen. Nur Autos. Aber keine Fußgänger. Ich ging zu Fuß, weil mein Taxigeld nur für den Rückweg zum Hotel reichte.
Ich hatte erwartet, sie wäre außer sich. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht war. Aber die meisten Menschen weinen oder ringen die Hände, wenn sie außer sich sind. Sie nicht. Sie war still, sehr still. Still wie eine Hotelpalme an einem dieser erstickend heißen Tage. Ich umarmte sie, aber ich kann nicht sagen, es hätte sich angefühlt wie Fleisch, nicht wie lebendig atmendes Fleisch. Sie wandte die Augen ab. Sie ließ mich nichts von sich sehen, nicht an das, was sie fühlte, heran. Vielleicht gab es keine Möglichkeit, ihr näherzukommen. Ich weiß nur, sie war froh, dass ich da war, um sie nach Hause ins Hotel zu bringen.
Die Hotelmanager waren überrascht, sie wieder auf dem Dienstplan zu finden. Wie jeder andere hatten sie geglaubt, sie würde mit Jermayne fortgehen. Sie hielten ihre Geschichte für einen Glücksfall. Ein bisschen Sternenstaub, der aus dem Himmel und ihr zu Füßen gefallen war. So sahen sie es. Ich deckte ihre Geschichte von einer Fehlgeburt. Das Management war nett. Sie bekam Urlaub. Eine der Frauen umarmte sie. Ein Mann, den wir kaum kannten, er hatte etwas mit der Wäscherei zu tun, schenkte ihr Blumen. Bald war sie wieder in Uniform, wieder Leiterin des Zimmerpersonals, aber sie fand nicht zurück zu der Person, die sie gewesen war.
Sie lächelte die Gäste nicht mehr an. Blickte einfach durch sie hindurch, wenn sie mit ihren kleinen Beschwerden kamen. Es war ihr egal. Ich sah sie zum künstlichen Riff rudern. Sie machte das ganz allein. Ich wäre gern mit ihr zusammen da rausgefahren, aber sie hat mich nicht gebeten, und ich habe nicht gefragt, weil es Pilgerfahrten waren. Ich konnte ziemlich deutlich sehen, wie sie am Saum des Meeres auf und ab gehend in Richtung Europa schaute.
Eines Nachmittags, während ich ihre einsame Gestalt auf dem Riff beobachte, steht plötzlich Mr. Newton vom Management hinter mir und flüstert mir ins Ohr. Ob es mir gefallen würde, Leiterin des Zimmerpersonals zu werden? Also ja, das bin ich heute noch. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich bin glücklich. Ich glaube an die Liebe. Es wäre schön, wenn eines Tages ein bisschen davon aus dem Himmel und mir zu Füßen fiele. Aber bevor ich mich danach bücke, will ich erst sicher sein, was es ist.
Zwei
Der Inspektor
Das Boot, für das sie bezahlt hatte, stank nach Fisch. Den Bootsführer hat sie nie gesehen. Es gab die Mannschaft – ein paar Männer, immer mit dem Rücken zu ihr – und die anderen. Es war Nacht, und so war kaum zu erkennen, wie viele sie waren. Aber schließlich bleibt Fracht ja auch nicht stehen und zählt nach.
Um ihre Überfahrt zu bezahlen, hatte sie Hotelsex mit Fremden gehabt – einschließlich des Holländers, bei dem sie schwimmen lernte. Sie hatte Geld aller Nennwerte und Währungen gespart. Manches, dachte sie, müsse chinesisch sein, aber da waren auch Euros und Pfund und amerikanische Dollar. Sie rollte die Scheine jedes Mal neu zu einer Zigarre, die sie zur sicheren Aufbewahrung in sich einführte.
Stundenlang nichts als das Klatschen des Meeres gegen den Bugspriet. Die Fracht sitzt zusammengekauert da. Menschen aus unterschiedlichen Teilen des Kontinents. Niemand spricht, aus Angst, gehört zu werden. Die Gefahr umgibt sie, dick geschichtet, Ohren, die gut hören, bohrende Augen in stockfinsterer Nacht. Sie sitzen auf ihrer gebündelten Habe. Sie sitzen auf leeren Gedärmen. Sie haben seit Stunden nichts gegessen, mindestens seit einem halben Tag. Man hat ihnen geraten, es sei besser so.
Als das Boot langsamer wurde, reckten sich die Hälse. Köpfe drehten sich. Diejenigen, die ihr gegenübersaßen, starrten über ihre Schulter hinweg. Da drehte sie sich um und sah die Küstenlichter Europas. Vom Heck her kam ein lautes Platschen. Sie sah ein kämpfendes schwarzes Gesicht, jemanden, der sich neben dem Boot an eine Boje klammerte. Der Mann hing noch daran, als das Boot wegfuhr. Jetzt hörte sie zum ersten Mal die Instruktionen. Ein anderes Boot würde kommen und sie aufnehmen. Nur keine Sorge. Sie müssten damit rechnen, ungefähr eine Stunde oder etwas länger im Meer zu sein. Sie sollten sich einfach an der Boje festhalten und warten. Sie bräuchten keine Angst zu haben. Alles würde nach Plan laufen, wie schon so oft. Sie fühlte sich an die Hotelstimme erinnert, die sie benutzten, um Gäste zu beruhigen – sanft, liebenswürdig, lächelnd. Das Wasser wird gleich wieder angestellt. Es dauert nicht mehr lange, bis der Stromausfall behoben ist. Der Handwerker ist schon unterwegs zu Ihrem Zimmer. Selbstverständlich können Sie das Leitungswasser trinken, wenn Sie möchten, aber es empfiehlt sich nicht.
Ein Platschen. Wieder strampelte ein Körper in dem ungewohnten Element, und wie zuvor blieben zwei ängstliche Augen in der Dunkelheit zurück.
Ein älterer Mann weiter hinten am Seitendeck kündigt leise an, dass er nicht schwimmen kann. Er hat eine Kiste mit seinen Sachen auf dem Schoß, die langen Bauernarme darübergeworfen. Niemand sagte etwas, niemand drehte sich nach seinem Platschen um.
Sie kann wenigstens schwimmen. Der Holländer hatte sie abends regelmäßig in den Pool geschmuggelt. Er sagte ihr, sie solle sich aufs Wasser legen und so tun, als wäre es ein Bett. Dann zeigte er ihr, wie sie die Arme bewegen und immer denken müsse, sich nach etwas auszustrecken, was knapp außerhalb ihrer Reichweite lag.
Ein Gesicht mit einer schwarzen Wollmütze hockt in ihrer Nähe. Als das Boot leise abdreht, sieht sie die Boje. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und bückt sich gerade, um sie aufzuheben, da schubst eine Hand sie über Bord, und sie fällt seitwärts ins Meer. Zuerst, wundersamerweise, scheint sie nicht nass zu werden. Sie ist im Wasser, aber das Wasser nicht in ihr. Es war nur der Bruchteil einer Sekunde, an den sich Hoffnung und Erstaunen klammerten. Dann, urplötzlich, drang das Wasser durch ihre Kleidung, so schockartig, dass sie um sich schlug, bis sie die harte Plastikboje spürte.
Das Boot entfernte sich, und die Nacht und ein Gefühl der Leere schlossen sie wie eine Mauer ein. In unsichtbarer Ferne hörte sie das nächste Platschen. Vom Boot aus waren die Küstenlichter klar gewesen. Jetzt sind keine mehr zu sehen. Das Meer ist im Weg, es wogt und schleudert sie um die Boje herum. Die Boje ist schwer zu fassen. Sie ist zu dick, zu rund. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich am Ankerseil festzuhalten und die Hände zu wechseln, sobald ein Arm erschlafft.
Wie lange war sie schon im Wasser? Was ist Zeit unter diesen Umständen? Was eine Stunde? Und was zehn Minuten? Zeit lässt sich auch anders messen. An der Kälte. An der Angst. An der Dauer, bis Fleisch fühllos wird, bis es verrottet und sich von den Knochen löst. Sie begann, an den Worten der Mannschaft zu zweifeln. Sonst wäre schon etwas geschehen. Das erschien ihr eher glaubhaft, weil selten geschieht, was eigentlich geschehen sollte.
Sie sah die Sonne aufgehen und sich höher an den Himmel schieben. Die letzten blinkenden Lichter erloschen. Das Meer schwoll an, und die Küstenlinie Europas verwandelte sich in grauen Dunst.
Der Holländer hatte ihr beigebracht, wie ein Hund zu schwimmen. «Hundepaddeln.» Aus eigenem Antrieb war sie nur auf eine Länge des Poolbeckens gekommen. Aber er hatte sie ermutigt weiterzumachen, zu üben. Einen Monat später schaffte sie fünfzig Bahnen. Einmal war sie zur Belustigung eines Hotelgastes, der die ganze Zeit mit einem Cocktail im Liegestuhl saß, hundert Bahnen geschwommen und hatte die Wette um zehn Dollar gewonnen.
Ihre Schultern schmerzen, ihre Lippen sind aufgequollen, die Augen brennen. Ihre Haut will nichts mehr von ihr wissen. Sie hat den seidigen Glanz verloren, den die Gäste immer so gern kommentierten. Jedes Mal, wenn jemand stehen geblieben war, um sie zu tätscheln, hatte sie es genossen, das langsame Wunder ihrer selbst in den Augen und im Gesicht eines vollkommen Fremden aufscheinen zu sehen.
Am späten Nachmittag beschließt sie zu schwimmen. Sie hat eine Plastiktüte mit ihrer Hoteluniform und dem Stechmesser aus dem Gitterstab des Vogelkäfigs bei sich. Sie wird die Boje mitnehmen.
Die erste Aufgabe besteht darin, das Messer herauszubekommen. Trotz der langen Stunden im Meer ist die Uniform noch trocken. Sie kann die Falte eines Ärmels im Inneren der Plastiktüte ertasten. Das Messer ist in den Rock eingerollt. Sie muss mit den Fingern einer Hand an dem Knoten zupfen. Die andere Hand hält die Boje fest. Mehrmals lässt sie das Seil los, um mit beiden Händen zu zupfen. Jedes Mal kommt sie ein bisschen weiter, bevor das Meer sich scheitelt und sie sinkt. Einmal, als sie es fast geschafft zu haben glaubte, war ihr Kopf schon unter Wasser. Aber auch diesmal reichte es nicht, und sie kam wieder an die Oberfläche – in Panik bei dem Gedanken, wie schnell, wie leicht es mit dem Untergehen ging, ein Aussetzer genügte, und schon war es passiert. Sie erinnert sich, dass sie einmal eine Frau beim Abkauen einer Nabelschnur gesehen hat. Als sie den Knoten oben an der Plastiktüte abbeißt, verpufft etwas heimatliche Luft, Wäscheluft.
Sie muss das Messer rausziehen, ohne dass die Uniform nass wird, und die Tüte wieder zubinden, nicht ganz so fest diesmal, aber auch nicht zu locker für das Meer.
Es dauerte eine Ewigkeit, sich durch das vertäute Seil zu säbeln, Faser um Faser. Als die letzte riss, sprang die Boje weg, und sie musste hinterherschwimmen. Ihr Körper tat nicht, was sie wollte. Er benahm sich wie ein Brett. Sämtliche Glieder waren steif. Sobald sie nach der Boje griff, schwappte das Ding weg, und sie musste weiter paddeln. Sie glaubte die Boje schon verloren, dachte, das sei es gewesen, bis hierher und nicht weiter, so nah am Land, als ihre Hand das Seilende zu fassen kriegt. So geht sie wenigstens nicht unter. Der Rest bleibt ihr überlassen. Eine Hand gegen die Boje gedrückt, die andere an das Seil geklammert, beginnt sie mit Froschbeinschlägen in Richtung Küste zu schwimmen.
Bei Sonnenuntergang trat sie immer noch. Sie hatte das schreckliche Gefühl, sich vom Land zu entfernen, statt ihm näher zu kommen. Aber sie schwamm weiter, es gab keine andere Wahl. Irgendwann in der Nacht hatte sie plötzlich das gegenteilige Gefühl. Ihr war, als würde sie ans Ufer gezogen. Die Lichter, die sie in der Nacht zuvor gesehen hatte, tauchten wieder auf. Es war nicht so weit wie befürchtet.
Als Kind hatte sie Bilder vom Meer und der Welt darüber gemalt. Wo beides zusammenstieß, malte sie einen schrägen Boden, wie eine Hotelrampe für Rollstühle. Genauso präsentiert sich ihr Europa. Sie findet sich im geisterhaft flachen, von Hunden und Menschen verpissten Wasser wieder. Hier ein durchtränkter Batzen Papier. Dort die blinden Augen eines Fischkopfs, der sich auf einem Stück Spiraldraht dreht. Nach zwei Nächten im Meer hebt sie ihr Gesicht vor einer Reihe sonnenbadender, dem Meer entgegengestreckter Füße aus der seichten Brühe in die leise murmelnde Luft.
Einer nach dem anderen kommen die Sonnenbadenden aus ihren Liegstühlen hoch. Sie setzen sich auf, die Gesichter hinter Sonnenbrillen, unter weißen Schlapphüten. Mit den Fingern zeigend, denkt sie, aber vielleicht auch nicht. Sie kämpft sich mit weichen Knien auf die Beine, die kostbare Plastiktüte an sich gedrückt, schafft ein paar stolpernde Schritte wie eine verkrüppelte alte Frau. Wegen all der Menschen fühlt sie sich getrieben, weiterzugehen, sich zu bewegen. Sie zwingt ein Lächeln auf ihr gespanntes Gesicht, schlägt eine Richtung ein und hält sich an den nassen Kies. Nur ein bisschen mehr, und das Lächeln zerreißt ihr das Gesicht. Sie erlaubt sich nicht, den Strand hinaufzublicken. Sie kennt das schuldige Erröten, das sie im ersten Hotel gespürt hatte, sooft ihr Blick an der Obstschale hängenblieb, die für die Gäste in der Empfangshalle stand. Dieses Schuldgefühl war ihr ein Rätsel, da sie im Hotel doch nie aufs Essen aus gewesen war. Es hatte etwas mit Überfluss zu tun – und sie wusste, der Überfluss lag gleich hinter dem Strand. Also setzt sie ihr Hotelgesicht auf und folgt dem Wasserrand, bis sie an den letzten Sonnenbadenden vorbei ist.
Es ist steinig unter ihren Füßen. Die Flut umspült ihre Knöchel, zieht Essensreste und Plastikfetzen zurück ins Meer. Sie hebt die Augen nicht, noch nicht. Sie wird sich nicht erlauben, den Strand auch nur mit einem Blick zu streifen. Genauso, wie sie der unerwünschten Aufmerksamkeit gewisser Hotelgäste auszuweichen pflegte. Dann ändert sich die Luft. Es riecht wie auf dem Boot, dieser fischige Geruch. Sie hat eine Mole erreicht, eine Aufschüttung aus Geröll. Die Strandlinie ist zu Ende. Jetzt wird sie es wagen. Sie wendet ihren Kopf vom Meer ab und von dem nassen Kies, einer Reihe auf der Seite liegender Boote zu. Sie geht bis zum ersten, lässt sich daneben in den Sand fallen und zieht den gerippten Rumpf über sich.
Drei
Der Inspektor
Im Mai wird es zuerst im südlichen Europa warm. Die Vögel erwachen, schlüpfen aus ihren Winterquartieren. Die ersten riesigen Touristenbusse kommen an. Die Zigeuner beginnen ihren Zug nach Norden. Scharenweise nehmen Boote aus Libyen und Tunesien ihre abenteuerlichen Fahrten übers Mittelmeer wieder auf. Die Überwachungsflüge mehren sich – und mit deprimierender Regelmäßigkeit erreichen uns Berichte über Afrikaner, die wie Korken aus dem Meer auftauchen, Afrikaner, die an Wrackteile geklammert, die Arme um Trümmer geschlungen, warten. Manchmal kreuzt ein Rettungsboot auf, manchmal nicht.
Die Cafés im Umkreis des Bahnhofs bieten Kaffee, Aschenbecher, Snacks. Die Barmänner sehen aus wie Barmänner, zu nichts anderem bestimmt, als Barmänner zu werden. Alle haben dieselben breiten Gesichter, Kinnbacken, die ihre Züge nach unten drücken und fleischige Falten bilden, in denen sich Geheimnisse verbergen. Sie sind darauf gedrillt, zuzuhören, ohne sich an das Gesagte zu erinnern. Sie sind wie Abgeordnete von Geistern.
Sie halten es für möglich, dass die Frau hier durchgekommen ist, ja, diese Möglichkeit wird sofort eingeräumt, aber niemand scheint sich zu erinnern. War sie groß? So oder so? Nein? Kleiner? Die Barmänner sind nicht sicher, sie sträuben sich, etwas zu sagen. Unsicher, wie sie sind, wollen sie nichts Falsches behaupten. Sie wissen doch, wie das ist, Inspektor. Wer will schon was Falsches behaupten?
Sie können schließlich nicht auf jede Krabbe achten, die von der Flut angespült wird.
Also dann, wo könnte man suchen? Einen Hinweis, bitte.
Sie gehen mit an die Tür und zeigen auf die Autobahnzufahrt. Das ist der Weg, über den ein Geist nach Europa verschwinden könnte.
Auf dem kleinen LKW-Parkplatz neigte der Mann an der Kasse seinen Kopf zu einem der Ecktische, wo ein dicker Fahrer, ganz Bauch und runde Knie, mit offenem Mund und gerunzelter Stirn auf eine zwischen gestreckten Armen entfaltete Zeitung starrte. Ein paar Tage zuvor hat er seine Brille verloren, und mit der seiner Frau kommt er nicht so gut klar. Also brennen seine Augen Löcher ins Gedruckte – die Todesanzeige einer bedeutenden Persönlichkeit, ein schockierendes Sportergebnis, neue Steuergesetze, das Horoskop des Tages. Die Unterbrechung macht ihm nichts aus. Er rafft die Zeitung zusammen und späht über das weibliche Brillengestell. Sein Blick war offen, hilfsbereit. Er rollte seine wulstige Zunge. Schob seinen Stuhl zurück. Zerrte an seinem Hosengürtel, verlagerte das Gewicht, und schon waren wir am Fenster. Aber wie hat er es dorthin geschafft? Ohne eine erkennbare Bewegung seiner Füße? Er atmet in schnellen Stößen, jedes Wort ein neuer Stoß. Antonio ist derjenige, den man fragen muss. Sein Lastwagen kommt mit der Fähre aus Messina. Und was, wenn er wissen will, wer ihn empfohlen hat? Gatti. Sagen Sie Gatti. Gatti und weiter? Einfach Gatti. Gatti. Gatti. Da, fragen Sie Antonio.
Antonio sitzt in seinem Führerhaus, die langen Kilometer sind ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Fensterscheibe ist heruntergelassen. Er wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, wartet aber ab, will erst mal hören. Dann, ohne ein Wort, zeigt er auf die Beifahrertür. Diese Lastwagen sind wirklich hoch. Man muss Schwung nehmen – erstaunlich, dass Fernfahrer wie Gatti oft so fette Kerle sind. Obwohl, Antonio nicht. Er ist spindeldürr. Nur Haut und Knochen. Die langen Ärmel sind an den Manschetten zugeknöpft. Eine Hand ruht auf dem Schaltknüppel. Blasses Gesicht. Seine Augenbrauen sind dunkel, die Haare ebenfalls, nirgendwo ein graues Haar. Geistig vielleicht etwas langsam. Wie alt? Ende dreißig, Anfang vierzig? Einundvierzig wäre sicher gut geschätzt. Die Haut um seine Kehle hat die Farbe von Nesselfieber. Gelegentlich steigen die Nesseln bis zu den Wangen auf, dann weichen sie wieder einem vollkommen blassen, unverbindlichen Gesicht. Sein Atem ist unstet, nervös unter dem Eindruck von Autorität.
Er nahm seine Hand vom Schaltknüppel, steckte die Zigarette wieder in den Mund und zündete sie an. Er blies den Rauch aus dem Seitenfenster, hielt die Zigarette vors Gesicht und nickte langsam. Da war so jemand, sagte er. Sie stand weiter oben an der Straße, etwas entfernt von den Prostituierten. Schwarz? Ja, das muss sie gewesen sein. Weil sie offensichtlich keine Prostituierte war, hielt er bei ihr an. Und warum das? Warum bei ihr? Zuerst hatte er überlegt, bei einer der Prostituierten, einem der albanischen oder bulgarischen Mädchen, zu halten. Er hatte daran gedacht und sich dann, im Nachhinein, zurückgesehnt. Nach seinem eigenen Bekunden sind manche dieser Mädchen schamlos. Sie machen sich gegenseitig Konkurrenz. Da zieht eine mitten in seinem Scheinwerferlicht ihr Oberteil runter und wackelt mit den Titten. Eine andere lüftet ihren Rock, und an einem vorbeihuschenden Blitzen merkt er, dass sie keine Unterhose anhat. So fährt er vielleicht mit Erinnerungen weiter, die sehnsüchtige Gefühle, Gelüste in ihm wecken, und wenn dann etwas später eine Frau aus den Bäumen an der Straße auftaucht, kann es schon sein, dass er unwillkürlich, mit herzrasender Entschlossenheit, auf die Bremse tritt und an den Rand fährt.
Vier
Der Lastwagenfahrer
Sie trug einen Mantel. Ein Tuch um den Hals. Als sie ins Führerhaus kletterte, wickelte sie das Tuch ab und steckte es in ihre Manteltasche. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe. Es war dunkel. Ich fragte, wo sie hinwollte. Zuerst verstand sie nicht. No lingo. No Italiano. Sie deutete auf die Karte auf dem Armaturenbrett. Sie sprach Englisch. Ich verstehe ein paar Wörter. Beckham. Manchester United. Sally. Wörter aus ein paar Songs. Yesterday. Summertime. Ich zeigte ihr, auf welcher Straße wir waren. Dann frage ich noch mal. Wo will sie hin? Diesmal versteht sie. Die Sache ist klar. Sie will nach Norden. North, das verstehe ich. Buono! Von mir aus. Manchmal ist es gut, als Fahrer jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Ich hab mein Radio. Wenn es Fußball gibt, höre ich zu. Ich hab mein Handy. Jeden Abend rufe ich die Kinder an. Meine Frau ist oft zu müde zum Reden. Manchmal liegt sie schon im Bett, wenn ich anrufe, und dann singe ich ihr von meiner einsamen Strecke auf der Straße etwas vor. Die Leute sagen, ich hätte eine gute Stimme. Ich singe gern. Manchmal höre ich meine Frau am anderen Ende seufzen, und es ist, als wären wir wieder jung. Also singe ich der Schwarzen was, zum Zeitvertreib. Musik versteht jeder. Warum? Weil Musik meiner bescheidenen Meinung nach mehr bedeutet. Sie geht ans Herz.
Während ich sang, behielt sie die Straße fest im Blick; ihre Augen bewegten sich nicht, aber sie lächelte. Ich sang, und als ich aufhörte, lächelte sie weiter. Ich habe immer Schokolade dabei. Ich bot ihr ein Stück an, und sie steckte es in ihre Manteltasche. Das ärgerte mich. Ich wurde wütend. Aber warum? Ich bot ihr Schokolade an, und sie nahm sich welche. Das war es nicht, was mich wütend machte. Das hatte ich ja gehofft, darum hatte ich ihr was angeboten. Aber warum steckte sie die Schokolade in die Tasche? Das war es, was mich wütend machte. Keine Ahnung, warum. Sie sah mich nicht an. Sie sah auf die Straße. Ich fragte mich, ob sie spät dran war. Die Art, wie sie auf die Straße starrte, wissen Sie, als wäre sie ein Hindernis, und immer noch mehr abzufahren, bevor sie ankommt, wo sie hinwill.
Ich biete ihr eine Zigarette an; diesmal schüttelt sie den Kopf. Sie ist wie eine Zombiefrau. Kann die Augen nicht von der Straße lösen. Ich wünsche schon, ich hätte sie nicht mitgenommen. Ich stelle das Radio an. Es ist nicht dasselbe wie mein Singen. Die Musik macht alles nur schlimmer, verstärkt die Spannung im Führerhaus. Das Schweigen, das schwarze Pflaster, das draußen vor der Windschutzscheibe abrollt, die geschlossene Dunkelheit überall um mich herum und diese schwarze Frau, die weder spricht noch Schokolade isst, noch irgendwas zu meinem Singen sagt. Obwohl das, wenn ich so unbescheiden sein darf, schon Extraklasse ist. Früher habe ich bei uns im Dorfchor gesungen. Wir traten bei Wettbewerben auf. Ich hätte Sänger werden können. Meine Frau, die damals noch nicht meine Frau, sondern ein hübsches Mädchen war, wurde schwanger. Timing ist alles auf der Welt. Wie bei den Kaninchen. Eins rennt über die Straße und verreckt unter meinen Rädern. Das nächste rennt los und schafft es auf die andere Seite.
Schließlich erreichen wir die Abzweigung. Ich weiß, sie will nach Norden, also trennen sich unsere Wege hier. Ich schalte runter, wechsele die Spur. Zum ersten Mal – nein, vielleicht ist es das zweite Mal –, seit ich sie mitgenommen habe, guckt sie mich an. Sie versteht nicht, warum wir halten. Ich zeige ihr auf der Karte, wo ich hinmuss, und dann zeige ich ihr die Straße nach Norden. Aber sie weigert sich, das zu verstehen. Weigert sich. Sie versteht nicht, wieso die Straße sich an dieser Stelle teilt. Ich suche ein Stück Papier und male ihr ein Bild. Ich male ein Bild von ihr und eins von mir. «North», sagt sie. Ich verstehe. Die Sache ist klar. Ich deute wieder auf die Karte, zeige ihr, welche Straße ich nehmen muss. Wir sind an den Rand gefahren. Ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer. Um diese Zeit ist nicht viel Verkehr. Hauptsächlich Laster, ein paar Personenwagen, aber nicht viele.