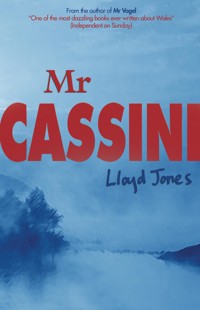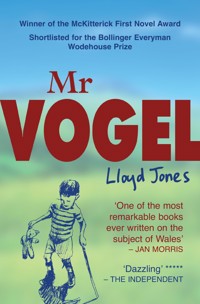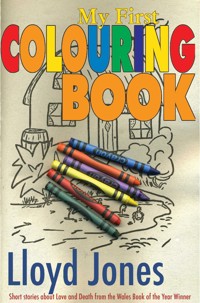9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder Tango beginnt mit einem Rückwärtsschritt: Neuseeland 1916. In einer abgelegenen Höhle an der Küste verstecken sich die junge Louise und der Klavierstimmer Schmidt vor den Wirren des Weltkriegs. Zum Zeitvertreib tanzen sie Tango, die Begleitmusik singen sie selbst. Sie kommen sich näher, aber schon bald holt die Wirklichkeit sie ein. Erst Jahre später begegnen sie sich in Buenos Aires ein zweites Mal. Schmidt hat indes geheiratet, wird bald Vater, und so bleiben ihnen wieder nur der Tanz und die Lieder Carlos Gardels. Ein Schritt nach vorn: zwei Generationen später trifft die elegante Rosa, Schmidts Enkelin, auf den jungen Studenten Lionel, der in ihrem Restaurant in Wellington Teller wäscht. Auf den Spuren des Großvaters führt sie ihn in die Welt des Tangos ein, beschwört den Zauber der Vergangenheit herauf, und eine weitere Affäre nimmt ihren Lauf. Lloyd Jones verwandelt die melancholischen Klänge des argentinischen Tangos in kraftvolle, sinnliche Prosa. Tanzend verlassen seine Figuren den gewohnten Alltag, finden in der Fremde zueinander und entdecken die Heimat neu. Für die Dauer eines Liedes scheint alles möglich, auch wenn die Realität jenseits der Tanzfläche eine andere sein mag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lloyd Jones
Hier, am Ende der Welt, lernen wir tanzen
Roman
Aus dem Englischen von Grete Osterwald
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Jeder Tango beginnt mit einem Rückwärtsschritt: Neuseeland 1916. In einer abgelegenen Höhle an der Küste verstecken sich die junge Louise und der Klavierstimmer Schmidt vor den Wirren des Weltkriegs. Zum Zeitvertreib tanzen sie Tango, die Begleitmusik singen sie selbst. Sie kommen sich näher, aber schon bald holt die Wirklichkeit sie ein. Erst Jahre später begegnen sie sich in Buenos Aires ein zweites Mal. Schmidt hat indes geheiratet, wird bald Vater, und so bleiben ihnen wieder nur der Tanz und die Lieder Carlos Gardels.
Ein Schritt nach vorn: zwei Generationen später trifft die elegante Rosa, Schmidts Enkelin, auf den jungen Studenten Lionel, der in ihrem Restaurant in Wellington Teller wäscht. Auf den Spuren des Großvaters führt sie ihn in die Welt des Tangos ein, beschwört den Zauber der Vergangenheit herauf, und eine weitere Affäre nimmt ihren Lauf.
Lloyd Jones verwandelt die melancholischen Klänge des argentinischen Tangos in kraftvolle, sinnliche Prosa. Tanzend verlassen seine Figuren den gewohnten Alltag, finden in der Fremde zueinander und entdecken die Heimat neu. Für die Dauer eines Liedes scheint alles möglich, auch wenn die Realität jenseits der Tanzfläche eine andere sein mag.
Über Lloyd Jones
Lloyd Jones, geboren 1955 in Lower Hutt, Neuseeland, hat zahlreiche Romane und Erzählungen veröffentlicht und gehört zu den namhaften, vielfach preisgekrönten Autoren seiner Heimat. Sein Roman «Mister Pip» wurde in über 30 Sprachen übersetzt, mit dem Commonwealth Writers’ Prize ausgezeichnet und stand auf der Shortlist des Booker Prize 2007. «Die Frau im blauen Mantel» wurde für den Internationalen Literaturpreis 2013 nominiert.
Inhaltsübersicht
Für meine Familie
«Tango ist das Streben von Mann und Frau
auf der Suche nacheinander.
Es ist eine Suche nach Umarmung,
eine Form des Zusammenseins.»
Juan Carlos Copes, Choreograph und Tänzer
1
Elf Jahre lang besuchte ein älterer Mann mit einem Silberknauf am Spazierstock Louises Grab mit Blumen. Er kam jeden Samstag mit einem Plastikeimer, Bürste, Reinigungsmitteln und einem Faltstuhl aus Segeltuch. Er war immer tadellos gekleidet. Schwarzes Sakko, weiße Hose. Eine leuchtend rote Blume im Knopfloch betonte sein schneeweißes Haar.
Im Jahr vor seinem Tod hatte er die Gewohnheit angenommen, den Cementerio de la Chacarita in Begleitung seiner zehnjährigen Enkeltochter zu besuchen. Während er an Louises Grab saß und sich mit seinem Fedora das Gesicht fächelte, nahm seine Enkelin den Eimer und stellte sich mit den anderen Trauernden bei den Wasserhähnen an.
Er besaß ein eigenes Auto, aber für diesen Weg nahm Paul Schmidt lieber den Bus. Der Fahrer half ihm die Stufen hinunter. Derartige Unsicherheit oder Zögern kannte er auf der Tanzfläche nicht. Er konnte sich stets auf dieselbe Ermahnung verlassen: «Vorsicht, der Verkehr, Señor.» Mit einem abschätzigen Räuspern machte Schmidt sich auf, über die belebte Straße, zum Blumenstand an der Coronel Díaz.
Einen großen Betrug im Mittelpunkt seines Lebens, war Schmidt auf viele kleine Treueverhältnisse bedacht. Wie etwa zu jenem Busfahrer. Oder zu dem paraguayischen Blumenhändler, bei dem er regelmäßig blaue Schwertlilien kaufte.
Eines Samstagmorgens erblickte er in den Auslagen eines konkurrierenden Händlers eine bestimmte Blume – Ginster mit Hahnenfuß –, die eine alte Erinnerung in ihm weckte. Unter einigen Schwierigkeiten erhob er sich, während der Bus noch fuhr, von seinem Platz und stolperte an den Knien der neben ihm sitzenden Frau vorbei. Der Bus ruckte, und als seine Hände nach den von oben herabhängenden Schlaufen griffen, schepperte sein Spazierstock in den Gang. Er kümmerte sich nicht darum. Später erinnerte der Fahrer sich daran, wie Schmidt sich vorbeugte, die Hand haltsuchend auf der Schulter einer nicht protestierenden Frau, um durch die Heckscheibe einen Blick auf den zurückweichenden blühenden Ginster zu erhaschen.
An der nächsten Haltestelle (nicht seiner gewohnten) kämpfte Schmidt sich die Stufen hinunter. Der Fahrer holte ihn ein und reichte ihm seinen Stock. Der alte Mann schaute nur flüchtig hin, nahm ihn ohne ein Wort des Dankes. Der Fahrer lächelte. Zwischen ihnen bestand ein Einvernehmen, ja sie hatten auf der Grundlage von zwei vorhersehbaren Ereignissen in ihrer beider Leben sozusagen Freundschaft geschlossen. Das eine war die Busfahrt selbst, wo der Señor einstieg und wo er wieder ausstieg. Der andere signifikante Moment kam in der Woche vor Weihnachten, wenn der Señor ihm eine Kiste teurer Zigarren gab. Es geschah immer im letzten Augenblick. Während der Bus sich bremsend der Haltestelle näherte, wurden die Zigarren rasch zum Vorschein gebracht und ohne Getue übergeben, als könnte er nichts mehr damit anfangen; der Fahrer seinerseits nahm die Kiste stets mit Lauten von Dankbarkeit und falscher Bescheidenheit entgegen.
Jetzt verfolgte er durchs Busfenster den Weg des alten Mannes über die breite und belebte Straße. Er sah ihn seinen Stock gegen den fließenden Verkehr heben. Später sagte der Blumenverkäufer, der Señor habe mit «Augen, Gesicht und Erinnerung» so an seinen Blumen gehangen (nicht nur an dem gelb blühenden Ginster, wohlgemerkt, sondern an seinen Blumen), dass er den Getränkewagen aus der anderen Richtung nicht bemerkte. Unterdessen stieg, vom Fenster her, eine dumpfe Warnung in der Kehle des Busfahrers auf. Er schloss die Augen, um den Moment des endgültigen Aufpralls zu vermeiden. Es war eine Geschichte, die er oft erzählen sollte. Zuerst die Ablenkung. Wie dem alten Mann plötzlich das Blut zu Kopfe stieg. Dann seine Sturheit. Die durchbrochene Routine und – im Endergebnis – der Verlust der Zigarren zu Weihnachten. Es war ein Lehrstück.
2
Im Tod gibt es keine Geheimnisse. Auf dem Friedhof von La Chacarita werden die Reichen in riesigen Pharaonengräbern beigesetzt; ihre Mausoleen sind berühmten Kapellen nachgebildet. Gemeißelte Engel und Lautenspieler drehen Pirouetten in Beton und Gips. Bibelszenen sind verschwenderisch in Stein gehauen. Wenn die Lebensart der Reichen im Tod fortbesteht, gilt das Gleiche für die Armen, die einer am anderen, gequetscht und geschichtet, in massiven Wandgräbern untergebracht sind. Diese älteren Begräbnismauern bilden Innenwände auf dem Cementerio. Die neueren Gewölbe folgen den Entwürfen von Ladenpassagen. Die Toten liegen reihenweise dicht übereinander, Galerie um Galerie, und Treppen führen zwei oder drei Stockwerke unter die Erde zu Werkbänken und Friedhofsarbeitern in blauen Latzhosen, die ihre Besen schultern. Die Luft ist stickig vom süßlichen Geruch alter Blumen, die in den Handgriffen der Särge stecken.
Es gab fast nichts, was Schmidt sich nicht hätte leisten können. Seiner Witwe hatte eine kleine Familiengruft vorgeschwebt, vielleicht mit einem Orchestermotiv, um die Geschäftsinteressen der Familie zu symbolisieren.
Stattdessen war Schmidts letzter Wille zur großen Überraschung seiner Frau und der Familie ein schlichtes Begräbnis neben seiner treu ergebenen Ladengehilfin gewesen, einer unscheinbaren, stillen Person, der ‹Engländerin›, die Señora Schmidt einfach als Louise gekannt hatte.
Sie hatten Höflichkeiten ausgetauscht. Für richtige Gespräche musste man sich große Mühe geben. Das Spanisch dieser Frau war bestenfalls infantil. Wenn sie einkaufen ging, deutete sie auf die Ware, die sie haben wollte, steckte das Wort auf ihre Fingerspitze. Jetzt, da Schmidts Witwe versuchte, sich alle anderen Begegnungen mit ihr in Erinnerung zu rufen, waren die Gelegenheiten so kurz gewesen, dass nichts sonderlich Aufschlussreiches oder Enthüllendes hängengeblieben war.
Einmal, während eines Sommergewitters, hatte Schmidt die ‹Ladengehilfin› auf ihr Drängen hin im Taxi mitgenommen und an ihrer Wohnung abgesetzt. Seine Witwe erinnerte sich, zu einem grauen Gebäude mit einem rot-blauen Gipsrelief (einer Rosette, wie ihr schien) aufgeblickt zu haben, als das Gesicht der Ladengehilfin sich plötzlich ins Fenster senkte, um ihr für ihre Freundlichkeit zu danken. Sie hatte nasse, unbändige Haare, ein abgespanntes Gesicht mit schwarz verschmiertem Eyeliner an einem Augenwinkel. Niemand würde sie je eine klassische Schönheit nennen.
Louise war seit elf Jahren tot, aber eine alte Frau, eine ehemalige Nachbarin, erinnerte sich an die ‹Engländerin›. Wie verschlossen sie gewesen war. «Sie konnte nicht sprechen», rief die alte Frau. Und nein, sie suchte keine Freundschaft. «Was war mit Besuchern? Gab es viele?» Das Gesicht der Nachbarin wurde nachdenklich. Schmidts Witwe wollte ihr schon Geld bieten, aber dann redete die Frau: «Viele, nein. Nicht viele. Aber es gab einen …», und begann, den verstorbenen Ehemann zu beschreiben, seinen weißen Haarschopf, seine sanften Züge, die kastanienbraunen Augen, den Stock, die gepflegte Kleidung. «Sie wissen ja, wie das ist, Señora. Manche beschließen ihre Tage und haben die Zeit bezwungen. Andere treten immer noch auf der Stelle, wenn sie diese Welt verlassen. Der Señor gehörte zur ersten Kategorie.» Das Gespräch fand auf dem Treppenabsatz statt. Derweilen hörte man einen stetig tropfenden Wasserhahn. Dieser Ort war so heruntergekommen. Ihr Mann war immer so pingelig gewesen. Sie konnte ihn hier nicht unterbringen, auf diesem Treppenabsatz. Sie begann den Flur entlangzugehen, blieb stehen und schaute fragend zurück. «Dieses Zimmer am Ende?» Die Frau nickte. «Si, Señora, das ist es.» Sie dachte, er muss diesen Anblick gesehen haben, dasselbe kalte Licht, das durchs Fenster an der Stirnseite einfiel, dieselben kahlen Dielen, knarrend unter seinen Füßen. Aber was hatte er empfunden? Erregung? Herzklopfen? Die Nachbarin gesellte sich zu ihr. «Señora, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen den Hof zeigen. Manchmal saßen sie im Garten unter der Linde, der Gentleman und die fremde Frau. Der Baum ist nicht mehr da, muss ich leider sagen …»
Schmidts Witwe schüttelte den Kopf. Sie hatte genug gesehen und gehört. Sie war bereit, zu gehen. «Da ist noch was anderes», ergänzte die Nachbarin und begann den Tag zu beschreiben, als die Männer des Vermieters aufgetaucht waren, um die Sachen der Toten wegzuschaffen. Sie wirkte plötzlich hinterhältig und schob ihr Gesicht näher heran, um zu gestehen: «Ich steckte den Kopf durch die Tür, für einen Blick. Ich war auch neugierig.» Nun, es gab nicht viel auszuräumen. Ein Grammophon, einen Stapel Schallplatten, ein paar Kleidungsstücke, ein Paar schwarze Stilettos, «wie die Leute sie tragen, die im Ideal tanzen gehen». Die Witwe hatte Freunde, die dort tanzten. Jetzt fragte sie sich, ob die Freunde ihren Mann mit der Ladengehilfin gesehen und beschlossen hatten, nichts zu sagen. Die Nachbarin fuhr fort. Sie war einiges an Unordnung gewöhnt, aber was im Zimmer der Toten auffiel, waren die Dielen. Die stachen heraus. Wie lang sie waren, und mit ‹Schleifstellen› in der Mitte des Raums. Die Witwe fühlte ihre Augen brennen, als sie die nächste Frage ausstieß, aber sie musste sie stellen: «Die Fremde und der Señor tanzten gern? Ist es das, was Sie mir sagen wollen?» Die Nachbarin warf ihre Hände in die Luft. «Tanzen? Sie tanzten und tanzten. Oh, wie sie tanzten. Dann saßen sie im Garten, um sich auszuruhen, und dann tanzten sie wieder. Diese Frau sprach nicht. Sie tanzte nur.»
3
Niemand geht unbemerkt durchs Leben. Die panadería, in der sie ihre Brotstangen kaufte. Der Busfahrer. Der Zeitungsstand, an dem sie die englischsprachige Buenos Aires Herald bekam. Und natürlich war da Max. Der homosexuelle Max. Sein Gesicht neigte sich, um von seinen Stammkunden ein Küsschen auf jede Wange zu empfangen. Max, geschwollen wie ein aufgegangenes Soufflé unter seiner Kellnerjacke. Max mit seinem bartlosen Kinn. Den verständnisvollen kleinen Augen, die hinter seinen Brillengläsern glühten. Seine Leiche wurde jenseits der Avenida Moreau de Justo in einem ewigen Haufen von Plastikmüll und Flaschen am Anlegesteg gefunden, den Ellbogen gegen ein aufgedunsenes Schwein gedrückt.
In dem Café, wo Max bedient hatte, legten kleine Kinder mit erwachsenen Gesichtern am Ende spindeldürrer Körper spätnachmittags Feuerzeuge auf die Tische der Trinker. Die Trinker verscheuchten sie wie Schmeißfliegen. Sie klopften ihre Zigaretten an den Aschenbechern ab und gaben ihre nachdenklichen Antworten. Ein Mann mit halber Glatze, ja? Nein. Niemand konnte sich an Max erinnern. Dreißig Jahre lang hatte er hinter den Jalousien von La Armistad im Viertel Montserrat gearbeitet, doch niemand erinnerte sich an seinen Namen.
Zeit ist grausam, wenn auch notwendigerweise. Die Welt muss Raum schaffen für so viele Namen.
In den 1940er Jahren hatte ein junger Mann mit einem großen rosa Muttermal am Hals regelmäßig Kaffee auf einem silbernen Tablett für die Angestellten in Schmidts Laden an der Coronel Díaz gebracht.
Jahre später ist das Muttermal verblasst und krümelig wie eine verblühte Schmucklilie über einem ausgefransten, schmuddeligen Kragen. Seine Augen heben sich zu der gerunzelten Stirn, während er zurückdenkt.
«Si. Die Señora bestellte immer einen kleinen Schwarzen.»
«Einen kleinen Schwarzen?»
«Si, espresso.»
«Sonst nichts?»
Der Mann zuckte die Schultern; er reckte den Kopf und schürzte die Lippen; seine Augen senkten sich in die Grube der Erinnerung.
«Manchmal ein Gebäck», sagte er.
«Was für ein Gebäck?»
«Señora, es ist lange her.»
Louises Freunde, diejenigen, denen sie vertraute und zuhörte, auf die sie sich tagein, tagaus, Jahr um Jahr in ihrem einsamen Exil verlassen konnte, finden sich in mehreren Räumen eines restaurierten Palasts zwischen Piedras und Avenida Independencia. Troilo. Goyeneche. Gardel. Jeder mit einem eigenen Zimmer. An den Wänden sieht man ihre Fotografien. Die persönlichen Gegenstände sind ehrfürchtig zur Schau gestellt, eigentlich keine besonders interessanten Dinge – aber dass sie Gardel gehörten, bedeutet alles. So findet man eine lange Glasröhre, in der die Zahnbürste des Sängers steckte, seinen silbernen Schuhlöffel, einen Ring mit seinem eingravierten Bildnis, den der liebende Sohn seiner in Frankreich geborenen Mutter schenkte, seine französisch geschnittenen Krägen, seinen Stock, seine seidenen lengue; und da das kleinste Detail nicht übersehen werden darf, ist auch die Lochzange von Schalter Nummer 10, wo Gardel bei den Galopprennen im Hipódromo Argentino de Palermo immer seine Wetten setzte, mit dabei.
Dann sind da all die Fotos. Gardel wie ein Filmstar, sein allgegenwärtiges Lächeln, das mit Pomade zurückgekämmte Haar in dem Stil, den er in Mode brachte. Auf Gruppenfotos muss man nur den Brennpunkt suchen, und man weiß, wer Gardel ist. Es ist der mit dem strahlenden Lächeln, der dankbare Empfänger einer Jahrhundertstimme und universeller Liebe.
Louise war ein paar Jahre vor Gardels Tod, bei dem Flugzeugunglück in Kolumbien, nach Buenos Aires gekommen. Höchstwahrscheinlich befand sie sich unter den Hunderttausenden, die während seines Trauerzugs die Corrientes hinauf zum Cementerio de La Chacarita die Straße säumten. Die Prozession führte durch das Arbeiterviertel Almagro, wo sie wohnte. Sie erlebte dieses und andere wichtige historische Ereignisse: die Revolution, den Krieg, den Aufstieg von Juan und Eva Perón, Evitas Tod und einen noch größeren Trauerzug als den, der Gardel das letzte Geleit gegeben hatte. Gardels Anhänger und Verteidiger seines unantastbaren Rufs lassen sich keine Gelegenheit entgehen, darauf hinzuweisen, dass Buenos Aires bei Evitas Begräbnis viermal so viel Einwohner hatte wie zu Gardels Zeiten. Aber diese Ereignisse bilden ohnehin nur den Hintergrund. Sie gehören nicht zur Geschichte von Louise und Schmidt. Einen Einfluss hatten eher die Komponisten, die Sänger und Bandoneonspieler.
Andererseits war Gardel vielleicht ‹ein bisschen vor ihrer Zeit›, wie man so sagt. Gardel sollte man sich eher als den ‹Freund eines Freundes› vorstellen. Sie und Paul Schmidt waren sowohl zeitlich als auch dem Empfinden nach zwei anderen näher, Aníbal Troilo und Goyeneche.
Troilos Bandoneon liegt in der Troilo sala unter Glas. Sein berühmtester Tango ‹Danzarin› war eines ihrer Lieblingslieder. Von Louises übrigen Freunden sind Julio María Sosa durch seinen Remington-Rasierer, Sabina Olmos durch ihre Parfümfläschchen und Hugo Carril durch seine Toilettenartikel vertreten.
All die Tage und Nächte, die Schmidt zu Hause sein anderes Leben pflegte, das Feuer im heimischen Herd schürte, den Ehemann und Vater spielte, kauerte Louise vor ihrem 1938er RCA Victor Radio. Das Radio im Raum neben der Troilo sala sieht aus wie eine wunderschöne kleine Holzkapelle.
4
Rosa ist der Name des kleinen Mädchens, das auf dem Cementerio de La Chacarita immer Schlange stand, um den Wassereimer zu füllen.
Zusammen mit ihrem Großvater stieg sie an der Ecke Paraguay und Coronel Díaz in die Linie 39. Der Bus kannte den Weg zum Friedhof – sie fuhren unter den Baumkronen der Honduras entlang, rumpelten über die Eisenbahnschienen mit all dem liegen gebliebenen Müll, an den Männern vorbei, die unter einem alten Blechdach Fleisch am Spieß grillten, vorbei an den Märkten. Bevor sie von der Maure auf die Corrientes abbogen, schaute ihr Großvater immer durch das Fenster auf der rechten Seite nach den beiden Mietshäusern, die wie Abschussrampen auf einer planierten Fläche standen. Der Friedhof war die Endstation der Buslinie. Nach dem Aussteigen starrte Rosa die breite Treppe zum Eingang des Cementerio hinauf. Es war, als würde man ein Opernhaus betreten, erhaben und verheißungsvoll. Das Zupfen an ihrem Arm war ihr Großvater. Sie hatte vergessen, Blumen mitzubringen. Also kauften sie bei einem Blumenhändler an der Guzmán Jasmin, den Rosa auf Gardels Grab legen konnte.
Für ein Kind ist der Tod eine etwas unglaubwürdige Geschichte. Die Gruften. Die schwebenden Engel. Die Friedhofsarbeiter. Die in Grün, die das Laub sammeln. Die in Blau mit Schrubbern und Eimern, um die Stufen der riesigen, pompösen Familiengräber zu wischen. An einem Sommermorgen spähte Rosa die schattige Treppe hinunter in einen Schrein aus Licht. Unmöglich, sich vorzustellen, dass etwas so Kleines wie eine Blumenvase ein ganzes Leben enthalten sollte. Und einmal, als sie einen Verehrer eine Zigarette für die bronzene Hand des berühmten Sängers anzünden sah, begriff sie, dass Gardel nicht ganz so tot war, wie alle behaupteten.
Es war die Sache danach, auf die sie sich freute – wenn ihr Großvater den Grabstein seiner alten Ladengehilfin fertig gewaschen hatte und sie ins El Imperio de la Pizza gingen. Nichts hat sich verändert. Heute zieht das Lokal sich um die Ecke von zwei belebten Straßen. Die aufgestoßenen Türen lassen Abgase und gelegentlich einen Durchzug frischer Luft herein.
Rosa und Schmidt setzten sich immer an denselben Tisch, mit Blick aus den Türen nach draußen, über die Avenida Corrientes hinweg auf die Palmen vor dem großen Eingang zum Friedhof. Der alte Mann ließ sich auf den Stuhl sinken, als hielte er ihn für seine letzte Ruhestatt. Ein schwerer Seufzer, und sein Gesicht erstarrte. Mehrere lange Minuten richtete Rosa ihre Aufmerksamkeit auf die riesigen Metallfächer, die sich in den Drahtkäfigen drehten; blieb geduldig und respektvoll sitzen, bis ein Zucken durchs Gesicht ihres Großvaters fuhr und ein Lächeln hervorbrachte. «Bin ich eingenickt? Nein. Hab ich geschnarcht? Ich hab doch nicht geschnarcht, oder?» Ungefähr jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem der älteste unter den Kellnern beschloss, aufzublicken, um sie zu entdecken und sich mit einem von schlechten Zähnen geschluckten Lächeln ihrem Tisch zu nähern.
Es gab immer eine herzliche Begrüßung. Genau wie seinen Busfahrer und den Blumenverkäufer bedachte Schmidt auch seinen Kellner zu Weihnachten. In einem Jahr kam der Kellner mit ihrer Pizza an den Tisch gehumpelt und klagte über Arthritis im Hüftgelenk. Sein Motorroller brauchte eine Reparatur, die er sich nicht leisten konnte. Was bedeutete, dass er zu seiner Arbeit im El Imperio laufen musste. Nachdem der alte Mann sich hinkend mit dem silbernen Tablett entfernt hatte, hinterließ Schmidt ihm an diesem Tag außer dem üblichen Trinkgeld einen Umschlag mit der nötigen Summe für die Reparatur. Rosa hatte beobachtet, wie ihr Großvater die Scheine herauszählte, bis er ihren Blick bemerkte. Einen Finger auf die Lippen gelegt, sagte er: «Kein Wort zu deiner Großmutter.»
Die Ausflüge nach La Chacarita nahmen mit dem Tod des Großvaters ein Ende. Danach führte ihre Großmutter sie auf eine hoffnungslose Suche durch die Stadt. Ganze Tage wurden damit zugebracht, in Taxis ein- und wieder auszusteigen, um an alten Häusern mit verstaubten Fenstern hinaufzuschauen. «Hier war es, wo dein Großvater und ich 1926 gewohnt haben … Hier gingen wir sonntags immer so gern Mittag essen … Hier, das ist die Wohnung, in der ich mit deinem Vater schwanger war …»
Aber an diese Landschaft zu glauben, war noch schwieriger als an die Skulpturen auf dem Friedhof.
Das Lagerhaus, in dem ihr Großvater sein erstes Geschäft eröffnet hatte, war jetzt, völlig unerklärlich, eine parrilla. Rosa starrte in das Fenster und hörte ihre Großmutter die Tubas, Klaviere, Bandoneons und Gitarren anordnen. Schließlich hielt ein genervter Restaurantbesucher mitten im Satz oder mit einem halben Mundvoll inne, starrte finster zurück, und weg waren sie, um sich draußen vor die nächste Adresse zu stellen. Ein Café, ein Kleiderladen, ein Möbelhaus, alle waren einst Teil des Familienimperiums im Handel mit Musikinstrumenten gewesen. Jetzt war die Landschaft transformiert. Ohne Erinnerung. Alles, was sie von ihrer Ehe wiederzufinden hoffte, war unter neuen Schichten verschwunden. So hatte auch die Stadt sie betrogen.
Unvermeidlich endete der Ausflug vor dem letzten verbliebenen Geschäft, das von Schmidts Sohn geführt wurde, einem vergleichsweise stumpfen und einfallslosen Mann. Sein einziges nach außen gerichtetes Interesse galt dem Fußballclub Almagro. Roberto Schmidt und die Musik waren nicht füreinander geschaffen. Aber wie sein Vater war er ein großzügiger Mensch, der seiner Tochter keinen Wunsch abschlagen konnte. Also rannte Rosa, sobald sie wieder bei dem Geschäft ankamen, zu ihrem Vater und bettelte um Süßigkeiten, während die alte Frau allein draußen blieb, die Augen auf den Familiennamen SCHMIDT geheftet, der in erhabenen Goldbuchstaben über den Schaufenstern prangte.
Ihre Großmutter erzählte wieder und wieder dieselbe Geschichte. Sie war neunzehn Jahre alt gewesen, als sie sich auf eine Anzeige hin als Sekretärin bewarb. Sie hatte nie jemanden erlebt, der so hart arbeitete wie Rosas Großvater. «Es war, als wollte er verlorene Zeit aufholen.»
«Und natürlich sprach er ein kratziges Spanisch.»
Das war das Erstaunlichste, was Rosa je über ihren Großvater gehört hatte. Sie hörte diese Geschichte vielleicht zum dritten oder vierten Mal, als sie den Mut aufbrachte, zu fragen, warum ihr Poppa so ‹kratzig› Spanisch sprach, wie die Großmutter es ausdrückte.
«Er kam aus Bournemouth. Sein Vater war Glasbläser.»
«Dann war er also Engländer?»
«Nun, Schmidt ist ein deutscher Name, nicht wahr?»
Die alte Frau leierte diese Fakten mit wachsender Ungeduld herunter, als wäre das alles längst bekannt.
«Sein Vater war Deutscher. Ein deutscher Glasbläser. Dein Poppa war Klavierstimmer, als er emigrierte.» Die alte Frau schaute weg, das Gesicht verschlossen über einer halb vergessenen Erinnerung an die Ladengehilfin. Sie fügte hinzu: «Jeder kommt irgendwoher, Rosa. Sogar Schmetterlinge.»
Bei einem ihrer Ausflüge ließ Rosa ihre Großmutter auf einer Bank sitzen, während sie sich ein Eis holen ging. Es war ein heißer Dezembernachmittag, und ein ganzer Pulk drängte sich um den Eismann. Zurückblickend sah sie, dass ihre Großmutter des Wartens müde geworden war. Sie lag auf der Seite. Als Rosa schließlich zu der Bank zurückkehrte, war die alte Frau eingeschlafen, und sie setzte sich daneben, um ihr Eis zu essen. Vanille mit tollen Erdbeerkringeln. Ihr Lieblingseis. Sie aß es auf, leckte sich die Finger ab und wartete. Sie wartete, bis sie beschloss, ihre Großmutter habe genug geschlafen. «Nanna, wach auf. Nanna, wir müssen gehen.» Sie zog ihre Großmutter am Ärmel. Sie packte ihren Arm. Als sie ihn losließ, fiel er wieder zurück. Ein junger Mann, ein arbeitsloser Lehrer in abgewetztem Anzug, blieb stehen. Er redete sanft mit Rosa, dann hockte er sich neben den Kopf der alten Frau. Nachdem er ihren Puls gefühlt hatte, stieß er seinen Atem langsam pfeifend zwischen den Lippen aus. Er schaute Rosa an, schnalzte mit der Zunge. Er zog ein Bonbon aus der Tasche, das sie auswickelte und in den Mund steckte. Erdbeer und Banane. Wer hätte das gedacht …
Der Tod brachte immer neue Überraschungen.
Die alte Frau wurde auf dem Cementerio de la Chacarita begraben. Und als wollte sie die Ladengehilfin übertrumpfen, hinterließ sie die Verfügung, ihre Gebeine an der Seite ihres Ehemanns zu betten. Da sie zu Lebzeiten kaum eine einzige Nacht getrennt voneinander verbracht hatten, sah sie keinen Grund, im Tod etwas daran zu ändern, auch wenn es bedeutete, sich mit der ‹anderen Frau› neben ihnen abzufinden. Die Inschrift auf ihrem Grabstein lautet: Im Tod wie im Leben.
5
Wer genau hinschaut, findet das Kind im Erwachsenen und umgekehrt. Das Kind, dem Schmidt kein Eis und kein Ponyreiten abschlagen konnte und das einmal weinte, weil die Eltern sein Zimmer blau gestrichen hatten, ohne es zu fragen, ist zugleich die Frau mit den flammenden schwarzen Augen und den sturen Beinen, deren Art zu sagen «Ich sehe kein Tischtuch auf Tisch 6!» bei den Kellnerinnen hektische Betriebsamkeit auslöste, eilfertig darauf bedacht, das Versehen zu korrigieren.
Ich war neunzehn Jahre alt, gerade erst in die Stadt gekommen, ein Student, der einen Job brauchte. Rosa war sechsunddreißig. Bis heute kann ich mir Rosa nicht ohne eine Zigarette in der Hand vorstellen. Ich kann ihr gehobenes Kinn heraufbeschwören, bevor sie einen Rauchring an die Decke entließ. Der Raum über ihrem Kopf war immer in eine Dunstwolke gehüllt. Sie rauchte noch, als Rauchen nicht mehr angesagt war. Niemand, den ich kannte, rauchte. Wir tranken, aber aufgeklärt, wie wir nun waren, rührten wir keine Zigaretten an. Bei Rosa, hatte man das Gefühl, konnte eine Ausnahme gemacht werden. Es war verzeihlich, weil sie fremd war, und weil sie fremd war, rauchte sie. Eine Zigarette war ebenso wichtig für ihr Selbstgefühl wie der üppig rote Lippenstift, den sie betont dick auftrug. Rosas Aussehen und ihr akzentgefärbtes Englisch – eine zwanglose Mischung aus flachen australischen Vokalen (ihre Familie war nach Sydney ausgewandert, als sie achtzehn gewesen war) und dunkleren Spuren von etwas anderem, Italienisch, Spanisch oder was auch immer in Argentinien gesprochen wurde (ich wusste es damals nicht) – gehörten ebenfalls zu den Reizen des La Chacra. Rosa war fremd. Und ausländische Restaurants waren in Mode. La Chacra war das erste, wo es Ofenkartoffeln mit Sauerrahm gab. Der Salat wurde separat in einem Schälchen serviert. Niemand kommentierte diese kleinen Unterschiede. Es war schick, so zu tun, als hätten wir den Salat schon immer aus Schälchen gegessen. Die La-Chacra-Salate enthielten auch Blüten. Ich fand sie zerquetscht, beiseitegeschoben in den Schälchen, die zu mir in die Küche zurückwanderten. Manche nahmen eine Blüte in den Mund und schlossen die Augen in der Hoffnung, das Richtige zu tun und nicht etwa einen Prozess in Gang zu setzen, an dessen Ende ihnen eine Primel aus dem Hintern wachsen würde. Die andere Besonderheit am La Chacra war die Musik. Argentinische Musik. Tangomusik. ‹Mi Buenos Aires Querido›. ‹Adiós Muchachos›. ‹Tomo y Obligo›. ‹Mi Noche Triste›. ‹Viejo Rincón›. Lauter klassische Tangos, die Gardel in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts berühmt gemacht hatte, die aber in Buenos Aires heute noch Bestandteil fast jeder Tangosammlung sind.
Ich hörte sie zum ersten Mal in den späten Stunden beim Töpfe- und Pfannenscheuern. Troilo, Gardel und Goyeneche waren Hintergrundgeräusche – ein Bandoneon hier, dann eine honigsüße Stimme am Rand des Stimmengewirrs, während die englischsprachigen Gäste ihre argentinischen Steaks zersägten und sich über die mit leeren, von Kerzenwachs tropfenden Chianti-Flaschen dekorierten Tische hinweg anschrien.
Die letzte Stunde der Schicht eines Tellerwäschers ist die schlimmste. Sie zieht sich ewig hin. Der Minutenzeiger auf der Uhr scheint von unsichtbarer Hand gebremst zu werden. Dann, wenn du fast auf dem Nullpunkt bist, stapeln sich plötzlich die Pfannen und laufend kommen welche nach, als nähme es kein Ende. Zu allem Übel schlüpfen die Bedienungen in ihre Mäntel, und es ist schwer, nicht in Selbstmitleid zu verfallen, wenn die letzte von ihnen «Ciao» ruft und hinausrennt zu ihrem Freund, der im Auto auf sie wartet. Dies war auch die Zeit, zu der im Restaurant eine andere kleine Schicht anbrach, von der nur wenige etwas wussten. Dann nämlich drehte Rosa die Stereoanlage auf, und bei den ersten herzzerreißenden Takten von ‹Mi Buenos Aires Querido› hatte ich schnell vergessen, wozu ich eigentlich da war – Pfannen zu scheuern und die Spülmaschine zu füttern. Ich vergaß das alles und versank in den wundervollen Zupf- und Schrammelmelodien, die sich mir so einprägten, dass ich am Ende mitsingen konnte.
Ich war erst seit einer Woche da, und in dieser Zeit hatte ich Rosa eine Bedienung feuern sehen, die einmal zu oft zu spät gekommen war. Ich hatte ihren Wutanfall erlebt, nachdem eine große Gesellschaft, für die sie Extra-Vorbereitungen getroffen, mehr Vorräte eingekauft und zwei zusätzliche Kellnerinnen angeheuert hatte, telefonisch abgeblasen worden war (später am selben Abend feuerte sie die Kellnerinnen), und ich hatte gelernt, den Kopf einzuziehen und sicherzustellen, dass die Arbeitsflächen abgewischt waren und ich die Küche blitzblank verließ. Ich hatte nicht mehr als zwei Worte mit Rosa gesprochen, aber das alles sollte sich ändern.
Es war an einem anderen Abend mitten in der Woche, nachdem ich meine schmutzige Schürze auf den Wäschehaufen geworfen hatte und nach vorn ins Restaurant kam, dass ich Rosa mit ihrer Zigarette tanzen sah. Sie kehrte mir den Rücken zu. Trotzdem erkannte ich die kreisförmige Haltung ihrer Arme, das glimmende Ende der Zigarette ungefähr im Abstand eines Tanzpartners. Das war es, was sie tat. Sie tanzte. Ich wünschte, sie hätte es nicht getan, weil es ein so intimer Moment war, den ich als potenziell gefährlich abgespeichert hatte. Rosa würde es nicht mögen, ertappt zu werden. Doch wenn ich schnell genug wäre, könnte ich mich unbemerkt zur Tür hinausstehlen und ihr die Peinlichkeit wie mir den Jobverlust ersparen.
Genau das wollte ich gerade tun, als sie über die Schulter nach hinten schaute und mich ohne das geringste Anzeichen von Scham oder Entwürdigung, ohne jede Regung, von der ich angenommen hatte, sie würde sie empfinden, die ich an ihrer Stelle mit Sicherheit empfunden hätte, einen Augenblick so ansah, als versuchte sie sich zu erinnern, wer ich sei. Meistens hatte Rosa die unruhige Energie einer Amsel in der Hecke. Ganz Augen, Brust und zuckende Füße. Die Zigarette in der Hand machte sie gebieterisch, Katharina die Große mit pechschwarzem Haar. Urteilendes Ermessen zog in ihr Gesicht ein. Ihre Augen wurden schmal, wie eben jetzt. Ihr Blick wanderte zur Tür, und sofort schien sie zu wissen, was ich gedacht hatte. Es folgte ein kurzes Schnauben – als wäre sie gerade zu einer Einschätzung der Fakten gekommen, die unsere Leben trennten: Sie war sechsunddreißig, verheiratet, und ich ein unbedarfter neunzehnjähriger Student. Sie führte ein eigenes Restaurant. Ich war der Tellerwäscher. Diese Unterschiede traten hervor und verblassten, während sie die Zigarette wieder in den Mund steckte und mich zu sich winkte – und da war es wie bei jeder anderen Anweisung, die eine Chefin ihrer Hilfskraft erteilt.
«Ich muss tanzen», sagte sie.
Ich dachte, sie habe diesem Gedanken ganz allgemein, ins Blaue hinein Luft verschaffen wollen. Ich bezog ihn nicht unbedingt auf mich. Aber dann schnippte sie mit den Fingern und gab mir zu verstehen, ich solle kommen.
«Ich kann nicht», sagte ich.
Sie warf mir einen seltsamen Blick zu.
«Ich kann nicht tanzen», erklärte ich.
«Jeder kann tanzen.»
«Ich nicht.»
«Dann hast du eine Verletzung?»
«Nein», sagte ich.
«Bist du vielleicht krank?»
«Nein, Rosa, ich bin nicht krank.»
«Dann kannst du auch tanzen.» Schon suchte sie nach einem Platz für ihre Zigarette.
Ich hatte keine Wahl. Mit einem triumphierenden kleinen Lächeln schlüpfte sie in meine Tellerwäscherarme.
«Danke, Pasta.»
Das war die andere Sache, die mir passierte und neu für mich war. Ein Spitzname, den Angelo, der Koch, mir wegen meines großen Appetits auf Pasta gegeben hatte.
«Leg deine Arme um mich.»
Ich tat, was sie sagte; ich spürte ihren rauchigen Atem in meinem Gesicht.
«Richtig rum, bis nach hinten», wies sie mich an. «Die argentinische Art ist, enger zu tanzen. Bei der anderen kommt es einem vor, als trügen zwei Menschen einen Wasserkanister zwischen sich herum. Das ist nichts für mich.»
Es lief ‹Mi Noche Triste›. Sie summte mit, während sie wartete – und wartete.
Sie sagte mir etwas ins Ohr. Sie flüsterte.
«Du machst ja gar nichts.»
«Ich sagte doch, ich kann nicht tanzen.»
«Jeder kann tanzen.»
«Ich nicht.»
Rosa ließ sich nicht so leicht beirren. Wir traten auseinander, damit sie die nötigen Korrekturen machen konnte. «Du musst die Knie ein wenig beugen. Nicht zu sehr. Nur so.» Sie schaute mir in die Augen, um zu sehen, was darin schlummerte. Ich fühlte ihre Hand mein Kinn zurechtrücken. «Du bist nicht entspannt. Wie willst du tanzen, wenn du nicht entspannt bist? Atme!», kommandierte sie. Ich atmete. «Gut. Also, besser. Jetzt fängst du an, dich zu entspannen, ich merke es.» Sie wies mich an, die Hände auf ihre Schultern zu legen und sie im Gehen rückwärts zu führen. Und als ich ein einziges Mal nach unten schaute, fragte sie: «Hast du was verloren? Hast du was über den Boden rollen hören? Nein. Also warum guckst du nach unten?»
«Tut mir leid.»
«Das braucht es nicht. Du fängst ja erst an.»
Und dann: «Jetzt versuch, um mich herumzugehen. Aber geh, als wolltest du durch mich hindurch. Wenn du mich trittst, bin ich selber schuld. Kein Problem.»
Das machte mich nun wirklich stutzig. Sie hatte eine Kellnerin wegen etwas viel Geringerem gefeuert, wegen etwas, was eher ihre eigene Unbeherrschtheit unterstrich. Ich konnte mich nicht entspannen. Ich war extrem nervös.
«Warte», sagte sie und löste sich, um ihre Zigarette wegzubringen. Vom Tisch aus blickte sie zurück und lächelte, als wäre ihr eben wieder meine tollpatschige Jugend eingefallen.
«Lionel, du bist immer noch nicht ganz entspannt, oder?»
«Nein.»
«Also, wie willst du tanzen, wenn du nicht entspannt bist? Komm.»
Sie starrte auf meine Hände und lächelte, als ich sie mit einer hölzernen Bewegung wieder in meine Arme treten ließ. Wir waren jetzt so nahe aneinander, dass ich ihre Oberschenkel an den meinen fühlen konnte. Ihre Brüste drückten gegen meine Rippen. Auf den Takt begann ich zu gehen und sie rückwärts zu führen. Zu meiner Überraschung funktionierte es. Rosa war ein weichendes Hindernis. Sie bewegte sich mit erstaunlicher Leichtigkeit. Absolut gekonnt. Zu meinem Glück war ‹Almagro› das letzte Stück auf der Kassette, und als es zu Ende war, befanden wir uns am Empfang, wo sie mich losließ.
Aus den Lautsprechern hörte ich es surren. Einen Moment lang dachte ich, sie würde ein neues Band einlegen. Stattdessen schweifte ihr Blick irgendwo in Richtung Bar.
«Ich habe Lust auf ein Glas Wein», sagte sie. «Willst du auch etwas?»
Ich schaute umständlich auf meine Uhr. Es war schon spät. Aber das war nicht das Problem, als das ich es ausgab. Verlegen erzählte ich ihr, ich hätte eine frühe Vorlesung, was zwar stimmte, jedoch nichts zur Sache tat. Sogar in meinen eigenen Ohren klang es wenig überzeugend, doch bevor ich umschwenken konnte, ging Rosa schon zur Tür.
«Natürlich», sagte sie. «Du musst gehen. Es ist Zeit. Sieh nur, wie spät es ist, und ich halte dich auf. Geh.»
Sie war schnell gegangen, viel zu schnell; jetzt wartete sie an der Tür, dass ich ging.
Während meiner kurzen Zeit als Küchenhilfe im La Chacra waren Gerüchte über Rosas Ehe umgegangen. Wenn die Kellnerinnen nach hinten kamen, um in der Lieferbucht zu rauchen und zu schwatzen, hörte ich sie über Ivan reden. Ein paar Mal war ich noch am Putzen, als er im Restaurant vorbeikam, um Rosa abzuholen. Das erste Mal brachte ich gerade Angelos Pfannen raus, da drückte er sich an der Tür herum. Ich war weniger überrascht darüber, wie er aussah, als wie er nicht aussah. Ich hatte jemand Älteren erwartet. Oder meine ich eigentlich jemanden, der selbstbewusster wirkte? Jemanden, der sich nicht scheuen würde, Rosa über die Tanzfläche zu führen. Ivan trug einen unförmigen Wollpullover. Seine Hände hingen schlaff in den Taschen. Die Koteletten waren zu buschig. Ein Blick auf den schlurfenden Ivan, und man wusste, warum der Restaurantbetrieb Rosa überlassen blieb. Er fühlte sich so offensichtlich unwohl, da zu sein. Ein Jammerlappen, dachte ich.
Rosa blickte von ihrer kleinen Rechenmaschine auf, sah mich und rief quer durch das leere Restaurant: «Sag unserer neuen Küchenhilfe guten Tag. Er heißt Lionel.» Ivan hob die Hand und schaute weg. Er wollte es wirklich nicht wissen. Er wollte nur wieder raus. Er klimperte mit Kleingeld in der Tasche, während er darauf wartete, dass Rosa endlich zumachte. Aber das konnte sie nicht, bevor ich hinten fertig war. In der Zwischenzeit kümmerte sie sich freundlich und besorgt um ihn. «Ivan, setz dich doch und trink etwas. Bis du fertig bist, ist Lionel auch so weit. Nimm dir einen Brandy. Oder ein Wasser, irgendwas.»
Ivan zuckte nur die Schultern und klimperte mit seinen Münzen in der Tasche.
Dann sah ich ihn eine Weile gar nicht. Wir alle nahmen an, er säße wartend zu Hause vor dem Fernseher oder läge im Bett herum. Der Name Ivan fiel immer seltener. Ich war seit einem Monat dort, als abends eine Kellnerin nach hinten kam und sagte, Rosa habe Kay die Aufsicht übertragen, weil sie Ivan zum Flughafen fahren müsse. Wir entnahmen dem, dass es aus war mit der Ehe. Ivan flog nach Melbourne zurück. Oder war es Sydney? Jemand sagte, Ivan treibe sich mit jugoslawischen Betrügern herum. Ivan war gleichbedeutend mit schmutzigen Geschäften geworden. Deshalb waren wir um Rosas willen alle froh, dass sie sich diesen Stachel endlich aus dem Fleisch gezogen hatte.
Für Rosas Rückkehr wurde eine Wetterwarnung ausgegeben. Alle stimmten überein, dass dies kein guter Zeitpunkt war, sie um irgendwas zu bitten oder zu spät zu kommen. Wir machten uns auf einen Feuersturm gefasst. Daher war es eine Überraschung, dass sie eher bedrückt wirkte; nun gut, auch damit hätten wir rechnen können. Es war vorbei, und selbst wenn die Ehe schlecht gewesen war (wie wir beschlossen hatten), war ein gewisses Maß an Kummer doch verständlich. Kay, die älteste der Kellnerinnen (sie mag vielleicht zweiunddreißig gewesen sein), gab den Ton an, indem sie leise sprach und sich überhaupt bewegte wie auf einer Intensivstation. Sie hatte selber eine kaputte Ehe hinter sich. «Glaubt mir, einmal und nie wieder.» Ihre ruhige, zupackende Art drang bis in die Küche. Die Teller wurden behutsam abgesetzt statt im Stapel hingeknallt. Angelo kam extra zu mir an die Spüle gelaufen, statt einfach loszubrüllen, wann er die Fleischpfanne wiederhaben könne.
Manche Dinge blieben genauso wie zuvor. Die niedrig hängende Rauchwolke über Rosas Kopf. Wenn ich innehielt, um gute Nacht zu sagen, zwang sie sich zu lächeln, verabschiedete sich mit einem schnellen «Gute Nacht, Pasta» und kehrte an ihre Rechenmaschine zurück. Insgeheim wünschte ich mir, ich hätte die Einladung zu einem Drink angenommen. Ich hätte meine Nervosität einfach schlucken und mich auf den Moment einlassen sollen. Denn das andere, was sich verändert hatte und worauf ich Rosa aufmerksam machen wollte, war die Musik. Aus welchem Grund auch immer drehte sie die Musik nicht mehr auf, wenn die letzte Bedienung Schlag Mitternacht nach draußen gerannt war. So verbrachte ich die späte Stunde scheuernd, ohne den Balsam von Troilo, Gardel und Goyeneche.
Ich beschloss, Rosa darauf anzusprechen, und eines Abends rief ich ihr im Hinausgehen in ihrer Nische zu: «Was ist mit der Musik passiert, Rosa? Sie fehlt mir.»
Sie hob den Blick nicht von den Ziffern, ihre flüsternden Lippen bewegten sich bis ans Ende der Zahlenreihe auf dem Ausdruck der Rechenmaschine. Es war nur eine Sache von Sekunden, aber ich hatte das Gefühl, sie mit einer unverzeihlichen Trivialität gestört zu haben. Schließlich blickte sie auf und musterte mich durch den grauen Rauch.
«Was willst du? Willst du tanzen?»
«Ja», sagte ich, obwohl es nicht stimmte. Das meinte ich nicht. Mir fehlte nur die Musik.
Dennoch hatte ich erwartet, sie würde angenehm überrascht sein, das zu hören. Stattdessen blieb ihr Ausdruck völlig unverändert. Sie drückte nur ihre Zigarette in einem Aschenbecher aus. In der Grundschule hatte immer ein Junge auf dem heißen Asphalt gesessen und rote Ameisen unter der Fingerspitze zu Brei zerquetscht. Ebenso genüsslich drehte Rosa ihren Finger, um eine Zigarette auszudrücken.
«Also», sagte sie nach langer Überlegung. «Ich glaube nicht.» Das war alles, was sie sagte. Sie steckte sich eine neue Zigarette in den Mund und tastete zwischen den Papierkringeln der Rechenmaschine nach ihrem Feuerzeug. Damit war die Sache offenbar erledigt. Ich nickte. Für mich war es nur gut so. Besser sogar. Es war eine riesige Erleichterung. Ich hatte das Richtige getan. Jetzt konnte ich gehen. «Obwohl», sagte sie. «Wenn du interessiert bist …»
Die Amsel in der Hecke hielt plötzlich still, ihre Augen funkelten mich an.
«Ja», hörte ich mich sagen.
«Dann musst du ein paar Stunden nehmen. Die Stunden kann ich arrangieren, und dann tanze ich vielleicht mit dir.»
6
D