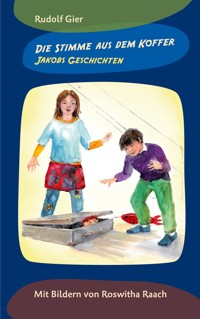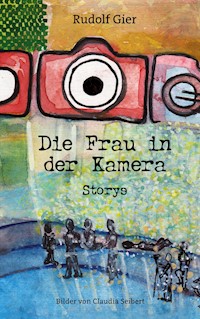
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dreizehn bizarre Geschichten, aufgeteilt in drei Abschnitte, enthält der Band Die Frau in der Kamera. Die Storys des ersten Teils, »Verfluchter Alltag«, erzählen realistische Begebenheiten. Da treffen sich zum Beispiel zwei alte Freunde wieder. Der eine hat sich beruflich etabliert, der andere hängt seinen Jugendträumen nach. In Erinnerungen schwelgend fachsimpeln die beiden über ihre unterschiedlichen Musikgeschmäcker und begeben sich damit auf ein gefährliches Terrain. Im zweiten Abschnitt »Hirngespinste« konfrontiert der Autor seine Protagonisten mit fantastischen Plots. In der Titelgeschichte macht sich Jonas Pfeifer mit einer alten Spiegelreflexkamera auf den Weg. Als er eine Frau fotografiert, passiert es: Die Person verschwindet wie im Zaubermärchen von der Bildfläche, und eine ungewöhnliche Liaison nimmt ihren Lauf. »Aus der schönen neuen Welt« lautet das Motto des dritten Teils. Helge Wolf, dessen Frau verstorben ist, erhält einen Haus¬haltsroboter, der ihm unter die Arme greifen soll. Schon bald zeigt sich, dass der Androide seinem Besitzer nicht nur haushälterisch, sondern auch in ethisch-moralischen Fragen haushoch überlegen ist. ¬Unabhängig von Genres und Sujets rollt der Autor groteske Situationen auf. Unterhaltsam und augenzwinkernd, häufig auch mit einer Prise Melancholie, schreibt er in einem Stil, den man als skurrilen magischen Realismus bezeichnen könnte. Visuell in Szene gesetzt werden die Texte durch Aquarelle der Malerin Claudia Seibert. Sie vermeidet bewusst, die Geschichten realistisch zu illustrieren. Gegenständliche Elemente aus den Texten kombiniert sie mit abstrakten Formen und leuchtenden, in mehreren Schichten gestalteten Farbflächen. Die Bilder öffnen damit den Blick für Lesarten jenseits des Oberflächlichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Dreizehn bizarre Geschichten, aufgeteilt in drei Abschnitte, enthält der Band Die Frau in der Kamera. Die Storys des ersten Teils, »Verfluchter Alltag«, erzählen realistische Begebenheiten. Da treffen sich zum Beispiel zwei alte Freunde wieder. Der eine hat sich beruflich etabliert, der andere hängt seinen Jugendträumen nach. In Erinnerungen schwelgend fachsimpeln die beiden über ihre unterschiedlichen Musikgeschmäcker und begeben sich damit auf ein gefährliches Terrain.
Im zweiten Abschnitt »Hirngespinste« konfrontiert der Autor seine Protagonisten mit fantastischen Plots. In der Titelgeschichte macht sich Jonas Pfeifer mit einer alten Spiegelreflexkamera auf den Weg. Als er eine Frau fotografiert, passiert es: Die Person verschwindet wie im Zaubermärchen von der Bildfläche, und eine ungewöhnliche Liaison nimmt ihren Lauf.
»Aus der schönen neuen Welt« lautet das Motto des dritten Teils. Helge Wolf, dessen Frau verstorben ist, erhält einen Haushaltsroboter, der ihm unter die Arme greifen soll. Schon bald zeigt sich, dass der Androide seinem Besitzer nicht nur haushälterisch, sondern auch in ethisch-moralischen Fragen haushoch überlegen ist.
Visuell in Szene gesetzt werden die Texte durch Aquarelle der Malerin Claudia Seibert. Sie vermeidet bewusst, die Geschichten realistisch zu illustrieren. Gegenständliche Elemente aus den Texten kombiniert sie mit abstrakten Formen und leuchtenden, in mehreren Schichten gestalteten Farbflächen. Die Bilder öffnen damit den Blick für Lesarten jenseits des Oberflächlichen.
Rudolf Gier, 1957, lebt als Autor, Videofilmer und Medienpädagoge in Münster. Er schreibt für Kinder und Erwachsene, veröffentlicht in Zeitschriften, Anthologien und im Rundfunk. 2016 erschien das Kinderbuch Luis und das Abenteuer im Regenbogenland.
Claudia Seibert, 1960, arbeitet als Künstlerin und Pädagogin. Neben großformatigen Bildern malt sie Aquarelle, zum Teil in seriellen Reihen. Eines ihrer Projekte ist in dem Buch 114 Skulpturenstücke dokumentiert.
Inhalt
I. Verfluchter Alltag
That‘s Jazz
Bärwalds Berechnungen
Digitally remastered
Verloren
Sochlers Hochzeit
II. Hirngespinste
Tigermücke
Die Frau in der Kamera
Kammerspiel zu dritt
Geräusche
III. Aus der schönen neuen Welt
Ein neuer Freund des Menschen
Kontrolle 6
Neukonfiguration
Leben hinter Glas
I.
Verfluchter Alltag
That’s Jazz
Baumann hatte sich nichts dabei gedacht, als er sein Tenorsaxofon vor fünfzehn Uhr aus dem Koffer nahm. Wer sollte schon etwas dagegen haben, wenn er ausnahmsweise ein bisschen früher spielte? Naja, was hieß hier spielen! Baumann war, obwohl schon Mitte dreißig, ein Anfänger auf dem Instrument. Er war noch auf der Suche nach einem sauberen, eigenständigen Ton. Spielen bedeutete für ihn im Wesentlichen, Skalen rauf und runter zu leiern oder rhythmische Übungen zu absolvieren, die ihm sein Lehrer aufgegeben hatte. Seine Technik steckte noch in den Kinderschuhen.
Die ersten Töne, mit denen er sich nur vergewissern wollte, ob mit dem Instrument alles in Ordnung war, klangen schrill. In diesem Moment klingelte es. Baumann legte das Saxofon beiseite und öffnete. Kreye, ein Nachbar, stand vor der Tür und war offensichtlich erregt.
»Was fällt Ihnen ein, während der Mittagsruhe so einen Lärm zu veranstalten!«
Kreye war Anfang sechzig und vor einigen Jahren frühpensioniert worden. Er wohnte schon viel länger in dem Haus als Baumann. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hatte er noch volles Haar. Seitenscheitel, gepflegtes Äußeres und dezentes Auftreten gaben ihm einen seriösen Anstrich. Er wirkte nicht einmal unfreundlich und war bisher nie aufdringlich geworden. Umso mehr verwunderte es Baumann, dass er nun derart heftig auf ihn einredete.
»Meine Frau steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, und da kommen Sie uns mit Ihrem gnadenlosen Getöse!«
Baumann wusste, dass er noch nicht gut spielen konnte, und die Sache war ihm peinlich. Er entschuldigte sich. Aber Kreye ließ nicht locker: »Bis fünfzehn Uhr will ich hier keinen Ton mehr hören, ist das klar!«
Baumann nickte beschämt und sah, wie Kreye sich umdrehte und wieder die Treppe hinaufging. Dann fiel oben die Wohnungstür ins Schloss.
Noch nie hatte sich Kreye direkt zu seinen musikalischen Versuchen geäußert, aber Baumann spürte jedes Mal, wenn sie sich im Hausflur begegneten, wie sehr Kreye daran Anstoß nahm. Das Nachbarschaftsverhältnis zwischen ihnen hatte sich jedenfalls, nachdem Baumann das Instrument vor ein paar Monaten angeschafft hatte, erheblich verschlechtert. Dabei war Kreye, was diese Geschichte anbelangte, vermutlich noch nicht einmal der Hauptdrahtzieher, sondern es war seine Frau. Sie verhielt sich Baumann gegenüber immer mit zur Schau gestellter Freundlichkeit. »Guten Morgen, Herr Baumann, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag«, pflegte sie zu sagen. Dabei gehörte Erfolg nicht gerade zu Baumanns Markenzeichen. Im Gegenteil: Er hatte seine Stelle verloren und durchlebte gerade eine berufliche und persönliche Misere, was ihr nicht entgangen sein konnte. Es war zynisch, ihm in dieser Lage einen »erfolgreichen Tag« zu wünschen.
Als vor einigen Monaten Baumanns Frau ausgezogen war, kam die Schnepfe gleich mit einer spitzen Bemerkung um die Ecke. »Guten Tag, Herr Baumann, ich hoffe, Ihrer Ehepartnerin geht es auch gut. Richten Sie ihr doch bitte herzliche Grüße von mir aus, wenn Sie sie das nächste Mal sehen.«
Allein an der verstellten Stimme glaubte Baumann ihren Charakter zu erkennen. Alles, was nicht ihrem Weltbild entsprach, schien sie zu verachten. Offensichtlich stand sein Saxofonspiel ganz oben auf ihrer roten Liste.
Er hatte schon länger den Verdacht, dass sie ihn belauschte. Die Decken und Wände waren dünn, und sein Geblase konnte man überall im Haus wahrnehmen. Aber während die anderen Nachbarn es ignorierten und sich nicht weiter daran störten, hatte sie offensichtlich nichts Besseres zu tun, als jeden Ton, den er von sich gab, mit arroganten Sprüchen zu kommentieren. Immer wenn er danebengriff oder schlecht intonierte, stampfte sie auf den Fußboden.
Baumann war davon verunsichert. Er schämte sich regelrecht für seine miserablen Übungseinheiten, verlor an Selbstvertrauen, und die Sache machte ihm immer weniger Spaß. Er musste feststellen, dass er in den letzten Wochen kaum Fortschritte erzielt hatte und sein Spiel zunehmend stagnierte, ein Trend, den er zu einem guten Teil den beiden Nervensägen ankreidete.
Aber er hatte keine Lust, sich das Instrument von den Spinnern vermiesen zu lassen. Allein aus Trotz würde er weitermachen. Um Punkt fünfzehn Uhr nahm er das Saxofon und legte von Neuem los.
Mit der Wut im Bauch, die sich angestaut hatte, spielte er kraftvoller und zupackender als zuvor. Er fing an zu experimentieren. Das hatte er sich noch nie getraut. Er dachte nicht mehr so viel darüber nach, ob er die Töne traf. Er spielte einfach. Diese »Das-wollen-wir-doch-mal-sehen-Improvisation« ermutigte ihn und wirkte befreiend. Es klang gar nicht so schlecht. Und vor allem: Er war richtig laut.
Erneut klingelte jemand. Baumann ging zur Tür.
»Was wollen Sie denn schon wieder? Die Mittagspause ist längst rum.« Kreye hatte sich vor ihm aufgebaut wie ein Boxer, was gar nicht zu seiner gediegenen Erscheinung passte. Bestimmt war er wieder von seiner blöden Schnepfe geschickt worden.
»Diesen höllischen Lärm nennen Sie spielen?«
»Davon verstehen Sie nichts, Herr Kreye, das ist Jazz!«
»Von Ihnen muss ich mich nicht belehren lassen, Herr Baumann. Ich habe jahrelang als Toningenieur beim Swing-Orchester der Bundeswehr gearbeitet.«
Baumann erinnerte sich an ihre erste Begegnung. Kreye hatte erwähnt, dass er Berufssoldat gewesen war, ohne näher darauf einzugehen. Es hatte Baumann auch nicht sonderlich interessiert. Immerhin konnte sich Kreye eine große Wohnung leisten, und er fuhr einen dicken Mercedes. Folglich musste er mindestens Offizier gewesen sein. Dass er bei der Bundeswehr als Toningenieur gearbeitet hatte, hörte Baumann zum ersten Mal.
»Glauben Sie mir, Herr Baumann, ich kenne mich aus mit Jazz. Glenn Miller, Woody Herman, Duke Ellington, Count Basie, um nur einige große Namen zu nennen. Oder, um bei Ihrem Instrument zu bleiben: Lester Young. Das ist Jazz. Ihr Geblase hat nicht das Geringste damit zu tun.«
»Schon mal was von Charlie Parker, John Coltrane oder Archie Shepp gehört?«
»Charlie Parker ist mir ein Begriff. Und wenn ich mich recht erinnere, spielte er nicht Tenor-, sondern Altsaxofon. Mit dem Dreck, den er absonderte, Bebop genannt, nahm der Untergang oder zumindest eine lang andauernde Stagnation des Jazz seinen Anfang. Drogenabhängige schreiben keine Musikgeschichte, mein Freund, das müssten Sie als Sozialarbeiter doch eigentlich wissen, auch wenn Sie gegenwärtig nicht in der Lage sind, Ihren Beruf aktiv auszuüben.«
Baumann war nicht entgangen, dass Kreye auf seine Arbeitslosigkeit angespielt hatte, und konterte. »Auch wenn Sie dem Staat als Frühpensionär auf der Tasche liegen, haben Sie mir keine Vorschriften zu machen, was und vor allem wie ich spiele.«
Kreye gab sich unbeeindruckt. »Baumann, tun Sie mir einen Gefallen: Verkaufen Sie Ihr Instrument. Sie sind gänzlich untalentiert, und jede Sekunde, die Sie darauf verwenden, ist verschwendete Zeit. Das sage ich Ihnen als Jazzexperte und Toningenieur. Und als Nachbar, der sich den ganzen Tag diesen unprofessionellen Scheiß anhören muss, gebe ich Ihnen einen guten Rat: Machen Sie noch heute damit Schluss!«
Baumann schlug Kreye die Tür vor der Nase zu. »Na schön, das kannst du haben, Arschloch«, dachte er und nahm sein Saxofon. Ohne jegliche musikalische Absicht blies er kraftvoll hinein. Er wollte nur eins: laut sein und Kreye beweisen, dass er sich von ihm nicht herumkommandieren ließ.
Keine zwei Minuten vergingen, da klingelte es nervtötend. Kreye hielt den Knopf gedrückt, bis Baumann öffnete.
Diesmal fuchtelte Kreye mit einer Handfeuerwaffe herum, die er vermutlich noch aus seiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr hatte. Ob die Knarre geladen war, konnte Baumann nicht einschätzen.
»Sofort das Saxofonfeuer einstellen, Baumann, sonst knallt’s! Ich fackle nicht lange und werde dich standrechtlich erschießen!«
»Jetzt ist es passiert«, ging es Baumann durch den Kopf, »der Typ dreht durch.« Er nahm die Hände ein wenig hoch und versuchte Kreye zu beschwichtigen.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Dass Kreye wirklich abdrücken würde, konnte sich Baumann nicht vorstellen. Aber ganz auszuschließen war es nicht.
Kreye blickte Baumann einen Moment irre an. Glücklicherweise ließ er die Waffe dann in seine Hosentasche verschwinden und ging in seine Wohnung zurück.
Nach diesem Vorfall machte Kreye ihm nie wieder eine Szene. Im Gegenteil: Wenn sie sich im Hausflur begegneten, begrüßte ihn Kreye, distanziert zwar, aber höflich. Manchmal schien er Baumanns Namen vergessen zu haben oder ihn mit jemand zu verwechseln. »Guten Morgen, Herr Babel«, sagte er dann.
Als Baumann wieder eine Arbeitsstelle fand, verlor das Saxofon für ihn an Bedeutung. Immer seltener holte er es aus dem Koffer, und irgendwann spielte er gar nicht mehr. Ansonsten nahmen die Dinge ihren Lauf. Baumann fand eine neue Lebensgefährtin, und Kreyes Frau verstarb.
In den Wochen danach ging es mit Kreye rapide bergab. Bald schlurfte er gebeugt durch den Hausflur. Beim Treppensteigen musste er sich am Geländer festhalten. Aus dem einst jung gebliebenen Offizier im Ruhestand war ein alter Mann geworden. Er hatte jede Feindseligkeit abgelegt und gab sich zurückhaltend, beinahe sanftmütig. An manchen Tagen konnte er richtig nett sein. Wenn Kreye sich vor Baumann die Treppe hochquälte, hielt er an, trat zur Seite und machte Platz.
»Gehen Sie ruhig vor, ich habe Zeit. Wo ich Sie gerade sehe, Herr Babel, was macht eigentlich Ihr Saxofon?«
»Ich heiße nicht Babel, sondern Baumann. Und Saxofon spiele ich schon lange nicht mehr, Herr Kreye. Ich habe es verkauft.«
»Oh, das ist aber schade. Sie hatten echt Talent, Herr Baumann. Als Sie noch spielten, glaubte ich manchmal, den einschmeichelnden Ton des grandiosen Lester Young zu hören.«
Baumann war sich bewusst, dass die Einschätzung nichts bedeutete und von einem alten Mann stammte, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte. Außerdem mochte er keinen Swing. Aber er hatte Lust bekommen, Jazz zu hören. Er ging zu seinem CD-Regal und zog ein Album von John Coltrane heraus. Es war eine Aufnahme aus Coltranes Hard-Bob-Phase Ende der fünfziger Jahre.
Das leidenschaftliche Tenorsaxofon ertönte. In rasendem Tempo jagten die Noten dahin, schlugen wie metallene, gläserne und splitternde Klangflächen aneinander. Coltrane spielte sein Instrument, als ob er es in Stücke reißen wollte, und das Einzige, was man von ihm erwarten konnte, war das Unvorhersehbare. Baumann liebte diesen feurigen Sound und erinnerte sich wehmütig an sein eigenes Saxofon, von dem er sich leichtfertig getrennt hatte.
»Ich habe zu schnell aufgegeben«, dachte er. Natürlich, er hätte Musikern wie Coltrane nie das Wasser reichen können. Aber ganz schlecht war er auch nicht gewesen, und bestimmt hätte er das Zeug zu einem guten Gelegenheitsmusiker gehabt.
Eines Morgens öffneten Polizeibeamte die Wohnung von Kreye. Einer Nachbarin, die gegenüber wohnte, war die ungewöhnliche Stille im Treppenhaus aufgefallen. An Kreyes Tür horchend hatte sie keinerlei Lebenszeichen vernommen.
Kreye lag tot auf seinem Sofa, mit geschlossenen Augen und entspanntem Gesichtsausdruck. Vermutlich war er eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht.
Zu seinem Begräbnis erschienen nur wenige Personen, neben Baumann lediglich ein paar weitere Nachbarn aus dem Haus sowie ein Neffe.
Offenbar hatte Kreye kaum Freunde, und seine Kinder und Verwandten sahen keine Veranlassung, zu seiner Beerdigung zu erscheinen. Durch seine schroffe Art und mit tatkräftiger Unterstützung seiner boshaften Frau hatte Kreye es offensichtlich geschafft, sich Menschen, die an seinem Leben vielleicht hätten Anteil nehmen können, vom Hals zu halten.
Am folgenden Tag meldete sich Kreyes Neffe bei Baumann und übergab ihm ein großes dünnes Päckchen. Es war in Papier eingeschlagen und beschriftet mit: Für Herrn Babel.
»Das habe ich bei meinem Onkel gefunden. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass er am Ende seines Lebens etwas durcheinander war. Erst kürzlich hat er mir von Ihnen und Ihren musikalischen Ambitionen erzählt. Ich schätze, mit Herr Babel sind Sie gemeint. Das Päckchen lag auf dem Tisch am Sofa. Vermutlich war es das Letzte, womit mein Onkel sich beschäftigt hat, bevor er verstorben ist.«
Baumann bedankte sich, ging in seine Wohnung zurück und öffnete das Päckchen. Kreye hatte ihm eine seiner Schallplatten von Lester Young vermacht. Baumann betrachtete das Cover, das mit einer Schwarz-Weiß-Fotografie schön gestaltet war. Das Foto zeigte den berühmten Swing-Saxofonisten, den Kreye häufiger erwähnt und offensichtlich sehr bewundert hatte, mit voller Hingabe in Aktion.
Es war fast eine Ewigkeit her, dass Baumann eine Vinyl-Scheibe in seinen Händen gehalten hatte. Ein alter Plattenspieler stand aber noch im Regal. Er hob den verstaubten Deckel an, zog die Platte aus dem Cover, legte sie auf den Teller, brachte den Tonarm in Position und setzte vorsichtig die Nadel auf.
Als er das Knistern und die ersten Töne vernahm, fühlte er sich in längst vergangene Zeiten versetzt. Kein Wunder, die Aufnahmen des Albums stammten aus den dreißiger Jahren, der Blütezeit des Swing.
Noch nie hatte sich Baumann ernsthaft darauf eingelassen, diese Art von Musik, die er eigentlich nicht mochte, zu hören. Aber nun war er mit einem Mal positiv überrascht. Der zarte lyrische Ton Lester Youngs, seine leidenschaftlichen und zugleich introvertiert anmutenden Improvisationen, die Fähigkeit, sich wie ein Maler auf das Wesentliche zu konzentrieren und keine Note zu viel zu spielen, all das ließ ihn als Wegbereiter des modernen Jazz à la John Coltrane erscheinen.
Spätestens bei dem Stück »Honeysuckle Rose« wippte Baumanns rechter Fuß im Takt. Dazu ließ er seine Fingerkuppen über die Tischplatte tanzen, und sein Kopf sowie der gesamte Oberkörper gerieten in verzückte rhythmische Bewegungen. Die Musik, die er bislang bestenfalls belächelt hatte, begann ihn zu begeistern. Sie verbreitete auf geheimnisvolle Weise gute Laune, und Baumann fing an zu verstehen, wie unerschöpflich die Spielarten des Jazz waren.
»Trotz starker Gegensätze hätte es durchaus Gemeinsamkeiten zwischen mir und Kreye geben können«, ging es Baumann durch den Kopf. Dafür war es nun leider zu spät.
Immerhin, der zeitweise verstockte Nachbar hatte ihn dazu gebracht, den Swing nicht länger zu ignorieren. Und jetzt bedauerte er, dass der alte freundliche Herr so plötzlich verstorben war.
Bärwalds Berechnungen
Bärwald schob die EC-Karte in den Schlitz und tippte den Geheimcode ein. Eine Weile passierte nichts, und er spürte, wie seine Anspannung stieg. Jedes Mal, wenn er Geld abheben wollte, beschlich ihn das ungute Gefühl, dass der Automat sich weigern könnte, den gewünschten Betrag herauszugeben. Im schlimmsten Fall würde obendrein die Karte einbehalten.
Diesmal schien die Sache gut auszugehen. Der Monitor bot Beträge zwischen hundert und tausend Euro an. Er wollte vierhundert Euro mitnehmen und drückte die entsprechende Taste. Der Automat reagierte prompt und spuckte die Karte aus.
»Scheiße!«, fluchte Bärwald. Er hatte Angelika versprochen, nach Dienstschluss zum Supermarkt zu fahren. Aber er besaß nur noch zehn Euro Bargeld. Den Einkauf konnte er vergessen.
Knapp eintausendsiebenhundert Euro erhielt er jeden Monat von seinem Arbeitgeber überwiesen. Seit sie Joshua bekommen hatten, musste er den größten Teil des Einkommens allein bestreiten. Angelikas Verdienst aus ihrem Teilzeitjob reichte noch nicht einmal für die Miete. Berücksichtigte man alle anderen regelmäßigen Ausgaben für Dinge wie Lebensmittel, Kleidung, Versicherungen, Zeitungsabonnement, Friseur, Zigaretten, Kneipen- und Kino besuche, mussten nach seiner Schätzung am Monatsende rund fünfhundert Euro übrig bleiben. Aber so war es nie. Sein Konto geriet regelmäßig in die Miesen, und er wurde das Gefühl nicht los, dass ihm ein beträchtlicher Teil seines Geldes durch die Finger rieselte.
Er hatte beschlossen, wenigstens die notwendigsten Dinge zu besorgen. Während er den Einkaufswagen durch die Gänge des Supermarktes schob und ein paar Sachen hineinlegte, erinnerte er sich daran, wie er einmal als kleiner Junge zehn Pfennig gefunden hatte. Er malte sich aus, was er dafür alles bekommen konnte. Eine Wundertüte, Brause, Gummibärchen, Lakritz … Nachdem er eine Verkäuferin fragend angeblickt und ihr sein Geldstück gezeigt hatte, deutete sie auf eine Kugel Kaugummi. Weil er nicht wahrhaben wollte, dass er für zehn Pfennig so wenig bekam, ging er zu einem Süßigkeitenregal, schnappte sich blitzschnell eine Tafel Schokolade und schob sie unter den Pullover. Er ging zur Kasse und bezahlte das Kaugummi. Obwohl seine Hände zitterten, bemerkte niemand seinen Diebstahl. Zu Hause aß er die Schokolade heimlich auf. Danach traute er sich tagelang kaum vor die Tür. Oft stand er am Fenster und schaute hinaus, in Erwartung der Polizei, die in seiner Vorstellung jeden Augenblick vorfuhr, um ihn abzuholen.