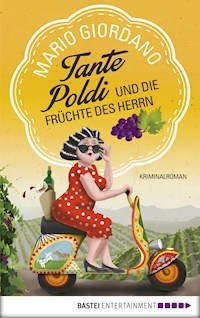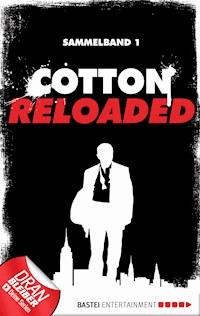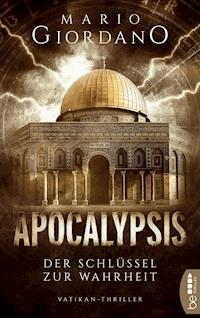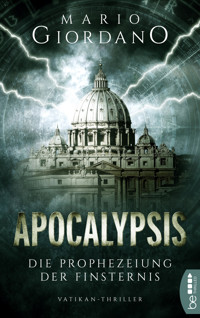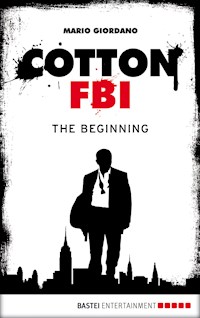9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Carbonaro-Saga
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, drei Generationen, drei Schicksale - eine mitreißende Familiensaga von großer erzählerischer Wucht.
Pina will herrschen. Anna will singen. Maria will Hosen tragen.
Drei Frauen der deutsch-italienischen Familie Carbonaro erzählen ihre Geschichte: Sie erzählen von einem archaischen Sizilien Ende des 19. Jahrhunderts, vom Fluch ihrer Vorfahrinnen, von Wundern, Illusionen und kleinen Triumphen. Von Liebe und Gewalt, von schönen Schneidern, Scharlatanen und traurigen Gespenstern. Sie erzählen von Flughunden und Krähen, von Sizilien und Deutschland, von Heimat und Fremdsein, Bombennächten und Bienenstich - und davon, wie das Glück sie immer wieder fand. In einem gewaltigen Bilderbogen lässt Mario Giordano die bewegten Schicksale dreier Frauen erstehen, die unbeirrbar ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben verfolgen. Und er nimmt uns mit auf eine Reise von Sizilien nach Deutschland, die ein ganzes Jahrhundert umspannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Pina will herrschen. Anna will singen. Maria will Hosen tragen.
Drei Frauen der deutsch-italienischen Familie Carbonaro erzählen ihre Geschichte: Sie erzählen von einem archaischen Sizilien Ende des 19. Jahrhunderts, vom Fluch ihrer Vorfahrinnen, von Wundern, Illusionen und kleinen Triumphen. Von Liebe und Gewalt, von schönen Schneidern, Scharlatanen und traurigen Gespenstern. Sie erzählen von Flughunden und Krähen, von Sizilien und Deutschland, von Heimat und Fremdsein, Bombennächten und Bienenstich – und davon, wie das Glück sie immer wieder fand. In einem gewaltigen Bilderbogen lässt Mario Giordano die bewegten Schicksale dreier Frauen erstehen, die unbeirrbar ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben verfolgen. Und er nimmt uns mit auf eine Reise von Sizilien nach Deutschland, die ein ganzes Jahrhundert umspannt.
Weitere Informationen zu Mario Giordano finden Sie am Ende des Buches.
Mario Giordano
DIE FRAUEN DER FAMILIE CARBONARO
ROMAN
Originalausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung März 2024
Copyright © der Originalausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign GbR
Umschlagmotiv: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung von Motiven von Bridgeman/Touring Club Italiano/UIG; Adobe Stock/asetrova; buxdesign Bildarchiv
CN · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26102-3V002
www.goldmann-verlag.de
Ciuri, ciuri, ciuri di tuttu l’annu L’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Blumen, Blumen, Blumen das ganze Jahr.
Die Liebe, die du mir geschenkt hast,
ich schenk sie dir zurück.
Sizilianisches Volkslied
Ich brauche keine Millionen, Mir fehlt kein Pfennig zum Glück … Ich brauche weiter nichts Als nur Musik, Musik, Musik.
Marika Rökk: »Musik, Musik, Musik«
FAMILIE CARBONARO
Pina Passalacqua: * 1884, Obstgroßhändlerin
Barnaba Carbonaro: * 1880, ihr Mann, Obstgroßhändler
Rosaria Russo-Passalacqua: * 1849, Pinas Mutter
Pancrazia Carbonaro: * 1864, Barnabas Mutter
Anna Mangano-Carbonaro: * 1913, Schneiderin
NinoCarbonaro: * 1910, ihr Mann, Sohn von Pina und Barnaba
MariaCarbonaro: * 1933, Obstgroßhändlerin
Weitere Kinder von Anna und Nino:
ToniCarbonaro: * 1935, Reiseleiter
GuiseppeCarbonaro: * 1937, Schneider
Aurora Carbonaro: * 1939, Sängerin
Angela Carbonaro: * 1946, Reiseleiterin
Franz Aschenbrenner: * 1933, Sohn von Barnaba Carbonaro. Einzelhändler
DIE FAMILIE CARBONARO
PINA, ANNA, MARIA
Drei Frauen erwarten mich im Haus der Zeit, in einem staubigen salotto irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie sitzen nebeneinander auf einem Sofa, meine Urgroßmutter Pina, meine Großmutter Anna und Tante Maria. Nonna Anna und Zia Maria sehen immer noch so aus, wie ich sie in Erinnerung habe – frisch und aufgeräumt, von Heiterkeit erwärmt wie von einem inneren Licht, das kein Kummer löschen kann. Meine Urgroßmutter Pina Carbonaro dagegen kenne ich nur aus den Anekdoten meines Vaters und den Hunderten von Fotos, die die Geschichte meiner Familie erzählen wie unzuverlässige Zeugen, die keinen Ärger wollen. So wie sie vor mir sitzt, schätze ich Pina auf Anfang vierzig. Sie ist klein, geradezu winzig, aber kerzengerade, in dem schwarzen Mantel mit Pelzkragen und dem altmodischen Hut wirkt sie einschüchternd streng. Bis ich sehe, wie sie verstohlen ihren Fingerstumpf reibt. Auch Gespenster haben nicht oft Gelegenheit für Begegnungen im Haus der Zeit.
Ich weiß, wo ich bin, nur nicht, wie ich hierhergekommen bin, doch die Frage stellt sich nicht. Solange ich davon erzählen kann, ist es real. Überall liegt Staub. Als fingerdicke Schicht bedeckt er Boden und Mobiliar, rundet Kanten und Erinnerungen, dämpft den Schlag eines ängstlichen Herzens. Im trägen sizilianischen Nachmittagslicht, das durch die Stores vor den Fenstern fällt, wird er zu einem Schleier, der sich niemals lüftet.
Der salotto ist kleiner, als er auf den Schwarz-Weiß-Fotos im Album meiner Eltern erscheint. Vielleicht liegt es an den gerafften Vorhängen mit Troddeln und Quasten, die den ganzen Raum einschnüren. Ich stehe auf einem gesprungenen Fliesenboden mit Jugendstilornamenten aus glasiertem sizilianischem cotto, die Wände sind mit Jugendstilmotiven bemalt, erotische Szenen mit Nymphen und jungen Knaben. Die Möbel dagegen sind dunkel und schwer, wie für Zyklopen getischlert. Ein monströser runder Esstisch aus poliertem Nussholz. Wuchtige Sessel mit Brokatpolstern, grün und gold, stehen breitbeinig auf Löwenfüßen wie alt gewordene Stutzer. In einer Glasvitrine klirrt dafür eine Menagerie aus Murano-Nippes, bayerischen Maßkrügen und Mokkatässchen aus feinstem Porzellan bei jedem Schritt, als tuschelten sie miteinander.
Ich weiß, wo ich bin. Mein Vater Toni Carbonaro hat mir oft von dem Haus seines Großvaters in Catania erzählt, mit den Gespenstern und den dreißig Zimmern und Sälen am Corso Sicilia, dort, wo sie später den Betonklotz der Banco di Sicilia ins Herz der Stadt gerammt haben.
Meine Urgroßmutter, meine Großmutter und meine Tante sitzen dicht nebeneinander vor mir auf einem Sofa mit Löwenfüßen und sehen fern. Denn vor ihnen, auf einem Küchenschemel, steht ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher, in dem eine Musikshow der RAI aus den Siebzigerjahren läuft. Celentano und Raffaella Carrà singen »Prisencolinensinainciusol«, einen Rocksong in einem erfundenen Kauderwelsch-Amerikanisch. Die beiden tanzen wie Götter eines freundlicheren Universums, der Song selbst ist so albern wie genial. Mein Vater, Toni Carbonaro, konnte ihn auswendig und hat ihn bei jeder, wirklich jeder Gelegenheit zum Besten gegeben. Es ist eine meiner ersten und letzten Erinnerungen an ihn. Mein Hals wird eng, mir kommen die Tränen, aber ich kann nicht wegsehen.
»Was singen sie da?«, fragt meine Urgroßmutter.
»Das ist Englisch, nonna«, sagt Tante Maria.
Die drei sprechen Italienisch, aber ich verstehe sie gut. Als der Song endet, lächelt meine Großmutter mich an.
»Machst du bitte aus, tesoro?«
Ich finde den Ausschaltknopf nicht gleich, der Fernseher erstirbt mit einem elektrischen Seufzer.
»Ist das Tonis Sohn?«
»Ja, mamma«, sagt nonna Anna zu ihrer Schwiegermutter.
»Warum sieht er aus wie ein bracciante?«
»Das ist die Mode heute, nonna«, erklärt Tante Maria.
»Was für eine Mode soll das bitte sein, wenn sie aussehen wie Feldarbeiter? Hat er keinen Anzug und keinen Binder? Und was sind das für Schuhe?«
Mein ganzes Leben schon trage ich Sneaker, Jeans, Hemd und Jackett, aber zum ersten Mal ist es mir nun peinlich.
»Soll ich wieder gehen?«
»Hol dir mal einen Stuhl, tesoro«, sagt meine nonna. »Wir haben nicht viel Zeit und wollen mit dir reden.«
Staub wirbelt auf, als ich mir einen der Sessel heranziehe.
»Du musst keine Angst haben.«
»Hab ich nicht.«
Meine Urgroßmutter mustert mich streng.
»Du erzählst Geschichten«, beginnt Tante Maria. »Von der Familie. Von deinem Urgroßvater.«
»Das meiste ist erfunden«, nuschele ich, wie zu meiner Verteidigung.
»Das hast du von deinem Vater«, sagt nonna Anna milde.
»Lügengeschichten«, sagt Pina.
Ich will widersprechen, doch Zia Maria hebt die Hand und wendet sich zu ihrer Mutter.
»Weißt du noch, wie Toni im Luftschutzbunker die Geschichte vom Großen Ossobuki erzählt hat, immer und immer wieder?«
Meine Großmutter nickt. »Er hat uns zum Jodeln gebracht.«
Sie glucksen.
»Kschsch!«, zischt meine Urgroßmutter, und die beiden schweigen. Dann wendet sie sich an mich.
»Hast du keinen Beruf gelernt?«
Ich schüttele den Kopf. Meine Urgroßmutter seufzt.
»Wie viel sind sechzehn Prozent von siebenhundertfünfzig?«
»Keine Ahnung«, stammele ich.
»Streng dich an.«
Ich quäle mich mit der Kopfrechenaufgabe ab. Die ganze Zeit über geht mir immer noch der Song durch den Kopf.
Ai ai smai senflecs Eni go for doing
Peso ai Prisencoli
Nensinainciusol
Ol rait.
Ich kann den Text auswendig, seit ich elf bin. Ich habe tausend Namen vergessen, Gesichter, Geburtstage und wie man Brüche kürzt, aber nie diesen Song. Wegen diesem Song, der eine Welt erschafft, in der Trost nicht nur ein Versprechen ist, wollte ich von meiner Familie erzählen.
»Hundertzwanzig?«
»Keine Ahnung vom Rechnen, aber willst Geschichten erzählen.«
Unbehaglich richte ich mich auf. »Ich möchte jetzt gehen.«
»Kschsch!«, zischt jetzt Tante Maria, und ich plumpse zurück in den Sessel.
»Was wollt ihr von mir?«
Nonna Anna lächelt mich weiterhin an, warm wie die Maisonne.
»Wir wollen dich ermutigen.«
Meine Urgroßmutter reibt ihren Fingerstumpf. »Wir wollen, dass du uns nicht vergisst«, sagt sie. »Wir sind zu oft vergessen worden.«
Ich weiß, wo ich bin. Dies ist das Haus der Zeit, dort, wo Vergangenheit und Zukunft verschmelzen. In den Zimmern, Sälen, Kammern und Nischen sitzen die Geister eines vergangenen Jahrhunderts, raunen sich Dinge zu und runden die Kanten. Eines Tages werde ich einer von ihnen sein oder bin es bereits. Die drei Frauen vor mir sind meine Familie. Ich bin hier, um ihnen zuzuhören.
PINA CARBONARO
Giardini Naxos, Sizilien 1896
Von den dreiundzwanzig Kindern, die ich geboren habe, haben sechs überlebt, geliebt habe ich jedoch nur die anderen. Sie hießen Salvatore, Antonino, Maria, Rosaria oder Ignazio. Es waren Zyklopen darunter, fischschwänzige Sirenen, Faune, Elfen und durchscheinende Zwitterwesen wie ganz aus Milch und Nebel. Sie alle waren zu zart oder zu fremd für diese Welt. Nach einer Woche vergingen sie einfach, still und ohne Klage, als ob sie sich in der Tür geirrt hätten. Von ihnen blieben nur ihre Namen, denn immer, wenn ein Kind starb, gab ich dem nächsten seinen Namen. So haben wir es gehalten. Aber auch die Namen haben mir nicht helfen können, meine überlebenden Kinder zu lieben. Jedenfalls nicht so, wie eine Mutter ihre Kinder lieben sollte.
Seit ich zwölf bin, wollte ich Kinder, viele Kinder. Ein ganzes Volk wollte ich erschaffen, herausgekommen ist nur eine Familie. Mit zwölf Jahren war ich ein Kind ohne Kindheit. Ein Mädchen, das nie lachte und zwei Schatten warf. Denn wie alle Frauen der Familie Carbonaro bin auch ich eine Nachfahrin von Nymphen und Sirenen.
Als wir vor langer Zeit unsere umbrandeten Felsen und kristallenen Quellen verließen, um in die Hütten der Fischer und Schäfer einzuziehen, folgten wir dem Versprechen, dass sie uns zuhören würden. Und wurden betrogen, ein ums andere Mal. Was auch immer wir wollten, die Männer sagten: Du darfst nicht, du kannst nicht, glaub mir, du magst auch gar nicht. E basta. Von den Nymphen und Sirenen Siziliens blieb nichts als ein Schatten zurück, sichtbar nur für uns Frauen. Es ist der Schatten einer milchigen Zwischenwelt, nach der wir uns unser ganzes Leben lang zurücksehnen. Ein unaufdringlicher Begleiter, selten mehr als eine fahle Eintrübung, hingehaucht von einer sterbenden Sonne. Aber ausgestanzt vom Licht eines sizilianischen Augustnachmittags, erregt er Missfallen und Eifersucht bei den anderen Frauen.
Das Italien, in dem ich am Ende eines freudlosen Jahrhunderts aufwuchs, war ein rückständiges Bauernland. Während die entmachteten sizilianischen Fürsten in ihren Barockpalästen Karten spielten, verendete die Landbevölkerung wie Vieh an Hunger, Typhus, Malaria oder Cholera. Hunderttausende wanderten ab in den Norden oder gleich nach Amerika.
Von der Armut blieb ich selbst jedoch verschont. Ich wuchs in einer prächtigen Stadtvilla auf, die einst einer Adelsfamilie aus Giardini gehörte, bis mein Vater sie durch Betrug und Drohungen praktisch enteignet hatte. Mein Vater, das war der Dottore Passalacqua, jeder kannte ihn. Ein jovialer Mann mit einer angenehmen Stimme und bäuerlichen Pranken. Mit Wohlstandsbauch, Schnurrbart und kleinen Fuchsaugen, die niemals mitlachten. Ein Mann, der gerne tötete. Nach dem Risorgimento, als Italien die Adelsherrschaft abgeschüttelt hatte und sich zu einem unabhängigen Nationalstaat entwickelte, riss er sich Hektar um Hektar alles Land von Letojanni bis Fiumefreddo unter den Nagel. Gutes, fruchtbares Land, Zitronen-, Orangen- und Mandarinenhaine, so weit das Auge reichte. Mein Vater und seinesgleichen waren wie ein giftiges Harz, das aus den Brüchen quoll, die der Sturz des Adels hinterlassen hatte. Opportunisten, Glücksritter, Piraten, frei von Skrupeln, unersättlich. Der junge italienische Nationalstaat war ihr Feind, und regelmäßig ließen sie Leute verschwinden.
Ich war das einzige Kind des Dottore Passalacqua und bewunderte ihn grenzenlos. Ich liebte ihn mehr als meine Mutter. Ich schämte mich nicht dafür, denn papà war stark und mamma schwach. Selbst wenn er nur im Unterhemd vor dem Spiegel stand und sein Rasiermesser an einem Lederriemen wetzte, bewunderte ich ihn. Wie präzise er sich schabte, sich die Nase hielt und mir dabei vom Krieg erzählte, wie er zusammen mit den Garibaldisten die adeligen Blutsauger vertrieben hatte. »Zack, Kopf ab!«, schrie er und lachte. »Piff, paff, den Baron aus dem Baum geknallt!«
Während mamma an der Welt litt, gebot papà über Land und Arbeiter. Während er Zitronen, Orangen und Mandarinen wachsen ließ, klagte mamma über das Leben und verging. Ich schämte mich für ihren Verfall und dass man im Ort über sie tuschelte. Damals war mir nicht klar, dass die Leute auf diese Weise nur ihrem Hass gegenüber meinem Vater ein wenig Luft verschafften.
Mamma war eine zarte Frau, wie aus geraspeltem Eis. Jede Begegnung erschöpfte sie, eine falsche Bewegung, und sie konnte zersplittern. Beim Einkaufen im Ort zu lächeln, kostete sie alle Kraft. Also hörte auch ich auf zu lächeln, damit sie nicht zersplitterte. Kindern gegenüber verhielt mamma sich geradezu scheu. Nur an den seltenen Abenden, wenn meine Eltern Gäste und gewisse hochgestellte Persönlichkeiten empfingen, blühte sie auf und sah aus wie eine Märchenprinzessin. Dann scherzte sie, nahm Handküsse und die Komplimente junger Herren entgegen, und mit Erstaunen vernahm ich, wie gewandt sie über Literatur, Politik und alles Mögliche plaudern konnte. Was meinen Vater jedes Mal so in Rage brachte, dass er sie noch in der gleichen Nacht grün und blau schlug.
Ich selbst dagegen fühlte mich von meinem Vater geliebt wie keine Tochter je zuvor, und das versöhnte mich mit meiner schwindenden Mutter und meiner Einsamkeit. Denn Freundinnen hatte ich keine, weil alle Angst vor meinem Vater hatten. Ich sah, wie die Leute dem Vater die Hand küssten und sich dabei fast in die Hosen schissen. Mir war damals nicht klar, warum, aber es interessierte mich auch nicht.
Nur wenn ich papà im Schlafzimmer grunzen und mamma wimmern hörte, dann flüchtete ich auf mein Zimmer und hielt mir die Ohren zu. Bis papà sich an mein Bett setzte, mir übers schweißnasse Haar strich, mir Kosenamen gab und mir erklärte, dass mamma wieder hysterisch gewesen sei und er sie nur kuriert habe, das müsse ich verstehen.
Ich verstand, dass Frauen alles Mögliche nicht sein durften, aber vor allem nicht hysterisch. Wenn mamma wieder hysterisch war und papà sie kuriert hatte, verbrachte sie die folgenden Tage in einem abgedunkelten Zimmer und ließ sich von mir füttern wie ein Kind. Ihre kleine, zusammengekauerte Gestalt auf dem Bett kam mir so zerbrechlich und durchscheinend vor wie die Vögelchen aus Muranoglas in der Vitrine im salotto, die bei jedem Schritt des Vaters entrüstet klirrten. Dabei stammte mamma von Quellnymphen und Tempelrittern ab, selbst im Dunkeln schimmerte ihre Haut noch wie reife Oliven. Ihr Haar floss so hell und fein wie das ihrer normannischen Vorväter, die tausend Jahre zuvor trutzige Burgen auf unsere sizilianische Erde gestampft hatten, die sie wie zum Ausgleich innen mit orientalischen Mosaiken und Wasserspielen erblühen ließen. Mit meiner Mutter schufen sich die Götter ein Spielzeug nach ihrem Ebenbild, um mit seiner Zartheit die Herzen der Menschen zu erschüttern und dann händeklatschend zuzusehen, wie jemand ihr Geschöpf zerbrach.
Diese Aufgabe fiel meinem Vater zu. Alles Magische in der Welt war für ihn nur Hysterie. Die Gezeiten des Herzens und glückliche Zufälle widerten ihn an wie die Abszesse, die er als junger Arzt zu Hunderten hatte stechen müssen, die sich dann weiter entzündeten, bis er am Ende doch amputieren musste. Was er allerdings auch viel lieber tat.
Mein Vater kannte nur einen Gott, und sein Name war roba. Kram. Besitz. Dazu zählten auch Menschen. Und um seinem Gott nah zu sein, raffte mein Vater so viel roba zusammen, wie er nur konnte. Widerstand wurde amputiert, Hysterie gebrochen. Das war, was ihm gefiel: besitzen und brechen.
Mit zwölf Jahren konnte ich nichts weiter tun, als meiner zerbrechenden Mutter in der Dunkelheit den Kummer aus den verfilzten Haaren zu bürsten.
»Versprich mir, dass du mich findest, wenn ich verschwinde«, flüsterte sie, da klang ihre Stimme bereits wie Staub.
»Du sollst nicht verschwinden, mamma.«
Ich sagte es so tapfer, wie ich konnte, so tapfer, dass es schroff klang.
»Aber ich bin schon fast verschwunden, gioia. Bald wird er genug von mir haben. Dann musst du mich finden, versprich mir das.«
»Ich will nicht, dass du verschwindest.«
»Du bist ein Teil von mir. Versprich es mir!«
»Nein. Du sollst nicht verschwinden.«
Die Schönheit meiner Mutter beschämte mich. Wenn ich mich selbst im Spiegel betrachtete, sah ich nur Knochen mit bäuerlichen Händen und empfindlicher heller Haut. Ich bekam ständig einen Sonnenbrand, musste mich im Sommer verhüllen und Hüte tragen. Ich hasste die Sonne. Ich fand meine Augen wässrig und meine nordische Nase zu groß. Wenn ich wenigstens auch groß und blond wäre, dachte ich verdrossen, stattdessen war ich klein, mit dem borstigen dunklen Haar meines Vaters. Alles an meinem Körper missfiel mir, und dennoch weckte er bereits Begehren.
Von der Begierde hatte ich mit zwölf nur eine ungefähre Ahnung. Meist fühlte ich mich bloß einsam und wünschte mir nichts so sehnlich wie eine Freundin, mit der ich Bücher und Geheimnisse teilen konnte. Bücher und Freundinnen blieben jedoch das Einzige, das mein Vater mir nicht schenkte. Zu den Geburtstagen lud er zwar Kinder aus dem Ort ein, die sich aber nur stumm über die Kuchen hermachten. Der Hunger der Kinder war mir unangenehm.
Alle waren hungrig. Die Kinder in der Schule und die auf der Straße starben früh an allem Möglichen, am Hunger, an infizierten Schnittwunden, an Erkältungen oder den Würmern. Der Tod war allgegenwärtig. Da ich mir selbst nicht viel aus Essen machte, verteilte ich es eine Zeit lang heimlich in der Schule, um Freundinnen zu gewinnen, bis mein Vater es mir verbot.
»Sie müssen sich vor dir fürchten. Wenn du sie fütterst, verachten sie dich nur.«
Und wie sie mich fürchteten. Selbst die Jungs, die sonst alle anderen Mädchen auf jede erdenkliche Art und Weise drangsalierten, machten einen Bogen um mich. Einmal, mit zehn, rettete ich Grazia Barbagallo vor drei älteren Jungs, die gerade dabei waren, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und sie dabei zu bespucken und Hure zu nennen. Als ich dazwischenging, rannten sie weg. Ich wäre damals gerne mit Grazia Barbagallo befreundet gewesen, denn sie war klug und wurde von den Lehrern oft wegen Aufsässigkeit zurechtgewiesen. Ich half der völlig Verstörten, ihr zerrissenes und beflecktes Kleid zu richten, bis Grazia mich erkannte, heftig erschrak und wegrannte. Statt mir ihre Rettung mit Freundschaft zu danken, verbarg sie sich danach vor mir, als wäre sogar eine Vergewaltigung weniger schlimm als meine Freundschaft.
Ich kannte die Gerüchte über meinen Vater durchaus, alle kannten sie. Die von den Brunnen voller Knochen und Leichen. Von den Leuten, die verschwanden. Von dem Schmied Tumino, der am helllichten Tag mit einem Kopfschuss getötet worden war, genauso wie Pino Occhipinti und Tano Schillaci. Niemand sprach darüber, aber die Kinder raunten sich die Namen zu wie Vokabeln. Vito Scuzzulato, Francesco Stracuzzi, Pippo Falconi, Nino Carnazzo, Placido Cassia. Erschossen, erwürgt, erschlagen, Kehle durchgeschnitten, von Hunden zerfleischt. Die Kinder raunten von Seen aus Blut, als ob es Mutproben wären. Dabei sahen sie jedes Mal verstohlen hinüber zu mir, Pina Passalacqua, der Tochter des padrone.
Meine Kindheit war kurz und grau. Die Götter hatten andere Pläne mit mir. Sie spielen gerne, die Götter, sie sind wie Kinder. Wenn sie sich zu sehr langweilen, brechen sie ihren Lieblingsspielzeugen die Beine, damit sie nicht weglaufen. Als ich zwölf wurde, quälten sie mich mit heftigen Menstruationskrämpfen.
Die Regelschmerzen kündigten sich mit Übelkeit und einer Trübung meiner Sehkraft an und schlugen dann so brutal zu, dass ich jedes Mal stöhnend zusammensackte. Ich blutete sehr stark und flehte mamma an, nicht in die Schule zu müssen. Wenn es mich manchmal mitten im Unterricht erwischte, konnte ich nur wimmernd zusehen, wie mein Leben aus mir herausfloss und mein Kleid rot tränkte. Ich wurde von Teufeln geritten, alles tat weh, selbst der Wind in meinem Haar, jeder Laut, selbst das Licht. Und so zog ich mich wie mamma in mein abgedunkeltes Zimmer zurück und wollte nur noch sterben. Sanft wie ein Aprilregen erklärte mir mamma, dass die Götter uns mit diesen Schmerzen dafür straften, dass wir wieder nicht schwanger geworden waren. Aber anstatt dass die Schmerzen uns einander näherbrachten, hasste ich sie für den Fluch meines monatlichen Purgatoriums. Mamma war schwach, papà war stark. Ich hoffte, dass es besser würde, wenn ich mich, so weit wie möglich, von ihr fernhielt. Daher bat ich papà, mich aufs Land mitzunehmen.
Das Landgut meines Vaters lag inmitten der Zitronenplantagen, die Gärten genannt wurden. In Wahrheit handelte es sich um Höllen der Schinderei, in denen braccianti und carusi in sengender Hitze zwölf Stunden täglich in gebeugter Haltung Erde hacken, die Bäume wässern und düngen und nachts auch noch mit Blausäure räuchern mussten gegen die Schädlinge. Zitronen, Orangen, Mandarinen, Bitterorangen. Jedes Jahr kaufte oder raubte mein Vater neues Land hinzu, denn seit es verlässliche Eisenbahnverbindungen in den Norden gab, wurde er reicher und mächtiger.
Das hundertjährige Gutshaus hatte einst derselben adeligen Familie gehört wie unser palazzo in Giardini und wurde früher nur zur Erntezeit vom Baron bewohnt. Aus irgendeinem Grund zog mein Vater es jedoch dem repräsentativen Stadtpalazzo vor. Vielleicht weil es wie verwunschen zwischen Palmen und Pinien inmitten von Zitronenspalieren stand, wo sich in paradiesischen Zeiten Nymphen und Faune zu ihren nächtlichen Tänzen trafen. Wahrscheinlich aber eher, weil mein Vater, der Dottore Passalacqua, seinem Reichtum gerne beim Wachsen zusah und den braccianti beim Schuften. Noch wahrscheinlicher, weil er dort unbeschwert die Frauen und Töchter seiner Arbeiter nötigen konnte, wie es ihm beliebte.
Mir gefiel das Landhaus, weil es voll mit Büchern war und fast nur Männer ein- und ausgingen, die meinen zweiten Schatten nicht sehen konnten. Überall waren Männer, Bewegung und Lärm. Die Pächter und Halbpächter, die Aufseher, Buchhalter, Zwischenhändler und ausländischen Einkäufer polterten durchs Haus, als gehörte ihnen die Welt. Wenn sie mich sahen, leckten sie sich die Lippen. Die wenigen Frauen blieben möglichst unsichtbar in der Küche. Papà residierte im ersten Stock wie ein Fürst und kontrollierte die Bücher. Die Männer küssten ihm die Hände, Geld wurde in dicken Packen auf seinen Tisch geworfen und an den Tresor verfüttert.
»Darf ich es zählen?«
»Nein, gioia, du verdirbst dir nur die Augen.«
»Aber ich kann gut zählen.«
»Hör auf zu fragen. Das ist Männersache.«
Alles, was interessant war, war Männersache. Wenn die Männer redeten, dann schrien sie. Alle schrien. Alle schwitzten und stanken. Alle rauchten. Alle spuckten. Alle starrten mich an, wenn ich die Zitronenspaliere abschritt. Die Männer waren Sklaven der Bäume. Jede Tätigkeit erforderte spezialisierte Arbeiter, die Bezeichnungen trugen wie aus einem arabischen Zauberbuch. Um im Rhythmus zu bleiben, sangen die zappaturi beim Hacken, es klang wie Schmerzensschreie. Alle paar Meter richteten sie sich kurz auf, um zu verschnaufen, bis der caposquadra sie wieder antrieb. Manchmal, wie aus dem Nichts, gab es Streit, und zwei braccianti gingen mit der zappa aufeinander los. Kurze Verpuffungen roher Gewalt, wie Windhosen zur Mittagszeit. Manchmal wurde einer von einem Skorpion gebissen oder verletzte sich so schwer, dass sie ihn wegschaffen mussten und er nie wieder zurückkam. Überall wartete der Tod. Die Männer schwiegen oder schrien. Sie hackten, sie düngten, sie wässerten, sie ernteten. Sie fluchten, sangen und starben. Selbst nachts, wenn es kühl genug war, hörte man immer irgendwo die braccianti einen Baum unter einer Plane abräuchern gegen die Schädlinge. Bittermandelgeruch wehte über dem Land wie die Fahne eines Geistervolkes, das sich manchmal einen der Arbeiter holte, wenn sie nicht aufpassten.
Die Männer waren so roh wie die Sonne, so versteinert wie das Land, so knorrig und geduckt wie die Bäume. Sie rauchten, stanken, grunzten und sangen. Wie Zyklopen kamen sie mir vor, mit Schwestern und Töchtern, deren Unschuld ihnen heilig war, und die mich bei einer günstigen Gelegenheit dennoch auf der Stelle vergewaltigt hätten, wenn die Angst vor dem padrone sie nicht abgehalten hätte. Die Gier der Männer widerte mich an, aber es gefiel mir, die Tochter eines gefürchteten padrone zu sein.
In den Zeitschriften meiner Mutter hatte ich von wundersamen Erfindungen gelesen, die gerade überall in der Welt gemacht wurden. Von Städten, die in der Nacht wie Kristalle funkelten, von Lichtspielen, von Männern, die fliegen, und Frauen, die Automobile fuhren. Aber davon kam nur wenig in Sizilien an. Nur wenn ich mit den Eltern sonntags nach Taormina hinauffuhr, sah ich die Fremden mit ihren Automobilen und Grammofonen, wie zum Beweis, dass die Zeitschriften nicht logen. Das Gutshaus meines Vaters dagegen erschien mir zunehmend wie eine Zyklopenhöhle, in der ich gemästet wurde, bis man mich irgendwann verspeisen konnte.
Unten in Giardini oder sonntags zur Messe in Taormina trug papà helle Anzüge, zeigte sich stets rasiert und parfümiert, ein Herr, ein gentiluomo. Auf dem Land jedoch, unter Zitronen und Männern, ließ er sich gehen. Da lief er im Unterhemd herum, rasierte sich nicht mehr, und wenn er mich umarmte, stank er nach Schweiß, Urin und den Hunden, mit denen er durch die Gärten zog, um sich an ihrer Raserei zu weiden, wenn sie einen bracciante auch nur witterten.
Und dann die nächtlichen Laute aus dem Schlafzimmer. Die Frauen waren immer jung und schlichen sich vor Sonnenaufgang hinaus. Ich kannte sie und wusste, wer ihre Verlobten und Ehemänner waren. Mit zwölf hatte ich nur eine vage Ahnung davon, was mein Vater mit den Frauen machte. Einen Vorgeschmack bekam ich allerdings, als er mich eines Abends auf seinen Schoß setzte und anfing, mich zu streicheln.
»Wie schön du geworden bist, gioia.«
Er schwitzte, sein Atem stank nach Rauch und Magen, seine Hände tasteten meine Beine und meine Brust ab, dort, wo sie so empfindlich war, dass ich mich zusammenkrümmte.
»Halt still. Es tut nicht weh.«
Ich versuchte, meine Brust mit den Armen zu schützen, aber mein Vater machte einfach weiter, nur gröber.
»Nur deine Hände, die sind nicht so schön. Die hast du von deiner Mutter, nicht von mir.«
Ich betrachtete meine Hände wie Fremdkörper, die ich eben erst an mir entdeckte.
»Was ist mit ihnen?«
»Sie sind knotig wie die einer Arbeiterin. Du musst dich mehr pflegen, hörst du? Halt still.«
Er fuhr fort, mich zu streicheln. Ich versteinerte, versteckte meine Hände.
»Hör auf zu weinen, es ist nichts Schlimmes. Ich bin doch dein papà. Du hast mich doch lieb, oder?«
»Ja, papà.«
»Dann zeig es mir.«
So ging es bald jeden Tag. Um dem Vater aus dem Weg zu gehen, kroch ich bei mamma in Giardini unter, aber papà nahm mich einfach wieder mit aufs Land wie eine entlaufene Katze. Beim nächsten Mal öffnete er seine Hose und verlangte, dass ich ihn berühren solle.
»Na los, mach schon. Zeig mir, wie lieb du mich hast.«
Er nahm meine Hand. Sein Geschlecht war runzelig und voller Haare und stank. Sobald ich es berührte, regte es sich träge, als träume es schlecht.
»Du lügst«, sagte mamma heiser, als ich mich ihr weinend anvertraute. »Dein Vater liebt dich, er würde dir niemals wehtun.«
»Bitte, sag ihm, dass er damit aufhören soll.«
Mamma stöhnte und wandte sich ab. »Ich kann nicht. Niemand kann das.«
»Bitte, mamma!«
»Warum quälst du mich? Mach deinen Vater nicht wütend, dann passiert auch nichts, hörst du?«
Damit zog sie sich wieder in ihre Traurigkeit zurück und überließ mich mir selbst.
Ich war zwölf, wie sollte ich meine Not anders auflösen, als meinem Körper die Schuld zu geben. Wenn der Ekel übermächtig wurde, ritzte ich mich mit einer Glasscherbe, weil der Schmerz mir kurz Erlösung verschaffte. Bis papà die Wunden bemerkte und darüber so wütend wurde, dass sein Geschlecht hart anschwoll. Da wusste ich, was mamma gemeint hatte. Da versteinerte ich einfach nur noch und wartete darauf, dass meine Kindheit oder – besser noch – mein Leben endlich enden würde. Da hörte ich auf, meinen Vater zu bewundern.
Schon mit zwölf wusste ich, dass ich als Sizilianerin keine Rechte hatte. Dass ich immer einen Mann brauchen würde, dass ich heiraten und Mutter werden musste, etwas anderes kannten wir nicht. Der ledigen Frau erkannte das Gesetz zwar immerhin zu, padrona di sè stesso zu sein, Herrin ihrer selbst, aber in der Wahrnehmung der Leute stand sie auf einer Stufe mit Huren und Krüppeln.
Wenn das so ist, dachte ich, dann heirate ich eben so schnell wie möglich. Aber einen, der mich niemals als Besitz betrachten würde. Einen, mit dem ich mein eigenes Volk gründen und nach meinen Regeln herrschen konnte.
Wie betäubt schlenderte ich damals oft stundenlang durch die Gärten, durch das Inferno aus Schinderei, Fülle und Blütenduft. An manchen Stellen kam es mir vor, als würde sich das Land an mich erinnern. An meinen alten Namen und an mein verlorenes Lachen. Ein schönes Gefühl war das, die Erinnerung eines Landes zu sein.
Aber mithilfe der Hunde fand papà mich auch dort und brachte mich zurück ins Haus. Einmal verließ ich das Haus in der Nacht und stellte mich unter einem abgedeckten Baum in den Blausäurerauch. Aber die Arbeiter vertrieben mich, ehe ich sterben konnte.
Von den Früchten waren mir schon damals die Zitronen die liebsten. Gleißend wie die Mittagssonne, sauer, bitter und ein bisschen süß wie das Land. Sie kamen einst auf arabischen Segelschiffen nach Sizilien, und wie allem Fremden wird ihnen das Wurzeln bei uns schwer gemacht. Doch in der uralten sizilianischen Erde gedeihen sie gut. Die Zitronen, stellte ich mir vor, waren die Töchter unter den Zitrusfrüchten. Hieß nicht eine Sorte deswegen Femminello? Die Bergamotten, duftend und ölreich, waren die Mütter. Die Orangen und Mandarinen die Väter und Söhne, denn sie prahlten mit ihrem Aroma wie Männer mit ihrem Besitz, ihre Süße war vulgär wie Männerlachen. Das Aroma der Zitronen hingegen war feiner und komplexer, ihre Form mädchenhaft, der Duft ihrer Blüten geheimnisvoll wie ein orientalisches Märchen. Am liebsten wollte ich mein ganzes Leben unter Zitronen verbringen, wie unter einem Volk von goldenen Schwestern.
Am meisten interessierte mich die Ernte, wenn die Männer die Früchte in Handelsware verwandelten. Dreimal im Jahr wimmelten die Gärten nur so von carusi und panarari. Mit Körben beladen flitzten sie zwischen den Bäumen und dem scalu, der Sammelstelle für die Früchte, hin und her. Die Zwischenhändler und die ausländischen Einkäufer standen neben papà am scalu, rauchten und verfolgten angespannt, wie die Früchte vom tagghiapieri auf Stroh ausgebreitet, vorsortiert und anschließend vom cantaturi gezählt wurden. Der cantaturi, ein Vertrauensmann des Einkäufers, wählte paarweise Früchte aus, hielt sie in die Höhe, zählte laut und legt das Paar in einen großen, mit Stroh gepolsterten Korb, die cuffuna. Nach vierundfünfzig Paaren schrie er jedes Mal »Tagghia!« und legte ein weiteres Paar in den Korb. Nach jeder zehnten cuffana ging die Charge an den Händler. Hundertzehn Früchte pro Korb, rechnet ich mit, tausendeinhundert Früchte pro Charge.
Das Verfahren erschien mir so umständlich wie das Eucharistieritual in der Kirche. Mein Vater brüllte die braccianti und die Vorarbeiter an, wenn Früchte aus Körben kullerten, wenn es ihm nicht schnell genug ging oder wenn er vermutete, dass der cantaturi zu seinen Ungunsten gezählt hatte. Tausende von Früchten wurden an jedem Erntetag gepflückt, Zehntausende wurden geschleppt, ausgebreitet und gezählt. Hunderttausende von Früchten gingen von Hand zu Hand, und mein Vater verfolgte jeden Handgriff, als ob es Juwelen wären.
»Warum hundertzehn und nicht einfach hundert?«, fragte ich.
»Schschsch.«
»Ich will nur wissen, warum.«
»Das musst du nicht wissen, gioia.«
»Sag’s mir trotzdem.«
»Lenk mich nicht ab, sonst bescheißt mich der Drecksack. Geh zurück ins Haus.«
Er wollte mich wegziehen, aber aus einem trotzigen Impuls heraus entwand ich mich und sprang in den scalu, mitten hinein in die Zitronen, die ausgebreitet auf dem Stroh lagen, wie Tropfen der Sonne selbst.
Wie von einer eisigen Böe getroffen, gefror da der sizilianische Nachmittag, und die Welt hörte auf, sich zu drehen. Ich weiß es noch wie heute. Die braccianti, die carusi, panarari, cantaturi und tagghiapieri, die Händler und mein Vater, die Mücken, die Fliegen und Skorpione, sogar der Staub in der Luft – alles erstarrte in der Bewegung. Dafür erhoben sich nun die Zitronen um mich herum in die Luft. Wie erlöst, als dürften sie endlich zur Sonne zurückkehren, trudelten sie in die Höhe wie Luftblasen vom Grund eines Ozeans, hüllten mich ein wie eine goldene Wolke. Ich wollte so gerne mit ihnen schweben, aber unter meinem kleinen Fuß lag eine zerquetschte Zitrone und hielt mich fest. Meine goldenen Schwestern verharrten noch einen Moment lang unschlüssig in der Luft, dann senkten sie sich wie der Staub wieder hinab auf das Stroh des scalu.
Als meine Welt sich weiterdrehte, stand ein panararu mit einem vollen Korb vor mir. Der Junge war etwas älter, aber kaum größer als ich, in seinem Blick lag nicht die übliche Furcht, sondern deutliche Missbilligung über die Störung des Ablaufs. Das machte mich gleich wieder wütend.
»Was glotzt du? Warum hundertzehn und nicht hundert?«
Der Junge wirkte kurz irritiert über die Frage und deutete dann auf die zermatschte Zitrone unter meinem Fuß. »Transportversicherung für den Einkäufer.«
Es war die erste ernsthafte Antwort, die mir ein Mann bis dahin gegeben hatte. Ich wollte mich bedanken, da wurde ich gepackt, emporgehoben und unsanft am Rande des scalu abgesetzt. Das Gesicht meines Vaters war rot angelaufen, die Einkäufer, die Zwischenhändler und auch die Arbeiter starrten mich an wie ein Insekt.
So lernte ich, dass ich in der Welt der Männer weniger wert war als eine Zitrone.
In den folgenden Tagen suchte ich nach dem Jungen vom scalu und beobachtete ihn heimlich. Wegen seines kleinen Wuchses riefen sie ihn nano, Zwerg, und zählten ihn immer noch zu den carusi, den Kinderarbeitern, die nur den halben Lohn bekamen und von den anderen braccianti nach Strich und Faden schikaniert wurden. Ich hörte, dass er Barnaba hieß, aber Nino genannt wurde. Er war der Einzige, der sich nicht nach mir umdrehte, wenn ich durch die Gärten schlenderte. Er schien mich nicht einmal zu bemerken, schien nur Augen für die Bäume und die Früchte zu haben. Ich sah, wie er sich von frühmorgens bis in die Nacht mit der zappa abrackerte, wie er hackte, düngte und wässerte. Obwohl barfuß, sah ich ihn nie stolpern, und bei der Ernte setzte er die Körbe am scalu so zärtlich ab, als ob darin seine neugeborenen Kinder schlafen würden. Da er offenbar gut kopfrechnen konnte, hatte man ihn zum caposquadra gemacht, um beim nächtlichen Räuchern die exakte Menge von Blausäure für jeden Baum zu berechnen, damit der Baum unter der Plane noch gerade so überlebte. Wenn einer der Vorarbeiter es wagte, ihn anzutreiben, spuckte er ihm vor die Füße.
Mich aber ignorierte er weiter, und das ärgerte mich so sehr, dass ich einem der Arbeiter, einem Salvo Sciortino, eine Lira dafür gab, Barnaba in die Jauchegrube zu stoßen. Er wäre dabei fast in der Scheiße ersoffen. Unter dem Gejohle der Arbeiter kämpfte er sich aus der Grube, und dann, ich bekam es gar nicht mit, hatte er auf einmal eine zappa in der Hand und ging mit einer Hacke auf Sciortino los. Es ging alles sehr schnell. Ich sah Blut und wie Sciortino zu Boden ging. Wenn nicht drei Männer Barnaba überwältigt hätten, hätte er Sciortino wahrscheinlich totgeschlagen.
Zur Strafe bekam er keine Arbeit mehr, wenn sich die braccianti frühmorgens bei uns im Hof versammelten. Damals hatte ich noch keine Vorstellung davon, dass Arbeitsverbot oder Arbeitsunfähigkeit den Untergang einer ganzen Familie bedeuten konnte. Ich bedauerte nur, dass ich Barnaba nun nicht mehr wiedersehen würde.
Bis er eines Morgens vor unserem Hof nach meinem Vater rief. Ich saß gerade mit papà beim Frühstück, als ich unten seine Stimme hörte.
»Padruni! Bitte, lasst mich wieder arbeiten, Herr. Es tut mir leid. Padruni!«
Ich hörte, wie die Vorarbeiter ihm androhten, die Hunde loszulassen, aber Barnaba ließ nicht locker. Papà stippte ungerührt ein cornetto in seinen caffè, bis er überschwappte. Ich stand auf, um vom Balkon aus nachzusehen.
»Bleib sitzen.«
»Aber da draußen ruft jemand nach dir.«
»Der wird gleich aufhören. Setz dich.«
»Er klingt aber verzweifelt.«
»Das ist gut. Sie müssen uns fürchten, merk dir das. Sonst werden sie uns totschlagen, so sind sie.«
»Du könntest ihm doch wieder Arbeit geben.«
Papà schüttelte den Kopf. »Das ist dieser Carbonaro, den sie ›den Zwerg‹ nennen. Ein Aufrührer und Nichtsnutz wie sein Vater. Es ist besser, ihn auszusortieren.«
»Du kennst seinen Namen?«
Mein Vater schlürfte seinen caffè und tätschelte den Dobermann zu seinen Füßen. »Ich kenne sie alle. Ihre Väter, ihre Mütter, ihre Kinder. Ich bin der padrone, ich muss wissen, wer für mich arbeitet, wem ich vertrauen kann, wer einen Gefallen wert ist oder wer Probleme macht.«
»Padruni!«
»Bitte, papà!«
Mein Vater schmatzte durch die Zähne und wischte sich den Mund mit dem Handrücken.
»Willst du sehen, wie man jemandem eine Lektion erteilt?«
Lektionen wurden immer aus einem thronartigen Sessel heraus erteilt, mit einem alten Säbel in der Hand, den Hund zu seinen Füßen. Papà gefiel es, Leute zu demütigen. Als Cucinotta, der Leibwächter meines Vaters, ein Kerl mit schlechter Haut, der alles tat, was ihm befohlen wurde, wirklich alles, mit seiner Flinte Barnaba hereinführte wie einen Sträfling, versteckte ich mich hinter dem Sessel. Barnaba wirkte noch kleiner als sonst, gleichzeitig strahlte er eine wilde Unbeirrbarkeit aus. Er küsste papàs Hand und bat um Vergebung. Ich fand, es war ein erbärmliches Schauspiel, und wollte mich schon davonschleichen, als mein Vater sagte:
»Deine Mutter ist doch die Hexe, nicht wahr?«
Davon hatte ich noch nie gehört. Interessiert lugte ich hinter dem Sessel hervor.
»Heilerin, Herr.«
»Ich habe Schmerzen im Rücken. Wenn sie die wegmacht, kannst du wieder anfangen.«
Was führt zu was? Das Leben ist ein Ozean aus Möglichkeiten, aber wir kämpfen an der Oberfläche gegen das Ertrinken an. Alle erwarten wir, dass das Glück uns findet, aber keiner will den Preis bezahlen. Es gibt Armut und Gewalt, Liebe und Trost, und alles vergeht. Zwischendurch müssen wir an Abgründe treten. Der eine will nur kurz erschaudern, um sich danach besser zu fühlen, ein anderer muss springen und sich im Fallen Flügel bauen. Und ich, Pina Passalacqua, damals zwölf Jahre alt, trat hinter dem Sessel hervor.
»Ich werde ihn heiraten.«
Alle hörten es. Mein Vater, Cucinotta mit der Flinte und auch Barnaba. Er starrte mich panisch an.
»Ach, gioia!«, knurrte mein Vater. »Das ist nur ein verlauster bracciante.«
»Ich werde ihn heiraten.«
Barnaba beeilte sich, den Raum zu verlassen. Ich sah, wie mein Vater aus dem Sessel schnellte. Ehe Barnaba die Tür erreicht hatte, packte er ihn am Nacken, wirbelte ihn herum und presste ihn gegen die Wand. Der Rüde drehte fast durch vor Wut, und Cucinotta entsicherte die Flinte.
»Du bist niemand, Carbonaro«, hörte ich meinen Vater keuchen. »Wenn du ihr zu nahekommst, werfe ich dich lebendig den Schweinen zum Fraß vor. Hast du das verstanden?«
Barnaba nickte, bleich wie Mandelmilch.
»Ja, Herr.«
Mein Vater stieß ihn von sich. »Du gehörst mir, Carbonaro. Vergiss das nie.«
Kaum war Barnaba weg, brüllte er mich an.
»Was sollte das? Willst du so enden wie deine Mutter?«
Ich weiß nicht mehr, was ich in diesem Moment dachte. Ich weiß nur noch, dass mich eine neue Zuversicht durchströmte, die meine Scham vertrieb, je mehr papà mich schüttelte und anschrie.
»Ich werde ihn heiraten«, wiederholte ich, wie die Formel eines Schutzzaubers.
»Eher bringe ich dich um.«
Ich entwand mich seinem Griff.
»Dann tu’s.«
Einmal in der Woche kam nun Barnabas Mutter ins Gutshaus. Pancrazia Carbonaro war damals eine schöne, immer noch junge Frau, gekleidet in Witwenschwarz, mit einem Gesicht, das niemals Ja sagte.
»Sie ist eine Hexe«, raunten die Frauen in der Küche.
»Eine Heilerin. Den Mann meiner Cousine hat sie von den Würmern geheilt und Tano Cubuzio vom bösen Blick. Ich schwöre.«
»Selber hat sie den bösen Blick. Sie wirft zwei Schatten, mehr muss ich wohl nicht sagen.«
»Bist du still!«
Sie warfen mir Blicke zu und senkten die Stimmen.
»War der Mann nicht Priester?«
»Alles Mögliche war der. Hat Eingaben beim Amt gemacht, unten in Giardini. Schöne Stimme hat er gehabt. Aber rumgehurt wie kein Zweiter.«
»Bist du still.«
Also begann ich, mich für die Heilerin zu interessieren. Wenn sie nach der »Behandlung« aus dem Schlafzimmer meines Vaters kam, dann mit einem Blick, der jeden, der es wagte, sie eine Hure zu nennen, zu Staub verwandelt hätte. Einmal blieb sie beim Hinausgehen vor einem Bücherschrank stehen.
»Komm raus da.«
Und als ich mich zögernd hinter dem Schrank hervorwagte, sagte sie:
»Du bist Pina, nicht wahr?«
Ich hielt Abstand. Im staubigen Halbdunkel der Bibliothek betrachtete sie mich prüfend.
»Willst du einen Talisman?«
»Weiß nicht.«
Sie reichte mir ein kleines Päckchen, nicht größer als eine Walnuss, sorgfältig eingeschlagen in Papier mit einem Marienbild. Es war federleicht und duftete angenehm nach Zitronenblüten.
»Leg ihn in dein Bett. Aber erzähl niemandem davon.«
»Was macht er?«
»Frag nicht. Nur Gutes.«
»Ich will es trotzdem wissen.«
Pancrazia Carbonaro runzelte verstimmt die Stirn.
»Er soll dich vor deinem Vater schützen.«
Als ich zur nächsten Sonntagsmesse mit meinen Eltern nach Taormina hinauffahren musste, weil papà dort Hof halten wollte, sah ich Barnaba vor der Kirche San Giuseppe mit einem anderen Mädchen. Das Mädchen in dem weißen Kleid mit den malvenfarbigen Blütenapplikationen war genauso arm wie alle in Taormina. Alle waren sie damals arm, da oben. Doch obwohl barfuß, leuchtete sie wie eine Pharaonin. Ihr Haar toste wie ein schwarzes Meer, ihre Haut schimmerte wie ein Sonnenuntergang. Sie war Sizilien, sanft und üppig, herrisch und abweisend, ein südlicher Wind, Sand und Jasminduft, das Murmeln von Wasserspielen. Selbst erwachsene Frauen nickten ihr wohlwollend zu. Sie war alles, was ich je sein wollte, trotz ihrer kleinen ordinären Gesten und ihres bäuerlichen Dialekts. Niemals war ich mir hässlicher vorgekommen, als beim Anblick von Rosaria Bagarella, Scham und Eifersucht löschten jedes andere Gefühl in mir aus.
Als Barnaba mit Rosaria Bagarella und den beiden Müttern zur passeggiata den Corso Umberto hinauf aufbrach, hätte ich am liebsten geschrien vor Wut, denn alle sahen ihnen hinterher, alle tuschelten, denn es bedeutete, dass es ernst war. Da nahm meine zerbrechliche Mutter meine Hand.
»Wer ist sie schon?«
In diesem Moment fühlte ich mich ihr nach langer Zeit wieder verbunden.
»Wie wird man begehrenswert?«, fragte ich leise.
»Das bist du längst. Er ist nur nicht der Richtige.«
»Und was, wenn ich alle Männer abstoßend finde, nur ihn nicht?«
»Dann musst du lernen zu vergessen.«
Damals fing ich an, mich manchmal heimlich zu berühren, ständig auf der Hut vor mamma, die unversehens in mein Zimmer hereinplatzte.
»Ich will alles wissen«, erklärte ich ihr eines Tages vor dem Spiegel und strich mir über den Bauch.
»Dafür bist du noch zu jung.«
»Ich blute.«
»Lass uns morgen darüber sprechen, ja? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.«
»Tut es sehr weh?«
Mamma zögerte, ihr Blick verklärte sich. »Nicht mit dem Richtigen.«
Der Gedanke, dass mamma außer meinem Vater noch einen anderen Mann geliebt haben könnte, war so unerhört für mich, dass ich allen Mut brauchte, um nachzufragen.
»Wer war es?«
Sie strich mir übers Haar. »Niemand, amore. Ein reisender cantastorio mit einer schönen Stimme, nichts weiter. Aber er war arm, und ich wollte keinen armen Mann, verstehst du?«
Ich kaute wieder auf meiner Lippe.
»Ich verspreche es dir«, sagte ich.
»Was meinst du, amore?«
»Dass ich dich finde, wenn du verschwindest.«
Meine Erinnerungen sind verdunstet wie ein Wasserfleck im Sommer. Unsere Sommer sind lang, aber auch sie vergehen, und es wird Winter, und du fragst dich, wo das Jahr bloß geblieben ist. Dieses Jahr, das letzte Jahr, die letzten zehn oder zwanzig. Ein Jahrhundert streckt und reckt sich, gähnt und erhebt sich, strauchelt, blutet, rappelt sich wieder auf, danke, nichts passiert. Am Morgen betrittst du das Bad, kneifst dir in die Wangen, legst Cologne auf und zupfst dir zwei Härchen von der Oberlippe, die vorher noch nicht da waren. Aber als du das Bad verlässt, ist es längst Abend, da staunst du. Imperien sind versunken, Wunderdinge sind geschehen, ein Jahrhundert ist zur Hälfte heruntergebrannt, du hast es gar nicht gemerkt. Bäume haben geblüht, Zitronen sind geerntet und verfrachtet worden, Kiste um Kiste um Kiste.
Ich erinnere mich an den Fahrtwind am Steuer eines Automobils. Elfen habe ich geboren und begraben. Es ist Nachmittag geworden, es ist Abend geworden, und nun bin ich alt. Fadenscheinig wie der Brokat des Sessels, in dem ich meine Tage verdämmere. Der kleine Finger meiner linken Hand schmerzt, obwohl da gar kein kleiner Finger mehr ist. Ich reibe den Stummel an der Armlehne des Sessels und sehe verwundert, dass der Stoff an der Stelle schon ganz durchgewetzt ist. Im Radio singt jemand einen Schlager auf Deutsch. Ich mag diese Sprache nicht, aber die Stimme ist schön.
»Hör doch, das ist die kleine Aurora!«
Ich weiß nicht, wer das sein soll. Nur dass es Mittag sein muss, das weiß ich, weil ich hungrig bin. Und dass ich Barnaba noch einmal küssen will. Ich spitze die Lippen, aber statt eines Kusses träufelt mir jemand Wasser auf die Lippen.
»So ist es gut.«
Ich weiß nicht, wer er ist, aber er riecht gut, ganz vornehm nach angenehmen Erinnerungen. Ich schließe die Augen, hoffe, dass er mich küsst, und auf einmal erinnere ich mich wieder an einen Vormittag im Juli, als der Himmel in Flammen stand und Herzen in Brand setzte. An die Umkleidekabine des Damenmodengeschäfts der Signora Matranga in Giardini. An Barnaba in flimmernder Mittagshitze auf einem Eselskarren voller Scheiße, weil er Dung für die Gärten meines Vaters holen musste. Ich erinnere mich, dass ich ihn nötigte, mich nach Hause zu fahren. Und wie er mich auf dem stinkenden Karren küsste.
Küss mich noch mal, denke ich, aber er dreht nur das Radio lauter.
»Hör doch!«
Ich verstehe kein Wort von dem deutschen Schlager, aber die Stimme des Mädchens kommt mir vertraut vor. Sie nimmt mich an die Hand, und ich erinnere mich wieder.
ANNA CARBONARO
Catania 1931
»Ich kann dich nicht heiraten«, erklärte ich dem schönen Schneider, laut genug, dass auch alle es hören konnten. Vor dem Haus meiner Eltern lehnte er an seinem Automobil, hinter geschlossenen Fensterläden beobachtete uns der halbe Ort. Der schöne Schneider trug an jenem Abend einen hellen dreiteiligen Leinenanzug nach neuester Mode, dazu Panamahut und einen Gehstock wie ein Dandy. Dabei wirkte er so linkisch und hölzern wie ein Jugendlicher, und dennoch stand ich in Flammen.
»Wer ist es? Ich bringe ihn um. Ich schwöre, ich bringe ihn um. Ist mir egal, ob sie mich ins Gefängnis werfen. Denn danach bringe ich mich selbst um. Was sagst du dazu?«
Was sollte ich dazu sagen? Manchmal kam mir mein Leben wie ein endloser Traum vor, und ich war nur eine verwirrte Zuschauerin. Nichts ergab irgendeinen Sinn, alles drehte sich im Kreis. Der Sommer verging zu schnell, immer war bereits wieder Winter. Mein Leben kam mir manchmal vor wie eine Fermate. So hatte ich es bei Señora Aramburú gelernt – ein Moment stummer Verwunderung, kurz bevor sich die Gefühle wieder überschlagen.
Ich gab dem schönen Schneider wortlos seinen Brief zurück, den ich vor den Augen meiner Eltern zerrissen hatte. Da war ich achtzehn. Zwei Männer machten mir den Hof, aber ich wollte keinen von ihnen. Obwohl ich Ninos Namen bereits heimlich mit dem Finger in den Staub geschrieben und hastig wieder ausgewischt hatte. Heiraten wollte ich ihn trotzdem nicht. Denn noch viel mehr als einen schönen Ehemann wollte ich etwas, das eine verheiratete sizilianische Frau nie bekommen würde.
Ich war die älteste von drei Töchtern des Fischers Alfio Mangano aus Ognina bei Catania. Unsere Lebensumstände waren bescheiden, aber nicht ärmlich, denn mein Vater war kühn und zäh, selten kehrte er ohne Fang zurück. »Er hat eine glückliche Hand«, sagten die Leute, was daran liegen mochte, dass meine Mutter, meine Schwestern und ich allesamt zwei Schatten warfen. Das galt unter Fischern als Glückszeichen. Man erkannte es daran, dass mein Vater sein eigenes Boot und sogar ein Radio besaß.
Meine Kindheit war angefüllt von Lachen und Gesang. Ich konnte die Elementarschule besuchen, und kein Nachbar, kein Verwandter hat mich je angefasst. Dennoch, das raunten mir ihre Schwestern zu, raubte ich den Spielgefährten meiner Kindheit, die inzwischen Fischer waren wie ihre Väter, den Schlaf. Ich hatte sie alle abgewiesen, allerdings gab es inzwischen zwei junge Männer, die mir gefielen. Das waren der Carabiniere Vincenzo Lombardo und der Schneider Antonino Carbonaro.
»Liebst du mich etwa nicht?«
»Gib dir gefälligst mehr Mühe«, erwiderte ich, diesmal so leise, dass es niemand hören konnte. Ich hätte gerne Ninos Hand genommen, seine schöne, gepflegte Hand. Ich musste immer alles berühren, vielleicht weil ich mich fürchtete, dass die Welt sich sonst in Luft auflösen könnte. Meine Hände mussten immer helfen, trösten, Zwiebeln schneiden oder Zöpfe flechten. Ich hätte Nino so gerne berührt. Aber ich sagte:
»Komm nicht wieder, Nino.«
Erst als ich wieder im Haus war, warf ich mich auf mein Bett und weinte still, denn ich wollte niemandem zur Last fallen. Ich wollte einfach nur zu Staub zerfallen.
Von klein auf war ich gewohnt, zu arbeiten und mich um meine Schwestern zu kümmern. Klaglos verrichtete ich, was zu tun war und mir aufgetragen wurde, und sang dabei. Nur manchmal, wenn die Hüfte wieder wehtat, zog ich mich für ein paar Minuten in eine stille Ecke zurück, kam der Welt kurz abhanden, wie man so sagt, bis es wieder ging. Der Hüftschaden war angeboren, als Kind hatte ich ihn kaum bemerkt, aber seit der Pubertät hinkte ich leicht, und eines fernen Tages würden die Arthrose und die Gicht mich mit Schmerzen an die Wohnung fesseln. Noch konnte ich es verbergen, aber wenn im Winter der Levante aus Osten mit Nebel und Regen wütete wie ein zorniger padrone, dann schmerzten mir die Gelenke manchmal so sehr, dass ich mir auf die Lippen beißen musste, um nicht laut aufzustöhnen. Ich erzählte niemandem davon, blieb heiter wie die Aprilsonne, die wärmt, ohne zu verbrennen. So wollte ich sein. Man sollte mir weder die Hüftschmerzen ansehen noch mein Geheimnis.
Und doch hatte ich eines.
Denn ich träumte vom Singen. Vom richtigen Singen, auf einer Bühne vor Publikum mit einem Orchester. Keine Opern, so naiv war ich nicht, ich wusste, dass es dafür niemals mehr reichen würde. Aber vielleicht ja Schlager, wie die im Radio, die ich immer mitsang. Ich weiß, es gehörte sich nicht, aber bevor ich nicht im Radio aufgetreten war, nur ein einziges Mal, wollte ich nicht heiraten.
Die Erfüllung dieses Traums erhoffte ich mir von Señora Aramburú, der ich jeden Dienstag und Freitag den Haushalt führte und dafür anschließend heimlich eine Stunde Gesangsunterricht mit Klavierbegleitung erhielt. Señora Aramburú war Peruanerin und hatte überall auf der Welt gesungen, sogar in New York am Century Theatre. Als ich bei ihr staubwischte, war das Century Theatre wegen seiner miserablen Akustik längst pleite und wurde gerade abgerissen. So weit war es mit Victoria Aramburú noch nicht gekommen. Mit Ende vierzig war die peruanische Diva immer noch der Liebling des Cataneser Publikums. Als soprano sfogato war sie wie geboren für die Opern Donizettis, Verdis und eben Bellinis, unserem berühmten Sohn der Stadt. Victoria Aramburú hatte in ihrer langen Karriere zwar auch die Königin der Nacht gesungen, aber an Hunderten, wohl Tausenden Abenden die Norma. Es war die Partie ihres Lebens. Dabei mochte die Diva uns Catanesen nicht, denn sie fand ihr Publikum, das ihr in der Abenddämmerung ihrer Karriere zu Füßen lag, provinziell und ignorant. Die Diva war voller Groll. Aber da das Klima bei uns angenehm und das Leben so preiswert war, dass sie sich eine prächtige Wohnung in Domnähe leisten konnte, hatte Señora Aramburú beschlossen, noch zu bleiben und einen ihrer betagten adligen Verehrer zu beerben. Das hatte sie mir selbst verraten. Dann allerdings wollte sie endlich nach Lima zurückkehren und in einem prächtigen Haus am Meer im mondänen Viertel Miraflores Hof halten.
Solange gefiel sie sich darin, dienstags und freitags ein Fischermädchen in Stimmbildung zu unterrichten.
»Ohne die Tretmühle einer frühen Ausbildung und den eisernen Willen einer ehrgeizigen Mutter wird es niemals mehr für eine Opernkarriere reichen, schlag dir das aus dem Kopf«, erklärte sie mir jedes Mal. »Wahrscheinlich wirst du sowieso demnächst irgendeinen schönen Trottel heiraten, dem dein Belcanto herzlich egal ist. Nein, widersprich nicht. Du wirst drei bis sechs Kinder kriegen wie alle in diesem Land. Deine Stimme und deine Schönheit, mein Kind, werden verkümmern, nichts wird bleiben. Glaub mir, ich kenne das Leben.«
»Warum unterrichtet Ihr mich dann, Señora?«
»Weil ich ein gutes Herz habe, frag nicht.«
Aber ich kannte den wahren Grund. Die Diva war die Tochter einer Köchin vom Volk der Quechua und eines Beamten der städtischen Straßenbahngesellschaft von Lima, das hatte sie mir stolz erzählt. Dass sie in den Barrios Altos aufgewachsen war, rund um die Plaza Italia, zwischen Schamanen und sizilianischen Händlern, dass sie wusste, was ein zweiter Schatten bedeutete. Glück nämlich, perlendes, übervolles Glück. Daher betrachtete sie mich insgeheim als eine Art Talisman und machte mir ein Angebot:
»Ich werde dich unterrichten und dich vor schönen Trotteln beschützen. Dafür kommst du mit mir nach Peru, und wenn du so weit bist, mache ich dich dort zum Star.«
Ich war erst achtzehn und hatte nur die Elementarschule besucht, aber blöd war ich nicht. Ich konnte mir schon denken, dass ich in Wahrheit bis an ihr Lebensende ihren Haushalt in Miraflores führen sollte. Dennoch sagte ich:
»Danke, das ist sehr großzügig, Señora.«
Die Diva lobte mich nur selten. Aber einmal nahm sie mich ins Opernhaus mit und zeigte mir die Wunderwelt des großen Saals mit den samtbezogenen Klappstühlen. Sie führte mich durch das Labyrinth der Hinterbühne, der Garderoben, Proberäume und des Schnürbodens. Ich taumelte an Beleuchtern vorbei, begegnete Tänzerinnen und Herren mit Rosensträußen. Alle waren so freundlich, jeder grüßte. Überhaupt sah ich dort viele Frauen. Frauen, die arbeiteten. Frauen, die sangen, spielten, tanzten oder nähten. Frauen mit kurzen Haaren, die mir im Vorbeigehen über die Hüfte strichen. Es war eine geheime Welt ohne Fenster und Tageszeiten. Wie ein unterirdisches Feenreich kam mir die Oper vor, befreit von der Zeit und der Schwerkraft, gewalkt aus Konzentration, Hingabe und vergnügter Täuschung. Eine Welt, die mich einschüchterte, aber ich wollte unbedingt dazugehören.
»Jetzt hör auf, mit dem Kopf zu nicken!«, schimpfte die Diva mich aus. »Das wirkt unsicher, und du schneidest dir nur den Atem ab. Kopf gerade, steh aufrecht, die Schultern runter, die Lunge muss frei hängen können. Stampf mal tüchtig auf, na los. Ja, so ist’s gut. Lass den Ton im Nasenraum kreisen, nicht pressen, lass ihn kreisen, und dann lass ihn einfach los. Sasasasaaaa. Spürst du es? Was machst du da, deine Stimme ist keine Waffe. Der Ton schießt nicht, er wird gebildet. Und zwar im Kopf, da gibst du ihm seine Form. Ist mir egal, ob du jetzt zu laut bist oder zu langsam, daran können wir arbeiten. Erst einmal musst du die Seele der Arie finden. Du musst verstehen, was du da singst. Ist es traurig oder heiter? Sag schon.«
»Beides irgendwie. Aber mehr traurig.«
»Bravo! Der süße Schmerz. Die Deutschen haben ein Wort dafür: Wehmut. Überhaupt, diese Deutschen mit ihrer grässlichen Krack-Krack-Sprache, aber dieser Schubert hat daraus Magie gemacht. Alles klingt bei ihm so tü-tüdö-tü-dö, dabei gehören seine Lieder zum Allerschwersten im Repertoire. Wenn man es nicht richtig macht, klingt es nur abgeschmackt. Dabei geht es immer nur um eines: Schicksal. Die Deutschen, musst du wissen, sind Ingenieure des Schicksals. Weil sie an allem leiden, am allermeisten an sich selbst. Aber für Schubert bist du noch nicht bereit. Du bist Belcanto. Wie unser geliebter Bellini. Na los, noch mal. Pam-padapam-padam. Was machst du da? Da steht eine Fermate, ich hab dir doch erklärt, was das ist, also nimm dir auch die Zeit. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Eine Fermate zeigt dir an, dass es hier, sagen wir, um einen Ausdruck der Verwunderung geht. Alle Bewegung hält inne, die Gefühle, die sich zuvor nur so ergossen haben, sind erschöpft, verstehst du? Ja, ein N ist immer tückisch, aber das N ist dein Freund, glaub mir. Ein N ist dental, also wenn du ein N singst, da hast du kurz Zeit bis zum nächsten Vokal. Noch mal. Wie hat es sich angefühlt?«
»Es war leichter.«
»Siehst du. Nimm die leichte Route. Wenn du dich nach einer Arie nicht besser fühlst als vorher, hast du was falsch gemacht. Wie soll sich das Publikum besser fühlen, wenn du es nicht tust?«
Nein, ich war nicht blöd, aber das bittersüße Gift der Diva verfehlte seine Wirkung dennoch nicht. Obwohl ich an den Noten schier verzweifelte, übte ich beflissen, verstörte meine Familie mit Atem- und Stimmübungen und träumte von Südamerika.
Bis eben der schöne Schneider dazwischenkam. Er erschien zur Anprobe eines Mantels für Señora Aramburú, als ich ausgerechnet gerade »O mio babbino caro« aus Puccinis Gianni Schicchi vorsang. Eine kurze Arie über eine junge Frau, die ihrem Vater mit Selbstmord droht, wenn sie ihren Geliebten nicht heiraten dürfe. Die Diva hatte in jungen Jahren einmal mit Puccini geschlafen, aber die mit der Liebesnacht verbundene Hoffnung auf ein Engagement an der Metropolitan Opera in New York hatte sich nicht erfüllt. Jedes Mal, wenn sie mich die kleine Arie singen ließ, entlud sich ihr Groll auf die italienischen Männer.
»Sie sind die niedrigste Form der Arroganz. Besonders die jungen sizilianischen Stutzer. Bäuerlich und ungebildet, halten sich für den Nabel der Welt mit ihrem Welpenblick. Oh, ich kenne diesen Blick, sie können mich nicht mehr täuschen. Wenn sich keusche Marienverehrung und viehische Lust in einer Verpuffung falscher Gefühle entladen. Sing weiter, Kind, nicht aufhören, aber merk dir meine Worte. Ich habe erwachsene Männer in Ohnmacht fallen sehen im Angesicht großer Schönheit, also meiner. Aber sie können mich nicht täuschen. Als erfahrene Bühnenpersönlichkeit sehe ich genau, dass alles nur eine einzige Schmiere ist, weil es von ihnen so erwartet wird. Von echten Gefühlen verstehen sizilianische Männer absolut gar nichts.«
In diesem Augenblick läutete es, die Diva eilte zur Tür, ich sang weiter, aber als der Schneider in den Salon trat, versagte mir die Stimme. Ich hatte noch nie einen so schönen Mann gesehen. Der Schneider starrte mich an wie eine Marienerscheinung, dann sackte er ohnmächtig zusammen.
Ich schrie auf, die Diva fluchte auf Spanisch und eilte zu dem Bewusstlosen.
»Ist er tot?«
»Blödsinn«, herrschte sie mich an. »Was stehst du da rum? Hilf mir!«
Zusammen hievten wir den Schneider in einen Sessel. Bleich wie Mondlicht kam er langsam wieder zu sich. Er roch gut, ganz vornehm. Als er mich erkannte, presste er hervor:
»Mein Name ist Antonino Carbonaro. Ich will Sie heiraten.«
Es war fast wie in den Heftromanen, die ich heimlich mit meinen Freundinnen tauschte. Sie hießen Mamma Rosa, Una rosa d’autunno, Lo schiavo oder Trionfo d’amore und kosteten eine halbe Lira. Es ging immer um Adelige, Sklaven und unglückliche Dienstmädchen. Meist waren die Küsse nur scheu, aber manchmal wollten die Kavaliere mehr. Gingen die Unholde weiter, wollten sie Mieder öffnen und Mädchen ins Unglück stürzen. Die wahre Liebe war etwas Reines, Zartes, das sich öffnete wie eine Knospe. Falsche Liebe dagegen war, wenn beide in Raserei auf den Diwan sanken. Wenn man wie vom Blitz getroffen wurde und die Begierde die Sinne benebelte. Falsche Liebe war zum Scheitern verurteilt. Alles war sowieso zum Scheitern verurteilt, wenn ein Mädchen auf den schneidigen Kavalier hereinfiel, der sich als Unhold entpuppte. Nur wenn sie sich auf den rechtschaffenen Langweiler mit dem reinen Herzen besann, hatte sie eine Chance auf wahres Glück. Alles, was ich über Liebe, Treue und Verrat wusste, hatte ich aus den Heften. Also musste ich nur herausfinden, ob Antonino Carbonaro ein Unhold oder rechtschaffen war.
Der Schneider griff sich ans Herz.
»Basta!«, rief die Diva und drängte sich zwischen uns. Ihr Groll entzündete sich zu flammender Entrüstung. »Kommen Sie zu sich!« Sie patschte dem Schneider zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht und zischte mich an. »Hol ein Glas Wasser, na los, kschsch.«
Mit zitternden Knien brachte ich das Wasser. Dem Schneider ging es schon wieder besser, er wirkte ganz rosig, geradezu erhitzt, und hatte nur Augen für mich. Das gefiel mir. Die Diva wollte mich zwar hinausscheuchen, aber bevor ich den Raum verließ, stammelte der Schneider:
»Darf ich Sie nach Hause begleiten?«