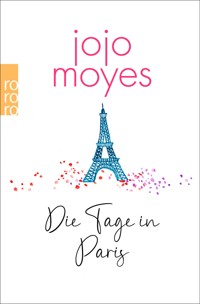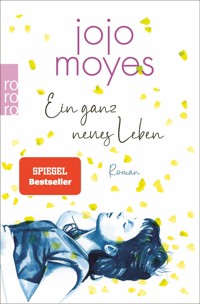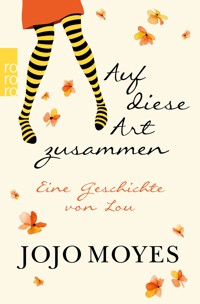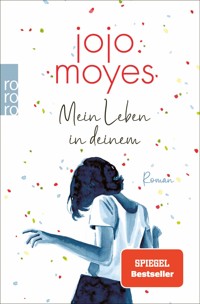14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Debütroman der Bestsellerautorin in neuer Übersetzung. Ein emotionaler Familienroman über ein irisches Landgut und drei Generationen von Frauen, die mehr verbindet, als sie sich eingestehen. Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland verlassen, unverheiratet und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser machen. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre Großmutter kennenzulernen. Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen. In ihrem ersten Roman schreibt Jojo Moyes über das besondere und oft komplizierte Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern. So emotional, so einzigartig, wie wir es von ihr kennen. Neu übersetzt von der Übersetzerin des Nr. 1-Bestsellers «Ein ganzes halbes Jahr».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jojo Moyes
Die Frauen von Kilcarrion
Roman
Über dieses Buch
Über die Kraft des Verzeihens
Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie Irland verlassen, unverheiratet und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser machen. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile sechzehnjährigen Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um auf Gut Kilcarrion ihre Großmutter kennenzulernen.
Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarrion durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind, zu verzeihen und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen.
Der berührende Debütroman von Jojo Moyes über das untrennbare Band zwischen Müttern und Töchtern – in neuer Übersetzung.
Vita
Jojo Moyes, geboren 1969, hat Journalistik studiert und für die «Sunday Morning Post» in Hongkong und den «Independent» in London gearbeitet. Der Roman «Ein ganzes halbes Jahr» machte sie international zur Bestsellerautorin. Zahlreiche weitere Nr.-1-Romane folgten. Jojo Moyes lebt mit ihrer Familie auf dem Land in Essex.
Karolina Fell hat schon viele große Autorinnen und Autoren ins Deutsche übertragen, u.a. Jojo Moyes, Bernard Cornwell und Kristin Hannah.
Impressum
Neuübersetzung
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel «Sheltering Rain» bei Hodder & Stoughton, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 im Wunderlich Verlag, Reinbek bei Hamburg.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2002 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 2002 by Jojo Moyes
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke, Cordula Schmidt
Coverabbildung Daniela Terrazzini/The Artworks
ISBN 978-3-644-51101-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Charles Arthur
und Betty McKee
Prolog
Dann wird der Erzbischof die rechte Hand der Queen küssen. Hiernach wird der Duke of Edinburgh die Treppen zum Thron emporsteigen, und nachdem er seine Krone abgenommen hat, wird er vor Ihrer Majestät niederknien, seine Hände zwischen die der Queen legen und dabei die Huldigungsformel sprechen:
Ich, Philip, Duke of Edinburgh,
werde zu Eurem Lehnsmann mit Leib und Leben
und irdischer Verehrung;
und Treue und Wahrhaftigkeit werde ich Euch entgegenbringen,
auf Leben und im Tod, gegen jedes Ungemach.
So wahr mir Gott helfe.
Und sich erhebend, wird er die Krone auf dem Haupt der Majestät berühren und die linke Wange Ihrer Majestät küssen.
Auf dieselbe Weise werden der Duke of Gloucester und der Duke of Kent einzeln ihre Huldigung darbringen.
Aus dem Zeremoniell des
Krönungsgottesdienstes 1953
Vermutlich war es ziemlich unmanierlich gewesen, dachte Joy später, seinen Zukünftigen an dem Tag kennenzulernen, der eigentlich der große Tag von Prinzessin Elizabeth sein sollte. Beziehungsweise der Tag von Queen Elizabeth II., wie ihr noch großartigerer Titel abends lauten würde. Im Verhältnis zu der Tragweite allerdings, die dieses Ereignis für sie beide haben sollte, hatte zumindest Joy kaum die angemessene Begeisterung aufbringen können.
An diesem Tag schien sich Regen anzukündigen, ganz und gar kein Königinnenwetter. Der Himmel über dem Hafen von Hongkong war stahlgrau gewesen, die Luftfeuchtigkeit enorm. Während sie mit Stella um den Victoria Peak ging, den höchsten Berg von Hongkong Island, in der Hand die Kladde mit Liedernoten, die Bluse an ihrem Rücken klebend wie Zuckerglasur, hatte Joy bei dem Gedanken an die Krönungsparty bei den Brougham Scotts nicht gerade monarchistische Euphorie empfunden.
Ihre Mutter zu Hause war nur noch ein Nervenbündel aus Vorfreude und Unzufriedenheit, was größtenteils an der Anwesenheit ihres Vaters lag, der von einer seiner China-Reisen zurückgekehrt war. Seine Besuche schienen stets mit einer rapiden Verschlechterung von Alice’ Laune zusammenzufallen. Ihr ständiges Verlangen nach einem besseren Leben irgendwo anders brach sich dann in zunehmend gemeinen und lieblosen Bemerkungen Bahn.
«Das wirst du nicht tragen», hatte sie stirnrunzelnd zu Joy gesagt und den Mund zu einem scharlachroten, missbilligenden Flunsch verzogen.
Joy hatte einen Blick zur Tür geworfen. Sie wollte sich unbedingt mit Stella treffen, um nicht mit ihren Eltern zur Villa der Brougham Scotts gehen zu müssen, und flunkerte deshalb, die Gastgeber wollten die Notenblätter frühzeitig haben. Wenn sie mit ihren Eltern unterwegs war, selbst zu Fuß, hatte sie das Gefühl, seekrank zu werden.
«Du siehst so unattraktiv aus, Darling. Und mit deinen Absätzen wirst du alle anderen überragen.» Dieses «Darling» war eine altbekannte Tarnung, wenn Alice etwas Unschönes zu ihr sagte.
«Ich werde mich setzen.»
«Du kannst nicht den ganzen Abend nur dasitzen.»
«Dann gehe ich eben ein bisschen in die Knie.»
«Du solltest einen breiteren Gürtel tragen. Das verkürzt optisch.»
«Der wird mir in den Brustkorb schneiden.»
«Ich weiß nicht, warum du dich so anstellst. Ich versuche doch nur, das Beste aus deiner Erscheinung zu machen. Schließlich unternimmst du selbst überhaupt nichts, um hübsch auszusehen.»
«Oh, Mummy, das ist mir egal. Und allen anderen ist es auch egal. Kein Mensch wird auf mich achten. Sie werden nur der Prinzessin zuhören, wenn sie ihren Eid schwört, oder was auch immer sie macht.» Lass mich einfach gehen, flehte sie in Gedanken. Es würde schon schlimm genug werden, Alice’ permanent ätzende Laune während der Party ertragen zu müssen.
«Aber mir ist es nicht egal. Die Leute werden denken, dass ich dir nicht beigebracht habe, auf deine Erscheinung zu achten.»
Was die Leute dachten, war sehr wichtig für Alice. Hongkong ist wie ein Goldfischglas, sagte sie gern. Es gab immer jemanden, der einen beäugte, der über einen redete. Das muss ja eine sehr kleine und langweilige Welt sein, in der sie leben, lag es Joy dann auf der Zunge. Aber sie sprach es nicht aus, vor allem, weil es zutraf.
Und dann war da auch noch ihr Vater, der zweifellos zu viel trinken und alle Frauen auf den Mund statt auf die Wange küssen würde, worauf sie sich beklommen umsehen würden, unsicher, ob sie ihn irgendwie dazu ermutigt hatten. Ich bin einfach nur mal ein bisschen aus mir herausgegangen, würde er später brüllen. Welche Ehefrau würde ihrem Mann diesen harmlosen Spaß nach wochenlanger, anstrengender Arbeit in China verübeln? Seit der japanischen Invasion war er nicht mehr wiederzuerkennen. Aber darüber sprach man damals nicht.
Außerdem waren da die Brougham Scotts. Und die Marchants. Und die Dickinsons. Und die Alleynes. Und all die anderen Ehepaare dieser besseren Kreise, die direkt unterhalb des Peaks wohnten, jedoch nicht unterhalb der Robinson Road (auf der mittleren Höhe lebten zu dieser Zeit lediglich kleine Angestellte), und die sich bei jedem Cocktailempfang im Hongkong-Cricket-Club sahen und bei den Pferderennen im Happy Valley, und die auf Sherry-seligen Dschunkenfahrten um die äußeren Inseln darüber stöhnten, wie schwierig es war, Milch zu bekommen, und über die Moskitos und die Immobilienpreise und die empörende Unhöflichkeit der chinesischen Hausangestellten. Oder sie redeten über England, und wie sehr sie es vermissten, und über die Besucher aus England und darüber, wie farblos und langweilig deren Leben war und wie trist es in England zuzugehen schien, obwohl der Krieg schon seit einer Ewigkeit vorbei war. Aber vor allem redeten sie übereinander. Die Militärangehörigen hatten eine ganz eigene Sprache entwickelt mit Insiderwitzen und Kasernenhumor, und die Kaufleute machten die Leistungen ihrer Konkurrenten herunter, während sich ihre Frauen in ständig wechselnden gehässigen Cliquen zusammenfanden.
Aber am schlimmsten war William, allgegenwärtig bei jedem gesellschaftlichen Ereignis, mit seinem fliehenden Kinn und seinem blonden Haar, das genauso dünn und zart war wie seine angestrengte, hohe Stimme. Ständig legte er Joy seine schweißige Hand auf den Rücken, um sie gegen ihren Willen irgendwohin zu dirigieren. Während sie ihm mit gespielter Höflichkeit zuhörte, konnte sie auf seinen Kopf herabschauen und abschätzen, wo sich sein Haar nächstens lichten würde.
«Glaubst du, dass sie nervös ist?», fragte Stella. Ihre Frisur, die zu einem Knoten aufgesteckt war, schimmerte wie feuchter Lack. Bei ihr kräuselte sich kein einziges Haar in der feuchten Luft, anders als bei Joy, deren widerspenstige Mähne sich schon nach Minuten aus der Frisur löste. Bei-Lin, ihre Amah, murmelte jedes Mal stirnrunzelnd vor sich hin, wenn sie es feststeckte, so als würde Joy das irgendwie mit Absicht machen.
«Wer?»
«Die Prinzessin. Ich wäre jedenfalls nervös. Stell dir nur mal all die Leute vor, die zuschauen werden.»
In den letzten Wochen hatte Stella, die zu diesem besonderen Anlass in einem roten Rock, einer weißen Bluse und einer blauen Jacke glänzte, nach Joys Meinung ein beinahe krankhaftes Interesse für Prinzessin Elizabeth an den Tag gelegt, über ihren Schmuck und ihre Garderobe spekuliert, über das Gewicht ihrer Krone und sogar darüber, dass ihr junger Ehemann vermutlich neidisch auf ihren Titel war, weil er nicht zum König ernannt werden würde. Langsam keimte in Joy der Verdacht auf, dass sie sich etwas zu sehr mit der Prinzessin identifizierte.
«Es werden sie ja nicht alle sehen. Es gibt massenhaft Leute wie uns, die nur übers Radio zuhören.» Sie traten zur Seite, um ein Auto vorbeifahren zu lassen, und warfen einen kurzen Blick ins Innere des Wagens, um festzustellen, ob jemand darin saß, den sie kannten.
«Aber sie könnte ja auch mit dem Text durcheinanderkommen. Mir würde es so gehen. Ich würde garantiert stottern.»
Das bezweifelte Joy, nachdem Stella praktisch das Musterbeispiel einer Lady war. Im Gegensatz zu Joy hatte sie die passende Größe, und stets trug sie elegante Kleidung, die ihr Schneider aus dem Tsim-Sha-Tsui-Viertel nach der neuesten Mode aus Paris anfertigte. Sie stolperte niemals über ihre eigenen Füße, war in Gesellschaft niemals verdrießlich oder brachte die Zähne nicht auseinander, wenn endlose Abordnungen von Offizieren zu «Empfängen» kommandiert wurden, um sie von ihrem bevorstehenden Einsatz im Koreakrieg abzulenken. Joy dachte oft, dass Stellas Außenwirkung ein paar Macken bekommen würde, wenn ihre Fähigkeit, das vollständige Alphabet zu rülpsen, bekannt wäre.
«Glaubst du, dass wir die ganze Zeit bleiben müssen?»
«Was? Während der gesamten Zeremonie?» Seufzend kickte Joy ein Steinchen weg. «Die dauert garantiert Stunden, und alle werden sich einen antrinken und übereinander herziehen. Und meine Mutter wird mit Duncan Alleyne flirten und damit anfangen, dass William Farquharson mit den Jardines verschwägert ist und die richtigen Zukunftsaussichten für ein Mädchen meines Formats mitbringt.»
«Ich würde sagen, er ist ziemlich klein für ein Mädchen deines Formats.» Stella hatte auch eine witzige Ader.
«Ich habe extra die Schuhe mit den höheren Absätzen angezogen.»
«Oh, jetzt komm schon, Joy. Das ist doch aufregend. Wir kriegen eine neue Königin.»
Joy zuckte mit den Schultern. «Warum sollte ich aufgeregt sein? Wir leben ja nicht mal in England.»
«Weil sie trotzdem unsere Königin ist. Wir sind sogar beinahe im gleichen Alter! Stell dir das mal vor! Und es ist die größte Party seit Ewigkeiten. Alle werden dort sein.»
«Aber es sind immer noch dieselben Leute. Es macht keinen Spaß, auf Partys zu gehen, wenn immer nur dieselben Leute kommen.»
«Oh Joy, du willst unbedingt ein Haar in der Suppe finden. Es gibt haufenweise neue Leute, du musst nur mit ihnen reden.»
«Aber ich habe nichts zu sagen. Alle interessieren sich nur fürs Einkaufen und Kleider und dafür, wer sich wem gegenüber unmöglich benommen hat.»
«Nichts für ungut, aber …», kam es scherzhaft von Stella. «Und was hast du sonst noch auszusetzen?»
«Ich meine nicht dich. Aber du verstehst doch, was ich sagen will. Es muss einfach noch mehr geben im Leben. Willst du nicht irgendwann mal nach Amerika? Oder nach England? Die Welt bereisen?»
«Das habe ich schon getan. Ich war an vielen Orten.» Stellas Vater war Flottenkommandant. «Ehrlich gesagt, finde ich, dass die Interessen der Leute überall gleich sind. Als wir in Singapur waren, kam man sich vor wie bei einer niemals endenden Cocktailparty. Sogar Mummy hat sich gelangweilt», sagte Stella. «Trotzdem, es sind nicht immer dieselben Leute. Es gibt ja noch die Offiziere. Die werden heute massenhaft da sein. Und ich bin sicher, dass du sie noch nicht alle kennengelernt hast.»
Es waren wirklich massenhaft Offiziere da. Auf der weitläufigen, herrschaftlichen Terrasse der Brougham Scotts, die in den seltenen Momenten, in denen sich der Nebel vom Peak zurückzog, einen Blick über den Hafen von Hongkong bot, wogte ein Meer weißer Uniformen. Im Haus, unter Ventilatoren, die sich wie riesige Propeller drehten, bewegten sich die chinesischen Bediensteten, die ebenfalls weiße Jacketts trugen, mit ihren weichen Schuhen lautlos zwischen den Gästen, um auf Silbertabletts eisgekühlte Longdrinks anzubieten. Geplauder hob und senkte sich vor der Hintergrundmusik, die ihrerseits von der schwülen Hitze gedämpft schien. Die Wimpel der Union-Jack-Girlanden hingen trotz des künstlichen Luftzugs wie feuchte Wäsche schlaff herunter.
Anscheinend genauso schlaff lag Elvine Brougham Scott, blass und sinnlich, auf einer Chaiselongue in einer Ecke des marmorgefliesten Salons, wie immer umschwärmt von einem Korps zuvorkommender Offiziere. Sie trug ein pflaumenfarbenes Seidenkleid mit herzförmigem Ausschnitt und einem Faltenrock, der sich um ihre langen, blassen Beine schmiegte. Unter ihren Armen zeigten sich keine Schwitzflecken, registrierte Joy und presste die Ellbogen an ihren Körper.
Joy und Stella gaben die Notenblätter ab und nickten zur Begrüßung, weil sie wussten, dass Mrs. Brougham Scott nicht gestört werden wollte. «Wie werden wir die Zeremonie hören?», fragte Stella und sah sich unruhig nach dem Radio um. «Woher werden sie wissen, wann es angefangen hat?»
«Keine Sorge, meine Liebe, es sind noch Stunden bis dahin», sagte Duncan Alleyne und warf im Vorbeigehen einen Blick auf seine Uhr. «Vergessen Sie nicht, dass sie in der Heimat acht Stunden später dran sind.» Duncan Alleyne redete immer wie ein Fliegerheld in einem Kriegsfilm. Die Freundinnen fanden das lächerlich, Alice jedoch schien sich dann zu fühlen, als wäre sie die Celia Johnson dieser Filme. Joy hätte sich schütteln können.
«Weißt du, dass sie die ‹lebendigen Worte Gottes› anerkennen muss?», fragte Stella hingerissen.
«Wie bitte?»
«Prinzessin Elizabeth. Bei der Zeremonie. Sie muss die ‹lebendigen Worte Gottes› anerkennen. Hab keinen Schimmer, wie sie lauten. Oh. Und sie wird von vier Rittern des Hosenbandordens begleitet. Wusstest du, dass der Orden so heißt, weil die Geliebte von König Edward III. auf einem Ball ihr Strumpfband verloren hat? Glaubst du, die Ritter müssen auf die Strumpfbänder von Elizabeth aufpassen? Sie hat schließlich eine Haushofmeisterin. Das hat mir Betty Warner erzählt.»
Joy nahm den entrückten Ausdruck in Stellas Blick wahr. Warum konnte sie sich nicht auch so von diesem Ereignis mitreißen lassen? Warum graute es ihr schon bei dem bloßen Gedanken an den Abend, der vor ihr lag?
«Und darauf kommst du nie. Ihre Brust wird mit heiligem Öl gesalbt. Ich wünschte, wir säßen nicht am Radio, sondern könnten sehen, ob der Erzbischof sie tatsächlich berührt.»
«Hallo, Joy. Meine Güte, du siehst … du siehst, ehrlich gesagt, total erhitzt aus. Musstest du zu Fuß herlaufen?» Das war William, der über seine eigene Gesprächseröffnung errötete, während er zögerlich die Hand zur Begrüßung ausstreckte. «Verzeihung. Ich habe nicht gemeint … ich meine, ich bin auch gelaufen. Und ich bin schrecklich verschwitzt. Viel verschwitzter als du. Sieh mal.» Joy schnappte sich einen rosafarbenen Longdrink von einem Tablett und trank einen großen Schluck. Prinzessin Elizabeth war nicht die Einzige, die an diesem Tag ihr Leben für ihr Land hingab.
Bis zur Krönung kamen so einige rosafarbene Longdrinks zusammen. Joy, die bei dem schwülfeuchten Wetter leicht dehydrierte, hatte festgestellt, dass diese Drinks äußerst angenehm durch die Kehle glitten. Sie hatten nicht nach Alkohol geschmeckt, und die Aufmerksamkeit ihrer Mutter war von dem blödsinnigen Dauergrinsen Duncan Alleynes und ihrem Ärger über den offenkundig allzu vergnügten Abend abgelenkt, den sich ihr Mann machte – und deshalb war Joy nicht darauf gefasst, dass sich Prinzessin Elizabeths Gesicht, deren Porträt an der Wand des Speisesaals aufgehängt worden war, plötzlich verdoppelte und über Joys Versuche, geradeaus zu gehen, komplizenhaft zu grinsen schien.
Die Party war in vollem Gange, und die Stimmen der üppig mit Getränken versorgten Gäste hallten in dem weitläufigen Erdgeschoss wider. Joy dagegen hatte sich immer mehr in sich selbst zurückgezogen, weil ihr das Talent fehlte, über Nichtigkeiten zu plaudern, wie es diesem Ereignis angemessen zu sein schien. Offenbar lag ihr Talent mehr darin, Leute zu vergraulen, als sie zu bezaubern. Irgendwann war es ihr gelungen, sogar William loszuwerden, und auch Stella war weg, verschluckt von einer Runde charmanter Marineoffiziere. Rachel und Jeannie, die beiden anderen jungen Frauen in ihrem Alter, saßen mit ihren beiden genau gleich pomadisierten Galanen in einer Ecke zusammen. Befreit von der Mäkelei – oder auch nur der Beachtung – ihrer Altersgenossen, waren die rosafarbenen Longdrinks und Joy zu richtig guten Freunden geworden.
Als sie feststellte, dass ihr Glas seltsamerweise schon wieder leer war, sah sie sich nach einem Hausboy um. Doch sie schienen alle verschwunden zu sein, was allerdings daran liegen konnte, dass es Joy schwerfiel, sie von den Gästen zu unterscheiden. Sie hätten alle Union-Jack-Jacketts tragen sollen, dachte Joy und musste kichern. Union-Jacketts. Oder kleine Kronen.
Schwach drang der Klang eines Gongs in ihr Bewusstsein und die gutgelaunte Tenorstimme Mr. Brougham Scotts, der versuchte, alle ums Radio zu versammeln. Joy lehnte sich an eine Säule und wartete darauf, dass sich die Leute vor ihr in Bewegung setzten. Dann könnte sie auf die Terrasse hinausgehen und in der Brise durchatmen. Doch fürs Erste schoben sich noch alle durcheinander und bildeten eine undurchdringliche Mauer.
«Oh Gott», murmelte sie, «ich brauche frische Luft.»
Sie hatte geglaubt, diese Worte nur in Gedanken gesagt zu haben, doch plötzlich wurde sie am Arm genommen und hörte eine leise Stimme: «Dann bringen wir Sie am besten mal nach draußen.»
Zu ihrer Überraschung stellte Joy fest, dass sie aufsehen musste. (Sie musste selten aufsehen, denn sie war größer als beinahe alle Chinesen und die meisten britischen Männer auf der Party.) Sie war gerade noch imstande, zwei längliche, ernste Gesichter zu registrieren, die über zwei engen, weißen Krägen auf sie herabblickten. Ein Marineoffizier. Oder zwei. So genau konnte sie es nicht sagen. Einer jedenfalls hatte sie am Arm genommen und steuerte sie sanft durch die Menge auf den Balkon zu.
«Möchten Sie sich setzen? Atmen Sie tief. Ich besorge Ihnen ein Glas Wasser.» Er setzte sie in einen Korbsessel und verschwand.
Joy sog die frische Luft ein. Mit der beginnenden Dämmerung hatte sich Nebel auf den Peak gesenkt und verbarg das Haus vor dem restlichen Hong Kong Island. Die einzigen Hinweise darauf, dass sie nicht vollkommen allein auf der Welt war, bestanden in den fernen, durchdringenden Hupsignalen der Lastkähne unten in der Bucht, dem raschelnden Laub der Banyanbäume in der Nähe und einem schwachen Geruch nach Knoblauch und Ingwer, der von irgendwo herangeweht wurde.
Es war dieser Geruch, der Joy den Rest gab. «Oh Gott», murmelte sie, «oh nein …»
Sie warf einen Blick über die Schulter, stellte erleichtert fest, dass die letzten Partygäste in dem Raum mit dem Radio verschwanden, beugte sich vor und erbrach sich heftig und geräuschvoll über die Balkonbrüstung.
Als sie sich keuchend wieder aufsetzte, das Haar verschwitzt an den Schläfen klebend, hatte sie den Marineoffizier vor sich, der ihr ein Glas eisgekühltes Wasser entgegenhielt. Joy sah ihn stumm vor Entsetzen an, dann senkte sie ihr Gesicht, das nun flammend rot war vor Verlegenheit, über das Glas. Schlagartig unangenehm nüchtern, betete sie darum, dass er weg wäre, wenn sie wieder aufblickte.
«Möchten Sie ein Taschentuch?»
Joy hielt den Kopf gesenkt, starrte grimmig auf ihre zu hohen Schuhe. Etwas Unaussprechliches steckte in ihrer Kehle fest und weigerte sich trotz ihrer wiederholten Schluckversuche, wieder nach unten zu rutschen.
«Hier. Nehmen Sie es.»
«Bitte gehen Sie weg.»
«Wie bitte?»
«Ich sagte, bitte gehen Sie weg.» Oh Gott, wenn sie nicht bald nach Hause verschwand, würde ihre Mutter sie entdecken, und dann wäre die Hölle los. Sie wusste, was sie zu hören bekommen würde. 1. Man kann dich wirklich nirgendwohin mitnehmen. 2. Dein Verhalten ist eine unglaubliche Schande, oder auch: Warum kannst du nicht ein bisschen mehr wie Stella sein? 3. Was werden die Leute denken?
«Bitte. Bitte gehen Sie einfach.»
Joy wusste, wie ruppig sich das anhörte, aber die Angst, entdeckt zu werden, ebenso wie davor, höfliche Konversation betreiben zu müssen, während Gott weiß was auf ihre Bluse gespritzt sein konnte – und auf ihr Gesicht –, ließ Ruppigkeit als das kleinere Übel erscheinen.
Danach herrschte längeres Schweigen. Aus dem Esszimmer drangen laute Begeisterungsrufe nach draußen.
«Ich glaube nicht … ich glaube, es wäre besser, wenn Sie jetzt nicht allein wären.» Die Stimme klang nicht jung, nicht nach den zackigen, lauten Tönen der meisten Offiziere, doch auch nicht nach dem Basso profundo, der sich nach längerer Zeit in einer Machtposition einstellte. Möglicherweise war er Stabsoffizier.
Warum geht er nicht?, dachte Joy.
Aber er blieb einfach stehen. Auf seinen makellosen Uniformhosen befand sich in Höhe des linken Schienbeins ein kleiner orangefarbener Spritzer.
«Hören Sie, ich fühle mich schon viel besser, danke. Und es wäre mir wirklich lieber, wenn Sie mich allein lassen würden. Ich denke, ich gehe nach Hause.» Ihre Mutter würde einen Tobsuchtsanfall bekommen. Aber Joy konnte sagen, dass ihr nicht gut gewesen war. Das wäre nicht mal eine Lüge. Und dieser Mann war der Einzige, der die Wahrheit kannte.
«Erlauben Sie mir, Sie nach Hause zu bringen», sagte er.
Neue Begeisterungsrufe hallten nach draußen, durchsetzt mit schrillem, etwas hysterischem Gelächter. Dann setzte Jazzmusik ein, nur um sofort wieder abzubrechen.
«Bitte», sagte er, «nehmen Sie meine Hand. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.»
«Würden Sie mich bitte einfach allein lassen?» Dieses Mal klang ihre Stimme barsch, sogar für ihre eigenen Ohren. Es entstand eine kurze Stille, und dann, nach einem endlosen, spannungsgeladenen Moment, hörte sie seine Schritte auf der Terrasse, als er langsam nach drinnen ging.
Joy war zu verzweifelt, um sich lange zu schämen. Sie stand auf, trank einen großen Schluck von dem eisgekühlten Wasser, und dann ging sie entschlossen, wenn auch etwas wacklig ins Haus. Mit etwas Glück konnte sie einem der Angestellten Bescheid sagen und entkommen, während alle anderen beim Radio waren. Doch als sie an der Tür zum Salon vorbeiging, kamen schon vereinzelte Gäste heraus. Zu den ersten gehörte Stella, mit Tränen in den Augen und enttäuscht herabgezogenen Mundwinkeln.
«Oh Joy, das ist doch einfach nicht zu fassen.»
«Was denn?» Joy überlegte, wie sie ihre Freundin möglichst schnell loswerden konnte.
«Dieses dumme, verflixte Radio. Wie kann es nur ausgerechnet heute kaputtgehen? Ich kann nicht glauben, dass sie nur eines im Haus haben. Bestimmt hat alle Welt mehr als einen Radioapparat.»
«Kein Grund zur Sorge, Stella, meine Liebe», sagte Duncan Alleyne, eine Hand an den Schnurrbart gelegt, während er die andere für seine vorgebliche väterliche Fürsorge ein wenig zu lang auf Stellas Schulter liegen ließ. «Es wird nicht lange dauern, bis einer von den Männern einen Apparat aus dem Haus der Marchants hergebracht hat. Sie werden beinahe gar nichts verpassen.»
«Doch, wir verpassen den gesamten Anfang. Und den werden wir nie mehr zu hören bekommen. Wahrscheinlich gibt es zu unseren Lebzeiten nicht noch eine Krönung. Oh, ich fasse es einfach nicht.» Inzwischen weinte Stella regelrecht, ohne auf die anderen Gäste zu achten, von denen offenkundig so manche die sakrale Krönungszeremonie eher als ziemlich lästige Unterbrechung einer absolut perfekten Party betrachteten.
«Stella, ich muss gehen», flüsterte Joy. «Tut mir wirklich leid. Mir ist nicht gut.»
«Aber das kannst du nicht machen! Bleib wenigstens, bis sie das Radio gebracht haben.»
«Ich melde mich morgen.» Als sie sah, dass ihre Eltern noch in der Gruppe bei dem stummen Radio saßen, ging Joy hastig zur Tür. Mit einem Nicken bedankte sie sich bei dem Hausboy, der sie hinausließ, und dann war sie weg, allein in der schwülen Nacht, nur begleitet von dem Sirren der Moskitos, die sich wie Sturzkampfbomber auf sie stürzten, und von leichtem Unbehagen bei dem Gedanken an den Mann, den sie hatte stehen lassen.
Die Ausländer in Hongkong lebten sehr gut, und dazu gehörten beinahe allabendlich Empfänge und Essenseinladungen. Deshalb war es nicht ungewöhnlich, dass sich frühmorgens kaum ein Gweilo blicken ließ. Und Joy, deren Missgeschick mit den rosafarbenen Drinks dazu geführt hatte, dass sie mit erstaunlich klarem Kopf aufwachte, fand sich in der seltenen Situation, eine Ein-Personen-Minderheit darzustellen.
Es war, als hätte der gesamte Peak einen Kater. Während chinesische Männer und Frauen auf leisen Sohlen schwere Körbe schleppten oder Müllkarren zogen, war kein einziger Europäer zu sehen. An den weiß gestrichenen, von der Straße zurückversetzten Häusern hingen wie zur Entschuldigung die bunten Girlanden, und Bilder der lächelnden Prinzessin rollten sich hinter Fensterscheiben auf, als wären sogar sie von den Exzessen der vergangenen Nacht erschöpft.
Joy und Bei-Lin schlichen über die Teakböden der Wohnung und unterhielten sich im Flüsterton – keine von ihnen wollte Alice und Graham aufwecken, deren hitzige, ausschweifende Streiterei bis in die frühen Morgenstunden gedauert hatte. Joy war zu dem Schluss gekommen, dass das einzig Sinnvolle ein Ausflug zu den New Territories wäre, um reiten zu gehen. Alle würden überempfindlich sein und sich elend fühlen. Noch dazu war die schwülfeuchte Luft drückender denn je. Sie verstärkte die Kopfschmerzen des Katzenjammers noch und würde dafür sorgen, dass an diesem Tag niemand etwas anderes tat, als schlechtgelaunt unter dem Ventilator auf den Polstermöbeln zu liegen und seine Wunden zu lecken. Es war kein Tag, um in der Stadt zu sein. Allerdings hatte Joy das Problem, dass an diesem Morgen niemand da war, der sie aus der Stadt herausbrachte.
Ungefähr um zehn Uhr war sie zum Haus von Stellas Eltern gegangen, aber die Vorhänge waren zugezogen, und sie hatte nicht stören wollen. Ihr eigener Vater, auf den üblicherweise Verlass war, wenn es darum ging, seine Prinzessin herumzuchauffieren, würde vermutlich nicht vor der Mittagszeit aufstehen. Und sonst gab es niemanden, den sie fragen wollte. Nun, als sie in einem Korbsessel am Fenster saß, spielte Joy mit dem Gedanken, die Straßenbahn bis zum Stadtzentrum zu nehmen und dann in einen Zug umzusteigen, aber das hatte sie noch nie allein getan, und Bei-Lin hatte es abgelehnt, sie zu begleiten. Sie wusste, dass die Laune der Hausherrin noch viel schlechter werden würde, wenn sie beim Aufstehen feststellte, dass ihre Angestellte zu einer «Spritztour» aufgebrochen war. «Oh, Gott schütze die dämliche Queen», hatte Joy bei ihrem Rückzieher gemurmelt.
Es war nicht das erste Mal, dass angesichts der räumlichen und persönlichen Einschränkungen ihres Lebens rebellische Gefühle in Joy aufkamen. Als sie mit ihrer Mutter in Australien gelebt hatte, kurz nachdem die Japaner in Hongkong einmarschiert waren und die Frauen und Kinder die Kolonie verlassen hatten, war Joy in den Genuss unerhörter Freiheiten gekommen. Sie hatten bei Alice’ Schwester Marcelle gewohnt. Die Türen ihres Hauses am Strand schienen immer offen zu stehen, sodass Joy und zahlreiche Nachbarn, die im Vergleich zu denen in Hongkong viel entspannter und fröhlicher wirkten, ein und aus gehen konnten, wie sie wollten.
Auch Alice war dort entspannt gewesen, war in der trockenen Wärme aufgeblüht, wo alle Englisch sprachen und die großen, sonnengebräunten Männer schamlos flirteten. Alice’ Umgangsformen waren der Gipfel der Vornehmheit gewesen, ihre Kleidung jenseits allem, was man dort je gesehen hatte, und sie konnte so auftreten, wie sie es sich wünschte: chic, kosmopolitisch und durch ihr Exil ein wenig exotisch. Zudem war Marcelle jünger als Alice und angenehm fügsam in allen Geschmacks- und Stilfragen. Das große Wohlwollen, das ihr entgegengebracht wurde, hatte dazu geführt, dass sich Alice von Joy viel weniger «strapaziert» fühlte als gewöhnlich und sie zum Strand oder ins Kaufhaus gehen ließ. Ganz anders als in Hongkong, wo sie sich ständig Gedanken über Joys mangelhaftes Erscheinungsbild und Benehmen machte und über die möglichen Gefahren, die in einem unzivilisierten Land drohen konnten, wenn sie Joy allein aus dem Haus ließ.
«Ich hasse mein Leben», sagte Joy laut, und ihre finsteren Gedanken hingen wie eine dunkle Wolke über ihr.
«Miss?»
Bei-Lin stand an der Tür. «Da ist ein Gentleman, der Sie sprechen möchte.»
«Meine Mutter.»
«Nein, Miss. Er fragt nach Ihnen.» Sie grinste vielsagend.
«Dann führst du ihn am besten herein.»
Stirnrunzelnd strich sich Joy übers Haar und stand auf. Gesellschaft war das Letzte, was sie wollte.
Die Tür wurde geöffnet, und ein Mann kam herein, den sie nie zuvor gesehen hatte. Er trug ein weißes Kurzarmhemd und cremefarbene Hosen, hatte säuberlich geschnittenes, rötliches Haar, ein längliches Patriziergesicht und hellblaue Augen. Außerdem war er groß, und als er durch die Tür ging, bückte er sich unnötigerweise etwas, offenkundig aus Gewohnheit. Marine, dachte Joy automatisch. Sie zogen vor Türen immer den Kopf ein.
«Miss Leonard.» Er hielt seinen Strohhut mit beiden Händen vor sich.
Joy sah ihn verdutzt an. Sie konnte sich nicht erklären, woher er ihren Namen kannte.
«Edward Ballantyne. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich. Ich wollte einfach … ich dachte einfach, ich sollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht.»
Joy musterte ihn, und als sie ihn wiedererkannte, wurde sie schlagartig rot. Sie hatte dieses Gesicht zuvor nur in einer Doppelversion gesehen. Unbewusst hob sie die Hand zum Mund.
«Ich habe mir erlaubt, Ihre Freundin nach Ihrem Namen und Ihrer Adresse zu fragen. Ich wollte einfach nur sicher sein, dass Sie gut nach Hause gekommen sind. Ich hatte ziemliche Schuldgefühle, weil ich Sie allein habe gehen lassen.»
«Aber nicht doch.» Joy betrachtete eingehend ihre Füße. «Mir ging es bestens. Sie sind zu freundlich», fügte sie hinzu, als ihr bewusst wurde, wie unhöflich sie sich angehört hatte.
Sie standen eine ganze Weile so da, bevor Joy klar wurde, dass er nicht vorhatte, sich zu verabschieden. Ihr war so unbehaglich zumute, dass ihre Haut prickelte. Noch niemals war sie so beschämt gewesen wie in der Nacht zuvor, und nun kehrte dieses Gefühl zurück wie ein ekelhafter Nachgeschmack. Warum konnte er sie nicht einfach in Frieden lassen? Sie mit ihrer Demütigung allein lassen? Bei-Lin drückte sich abwartend an der Tür herum, aber Joy ignorierte sie absichtlich; auf keinen Fall würde sie ihm etwas zu trinken anbieten.
«Ehrlich gesagt», erklärte er, «habe ich überlegt, ob Sie vielleicht gern einen Spaziergang machen würden. Oder eine Runde Tennis spielen. Unser Kommandant hat für uns eine Sondererlaubnis zur Benutzung der Tennisplätze unten an der Causeway Bay erhalten.»
«Nein danke.»
«Dürfte ich Sie dann vielleicht darum bitten, mir ein paar Sehenswürdigkeiten zu zeigen? Ich bin zum ersten Mal in Hongkong.»
«Es tut mir sehr leid, aber ich war gerade auf dem Weg aus dem Haus.» Joy konnte ihn noch immer nicht direkt ansehen.
Darauf folgte eine lange Pause. Er starrte sie garantiert an. Das konnte sie spüren.
«Haben Sie etwas Schönes vor?»
«Wie bitte?» Joy fühlte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Warum ging er denn nicht endlich?
«Sie sagten, Sie waren gerade auf dem Weg aus dem Haus. Ich habe mich nur gefragt … wohin?»
«Ich gehe reiten.»
«Reiten?» Er klang so begeistert, dass sie aufsah. «Gibt es denn Pferde hier?»
«Hier nicht», sagte sie. «Nicht auf der Insel jedenfalls. Aber in den New Territories. Ein Freund meines Vaters führt dort einen Reitstall.»
«Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich mitkomme? Ich reite zu Hause ein wenig. Es fehlt mir schrecklich. Genau genommen habe ich seit neun Monaten kein Pferd gesehen.»
Er klang so sehnsüchtig wie die meisten Militärs, wenn sie von ihren Familien sprachen. Er war, das musste sie zugeben, schrecklich gutaussehend, auf eine erwachsene Art.
Aber er hatte mit angesehen, wie sie sich auf dem Balkon blamiert hatte.
«Ich habe ein Auto zur Verfügung. Ich könnte Sie hinbringen. Oder Ihnen einfach nachfahren, falls das – ähm – angemessener ist.»
Joy wusste, dass ihre Mutter vollkommen entsetzt sein würde, wenn ihr Bei-Lin erzählte, dass Miss Joy mit einem fremden Mann im Auto weggefahren war. Doch das Nachspiel würde wahrscheinlich auch nicht viel schlimmer ausfallen, als wenn sie dablieb, der verkaterten Alice den ganzen Tag ins Gehege kam und als verbaler Punchingball dienen musste. Außerdem war die Vorstellung äußerst reizvoll, mit diesem fremden, großen, sommersprossigen Mann durch die stillen Straßen zu fahren. Er gab ihr nicht wie die anderen Offiziere das Gefühl, unbeholfen und maulfaul zu sein, sondern redete einfach drauflos und erzählte von sich; von seinen Pferden in Irland (seltsamerweise hatte er keinen irischen Akzent), von der Ursprünglichkeit der Landschaft und was es dagegen bedeutete, in der endlosen, klaustrophobischen Langeweile eines Schiffes eingesperrt zu sein und in dieser winzigen Welt monatelang am Stück mit denselben Leuten festzusitzen.
Sie hatte nie einen Mann reden hören, wie er es tat, ohne die ständigen, schneidigen Sprüche, die ein Markenzeichen der meisten Offiziere waren, mit denen sie zu tun hatte. Edwards Sprache war unverstellt und direkt. Er redete wie jemand, dem lange Zeit das Sprechen vorenthalten worden war, er plauderte in einem fort, nur unterbrochen von schallendem Lachen. Gelegentlich hielt er mit einem Blick auf sie inne, als wäre ihm seine mangelnde Zurückhaltung peinlich, doch nur, bis der nächste Gedanke aus ihm heraussprudelte.
Unwillkürlich musste auch Joy lachen, anfänglich noch gehemmt, doch dann zunehmend befreiter, und bis sie bei dem Reitstall ankamen, strahlte und kicherte sie auf eine Art, die ihr selbst vollkommen fremd war. Sie warf verstohlene Blicke auf den Mann neben ihr, senkte kokett die Augen, wenn er sie ansah, und benahm sich überhaupt – nun ja – wie Stella.
Mr. Foghill erklärte sich bereit, ihn reiten zu lassen. Darauf hatte Joy insgeheim gehofft, und nachdem sich Edward in dem Stallhof eine Weile mit ihm unterhalten und in höchsten Tönen von den großartigen Jagdpferden gesprochen hatte, die er kannte, und Mr. Foghill darin zustimmte, dass die irische Zuchtlinie der englischen eindeutig überlegen war, hatte Mr. Foghill seine anfängliche Zurückhaltung aufgegeben und ihm sogar sein eigenes Pferd angeboten, einen hochgewachsenen jungen Fuchs. Mr. Foghill hatte Edward noch gebeten, ein paar Runden in der Reithalle zu drehen, um einen Blick auf seinen Sitz und seine Zügelführung zu werfen, doch was er sah, hatte ihn offenkundig überzeugt, denn bald darauf ritten sie langsam durch das Tor und die Straße hinaus ins offene Gelände.
Zu diesem Zeitpunkt wusste Joy nicht mehr, was eigentlich mit ihr los war. Sie konnte einfach nicht mehr aufhören zu lächeln und zu nicken, wobei sie gleichzeitig versuchte, über das ungewohnte Pochen in ihren Ohren hinweg jedes seiner Worte zu verstehen. Sie war dankbar, sich an den Zügeln festhalten und ihren Blick auf den langen grauen Hals vor ihr richten zu können, der sich im Takt des Hufschlags hob und senkte, denn irgendetwas stimmte mit ihrer Konzentrationsfähigkeit nicht. Sie fühlte sich merkwürdig von ihrer Umgebung entrückt und nahm zugleich jede Kleinigkeit äußerst bewusst wahr. Wie seine Hände. Und seine Sommersprossen. Und die beiden Falten, die sich auf seinen Wangen bildeten, wenn er lächelte. Sie bekam nicht einmal etwas davon mit, dass die Moskitos ihren Nacken ins Visier nahmen, sich unter ihrem zurückgebundenen Haar verfingen und auf blasser, zarter Haut ein Festmahl abhielten.
Das Beste von allem war, dass er reiten konnte, richtig reiten. Er saß aufrecht und locker im Sattel, seine Hände bewegten sich leicht vor und zurück, sodass seine Zügel nicht in das Maul des Pferdes einschnitten, und ab und zu beugte er sich vor, um dem Fuchs über den Hals zu streichen oder eine nichtsahnende Fliege zu verscheuchen. Joy war schon einmal mit einem Mann, den sie gemocht hatte, in dem Reitstall gewesen, einem schüchternen Banker-Freund ihres Vaters. Doch als sie ihn im Sattel herumschlingern sah, außerstande, seine Angst zu verbergen, während das Tier leicht zu traben begann, hatte sich ihre aufkeimende Verliebtheit verflüchtigt wie Rauch im Wind. Und William würde sie niemals auch nur in die Nähe eines Pferdes bringen. Es gab nichts, was einen schneller von einem Mann abschreckte, als ihn auf einem Pferd zu sehen. Dennoch wurde Joy erst jetzt bewusst, dass es umgekehrt sehr anziehend wirken konnte, wenn ein Mann gut ritt.
«Waren Sie schon einmal in Schottland?», fragte Edward.
«Wie bitte?»
«Diese Moskitos. Sie sind wie die Bartmücken dort», sagte er und schlug sich auf den Nacken. «Stechen einen wirklich überallhin.»
Sie ritten weiter. Der Himmel trübte sich ein, und tiefhängende Wolken schoben sich heran, sodass Joy nicht genau wusste, ob es die feuchte Luft oder Schweiß war, der ihre Kleidung durchtränkte und dafür sorgte, dass einzelne Grashalme und Samen an ihrer Haut kleben blieben. Die Atmosphäre schien alle Geräusche zu dämpfen, die Hufschläge der Pferde hörten sich an, als seien ihre Läufe in Flanell gewickelt, und Joy hatte das Gefühl, als würde sich eine warme, feuchte Decke über sie beide legen. Hoch über ihnen zeichneten sich vor dem Lion Rock die Umrisse von Bussarden ab, und sogar sie schienen bewegungslos in der Luft zu hängen wie schwarze Tropfen, als sei ihnen jede Bewegung zu anstrengend, während die Zweige, die an ihren Stiefeln entlangstreiften, Wasserspuren hinterließen, obwohl es länger nicht geregnet hatte.
Falls er mitbekam, dass ihre Gedanken Karussell fuhren, dass sie ständig rot wurde, kaum einen Satz herausbekam oder dass ihr Pferd ihre Unaufmerksamkeit ausnutzte, um hier und da Blätter vom Gebüsch zu rupfen, sagte er nichts dazu. Als sie die Tiere auf einem Reitweg entlang eines Reisfelds zu leichtem Galopp antrieben und auch als er bei einer Hütte am Wegesrand anhielt, um einen Schnitz Wassermelone für sie zu besorgen, entspannte sie sich etwas, doch das machte sich nur dadurch bemerkbar, dass sie ihn nun ansehen konnte, ohne verlegen zu werden. In demselben Moment fiel ihr auf, dass sie ihr Haarband verloren hatte, sodass verschwitzte Strähnen unordentlich über ihre Schultern hingen. Doch auch dazu sagte er nichts, sondern schob ihr nur eine Locke aus dem Gesicht, als er ihr sein Taschentuch reichte, damit sie sich den Melonensaft von den Lippen wischen konnte. Noch Minuten nach dieser unerwarteten Berührung fühlte sich ihre Haut an wie elektrisiert.
«Wissen Sie, Joy, ich fand diesen Ausflug einfach großartig», sagte er nachdenklich, als sie die Pferde im Schritt zu dem Stallhof zurückgehen ließen. «Sie ahnen ja nicht, was es mir bedeutet hat, wieder einmal reiten zu können.»
Joy war bewusst, dass sie etwas sagen musste, doch sie befürchtete, dass ihr nur etwas Linkisches oder Unangebrachtes über die Lippen kommen würde oder, noch furchtbarer, dass sie sich irgendwie dieses seltsame, brennende Verlangen anmerken lassen würde, das wie aus dem Nichts in ihr aufgekeimt war. Aber wenn sie schwieg, was konnte er da schlimmstenfalls von ihr denken?
«Außerdem kenne ich nicht viele junge Damen, die reiten können. In jedem Hafen, den wir anlaufen, begegne ich immer nur welchen, die sich bei Cocktailpartys mit spritzigem Geplauder am wohlsten fühlen, und in solchen Sachen bin ich nicht besonders gut. Ich habe seit einer Ewigkeit niemanden mehr kennengelernt, mit dem ich wirklich eine entspannte Zeit verbringen konnte.»
Joy hätte ihn am liebsten geküsst. Und beinahe hätte sie gerufen: Das verstehe ich, das verstehe ich wirklich. Mir geht es genauso. Alles, was Sie beschreiben, habe ich auch schon gedacht. Doch sie lächelte nur und nickte verstohlen und schalt sich zugleich selbst für ihre schlagartige Verwandlung in eine von den dummen Gänsen, die sie immer verachtet hatte. Sie wusste nicht, was sie von einem Mann erwartete – es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass sie überhaupt Erwartungen haben durfte –, doch nun fühlte sie sich magisch von ihm angezogen. Und zwar nicht aufgrund bestimmter Eigenschaften, sondern aufgrund einer ganzen Liste von Eigenschaften, die er nicht hatte: seine Fähigkeit, ihr nicht das Gefühl von Unbeholfenheit einzuflößen, die Tatsache, dass er auf einem Pferd nicht aussah wie ein Sack Reis und dass er sie nicht anschaute, als wünschte er sich jemand anderen an ihre Stelle. In Joy stieg ein Gefühl auf, das stärker war als Übelkeit, aber genauso lähmend.
«Wie dem auch sei, danke. Es war wirklich das Beste seit langem.» Er rieb sich über den Kopf, sodass sich ein paar Haarsträhnen über seiner Stirn aufrichteten, und wandte den Blick von ihr ab. «Und ich weiß, dass Sie mich eigentlich nicht dabeihaben wollten.»
Joy starrte ihn entsetzt an, doch nun war er es, der sie nicht ansah. Wenn sie ihm erklärte, dass er sie missverstanden hatte, dass sie nicht ihn, sondern die Erinnerung an ihren unsäglich peinlichen Auftritt auf dem Balkon hatte abwehren wollen, wäre genau dies später seine Haupterinnerung an sie. Oh, wo war Stella, wenn man sie mal brauchte? Sie wusste immer, wie man mit Männern redete. Bis Joy zu dem Schluss kam, dass eine knappe Verneinung die beste Reaktion wäre, war es irgendwie zu spät dafür, denn nun ritten sie schon in den Stallhof.
Edward bot seine Hilfe bei der Versorgung der Pferde an, und Mr. Foghill schlug Joy vor, sich in der Zwischenzeit etwas frischzumachen. Als sie in den Spiegel der Damenumkleide sah, wurde ihr bewusst, wie fürsorglich dieser Vorschlag gewesen war. Sie sah aus wie eine Vogelscheuche. Ihr Haar war ein feuchtes, gekraustes Wirrwarr und sah aus wie ein Haarknäuel in einem Badewannenabfluss. Als sie versuchte, mit den Händen durchzufahren, blieben ihre Finger schon wenige Zentimeter von der Kopfhaut entfernt stecken, und auf ihrer weißen Bluse entdeckte sie grünliche Speichelspuren, wo das Pferd seinen Kopf an ihr gerieben hatte, nachdem sie abgestiegen war. Grimmig wischte sie sich mit einem feuchten Handtuch das Gesicht ab. Sie hätte heulen können, weil sie nicht einmal daran gedacht hatte, einen Kamm oder ein Ersatz-Haarband mitzunehmen. Das wäre Stella nie passiert. Doch als sie hinausging, empfing sie Edward mit einem freundlichen Lächeln, als fände er an ihrer Erscheinung nicht das Geringste auszusetzen. Seine eigene Hose allerdings war auch mit Pferdeschweiß und rötlichem Staub verdreckt und nur von den Knien abwärts sauber, weil ihm Mr. Foghill ein Paar Stiefel geliehen hatte.
«Ihre Kutsche steht bereit», sagte er und grinste. «Sie müssen mir sagen, wo es auf dem Rückweg langgeht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind.»
Edward war auf dem Weg nach Hause weniger gesprächig, was Joy ihre eigene Schweigsamkeit umso deutlicher bewusst machte. Obwohl sie sich in seiner Gesellschaft wohlfühlte, fiel ihr nichts Interessantes ein, das sie sagen konnte. Ohnehin würde sich einfach alles unzulänglich anhören, wo sie doch in Wahrheit ausdrücken wollte, dass innerhalb von vier kurzen Stunden ihre komplette Welt aus den Angeln gehoben worden war. Er hatte ihr Einblick in ein ganz anderes Land gegeben, mit frischen grünen Feldern, Jagdhunden und exzentrischen Dorfbewohnern, in dem es weit und breit keine Cocktailpartys gab. Wenn er redete, klang es nicht künstlich und nach Selbstbeweihräucherung; seine Sprechweise war Welten entfernt von der gezierten Art der Engländer in Hongkong, bei denen es immer nur um Geld ging. Bei seinen kräftigen, sommersprossigen Händen musste sie an Pferde und Liebenswürdigkeit denken und an etwas anderes, bei dem sich ihr Magen vor Verlangen zusammenzog.
«Ich wünschte, ich hätte Sie früher kennengelernt», sagte er im Fahrtwind.
«Wie bitte? Was haben Sie gesagt?»
«Ich sagte, ich wünschte, ich hätte Sie früher kennengelernt.» Ein Auto voller Marineoffiziere raste an ihnen vorbei, und der Fahrer hupte ihnen einen anzüglichen Gruß zu. «Es ist … ich weiß auch nicht. Es ist eben einfach ziemlich bitter, dass ich übermorgen wieder wegmuss.»
Joy gefror das Blut in den Adern. «Wie bitte? Was meinen Sie damit?»
«Wir laufen in zwei Tagen aus. Ich habe noch einen Tag Landurlaub, und dann geht es Richtung Korea.»
Joy stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Es war zu ungerecht. Jemanden gefunden zu haben – ihn gefunden zu haben – und nun musste er gleich wieder weg.
«Für wie lange?» Ihre Stimme zitterte leicht. Edward sah sie an, erhaschte ihren Gesichtsausdruck und blickte wieder auf die Straße.
«Ich glaube nicht, dass wir hierher zurückkommen», sagte er. «Wir leisten zusammen mit den Amis unseren Beitrag in den koreanischen Gewässern. Wir werden monatelang auf See sein.» Erneut warf er ihr einen Blick zu, sah ihr direkt in die Augen, als wollte er ihr vermitteln, dass man praktisch nicht in Verbindung bleiben konnte, wenn man ständig unterwegs war.
In Joy sträubte sich alles. Es war, als hätte man den Schlüssel zu seiner Gefängniszelle bekommen, nur um festzustellen, dass er aus Gummi war. Am liebsten hätte sie angefangen zu weinen. «Das kann ich nicht», flüsterte sie.
«Wie bitte?»
«Ich kann Sie nicht einfach so gehen lassen. Ich kann Sie nicht gehen lassen.» Dieses Mal sprach sie es laut aus und sah ihm in die Augen. Sofort machten sie ihre eigenen Worte fassungslos. Es war für eine junge Frau ihrer Herkunft einfach skandalös, so etwas zu sagen. Und dennoch waren ihr die Sätze unaufhaltsam über die Lippen gekommen.
In dem angespannten Schweigen, das darauf folgte, hätte Joy sterben können vor Verlegenheit. Dann nahm Edward ihre Hand. «Ich dachte nicht, dass Sie etwas für mich übrighaben», sagte er.
«Ich habe noch nie etwas für jemanden übriggehabt. Ich meine, vor Ihnen. Ich habe mich noch nie zuvor mit jemandem so wohlgefühlt.» Sie redete jetzt einfach drauflos. «Mir fällt es schwer, mich zu unterhalten. Und hier gibt es sowieso niemanden, mit dem ich mich unterhalten möchte. Abgesehen von Stella. Das ist meine Freundin. Und als Sie heute Vormittag gekommen sind, war mir das, was gestern Abend passiert ist, so peinlich, dass es mir einfacher vorkam, Sie wegzuschicken, statt nett zu Ihnen zu sein. Aber als Sie trotzdem geblieben sind, und bei der Autofahrt und überhaupt … so ein Gefühl hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie das Gefühl, nicht schief angesehen zu werden. So als könnte ich einfach ich selbst sein und würde verstanden werden.»
«Und ich dachte, Sie hätten einen Kater.» Er lachte.
Aber Joys Gefühle waren zu stark, um in sein Lachen einzustimmen. «Alles, was Sie heute gesagt haben, sehe ich genauso. Ich meine natürlich nicht das über die Jagd, weil ich noch nie an einer teilgenommen habe, aber alles, was Sie über Cocktailpartys und die Leute dort gesagt haben und darüber, dass Ihnen manchmal Pferde lieber sind als Menschen und es Ihnen gleichgültig ist, wenn man Sie für ein bisschen seltsam hält. Bei mir ist es genauso. Es war, als hätte ich mir selbst beim Denken zugehört. Und deshalb kann ich es nicht. Ich kann Sie nicht gehen lassen. Und selbst wenn Sie jetzt entsetzt sind und mich komplett peinlich finden, ist mir das egal, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl habe, mir selbst treu zu sein.»
Nach dieser Wortflut, die zweifellos die längste in Joys Erwachsenenleben gewesen war, liefen ihr zwei dicke, salzige Tränen über die erhitzten Wangen. Sie schluckte, war gleichzeitig erschreckt und berauscht von ihrem eigenen Verhalten. Sie hatte vor diesem Mann, den sie kaum kannte, ihr Innerstes auf eine Art nach außen gekehrt, die ihre Mutter und wahrscheinlich auch Stella für vollkommen verrückt halten würden. Und als sie zu ihm gesagt hatte, das sei ihr egal, war das nicht wahr gewesen. Denn wenn er sich nun von ihr abwandte, irgendeine höfliche Platitude darüber von sich gab, was er für einen netten Nachmittag gehabt habe, sie jetzt aber bestimmt sehr müde sei, würde sie sich beherrschen, bis sie zu Hause war, aber dann würde sie irgendeinen Weg finden, um sich … umzubringen. Denn es war einfach unmöglich, weiter ihr ödes, oberflächliches Leben zu ertragen, nachdem sie diese Gefühle in sich entdeckt hatte. Sag wenigstens, dass du mich verstehst, bat sie ihn in Gedanken. Es genügt mir, wenn du einfach nur sagst, dass du mich verstehst.
Wieder entstand ein langes, quälendes Schweigen.
«Ich denke, wir fahren jetzt besser zurück», sagte er, zog seine Hand zurück und legte sie wieder um den Schalthebel.
Joys Miene erstarrte. Langsam sank sie auf dem Beifahrersitz zusammen. Sie hatte einen gewaltigen Fehler gemacht. Natürlich. Was hatte sie nur auf den Gedanken gebracht, dass sie mit einem derartigen Ausbruch den Respekt eines Mannes gewinnen könnte, ganz zu schweigen von seinem Herz?
«Es tut mir leid», flüsterte sie und senkte den Kopf. «Wirklich, es tut mir leid.»
Oh Gott, wie hatte sie nur so dumm sein können?
«Was denn?», fragte Edward und strich ihr den feuchten Haarvorhang aus dem Gesicht. «Dass ich mit deinem Vater sprechen möchte?»
Joy sah ihn verständnislos an. Wollte er auch noch ihrem Vater erzählen, was für ein Dummkopf sie war?
«Hör zu.» Er umfasste ihre Wange. Seine Hand roch nach Schweiß. Und nach Pferd. «Ich weiß, das geht dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Aber Joy, wenn du mich willst, bitte ich deinen Vater um deine Hand.»
«Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass wir dazu unsere Zustimmung geben, oder?», sagte ihre Mutter entsetzt, während ihr zugleich die Verwunderung darüber ins Gesicht geschrieben stand, dass es ihrer Tochter gelungen war, solch starke Gefühle in einem Mann zu erwecken. (Ihre schlechte Laune war noch dadurch gesteigert worden, dass die beiden zurückgekommen waren, bevor sie Zeit gehabt hatte, sich zu schminken.) «Wir kennen ihn ja nicht mal.» Sie sprach, als wäre er nicht mit ihnen im Raum.
«Ich werde Ihnen alles erzählen, was Sie wissen möchten, Mrs. Leonard», sagte Edward, der seine langen Beine in der verschmutzten Hose vor sich ausgestreckt hatte.
Joy sah ihn nur stumm vor Freude an, so wie man vielleicht ein unglaubliches Überraschungsgeschenk betrachtete. Sie hatte sich auf der Rückfahrt wie benommen gefühlt, hatte beinahe hysterisch über ihr verrücktes Vorhaben gelacht. Sie kannte ihn doch gar nicht! Und er kannte sie nicht! Und trotzdem hatten sie sich wie Verschwörer angegrinst, ungelenk Händchen gehalten, und sie hatte ihm bereitwillig ihre Zukunft anvertraut. Sie hatte nicht erwartet, überhaupt jemanden zu finden. Hatte nicht einmal daran gedacht, sich nach einem Mann umzusehen. Aber er schien zu wissen, was er tat, und er schien außerdem viel mehr zu wissen, was das Richtige war, als sie. Und er hatte sich nicht im Geringsten von der Aussicht beunruhigen lassen, mit diesem Irrsinn vor ihre Eltern zu treten.
Edward atmete tief ein und begann, die Fakten herunterzuspulen. «Mein Vater ist Richter im Ruhestand, er und meine Mutter sind nach Irland gezogen, wo sie eine Pferdezucht unterhalten. Ich habe eine Schwester und einen Bruder, beide verheiratet, beide älter als ich. Ich bin neunundzwanzig Jahre alt, seit meinem Studium inzwischen beinahe acht Jahre bei der Marine, und ich verfüge zusätzlich zu meinem Sold über ein Anlagevermögen.»
Das leichte Naserümpfen ihrer Mutter bei der Erwähnung von Irland war durch das Wort «Anlagevermögen» ausgeglichen worden. Doch Joy sah ihren Vater an, suchte in seiner Miene nach einem Zeichen der Anerkennung.
«Das kommt schrecklich plötzlich. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht warten können», kam es von ihrer Mutter.
«Glauben Sie, dass Sie Joy lieben?» Ihr Vater, der sich mit seinem Gin Tonic im Sessel zurückgelehnt hatte, sah Edward eindringlich an. Joy wurde rot. Es wirkte beinahe obszön, dass er diese Worte laut ausgesprochen hatte.
Edward sah sie lange an, dann nahm er ihre Hand, sodass sie erneut errötete. Kein Mann hatte sie jemals vor ihren Eltern auch nur berührt. «Ich weiß nicht, ob einer von uns beiden es schon Liebe nennen könnte», sagte er langsam, beinahe mehr an Joy gewandt, «aber ich bin nicht jung und leichtsinnig. Ich habe schon viele junge Ladys kennengelernt, und ich weiß so sicher wie nur irgendetwas, dass Joy anders ist als alle anderen, denen ich je begegnet bin.»
«Das kann man wohl sagen.» Ihre Mutter.
«Alles, was ich Ihnen versichern kann, ist, dass ich davon überzeugt bin, sie glücklich machen zu können. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich Ihre Vorbehalte ausräumen, aber es ist leider so, dass wir sehr bald wieder auslaufen.»
Joy kam nicht auf den Gedanken, die Geschwindigkeit zu hinterfragen, mit der sich seine Gefühle eingestellt hatten. Sie war einfach nur glücklich darüber, dass sie der Intensität ihrer eigenen Gefühle entsprachen. Und sie konnte es noch immer kaum fassen, dass sie jemand einzigartig genannt hatte, und zwar auf eine gute Art. Es dauerte eine Weile, bis sie bemerkte, dass seine Hand verschwitzt war.
«Das kommt zu plötzlich, Graham. Sag ihnen das. Sie kennen sich doch überhaupt nicht.»
Joy registrierte den Glanz in den Augen ihrer Mutter, die Unruhe, die sich dahinter verbarg. Sie ist eifersüchtig, fuhr es ihr durch den Kopf. Sie ist eifersüchtig, weil sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden ist und die Vorstellung nicht ertragen kann, dass mich jemand hier herausholt.
Ihr Vater musterte Edward noch eine Weile, als würde er nach einer Lösung suchen. Edward hielt seinem Blick stand. «Nun, bei der Jugend von heute geht manches schneller», sagte Graham und bedeutete Bei-Lin mit einer Geste nachzuschenken. «Und du weißt doch noch, wie es im Krieg war, Alice.»
Joy gelang es nur mühsam, ihre Aufregung im Zaum zu halten. Sie umklammerte Edwards Hand und spürte einen sanften Gegendruck.
Ihr Vater trank den letzten Schluck aus seinem Glas. Einen Moment lang schien seine Aufmerksamkeit von etwas vor dem Fenster gefesselt zu sein. «Also, nehmen wir einmal an, ich würde zustimmen, junger Mann. Welche Pläne hätten Sie dann in dieser Sache innerhalb von sechsunddreißig Stunden?»
«Wir wollen heiraten», stieß Joy aus. Nun, wo es nur noch um die zeitliche Planung zu gehen schien, war sie wieder imstande, sich an der Unterhaltung zu beteiligen.
Ihr Vater beachtete sie nicht. Er führte sein Gespräch mit Edward.
«Ich werde Ihre Wünsche respektieren, Sir.»
«In diesem Fall würde ich sagen, Sie haben meinen Segen. Zur Verlobung.»
Joys Herz schlug schneller. Dann schien es stillzustehen. «Sie können heiraten, wenn Sie das nächste Mal auf Landurlaub sind.»
Darauf herrschte verblüfftes Schweigen. Joy kämpfte gegen ihre Enttäuschung und registrierte am Rande Bei-Lins Schritte, die sich von der Tür entfernten. Sie hatte bestimmt nichts Eiligeres zu tun, als der Köchin die Neuigkeit zu verkünden. Der Blick von Joys Mutter wanderte von Joy zu ihrem Vater. Was würden nur die Leute denken?
«Wenn ihr es ernst miteinander meint, macht diese Wartezeit nichts aus. Ihr könnt den Ring kaufen, die Verlobungsanzeige veröffentlichen und später heiraten.» Ihr Vater stellte sein Glas mit Nachdruck auf dem Lacktisch ab, als wolle er damit seinen Urteilsspruch unterstreichen.
Joy wandte sich Edward zu, der langsam und tief ausatmete. Bitte widersprich ihm, flehte sie in Gedanken. Sag ihm, dass du mich jetzt heiraten musst. Bring mich weg von hier auf deinem großen, grauen Schiff.
Doch Edward schwieg.
Als sie ihn so ansah, überkam Joy die erste Enttäuschung über ihren neuen Gefährten, die erste ahnungsvolle, bittere Erkenntnis, dass der Mann, in den sie ihre größten Erwartungen, ihr größtes Vertrauen gesetzt hatte, nicht ganz so war, wie sie es sich erhoffte. «Und wann wird das sein?», fragte sie und versuchte, das Zittern aus ihrer Stimme zu verbannen. «Wann wirst du wieder Landurlaub haben?»
«Unser nächster planmäßiger Halt ist in New York», sagte er beinahe entschuldigend, «aber erst in neun Monaten. Womöglich sogar erst in einem Jahr.»
Joy setzte sich aufrechter hin und warf einen Blick auf ihre Mutter, die nun wesentlich entspannter schien. Ein herablassendes Lächeln umspielte ihre Lippen, das ausdrückte: «Oh, die jungen Leute. Sie denken gleich, sie hätten sich verliebt, aber wir werden ja sehen, ob das in einem halben Jahr nicht schon wieder ganz anders aussieht.» Alice wollte recht behalten, wurde Joy mit einem Schauder bewusst. Sie wollte die Bestätigung dafür, dass es keine wahre Liebe gab, dass jeder in einer genauso unglücklichen Ehe landete wie sie selbst. Aber wenn sie glaubten, Joy ließe sich davon abschrecken, täuschten sie sich. Sie sah ihrem frischgebackenen Verlobten tief in die blauen Augen. «Gut, dann sehen wir uns in neun Monaten wieder», erklärte sie und versuchte, aus ihrem Blick ihre ganze Überzeugung sprechen zu lassen. «Nur … nur schreib mir.»
Die Tür wurde geöffnet. «Gott schütze die Queen!», sagte Bei-Lin, während sie ein Tablett mit Getränken hereintrug.
Kapitel 1
Kates Scheibenwischer gaben kurz vor Fishguard den Geist auf. Zuerst blieben sie hängen, dann glitten sie schicksalsergeben Richtung Motorhaube herunter, und zwar exakt in dem Moment, in dem sich der Regen, der bisher heftig gewesen war, in eine Sturzflut verwandelte.
«Oh verflixt», sagte sie und fuhr einen Schlenker, während sie an dem Regler für den Scheibenwischer herumschaltete. «Ich sehe rein gar nichts. Liebling, wenn ich an der nächsten Parkbucht kurz ranfahre, könntest du dann mit deinem Ärmel die Windschutzscheibe abwischen?»
Sabine zog die Knie an die Brust und warf ihrer Mutter einen mürrischen Blick zu. «Das nützt doch überhaupt nichts. Wir können es genauso gut gleich ganz sein lassen.»
Kate bremste das Auto ab, kurbelte ihr Fenster herunter und versuchte, mit ihrem Samtschal ihre Hälfte der Windschutzscheibe abzuwischen. «Wir sind spät dran. Und ich will auf keinen Fall, dass du die Fähre verpasst.»
Ihre Mutter war ein eher sanftmütiger Charakter, aber Sabine kannte diesen unerbittlichen Unterton in Kates Stimme, und dieses Mal bedeutete er, dass höchstens ein Tsunami Sabine davor bewahren konnte, die Fähre zu besteigen. Das war keine große Überraschung. Sie hatte diesen Unterton in den vergangenen drei Wochen häufig gehört, und als sie nun schon wieder vorgeführt bekam, dass sie nach Meinung ihrer Mutter nicht das Geringste mitzuentscheiden hatte, schob sie unwillkürlich ihre Unterlippe vor und drehte sich in stummem Protest weg.
Kate, die bestens auf die Launenhaftigkeit ihrer Tochter eingestellt war, sagte: «Weißt du, wenn du nicht deine gesamte Energie darauf verwenden würdest, diese Reise abzulehnen, könntest du dir vielleicht einfach eine schöne Zeit machen.»
«Und wie soll das gehen? Du verfrachtest mich an einen Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben erst zwei Mal war, damit ich in dieser Einöde bei einer Großmutter, die du so sehr magst, dass du sie seit Jahren nicht gesehen hast, so was wie das Dienstmädchen spiele, während mein Großvater den Löffel abgibt. Einfach super. Tolle Ferien. Ich kann es echt kaum erwarten.»
«Oh, sieh mal. Sie funktionieren wieder. Mal sehen, ob wir es zum Hafen schaffen.» Kate schlug das Lenkrad ein, und der reichlich lädierte VW schoss mit einem Satz auf die nasse Straße, wobei teefarbene Wasserschleier bis zu den Seitenfenstern emporspritzten. «Hör mal. Wir wissen doch gar nicht, ob dein Großvater wirklich so krank ist, anscheinend ist er nur gebrechlich. Und ich glaube, es tut dir gut, eine Weile aus London herauszukommen. Du kennst deine Granny ja kaum, und es wird bestimmt schön für euch, wenn ihr ein bisschen was voneinander habt, bevor sie zu alt wird oder du anfängst, durch die Welt zu reisen, oder was auch immer.»
Sabine starrte weiter durchs Beifahrerfenster hinaus. «Granny. Das soll wohl nach heiler Familie klingen.»
«Und ich weiß, dass sie sehr dankbar für die Hilfe ist.»
Sabine hatte noch immer keine Lust, ihre Mutter anzusehen. Sie wusste nämlich haargenau, warum sie nach Irland verschifft wurde, und ihre Mutter wusste es auch. Wenn Kate so eine verdammte Heuchlerin war und es nicht zugab, dann konnte sie von Sabine auch keine Offenheit erwarten.
«Linke Spur», sagte sie, ohne Kate anzusehen.
«Was?»
«Linke Spur. Für die Fähre musst du dich links einordnen. Echt, Mum, warum kannst du nicht einfach deine Brille aufsetzen?»
Mit einer ruckhaften Bewegung lenkte Kate das kleine Auto auf die linke Fahrspur, ohne das Protestgehupe hinter ihr zu beachten, und manövrierte es unter Sabines schlechtgelaunten Anweisungen zu dem im Wind schaukelnden Schild mit der Aufschrift «Reisende ohne Fahrzeug». Sie fuhr weiter, bis sie einen Parkplatz entdeckte, eine regengepeitschte Betonwüste neben einem grauen, gefängnisartigen Verwaltungsbau. Warum mussten Amtsgebäude eigentlich immer so abschreckend aussehen, ging es Sabine durch den Kopf. Als ob die Leute nicht so schon mies genug drauf wären. Nachdem das Auto und die Scheibenwischer angehalten hatten, sorgte der Regen freundlicherweise dafür, dass das Gebäude verschwamm wie auf einem impressionistischen Gemälde.
Kate, für die ohne ihre Brille beinahe alles so verschwommen aussah wie auf einem impressionistischen Gemälde, sah zu ihrer Tochter hinüber und wünschte sich plötzlich, sie könnten sich so herzlich voneinander verabschieden, wie es nach ihrer Überzeugung andere Mütter und Töchter taten. Sie wollte ihr sagen, wie leid es ihr tat, dass Geoff auszog und dass zum dritten Mal in Sabines jungem Leben die häuslichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt wurden. Sie wollte ihr sagen, dass sie die Reise nach Irland organisiert hatte, um sie zu beschützen, um sie vor den erbitterten Streitereien zu bewahren, die sie und Geoff in letzter Zeit kaum noch hatten vermeiden können, schließlich beendeten sie eine sechsjährige Beziehung. Sie wollte ihr sagen, dass es da noch eine Großmutter gab – dass Sabine noch jemand anderen hatte, nachdem sie sich mit Kate überhaupt nicht mehr verstand.