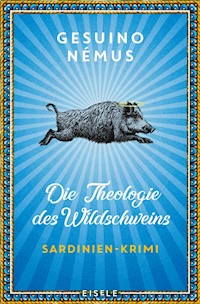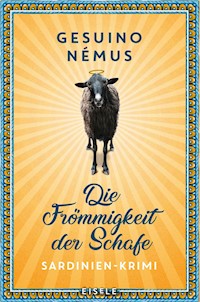
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eisele eBooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein-Sardinien-Krimi
- Sprache: Deutsch
»Gesuino Némus erzählt poetisch von der Welt, aus der er selbst stammt. Großartig!« Brigitte Seit Mariàca Tidòngia, die Tochter eines Hirten, am 1. Oktober 1964 auf das Fensterbrett ihrer Schule sprang und davonrannte, wurde sie auf Sardinien nie mehr gesehen. Sie scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Fünfzig Jahre später führen zwei verdächtige Todesfälle den Polizisten Ettore Tigàssu zurück auf ihre Spur. Denn einer der Toten ist Marcellino Nonies, Mariàcas alter Lehrer. Hatte er all die Jahre Kontakt zu Mariàca, die ganz sicher nicht mehr auf Sardinien lebt, aber vielleicht im Ausland Unterschlupf gefunden hat? Seine handschriftlichen, kaum entzifferbaren Aufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Brigadiere Tigàssu zerbricht sich den Kopf – und verdirbt sich die Augen über der Lektüre des geheimen Tagebuchs, das ihm so einige Rätsel aufgibt. Und wie immer will niemand in der kleinen Gemeinde von Telévras von irgendetwas eine Ahnung haben. Seine Ermittlungen führen Ettore Tigàssu quer über die Insel – und durch fünfzig Jahre italienische Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Zwei seltsame Todesfälle führen den Polizisten Ettore Tigàssu in dem kleinen sardischen Örtchen Telévras zurück auf die Spur eines seit fünfzig Jahren verschwundenen Mädchens. War die Hirtentochter Mariàca Tidòngia damals abgehauen, um im Ausland Unterschlupf zu finden? Als nach dem Tod ihres alten Lehrers, Marcellino Nonies, ein handschriftliches Manuskript auftaucht, scheint es, als habe dieser all die Jahre sehr viel mehr gewusst, als er sagte. Aber wie immer wollen auch die Dorfbewohner der kleinen Gemeinde Telévras von all dem nichts gehört haben, sodass Ettore Tigàssu in längst vergangenen Zeiten nach Antworten suchen muss …
Der Autor
GESUINO NÉMUS (der mit richtigem Namen Matteo Locci heißt) wurde 1958 in Jerzu geboren, einem kleinen Dorf auf Sardinien. Heute lebt er in Mailand. Seit frühester Jugend hielt er sich mit verschiedensten Tätigkeiten über Wasser. Für seine mittlerweile fünf Teile umfassende Krimireihe um das sardische Dorf Telévras wurde er in Italien mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Campiello und dem John-Fante-Preis. Nach Die Theologie des Wildschweins und Süße Versuchung ist Die Frömmigkeit der Schafe der dritte Sardinien-Krimi, der auf Deutsch erscheint.
AUS DEM ITALIENISCHEN VON SYLVIA SPATZ
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
Die Übersetzung des vorliegenden Werkes wurde vom Zentrum für Bücher und Lesen des italienischen Kulturministeriums gefördert. Wir danken für die freundliche Unterstützung.
ISBN 978-3-96161-154-6
Die Originalausgabe »Il catechismo della pecora«
erschien 2019 bei Lit Edizioni Srl, Rom.
© 2019 Gesuino Némus
© 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
This translation of Il catechismo della pecora is published by arrangement with Ampi Margini Literary Agency and with the authorization of Lit Edizioni.
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © Shutterstock
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Warnungen an den Leser
Das hier ist ein Buch. Mit Vorsicht und nur nach Absprache mit einem Lektor lesen, der das Vertrauen der Familie genießt. Möglichst keine Lektüre allein im stillen Kämmerlein, nicht zur Selbsttherapie geeignet. Die empfohlene Tagesdosis sollte möglichst nicht überschritten werden, wenn nicht lange im Voraus der Verlag Elliot, Via Isonzo 34, Rom in Kenntnis gesetzt wurde.
Zusammensetzung
Bei dem aktiven Wirkstoff handelt es sich um gesuloide®, ein Derivat von nemusolina®, das vor Kurzem in unserem Labor Santini1…D’Amore s. a. f. unter Anwendung der Formel
entwickelt wurde.
Doch wenn gilt: M2,3,4 [Ca5, 5REE5, 0?1,5] 2M1 (Al1,1Fe3+0,9)(OH) 4 [Si8B8O40 (OH) 4], ist unbegreiflich, warum sie sich auf X4 Y2 Z T2 [B4 Si4 O22] W2 kürzen lässt, vor allem, wenn man bedenkt, dass:
Trägerstoffe
Bitterschokolade mit Nüssen oder Mandeln, gehackte Pistazienkerne aus der Ogliastra, Ricotta mit Orangenschale und Wildbienenhonig, cremig gerührter Schafskäse, Cannonau Jahrgang 1969 (noch in Spuren enthalten).
Anwendungsgebiete
Hypomanie, Depression aufgrund von Nicht-Veröffentlichung eigener Werke, geistige Überreizung nach der Lektüre von Elias Canetti oder der Biographie von Franz Kafka, chronische, seit mindestens 45 Jahren nachgewiesene Erschöpfungszustände nach der Lektüre von Ulysses von James Joyce, unverständliches Gegrummel, auch kreativer Mumble genannt, wirre Theorien, die der Patient/die Patientin mit dem auf den ersten Blick unverfänglichen Satz »Liebe Loretta Santini und liebe Lavinia Emberti Gialloretti, die folgenden Punkte zerstören das ganze Romankonzept« eingeleitet hat.
Gegenanzeigen
Darf nicht angewendet werden: bei diagnostizierter Allergie gegen den Konjunktiv, Risiko eines anaphylaktischen Schocks infolge von consecutio temporum und captatio benevolentiae, während der Teilnahme an einer öffentlichen, durch Fotos (oder Polaroid) dokumentierten Bücherverbrennung von Die Theologie des Wildschweins.
Warnhinweise
Die empfohlene Dosis sollte nicht überschritten werden. Im Falle einer Schwangerschaft möglichst kein Vorlesen. Der Fötus hört mit.
Wechselwirkung bei gleichzeitiger Einnahme mit anderen Arzneimitteln
Der Wirkstoff gesuloide® verstärkt die Wirksamkeit des Zeichentrickfilms Il topo con gli occhiali (44. Ausgabe des Zecchino d’Oro, 2001) und des gesungenen Songtexts: »Es lebe die Literatur! Das Abenteuer beginnt. Ein Traum mit offenen Augen in einer Welt, wie du sie dir wünschst. Bücher sind wie Flügel, die dich fliegen lassen. Bücher sind wie Segel, mit denen man übers Meer fahren kann. Bücher sind wie Freunde, die Gesellschaft leisten. Bücher sind Träume voller Fantasie. Bücher sind Augenblicke voller Emotionen, von Freude bis zur Gänsehaut.«
Dosierungshinweise
Buchseiten nicht ohne Rücksprache mit dem Lektor in Säure auflösen. Alle drei bis vier Stunden eine Seite lesen, nicht unmittelbar vor und nach den Mahlzeiten. Kann abführend wirken und zu Gewichtsverlust führen.
Unerwünschte Nebenwirkungen
Übergroßes Verlangen nach Metonymien und Synästhesien. Kann Verlangen nach Synekdochen oder Anaphern auslösen. Im Fall von Überdosierung wurden folgende Symptome festgestellt: Chiasmus, Anakoluth, Hendiadyoin und Paronomasie. In lediglich einem Fall traten Anastrophen und Hyperbata auf. Bei Patienten, die zu Litotes neigen, kann es zu Hystera-Protera kommen.
1.
Telévras, Juni 2017
Sein Klebsamenstrauch verkümmerte mit einem Mal, aber das schien Marcellino Nonies, Dorfschullehrer für alle Klassen, nicht zu interessieren, und auch nicht, dass die Knospen an seinem Oleander mit der Blüte spät dran waren.
Die Beschlüsse des G20-Gipfels zum Klimawandel kümmerten ihn anscheinend ebenso wenig.
Vom Preisanstieg für Benzin und Weizen Type 00 ganz zu schweigen.
Oder dem letzten Jahrgang Cannonau, der für das Schicksal der Menschheit auch nicht ohne Bedeutung war.
Seine schwarze Drillichjacke hatte er zusammen mit der bunten Weste und dem weißen Hemd in den Schrank gehängt. Darüber, so dass der Henkel des Bügels fast bedeckt war, seinen Hut, ebenfalls schwarz und abgewetzt. Im Halbdunkel sah das Ensemble fast echt und lebendig aus, wie eine Art selbstgefertigte Marionette, so viel Sorgfalt hatte er darauf verwandt, die Kleidungsstücke mit seinen anderen wenigen Habseligkeiten ordentlich zu verwahren.
Er hatte es gerade noch geschafft, zwei Löffel kalte Suppe zu essen und ein Glas von seinem selbstgebrannten Kräuterschnaps zu trinken. Das Schlucken hatte ihm große Beschwerden bereitet.
Dann hatte er sich in die Nähe der Eingangstür vor seinem Steinhäuschen auf einen Stuhl aus Bast gesetzt und den Kopf nach rechts sinken lassen.
Doch davor hatte er noch einmal tief Luft geholt.
Er glich einem Darsteller, wie man sie einst bei Varietévorstellungen vor Filmvorführungen sah. Nach der letzten Darbietung traten sie vor den Vorhang, um einem undankbaren herzlosen Publikum zu danken, müde Lebensklugheit und ein beiläufiges Lächeln im Gesicht.
Eine tiefe letzte Verbeugung, ganz wie sein geliebter Charlie Chaplin.
Reaktionen von Seiten des Publikums waren nicht vorgesehen. Eine Zugabe verweigerte er.
Denn er war, schlicht und ergreifend, tot.
2.
Télevras, 1972
»Nun c’est nudda ’e fai. Su frastìmu ’e su babbu piccìgada. Da kann man nichts machen. Dem Fluch ihres Vaters entkommt sie nicht.«
Seit ihr Vater sie verflucht hatte, war Mariàca Tidòngias Leben eine Abfolge von Missgeschicken und Kümmernissen. Nichts Schwerwiegendes, aber viele kleine Desaster hatten dazu geführt, dass sie zur Außenseiterin wurde.
Denn wenn der eigene Vater einen in der Öffentlichkeit verflucht, wird man bald von allen gemieden. Es war, als wäre an jenem Tag, in jener Stunde, in jenem Augenblick, als der Vater ihr den fürchterlichsten Fluch im Hoheitsgebiet der Römisch-Katholischen Kirche an den Kopf warf – »Chi Deus ti ›óccia‹ Mari’, Möge Gott dich töten, Maria« –, die Zeit stehengeblieben.
Sie war schwanger geworden.
Mit ihren vierzehn Jahren lag sie eine Winzigkeit unter dem Durchschnittsalter, in dem man üblicherweise heiratete und das erste Kind in die Welt setzte, es sei denn, man plante, die soziale Leiter zu erklettern und erst das Abitur zu machen und dann zu studieren. Doch die Schule kam für sie nicht infrage, und zwar nicht so sehr wegen wirtschaftlich prekärer Lebensverhältnisse, sondern weil ihr die Schule vom ersten Tag an wie ein Gefängnis vorkam.
Marias Mutter war bei der Geburt gestorben. Natürlich waren das damals andere Zeiten und eine Hausgeburt nicht ohne Risiken, und dazu kam, dass der Vater holzköpfig war und sich weigerte, trotz der starken Blutungen seiner Frau eine Hebamme herbeizurufen. Er war es, der am Ende die Nabelschnur durchtrennte.
Sie lebten, abgeschieden vom Rest der Welt, in den Bergen, in einem einfachen Haus, das zwischen dem Pferch für die Tiere und einer baufälligen Nuraghe lag. Dort wuchs Maria auf, bis man sie im Oktober 1964 in die Schule zwang. Sie war an Freiheit gewöhnt, wie es nicht anders sein kann, wenn man von klein auf an Weite gewöhnt ist, und haute bereits am ersten Tag aus der Schule ab. Noch während der Lehrer die außerordentliche Bedeutung von Schulbildung erläuterte, stieg sie aufs Fensterbrett und sprang ohne ein Wort aus dem Klassenfenster. Zum Glück lag der Raum im ersten Halbgeschoss, und sie flog nur zwei Meter in die Tiefe. Unter dem höhnischen Gegröle ihrer Klassenkameraden machte sich Maria davon.
Beebeebee.
Das Geblöke von Schafen, den liebenswürdigsten und edelsten Tieren unserer Schöpfung, ist der Inbegriff lautmalerischer Bösartigkeit.
Der Maestro hatte seine liebe Mühe, wieder Ruhe herzustellen, bis schließlich, vom unerwarteten Lärm alarmiert, der Schuldirektor einschritt.
Die Stimme des Direktors konnte einen in Angst und Schrecken versetzen. Was für ein Pech, wenn er einen, etwa auf dem Weg zum Klo, ansprach. Aber der Weg dorthin führte nun mal an der stets geöffneten Tür zu seinem Büro vorbei.
»Schon wieder zum Klo unterwegs, Porcu? Wie oft musst du denn dahin?«
»Zwei Mal, Herr Direktor.«
»Und wie oft pinkelt ihr zu Hause? Seid wohl reich geworden?«
Aus diesem Grund hielten es alle so lange aus wie es ging, mindestens vier Stunden.
»Ich kümmere mich darum, ihr macht weiter. Sitzenbleiben und keinen Mucks, verstanden?«
Seine Stimme war einfach furchterregend.
Er hakte sich bei dem Klassenlehrer unter und führte ihn vor die Tür, die er aber nur anlehnte, damit auch noch das leiseste Flüstern von uns zu hören war.
»Sie machen mit Ihrer Stunde weiter. Dem Maresciallo sagen wir nichts. Ich werde selbst bei dem Vater vorbeischauen und ihn ermahnen, dass er seine Tochter zum Schulbesuch zwingen muss, wenn er nicht wieder hinter Gitter wandern will. In diesem speziellen Fall bleibt man besser diplomatisch. Er hat nämlich bereits seine Probleme mit der Justiz. Sie haben ihn schon zweimal wegen Viehraub drangekriegt und einmal wegen Schlägerei. Da geht man besser behutsam vor.«
»Gut, Herr Direktor. Sie hat ihren Schulkittel und die rosa Schleife hier gelassen. Was soll ich damit machen?«
»Die bringe ich dort vorbei. Wollen wir hoffen, dass sie wirklich nach Hause gegangen ist. Fehlt nur noch, dass wir im Wald nach ihr suchen müssen.«
»Sie lebt allein bei ihrem Vater, Herr Direktor. Ich will mir gar nicht ausmalen …«
»Genau, malen Sie sich mal nichts aus, und lassen Sie uns hoffen, dass wir nicht die Carabinieri rufen müssen, um nach ihr zu suchen … oder um sie zu beschützen. Hoffen wir, dass er sie nicht schlägt. Ich mache mich auf den Weg.«
Und mit diesen Worten ging er.
So nahm die Geschichte von Mariàca Tidòngia ihren Lauf.
3.
Nach jenem 1. Oktober 1964 ging Maria nie wieder in die Schule. Sobald sie der Carabinieri ansichtig wurde, lief sie davon. Der örtliche Maresciallo tat sogar so, als würde er den Vater ihretwegen festnehmen. Aber es war nichts zu machen. Während er ihn vorgeblich gewaltsam zum Mannschaftswagen zerrte, rief sie vom Dach aus, auf dem sie Zuflucht gesucht hatte: »Babba’ tranchilgiu, ca ’in ci pentzu eu a is’erbéis.«
Sie werde sich um die Schafe kümmern, versprach sie dem Vater.
Mittlerweile war sie acht Jahre alt.
In jener kleinen Dorfgemeinschaft galt die Schule als Geschenk Gottes und als soziale Verpflichtung, der möglichst eifrig und erfolgreich nachzukommen war. In diesem Fall suchte man nach einer kreativen Lösung. Hin und wieder würde der Lehrer Maria in den Bergen aufsuchen, um ihr wenigstens das Lesen und Schreiben beizubringen. Und sie sollte am Ende jedes Schuljahrs als »Privatschülerin« erscheinen, aber sie erwiderte: »Imparu a sola, c’est meda cosa ’e fai innói. Ich lerne alles allein, hier ist viel zu tun.«
»Und wie willst du alles allein lernen?«, fragte der Maestro.
»Issu lassideddusu innoi is librus ca m’apu arrangiai eu.«
Er solle die Bücher nur dalassen, sie werde schon zurechtkommen.
Und so legte er sie auf einem Stein ab und hoffte, dass wenigstens der Vater ihr die Grundlagen der italienischen Sprache beibringen und das Mädchen sich das Ganze mit der Zeit doch noch überlegen würde.
Doch der Vater bremste ihn bei der ersten Gelegenheit: »No sciu scriri mancu eu, fetti sa firma sciu fai.« Er könne nicht schreiben, sondern beherrsche lediglich seine Unterschrift.
»Sie will nicht zur Schule. Dieses Kind ist ein Unglück. Als Mädchen auf die Welt gekommen, und die Mama hat sie auch umgebracht, als sie aus ihr rauskam. Ihr wollt ihr helfen? Sucht eine reiche Familie in Cagliari für sie, oder besser noch auf dem Festland. Sollen sie sie mitnehmen. Seit sie zwei ist, ist sie beim Schafehüten in den Tacchi immer mit dabei. Die bleibt nicht im Haus. Habt Ihr das verstanden?«
»Würden Sie das Mädchen denn zur Adoption freigeben? Soll ich mit dem Pfarrer reden?«
»Sie ist nicht zu bändigen. Ihr wollt sie in ein Waisenhaus stecken? Nach zwei Tagen ist sie wieder hier. Bei Tzia Brigida hat sie nicht mal so lange stillgehalten, wie es gedauert hat, ihr die Milch zu geben.«
»Sie hat eine Tante?«
»Nein, nein. Bei uns heißen die Frauen, die sie gestillt haben, bis sie zwei war, tziu oder tzia. Wie soll ich sie denn allein großgezogen haben? Ohne die tzia und andere Mamas wäre sie verhungert. Aber die haben alle auch große Familien. Wenigstens geben sie uns die abgetragenen Kleider ihrer Kinder und passen hin und wieder auf sie auf. Aber sie ist an mich gewöhnt. Das einzige, was sie kann, ist mich hinter Gitter bringen, aber wenigstens habe ich dann meine Ruhe«, beschloss der Vater verbittert seine Rede.
Der Lehrer sprach ihm Mut zu, und er werde mindestens zweimal pro Woche kommen, um der Tochter wenigstens dabei zu helfen, dass sie die Abschlussprüfung des zweiten Grundschuljahres schaffte. Aber es kam ihm vor, als würde er gegen den Mistral anreden.
Er hatte den Eindruck, als flögen die Worte aus seinem Munde direkt nach hinten über seine Schultern davon, Richtung Meer, und als könnte nur der Horizont sie begreifen. Für den frisch gebackenen jungen Maestro war das eine bittere Lektion.
4.
»Na, was habe ich Ihnen gesagt, Nonies? Warten Sie etwa immer noch?«, dröhnte die Stimme des Schuldirektors an jenem Junitag im Jahr 1966.
Der Lehrer hatte der kleinen Maria geglaubt, die in lupenreinem Italienisch versprochen hatte: »Natürlich komme ich zu der Abschlussprüfung für die zweite Klasse, Signor Maestro.«
Lächelnd hatte er sie gefragt, ob sie wenigstens ihren Namen schreiben könne.
Sie hatte sich das nicht zweimal sagen lassen und ihn sogar mit einem Kugelschreiber niedergeschrieben, obwohl ein Bleistift genügt hätte.
Ich heiße Mariàca Tidòngia.
»Warum denn Mariàca? Heißt du nicht Maria?«
»Mein Babbo sagt, ich bin macca, verrückt, und deswegen habe ich mir diesen Spitznamen gegeben. Halb Maria und halb macca.«
»Das hast du schön geschrieben. Wie hast du das nur gelernt?«
»Mmm, keine Ahnung. Ich habe mir das Buch genommen und alles abgeschrieben. Mit ihm ist es mir zu langsam gegangen. Er hat mir das große M gezeigt und das T. Dann habe ich allein weitergemacht. Ist was falsch?«
»Nein, nein. Aber bei der Prüfung musst du deinen richtigen Namen schreiben, und nicht den Spitznamen. Ich werde dich ein Diktat schreiben lassen und hinterher kommen noch ein paar Additionen und Subtraktionen. Magst du Italienisch?«
»Nicht besonders, auf Italienisch kann man nicht singen.«
»Wie bitte? Auf Italienisch kann man nicht singen? Es gibt wunderschöne Lieder auf Italienisch.«
»Das Ave Maria auf Italienisch ist wirklich scheußlich. Das auf Sardisch ist schön.«
»Wo hast du das denn gehört?«
»Im Radio, wir haben eins mit Batterien. Tzia Brigida und tzia Margherita singen das Ave Maria auf Sardisch. Das hat ihnen Pfarrer Cossu gelernt.«
»Gelehrt. Man sagt, er hat sie das gelehrt, nicht gelernt. Also, ich erwarte dich zur Prüfung. Weißt du eigentlich, dass ich jetzt eine eigene Klasse habe? Möchtest du im nächsten Schuljahr, also in der Dritten, zu mir kommen?«
Ihre Begeisterung hielt sich in Grenzen. Das Konzept Schulklasse hatte sie noch nicht recht begriffen, und anstatt einer Antwort sang sie ihm auf Sardisch ein Lied vor und übersetzte es sofort danach für ihn auf Italienisch.
Hundert Köpfe/Hundert Hüte/Das Leben lehrt dich Genügsamkeit/Der Tod schenkt dir dann/Hundert Himmel/Hundert Niederlagen/So ist das Leben/Möge der Tod sterben
»Das kenne ich noch nicht. Und woher kennst du die italienische Version?«
Der Maestro war wirklich überrascht. Vor allem über ihre Übersetzung ins Italienische. Sie wollte ihm erst nicht verraten, wer ihr die beigebracht hatte.
»Mmm, das singe ich, seit ich auf der Welt bin.«
»Und die italienische Version? Wer hat dich die gelehrt?«
Sie flüsterte ihm einen Namen ins Ohr.
»Das glaube ich nicht.«
»Ich eigentlich auch nicht. Aber er sagt, sie ist von ihm.«
»Woher kennst du ihn überhaupt?«
»Er kommt hin und wieder mit der Schafherde von seinem Vater vorbei, um mir Liebeserklärungen zu machen.«
»Ihr macht euch Liebeserklärungen? Mit acht Jahren?«
»Nein, Signor Maestro. Nur er macht mir welche. Est conchinu. Er ist ein Dummkopf. Außerdem ist er hässlich, er hat vorne keine Zähne mehr. Wenn ich groß bin, verlobe ich mich mit Benito Urgu, dem, der bei den Barritas Lascia in pace il mio cuore singt. Babbo hat die Platten von ihm gekauft, und wir hören immer Whiskey, birra e Johnny Cola. Das ist richtig heiß, Signor Maestro …«
»Heiß? Wer bringt dir denn solche Wörter bei?«
»Der Wind bringt die Wörter, sagt dieser hässliche Trottel …«, und sie flüsterte ihm erneut seinen Namen ins Ohr.
»Ach, sagt er das? Der Wind bringt die Wörter … das erinnert mich an was, aber bringt der Wind nicht eher Antworten?«
»Keine Ahnung. Das ist alles von einem Amerikaner, wohl einer vom Stützpunkt hier in der Nähe. Die schießen immer in die Berge und erschrecken die Tiere. Sagen Sie ihm aber nicht, dass er hässlich ist, sonst schaut er mir nicht mehr meine Hausaufgaben durch.«
Beim Abschied war Maestro Marcellino Nonies sich dreier Dinge gewiss: Erstens hätte dieses Mädchen das alles in keiner Schule gelernt. Zweitens konnte ihr Gesuino Némus, den aufgrund seiner rätselhaften psychischen Erkrankung (nachzulesen in Die Theologie des Wildschweins) jede Schule abgelehnt hatte und dessen Namen sie ihm zweimal zugeflüstert hatte, nicht die Hausaufgaben korrigiert haben.
Und drittens hatte ihr das alles auch der Vater nicht beigebracht.
5.
»Finden Sie sich einfach damit ab, Nonies.«
Der Tonfall des Schuldirektors war nicht sehr freundlich.
An jenem Morgen waren sie mit den Vorbereitungen für die Abschlussprüfung der Grundschule beschäftigt, die ein paar Wochen später stattfinden sollte. Für den Maestro war es das erste Mal. Danach würden ihn all die Landkinder, denen er das Lesen und Schreiben beigebracht hatte, verlassen. Sie würden in einem Nachbarort die Mittelschule besuchen, der lag zwar nicht weit entfernt, aber er würde sie nicht mehr wiedersehen, sondern mit einer neuen ersten Klasse wieder von vorne beginnen. Er hatte ihre Stimmen liebgewonnen und das, was sie in ihren ersten Aufsätzen schrieben, und bei dem Gedanken daran beschlich ihn leichte Melancholie. Ihre Träume und Erwartungen: »Wenn ich groß bin, werde ich Ärztin«, »ich werde Schuldirektorin«, »ich singe beim Schlagerfestival mit«, »ich will Lehrer werden so wie Signor Marcellino«.
»Wer weiß, ob sie kommt«, fragte er sich laut.
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, die kommt nicht. Sie haben wirklich alles versucht. Wir können nichts mehr machen. Nicht einmal mir ist es gelungen, den Vater zu überzeugen, und es war schon ein Kunststück, dass wir eine Anzeige verhindert haben.«
»Aber dieses Mädchen ist wirklich sehr begabt, das weiß ich«, beharrte der Lehrer.
»Und woher wollen Sie das wissen? Sie haben doch nicht einmal mehr mit ihr geredet.«
»Ich würde etwas dafür geben zu erfahren, was sie im Leben mal machen will.«
»Was wird sie schon machen? Schafe hüten wird sie. Ist Ihnen klar, wie viele Kinder nicht mal das dritte Grundschuljahr beenden? Und was sollen wir tun? Die Eltern verhaften lassen? Das Gefängnis in San Daniele ist klein, da fehlte es noch …«
»Wir könnten zu ihr gehen und ihr die Prüfung zu Hause abnehmen.«
»Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Das haben wir noch nie gemacht. Das Kind ist schließlich nicht krank.«
»Aber mit Ihrer Erlaubnis …«
»Die bekommen Sie nicht von mir, und damit ist das Thema beendet.«
Es stimmte nicht, dass der Maestro Maria nicht mehr getroffen hatte. An Wochenenden, wenn er seine geliebten Heilkräuter sammelte, war es ihm mitunter gelungen, ihr über den Weg zu laufen. Er besaß kein Auto und war in den Bergen zu Fuß unterwegs. Außerdem wusste er, wohin sie die wenigen Schafe, die das Osterfest überlebt hatten, zum Weiden führte, und sobald das Wetter schön und sonnig wurde, hatte er eine perfekte Ausrede. Es war ihm sogar gelungen, ihr das halbherzige Versprechen zu entlocken, die Abschlussprüfung für die zweite und die letzte Klasse, die fünfte, in einem Rutsch zu machen.
»Sie müssen aufhören, sich für das Leben anderer verantwortlich zu fühlen«, fuhr der Direktor fort. »Die Menschheit fliegt bald zum Mond, und schauen Sie sich die Verhältnisse hier bei uns an. Mit dem Bus fährt man drei Stunden, um nach Nuoro zu kommen, und zurück das Gleiche. Die Astronauten brauchen für ihre 287.000 Kilometer weniger als wir für unsere 85. Aber was soll man machen? Wir sind hier auf die Welt gekommen, so ist das eben. Eher gewinnt Cagliari in der Serie A, als dass dieses Mädchen zur Prüfung erscheint.«
Tock, tock.
»Nur herein, die Tür ist auf.«
»Saludi. Soi enniu po sciri de sa piciochedda. Eita deppidi fai? Guten Tag, ich bin gekommen, weil ich wissen möchte, was meine Tochter machen soll.«
Vor ihnen stand Antonangelo Tidòngia mit Maria. Sie hatte sich sehr verändert, seit der Lehrer sie zum letzten Mal getroffen hatte, und wirkte älter als ihre elf Jahre. Man forderte die beiden auf, Platz zu nehmen. Während der Direktor das Prüfungsverfahren erklärte, hielt sie den Blick zum Boden gesenkt. Marcellino Nonies konnte sein Glück nicht fassen. Ihm war gleichgültig, dass das Mädchen vielleicht nur stockend schreiben und lesen konnte – er hatte sie dazu gebracht, wieder in die Schule zu kommen, wenn auch vielleicht nur für diesen einen Tag. Das allein zählte. Er würde ihr einen Schulkittel und eine blaue Schleife geben, sagte er, denn die rosa Schleife sei eigentlich nur für die erste Klasse …
»Ich will die in Rosa, ich bin ein Mädchen.«
»Aber das passt nicht mehr, du bist jetzt groß«, sagte der Lehrer sanft.
»Über die Schleife reden wir später, lassen Sie mich jetzt den Antrag ausfüllen, damit Signor Tidòngia unterschreiben kann, und dann besprechen wir alles Weitere«, unterbrach der Direktor. Er stand auf und ging hinaus, um den Schuldiener für die Schlüssel zum Aktenschrank zu holen. Draußen im Korridor flüsterte er diesem zu: »Nächstes Jahr gewinnen wir die Serie A.«
»Wirklich, Herr Direktor, sind Sie sich da sicher?«
»Hundertprozentig. Das ist mathematisch erwiesen.«
Und so war es: Am 12. April 1970 gewann das Fußballteam von Cagliari die italienische Nationalmeisterschaft.
6.
Als der Vater von Marias Schwangerschaft erfuhr, war er außer sich vor Zorn.
Er fasste es nicht, wie hatte das geschehen können, wo Mariàca doch tagaus, tagein in seiner Nähe war? Wo? Und vor allem mit wem? Er versuchte sie auf jede erdenkliche Art dazu zu bringen, ihm zu verraten, wer der Kindsvater war, und versprach hoch und heilig, dass er diesem nichts antun werde. Und wenn es der Pfarrer wäre.
Aber es war nichts zu machen.
Mariàca blieb jede Antwort auf die Frage schuldig, ja, sie war sogar stolz auf ihren Bauch und trug ihn jeden Sonntagmorgen, dem einzigen Tag, an dem sie das Dorf aufsuchte, zur Messe nämlich, in aller Öffentlichkeit zur Schau. Wortlos und frohgemut trug sie ihn durch die steilen Gassen spazieren, als machte ihr die Last nichts aus. Und auf dem Kirchplatz schleuderte der Vater ihr seine Verwünschung ins Gesicht.
Aber er hatte nicht mit der Reaktion der Leute gerechnet, die bald den Verdacht hegten, das Ganze sei nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Untereinander hatte man in dem kleinen Dorf hinter vorgehaltener Hand bald den wahren Schuldigen ausgemacht: Er, der Vater, war es.
Ein ganz gewöhnlicher Inzest, lautete das Urteil. Aber niemand, nicht einmal der Pfarrer, hatte ein Interesse daran, der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Und der Maresciallo schon gar nicht. Ein derartiges Verbrechen lag außerhalb seiner Vorstellungskraft, im Gegensatz zum Pfarrer, der seine Pappenheimer kannte.
Antonangelo verfiel in Depressionen und zeigte sich bald nicht einmal mehr zu den Festtagen.
Trübsinn ist bekanntlich wie Cannonau im Februar. Wenn er dich einmal am Wickel hat, kommst du nicht mehr davon los. Deine Stimmung wird immer düsterer, und du vertraust darauf, dass die Zeit alle Wunden heilt und sich am Ende alles lösen wird. Aber in diesem Fall löste sich gar nichts, und das Ende war selbst für eingefleischte Abstinenzler überraschend.
Man fand Antonangelo in der Nähe des Pferchs. Er hatte sich die Kehle durchschnitten. Er wollte keinen Lärm machen, wollte keine Aufmerksamkeit erregen, auf seine Art anders sein als andere. Feuerwaffen hatte er immer verabscheut, selbst die Knallfrösche, die auf Dorffesten die Tiere aufschreckten und in seinen Augen schlimmer waren als die Geschosse der Amerikaner bei ihren Militärübungen, mochte er nicht.
Es war ein tragischer Tod.
Er hatte dem schlimmen Gerücht, dem zufolge er der Kindsvater seiner Tochter war, nicht standgehalten. Und weil er Mariàca kannte, wusste er auch, dass sie den wahren Namen niemals preisgeben würde. Sie würde ihn hegen und pflegen, als hätte sie sich selbst befruchtet.
So erfuhr er nicht, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen unter dem Herzen trug. Ermittlungen fanden keine statt. Sie gehörten keiner Gerichtsbarkeit an, das Land, auf dem sie lebten, war rechtsfreier Raum, ja, man war sich nicht einmal einig, ob sie zu den Gemeinden Telévras oder Nessicùru gehörten, auch wenn die Alten behaupteten, in der Vergangenheit hätten sie zu Cuccureddu gehört, und jemand sich sogar bis ins 17. Jahrhundert vorwagte und sagte, damals hätten sie zu Alùstia gehört.
Ein Leichnam, der nicht eindeutig zuzuordnen war.
Manches kann auch nur in der Ogliastra passieren.
Man trug ihn in aller Eile zu Grabe, und niemand fragte sich, wo denn die Tochter und ihr Bauch abgeblieben waren. Damals ging man gerne ins Kloster zu den Schwestern, wo die sündige Frucht ausgetragen und dann zur Adoption an eine Familie in Nuoro oder Cagliari freigegeben wurde.
Und Mariàca? Hatte sie gelitten? Den Tod ihres Vaters betrauert? Niemand kam die Vermutung in den Sinn, dass sie ihn umgebracht haben könnte. Warum eigentlich?
Weil ich sie am 2. April 1972 noch gesehen habe. Sie verabschiedete sich mit einem Wangenkuss von mir. Drei Jahre zuvor war ich überglücklich gewesen, dass sie die Prüfung nach dem fünften Hauptschuljahr bestanden hatte. Vor Freude waren mir die Tränen gekommen. Die mündliche Prüfung? Sie trug alles ohne Stottern und Stocken vor und wirkte sehr reif für ihr Alter. Und ihr Aufsatz? Er beschäftigte sich mit dem Begriff der Freiheit, der Liebe zu den Schafen und der Natur. Die Mitglieder der Prüfungskommission mussten herzlich lachen, als sie lasen, dass man verlorene Schafe einfach dort lassen sollte, wo sie sich versteckt hatten, und der Direktor fragte sie: »Man merkt, dass du nicht am Katechismusunterricht teilgenommen hast und auch nicht an der Erstkommunion. Jetzt wirst du diese ja nachholen und sehen, dass das Gleichnis vom verlorenen Schaf das allerschönste von allen ist. Es stimmt doch, dass du die Erstkommunion empfangen willst?« Darauf sie, als hätte sie gerade eine Ketzerei gehört: »Schafe sind von allen die intelligentesten Lebewesen. Und sie lieben, wussten Sie das? Ich habe welche gesehen, die sich verliebt hatten und wütend wurden, wenn der Schafbock ihnen Hörner aufsetzte, das ist wie bei euch Männern.« Allgemeines Gelächter, dieses Mädchen war ungewöhnlich intelligent.
Ein Besuch der Mittelschule war ausgeschlossen, und ich wusste, dass sie schwanger war. Meiner Meinung nach war es einer der Freunde ihres Vaters gewesen, Hirte wie er, mit denen er recht häufig Gelage veranstaltete. Sie war damals schon eine Frau, auch wenn sie nicht älter als vierzehn war. Ich stellte ihr keine Fragen, weil ich sie gut genug kannte, um zu wissen, dass sie auf dem Absatz kehrtgemacht hätte. Sie sagte an jenem Tag wie aus dem Nichts zu mir: »Ich steige in den Bus, fahre nach Arbatax und nehme von dort ein Schiff.« Ich war wie vom Donner gerührt. Ich konnte sie nicht aufhalten. Sie machte mir ein Zeichen, dass ich keine Silbe verraten sollte. Ich gab ihr für den Bus zehntausend Lire.
Am Tag darauf fand man ihren Vater tot auf.
Als ich alles dem Direktor erzählte, sagte er, ich hätte sie aufhalten sollen, ich sei doch ihr Lehrer gewesen. Und ich hätte ihn früher darüber in Kenntnis setzen sollen, dass sie schwanger war und fort wollte. Warum? Nach fünfzig Jahren Schuldienst habe ich begriffen, dass man seine Lieblingskinder ziehen lassen muss. Sie hat mir das beigebracht. Ich muss immer noch an das Heft denken – wie oft denke ich daran –, in das sie ihre Gedanken schrieb … »Deus ti salvet Maria.« Sie ist fortgegangen, wie es nur die Kinder dieser Insel tun, schweigend und ohne Aufhebens.
Denn wir, die Kinder Sardiniens, beherrschen Abschiede meisterhaft …
(Marcellino Nonies, Die Frömmigkeit der Schafe, Seite 3)
7.
Narghilè, Juni 2017
Marcellino Nonies wartete bei den Carabinieri geduldig vor dem Büro des neuen Maggiore. Er war schon seit Langem nicht mehr in der Provinzhauptstadt Narghilè gewesen. Er hatte in seinem Leben noch nie ein Auto besessen und musste deshalb immer darauf warten, dass seine Nachbarn, Signora Brigida und ihr Mann, ihn aufforderten, mit ihnen zu kommen und »sich ein bisschen unter die Leute zu mischen«. Die Autofahrt dauerte eine knappe halbe Stunde, und zwei- oder dreimal im Jahr konnte man den kleinen Ausflug auf sich nehmen.
In der letzten Zeit hatte er allerdings Probleme beim Gehen, oft sogar beim Sprechen oder Schlucken. Das Alter, hatte er bei sich gedacht. Doch dann hatte er sich auf Rat seiner Nachbarn genau zwei Wochen zuvor im Provinzkrankenhaus untersuchen lassen.
Heute war er aus einem ganz anderen Grund in der Stadt. Die Carabinieri hatten ihn per schriftlicher Aufforderung einbestellt, es sei »sehr dringend« hatte der Carabiniere, der sie überreichte, gesagt.
Eine Stimme unterbrach ihn in seinen Gedanken. »Bitte kommen Sie, der Kommandant ist bereit.«
»Guten Tag, Professore, ich bin Achille Pantognostis, der neue Kommandant.«
»Ich bin kein Professore, Signor Generale. Nur ein einfacher Grundschullehrer.«
»Naja, wo wir schon dabei sind, ich bin auch kein General, sondern Major.«
»Entschuldigen Sie, ich kenne mich mit den Dienstgraden des Militärs nicht gut aus.«
»Und ich mich nicht mit den Ihren«, sagte der Kommandant freundlich, um für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen.
Achille Pantognostis wartete auf ein Lächeln, das aber ausblieb, und war überrascht von der eintönigen, metallisch klingenden Stimme des Lehrers.
»Ich nehme an, Sie kennen den Grund dafür, warum man Sie einbestellt hat. Ich wollte erfahren, warum die Tidòngia für die Zeit, in der sie unter polizeilicher Aufsicht steht, Ihre Adresse angegeben hat.«
»Unter polizeilicher Aufsicht? Weshalb?«
Achille Pantognostis kannte Sardinien kaum, denn er war erst seit wenigen Wochen auf der Insel, und ging deshalb wie selbstverständlich davon aus, dass jedermann Mariàca Tidòngia und Details zu ihrer Vergangenheit kennen müsste. Aber er war ein liebenswürdiger Charakter: »Es hat keinen Zweck, uns gegenüber mit Informationen hinter dem Berg zu halten. Sie haben nichts mehr von der Tidòngia gehört?«
»Nein, … was hätte ich denn von ihr hören sollen? Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie ein Teenager und schwanger.«
Der Maggiore nahm den ironischen Tonfall des Lehrers auf.
»Sie hat dreißig Jahre sowohl in Frankreich als auch in Italien hinter Gittern gesessen, und Sie wollen mir weismachen, dass Sie von nichts eine Ahnung haben? Als Adresse für Kontrollbesuche des Strafvollzugs hat sie Ihre Adresse angegeben, die sich, wie ich verifiziert habe, in all den Jahren nicht geändert hat. Ein merkwürdiger Zufall, finden Sie nicht?«
»Ja, das stimmt, aber ich habe wirklich nie wieder was von ihr gehört. Nicht mal eine Postkarte … schon merkwürdig.«
»Und Sie wissen auch nicht, dass sie einen Sohn hat?«
»Das dachte ich mir, auch wenn ich keine Ahnung hatte, dass es ein Sohn ist. Also ein Sohn …«
»Genau, ein Sohn. Eine wahre Leuchte auf dem Gebiet der Medizin, wohnhaft in Paris. Er ist mittlerweile fünfundvierzig Jahre alt.«
»In Paris? Sie ist also dorthin gezogen?«
»Stimmt genau. Aber da Sie ja nichts über sie wissen, werde ich Ihnen alles erzählen.«
Der Tonfall des Maggiore war schärfer geworden.
»Sie lebt also in Paris. Davor ist sie auch noch eine Weile in Italien unterwegs gewesen. Sie hat sich zwischen den beiden Ländern bewegt. Kleine Diebstähle in Supermärkten nahe der Grenze, Raubzüge in großen Ketten im Namen des Proletariats. Ihren achtzehnten Geburtstag beging sie mit einem bewaffneten Überfall auf eine Bank in Ventimiglia, angeblich, um die Unabhängige Arbeiterbewegung finanziell zu unterstützen. Danach hat sie nichts ausgelassen, vom Fall Aldo Moro bis zur ideologischen Nachfolgegruppe der Roten Brigaden. Sie hat sich schließlich endgültig nach Frankreich abgesetzt. Theoretisch ist sie mittlerweile auf freiem Fuß. In Italien hat sie nur noch eine geringe Reststrafe abzubüßen, bei der Einreise hat man sie verhaftet. Aber sie muss nur einmal in der Woche hier in der Kaserne zur Unterschrift erscheinen, mehr nicht. Nur ist sie hier noch nicht aufgetaucht. Aber vielleicht ist sie auch noch gar nicht hier angekommen.«
Marcellino Nonies verbarg seine Überraschung.
»Wenn Sie wüssten, wie viele Schüler ich in all den Jahren unterrichtet habe und wie viele davon mich so gut wie vergessen haben. Sie sind mit ihren Eltern nach Deutschland oder in die Schweiz ausgewandert, und das war’s. Ich kann unmöglich wissen, was aus ihnen allen geworden ist. Manche sind vielleicht Millionäre, andere Verbrecher … wer weiß das schon.«
»Damit wollen Sie mir also sagen, dass sie vom Lebenswandel der Tidòngia keine Ahnung haben, stimmt’s?«, sagte der Maggiore.
Marcellino Nonies antwortete zunehmend ungehalten: »Ich will auch nichts davon wissen, die Vergangenheit interessiert mich nicht.«
Achille Pantognostis sah ihn versöhnlich an. Dann sagte er in professionell neutralem Tonfall: »Falls Sie von ihr hören und sie sehen, sagen Sie ihr, dass sie sich umgehend beim Kommando der Carabinieri hier in Narghilè melden soll.«
»Mach ich.«
»Ich frage Sie zum letzten Mal. Können Sie mir bestätigen, dass Sie sie nicht mehr wiedergesehen haben? Sie ist also nicht bei Ihnen aufgetaucht? Ganz sicher?«