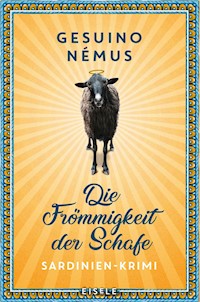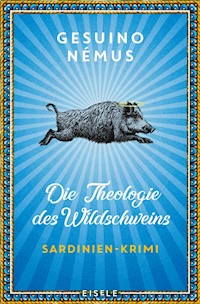Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein-Sardinien-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein schöner Ort zum Sterben Ein mysteriöser Autounfall und ein Selbstmord ohne ersichtliches Motiv – zwei Todesfälle bringen Unruhe das abgelegene sardische Bergdorf Telévras. Hierher verirrt sich kaum ein Tourist, die Bewohner müssen sich also etwas ausdenken, um der Entvölkerung des Ortes etwas entgegenzusetzen. Es sind moderne Zeiten, aber die Bewohner des Dorfes, mit ihren schrulligen Gewohnheiten und verqueren Ansichten, tun sich schwer damit, sich ihnen anzupassen. Zu den Mitgliedern des vielleicht kleinsten Tourismusvereins Italiens zählen Donamìnu Stracciu, seines Zeichens selbsternannter Dorfdichter, die überaus fromme Titina Inganìa, die man noch nie allein mit einem Mann gesehen hat, und Michelangelo Ambéssi, der jedem mit einer Körpergröße über 1,60 m grundsätzlich misstraut. Als eines kalten Wintermorgens Inspektor Marzio Boccinu – von seiner Dienststelle suspendiert – sich in Telévras einmietet, gerät er in ein Gewirr aus Verdächtigungen, Intrigen und eigenen romantischen Gefühlen, mit Konsequenzen, die jede Vorstellungskraft übersteigen ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Ins winzige sardische Örtchen Telévras verirrt sich kaum ein Tourist, denn es liegt abgeschieden in den Bergen und ist einfach zu weit weg vom Meer. Die Dorfbewohner und der dortige Heimatverein – vielleicht der kleinste Italiens – bemühen sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich, aber erfoglos, daran etwas zu ändern. Bis plötzlich zwei mysteriöse Todesfälle für mehr Publicity sorgen, als sie sich je zu wünschen wagten ...
Der Autor
GESUINO NÉMUS (der mit richtigem Namen Matteo Locci heißt) wurde 1958 in Jerzu geboren, einem kleinen Dorf auf Sardinien. Heute lebt er in Mailand. Seit frühester Jugend hielt er sich mit verschiedensten Tätigkeiten über Wasser. Für seine mittlerweile fünf Teile umfassende Krimireihe um das sardische Dorf Telévras wurde er in Italien mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, u.a. dem Premio Campiello und dem John-Fante-Preis. Nach Die Theologie des Wildschweins ist Süße Versuchung
AUS DEM ITALIENISCHENVON JULIANE NACHTIGAL
Besuchen Sie uns im Internet:
www.eisele-verlag.de
Das Zitat in »Sprichwörter, 30, 16« im Kapitel 33 ist entnommen aus: Jakob Sprenger/Heinrich Institoris. Der Hexenhammer. Erster Teil. Aus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet von J. W. R. Schmidt, 1906, Projekt Gutenberg.
Die Originalausgabe »Ora Pro Loco« erschien 2017 bei Edizione Manubri, einem Imprint der Elliot Edizioni, Rom.
ISBN 978-3-96161-136-2
© 2017 Lit Edizioni Srl
© 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
This translation of Ora Pro Loco
1.
Sein Herz hatte die Form einer Nuraghe. Er war ein sardopatico, ein Sarde durch und durch. Er war mit dieser Missbildung auf die Welt gekommen, die ihm einen frühen Tod bescherte. Unfreiwillig und zu seinem großen Bedauern senkte er das Durchschnittsalter auf jener von Meeresblau umgebenen »Insel auf der Insel«, die es, was späten Tod anging, leicht mit Okinawa aufnehmen konnte. Er unternahm alles, wenn auch vergeblich, um sein Ableben hinauszuzögern und wie die Hundertjährigen aus der Provinz Ogliastra gesund zu essen: fettes Schafsfleisch, reifer Pecorino mit Würmern, culurgiónes, die vor Knoblauch und salzigem Käse nur so strotzten, aber nichts half. Sein Zustand verbesserte sich nicht. Er hatte es auch mit dem Trinken versucht, zwei Liter Cannonau pro Tag, wie man es in dieser Gegend immer noch gerne tut, aber es war nichts zu machen. Je gesundheitsfördernder seine Essgewohnheiten, desto schlechter ging es ihm. Als er um die sechzig war, probierte er hin und wieder eine Radikalkur mit dem Salat von Nonna Elvira, einer Prise Kurkuma, zwei kleinen Tomaten aus dem Garten und dem köstlichen Risotto von Arborea auf englische Art. Aber auch damit hörte er immer bald auf. Gegen die DNA war kein Kraut gewachsen, da half der beste Lebensstil nichts. Und er stammte eben nur zur Hälfte aus der Ogliastra.
»Dieses gesunde Zeug ist nichts mehr in meinem Alter«, verkündete er eines Tages, als seinen Freunden auffiel, dass er ungewöhnlich blass und weniger munter war als sonst, und sie sich nach der Ursache erkundigten.
Gott holte ihn im Alter von 82 Jahren zu sich – Venanzio Oréri, Vorsitzender des Heimatvereins Pro Loco. Sein ganzes Leben lang hatte er für die Gegend geworben, ihre Attraktionen bekannt gemacht, die einzigartige Qualität der typischen Produkte herausgestellt, für die Traumstrände geworben, aber …
Umsonst.
Keine Spur von Touristen. Falls sich mal einer in die Gegend verirrte, denn die Ausschilderung war schlecht, dann nur auf die Schnelle. Die Zeit reichte dann gerade für Benzin bei der einzigen Tankstelle in der ganzen Gegend und eine Limonade für die mitfahrenden Kinder. »Den Touristen sind wir viel zu weit weg vom Meer«, so das Mantra in der kleinen Gemeinde. Venanzios Enttäuschung war anfangs groß gewesen, bis er auf die brillante Idee verfallen war, eine Sagra dei Tacchi zu organisieren, ein Fest, das die für die Ogliastra typischen spitzen Kalkfelsen feiern sollte, die ihrem Namen alle Ehre machten, denn sie sahen aus wie die Absätze hochhackiger Schuhe. Inmitten all dieses Kalks waren sie geboren, etwas anderes hatten sie nicht. »Das sind unsere Dolomiten«, betonte er allen gegenüber, Politiker eingeschlossen. Die darauf folgenden Kommentare hatten mehr oder weniger alle den gleichen Tenor. »Wie hoch dürfen sie denn sein? Zehn oder zwölf Zentimeter?« »Geht auch Keilabsatz oder müssen es Pfennigabsätze sein?« Eine Agentur vom Festland hatte es noch weiter auf die Spitze getrieben: »Achtzehn Zentimeter sind auch okay, die sind hier in Mailand diese Saison der Hit.«
Selbst wenn seine Initiative Erfolg gehabt hätte – es gab nur ein einziges kleines Hotel, öffentliche Verkehrsmittel fehlten, der letzte Zug war 1957 gefahren, und bei dem Zustand der Straßen hätte es ein kleines Wunder gebraucht. Lange Rede, kurzer Sinn: Es war ein aussichtsloses Unterfangen. Und jetzt hatte man ihn leblos in seinem Steinhaus am Fuß der Berge gefunden, mit dem unbeschwerten Gesichtsausdruck von jemandem, der in seinem Körperfett ruhend dahinscheidet, und er hinterließ eine Lücke in der kleinen Gemeinde, die nicht zu füllen war.
Eine treffende Formulierung: Denn niemand wollte seinen Posten als Vorsitzender des Heimatvereins.
Ein Machtvakuum, in das sich wahrlich niemand drängte.
Dario Trevéssu und Fausto Pappatrigu, seine beiden ältesten Freunde, kramten in den Dokumenten herum. Vielleicht fand sich ja eine Idee für die kommende Sommersaison, die sie gleich entsorgen konnten, ohne dass die Gemeinde etwas davon mitbekam. Aber nichts, nur das Faltblatt einer Reiseagentur mit vielen exotischen Fotos. Trevéssu stach auf einem angehefteten Blatt Papier der Satz ins Auge: »M. Venanzio aimez-vous cette phrase: La Sardaigne que vous voulez?«
Da standen auch noch andere Sätze in einer Sprache, die ihnen wie Französisch vorkam, das sie beide aber nicht beherrschten, und außerdem gab es da noch ein Blatt mit Notizen, fast wie ein kurzer Anmerkungsapparat, diesmal in Venanzios Handschrift. Am Rand befand sich eine Adresse: Rue de L’Arnaque, 1315 Paris.
Ihnen das geben, was sie verlangen.
Genau. Ihrer Vorstellung entsprechen.
Banditen funktionieren, das Meer nicht.
»Häh? … Banditen funktionieren? Venanzio war schon komisch«, sagte Dario Trevéssu ziemlich teilnahmslos. Fausto Pappatrigu war von der Hausnummer überrascht.
»1315? Kann das sein?«, rief er verwundert.
»Kann schon sein … Auf Sardisch bedeutet Paris zusammen, aber ich glaube, in Französisch heißt Paris einfach Paris«, gab Dario sich gelehrt.
»Eine ganz schön hohe Hausnummer! Um von eins bis 1315 zu kommen, braucht man einen Bus. Hier ist die höchste Hausnummer 88«, sagte Pappatrigu.
»Klar sind die hoch, da wohnen Millionen Leute, nicht wie hier, wo sich Fuchs und Hase Gutenacht sagen.«
In der Lokalpresse hatte gerade das Ergebnis der letzten Volkszählung gestanden. Alle, bis auf den letzten Einwohner, hatten mitgemacht. Man wollte wie immer über 1000 kommen, aber es hatte nicht gereicht: 987.
Und die Schulen? Es gab nur noch eine Grundschule und die vom Gesetz vorgeschriebenen Mindestklassen. Kinder wurden keine geboren, und die jungen Leute zogen weg, noch bevor sie volljährig wurden. Für die Zukunft fehlten Perspektiven – mit Touristen oder Festen rund um Wildschwein und Schaf war es nicht getan.
»Wir sind so gut wie am Ende«, so Darios Kommentar zur Volkszählung.
»Wir haben in zwanzig Jahren zweitausend Einwohner verloren. Venanzio hatte recht damit, dass wir alle dazu verdammt sind auszusterben … Wir werden eine Diaspora«, hatte Pappatrigu hinzugefügt.
Sie bemühten sich, die Dokumente in Ordnung zu bringen, und dabei fiel ihr Blick auf einen Satz, der auf einem Blatt Papier mit kleinen geometrischen Figuren stand, wie sie Venanzio gerne kritzelte, wenn er nachdachte oder gerade eine seiner genialen Ideen ausbrütete.
Sie hassen uns, sie hassen uns
aber wir müssen sie ärgern indem wir sie lieben
2.
»Saludàus.«
Der Ragionier Franco Farruncas – dunkler Anzug, die schwarze Krawatte eines Bestattungsunternehmers, blütenweißes Hemd, feine Stadtschuhe und vor allem eine aufgesetzte sardische Leutseligkeit – wirkte beim Betreten der Bar von Samuele Baccanti wie ein böses Omen. Keiner erwiderte seinen Gruß. Vor jenem 21. November hatte ihn noch niemand hier gesehen. Außerdem zieht man unfehlbar sofort den Unmut aller Einheimischen auf sich, wenn man wie er unaufgefordert den Sarden herauskehrt. Manche der Stammgäste setzten ein mitleidiges Lächeln auf, aber heimlich, denn man bleibt hier höflich gegenüber Leuten, die ohne es zu wollen in einen Fettnapf treten.
Samuele hatte indes von seinem Vater Tore gelernt, seinen Kunden jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, und ging daher schon mal zur Kaffeemaschine. Es war siebzehn Uhr nachmittags und bereits dunkel. Eigentlich eine ungewöhnliche Zeit für einen Espresso, trotzdem wusste Samuele schon, was der Andere bestellen würde.
»Einen Espresso und ein Glas Wasser mit Kohlensäure.«
Samuele war Ragionier Farruncas sozusagen zuvorgekommen, und dieser machte ihn darauf aufmerksam.
»Mir macht das Spaß …«, erklärte ihm Samuele mit einem Lächeln. »Ich versuche zu erraten, was Gäste, die das erste Mal die Bar betreten, bestellen werden. Und Sie sehen aus wie einer, der gerne einen Espresso und ein Glas Mineralwasser hätte.«
»Wie sind Sie darauf gekommen? Und wenn ich jetzt ein Glas Wein bestellt hätte?«
»Dann hätte ich den Espresso eben selbst getrunken. Sie haben gelbliche Zähne, vom Kaffeetrinken und vom Rauchen. Kommissar oder Polizeiinspektor? Hoher Polizeibeamter? Handlungsvertreter?«
»Ziemlich heiß, gut geraten … ist aber unwichtig.«
Als die Worte »ziemlich heiß« an die gespitzten Ohren der Stammgäste drangen, und das ausgerechnet in einer von Brandstiftung heimgesuchten Gegend, war ihnen klar, dass sie entweder einen Vollidioten oder irgendeinen Politiker vor sich hatten, der auf Unterschriftenfang war, weil er sich für die Fähren oder die Preise der Tickets etwas Neues ausgedacht hatte. Auch Samuele ging darüber hinweg. Er setzte ein Lächeln auf und fragte nicht weiter nach.
»Ich bin der neue Vertreter des Tourismusverbandes«, sagte der Fremde lässig.
Diese Nachricht wurde mit Desinteresse aufgenommen. Solcherart Typen kannte man hier. In den vergangenen dreißig Jahren hatte es mehr Vertreter zur Förderung des Tourismus als Chefredakteure der Unione Sarda, der Tageszeitung, gegeben.
Samuele gab sich trotz allem zuvorkommend.
»Sie haben einen sardischen Akzent? Wie kommt’s?«
»Eja, ich bin Sarde. Was ist daran komisch?«
»Wir sind an Akzente vom Festland gewöhnt, verstehen Sie?«
»Finden Sie es seltsam, dass man einen Sarden geschickt hat?«
In der Tat mehr als seltsam. Das sah nach dunklen Machenschaften aus. Es war gegen die Natur.
Aber Samuele behielt seine Gedanken für sich.
Ragionier Farruncas trank erst seinen Espresso, dann das Glas Wasser aus. Ebenfalls eine seltsame Geste, dachte Samuele bei sich, und sein Blick fand sofort komplizenhafte Zustimmung bei den Stammkunden.
»Erst das Wasser, dann der Espresso. Man trinkt das Wasser nicht hinterher. Völlig untypisch für einen Raucher. Wenn er sich jetzt auch noch eine Zigarette ansteckt, stimmt mit ihm was nicht.«
Franco Farruncas verschlimmerte die Lage, indem er eine Schachtel Zigarren mit Kaffeearoma zutage förderte. Für Samuele Baccanti war er damit für immer unten durch. Das gab sein unmissverständlicher Blick zu verstehen, den Samuele auch für jene bereithielt, die Cannonau mit Sprudelwasser verdünnten.
Farruncas schnupperte an seiner Zigarre.
»Ich bin auf der Suche nach den Leuten vom Heimatverein. Kennen Sie die? Und wissen Sie zufällig, wo ich sie finde? Man wird doch ein Büro haben«, sagte er freundlich.
»Der Vorsitzende ist vor ein paar Tagen gestorben«, antwortete Samuele ohne großes Interesse.
»Ich weiß, dass er verstorben ist. Der Kommissar der Präfektur hat es mir gesagt. Aber wissen Sie, ob man vielleicht schon einen Nachfolger gewählt hat?«
»Ah, der Kommissar der Präfektur hat Ihnen das gesagt. Hier gibt es nicht mal einen Bürgermeister, keiner hat hier Lust, sich für was auch immer zu engagieren. Und soweit ich weiß, nein, es gibt keinen Nachfolger. Das Büro befindet sich in Cuccureddu, im Dorf ganz oben. Dahin geht aber keiner, zu Fuß kommt man da kaum hin.«
»Was wollen Sie damit sagen? Das gehört aber doch immer noch zu Telévras, oder hat man sich dort unabhängig gemacht?«, fragte Farruncas sarkastisch nach.
Samuele blieb höflich. »Das könnte man fast meinen. Die leben dort praktisch in ihrer eigenen Welt und haben mit dem Rest des Dorfs nicht viel am Hut. Nicht mal hier in der Bar lassen sie sich sehen.«
»Soll das ein Scherz sein?«, fragte Farruncas.
»Nicht unbedingt«, gab Samuele, immer noch lächelnd, zur Antwort. »Mit dem Auto kommen Sie da nicht hoch, höchstens bis zum Ende der ersten Steigung. Dann fragen Sie sich weiter durch, falls Sie jemanden sehen. Wenn ich mich nicht irre, ist das Büro an einem kleinen Platz namens Regalìu.«
»Ich werde von hier zu Fuß gehen, für mein Auto sind die Straßen hier zu eng.«
Und so machte sich Franco Farruncas, der neue Vertreter des Tourismusverbandes, an den Anstieg.
3.
Es fing in Strömen an zu regnen. Kaum hatte der Ragioniere die steile Straße hinter sich gebracht, die an dem kleinen Platz endete, wo sich der Heimatverein befand, prasselte der Regen auf ihn herab. Er flüchtete sich unter einen der Bogengänge, nahm aber sofort wieder Reißaus, denn zwischen den alten Bodenplatten flossen kleine Regenbäche. Er wollte sich schon dafür verfluchen, dass er zu Fuß gekommen war, als sich Fenster öffneten und die wenigen Bewohner fröhlich ein Lied anstimmten. Im Chor hießen sie den Regen willkommen.
Es hatte seit dem vierzehnten März nicht mehr geregnet, und nach acht Monaten Trockenheit gehörte es sich, dass man das Ereignis gebührlich feierte. Und wenn man zum ersten Mal in diesem Ortsteil Cuccureddu war, begriff man sofort, dass die Leute hier etwas seltsam waren: Fenster wurden geöffnet, die wenigen Kinder kamen auf die Straße, um in der Dunkelheit zu jubeln, und die Frauen, die ebenfalls aus ihren Häusern traten, grüßten einander mit einem Lächeln, als gäbe es den heiligen Antonius zu feiern. Endlich war wieder Wasser da, und man hoffte, dass das Rationieren nun ein Ende haben würde. Nachdem Ragionier Farruncas das Getümmel in Augenschein genommen hatte, lief er eilig auf den Heimatverein zu und vergaß ganz, dass es gleichgültig war, ob er rannte oder sich langsam wie eine Schnecke fortbewegte – er würde immer gleich nass werden. Aber manches weiß man eben nur in Cuccureddu. Hier ist die Physik noch immer eine solide Angelegenheit und keine Science-Fiction. Und in der Tat war er bis auf die Knochen nass, als er vor dem Büro des Heimatvereins stand.
Die Tür war angelehnt, und es brannte Licht, und so trat er ein, ohne anzuklopfen. Drinnen hatten sich vier Leute um einen PC versammelt und verfolgten den Wetterbericht. »Wow, diesmal haben sie mal richtig gelegen«, lauteten die fröhlichen Kommentare.
»Hast du gehört, Fausto, angeblich soll es eine ganze Woche lang regnen.«
Farruncas räusperte sich höflich, um die Gruppe auf sich aufmerksam zu machen.
Alle drehten sich überrascht zu ihm um.
»Guten Abend, haben Sie sich verlaufen?«, fragte Dario Trevéssu zur Begrüßung, die anderen drei grinsten.
»Nein, ich suche nach den Leuten vom Heimatverein.«
»Da sind Sie richtig, aber der Vorsitzende ist verstorben. Und wer sind Sie?«, fragte Dario.
»Ich heiße Franco Farruncas und bin der neue Vertreter des Tourismusverbands. Ich bin Sarde, so wie ihr, und ich wollte mit euch über ein wichtiges Zukunftsprojekt für eure … für unsere Gegend hier sprechen.«
In Telévras für Überraschung zu sorgen, war schon immer schwierig gewesen, aber in Cuccureddu war das über die Jahre so gut wie unmöglich geworden. Ragionier Farruncas gelang indes etwas Ungewöhnliches: Den vier Einwohnern von Cuccureddu hatte es die Sprache verschlagen. Sie standen da wie angewurzelt und überlegten, wie jemand von Farruncas’ Niveau auf die Idee kam, sich die Mühe zu machen und ihren winzigen und unbekannten Heimatverein aufzusuchen.
»Ich würde euch ja auf der Stelle einweihen, aber hier geht es um eine wichtige Angelegenheit. Und ihr habt ja noch kein Führungsgremium gewählt. Ihr hinkt mit allem hinterher. Es fehlt nicht nur ein Vereinsvorsitzender, sondern auch ein Rechnungsprüferkollegium und eine Schiedskommission. Wenigstens hat mir der Kommissar der Präfektur das so erklärt.«
»Ja, stimmt«, sagte Dario Trevéssu. »Aber hier will niemand das Amt des Vorsitzenden übernehmen, das ist noch schlimmer als das des Bürgermeisters. Können Sie uns aber vielleicht schon verraten, worum es geht? Vielleicht in groben Zügen?«
»Zuerst müsst ihr einen Vorsitzenden wählen und die gesetzlich vorgeschriebenen Gremien einrichten. Aber ich garantiere euch, dass diese Gegend mit euer Mithilfe wieder erblühen wird, und diesmal gibt es Arbeitsplätze für alle. Und zwar offizielle, angemeldete, für die alle gesetzlichen Beiträge abgeführt werden.«
Arbeitsplätze. Das Zauberwort, und zwar das einzige, das selbst jene aufhorchen ließ, die sonst mit jedwedem Vertreter des Staates wenig am Hut hatten. Ob aus dem Mund eines Kommissars der Präfektur, Inspektors, Staatsanwalts, Politikers oder eines Priesters – dieses Wort war magisch.
»Nichts? Nicht mal eine Andeutung?«, bettelte Pappatrigu.
»Ich verhandle nur mit gewählten Gremien, die von ihrem jeweiligen gesetzlich vorgeschriebenen Vertreter repräsentiert werden. Ich kann nichts Schriftliches herausgeben. Ihr habt ja nicht einmal einen Bürgermeister. Haltet Wahlen ab, und ich werde euch offiziell in das Riesenprojekt einweihen.«
»Wahrscheinlich geht es um eine direkte Verbindung zum Meer, so eine Straße könnten wir dringend gebrauchen«, versuchte Dario Trevéssu ihn zu überrumpeln. Aber Ragionier Farruncas ging nicht darauf ein.
Die beiden anderen wandten sich wieder dem Wetterbericht auf dem PC zu.
Unter den Anwesenden war auch eine Frau. Den Ragioniere, der beim Reden mit seinen Blicken immer alle einbezog, so wie es routinierte, in Sachen Kommunikation geübte Politiker gerne machen, überraschte das.
»Je eher ihr loslegt, desto besser«, sagte er. Und fügte hinzu: »Sobald ihr gewählt habt, gebt ihr mir Bescheid. Ich lasse euch meine Visitenkarte da. Das Projekt ist seriös und betrifft die ganze Gegend, aber, sagen wir es mal so … ihr werdet am meisten davon profitieren. Mehr kann ich euch im Augenblick nicht verraten.«
Es regnete stärker, und die engen Straßen von Cuccureddu hatten sich in wahre Sturzbäche verwandelt. Farruncas verabschiedete sich von allen Anwesenden per Handschlag, auch die zwei vorm PC standen auf und gaben ihm die Hand.
Die eine war Titina Inganìa, Jahrgang 1972, aus religiösen Motiven Single. Sie unterwies die Dorfkinder im Katechismus. Der andere war Michelangelo Ambéssi, Jahrgang 1928. Er war an seinem ersten Schultag aus der Klasse ausgerissen und vom Fensterbrett direkt auf den Rücken seines Pferdes gesprungen, das der Vater darunter abgestellt hatte. Das war im Oktober 1934 gewesen. Seitdem hatte er keine Schule mehr von innen gesehen. Von ihm stammt das berühmte Zitat: »Wer über einen Meter sechzig groß ist, riskiert, vor Hunger umzukommen. Mütter, passt auf, dass ihr eure Kinder nicht zu hochpäppelt. Wir Sarden sind klein. Gott hat uns diesen enormen Vorteil geschenkt.«
Wen wundert’s: Er war einst ein großartiger Jockeyreiter gewesen.
4.
Um elf Uhr am Sonntagmorgen barg man den Leichnam aus der steilen Böschung Sa Spéntuma. Sergiolino, Fahrer des einzigen Busses, der auch unter der Woche regelmäßig verkehrte, hatte bemerkt, dass die Trockenmauer in der letzten Spitzkurve vor dem Ortseingang nach Telévras in Teilen zerstört war. Er hatte angehalten und in der Tiefe des kleinen Tals, in dem der Bergbach so angeschwollen war, dass er alles zu überschwemmen drohte, ein Autowrack entdeckt. Es hatte seit dem Vortag ununterbrochen geregnet, und obwohl man kaum etwas sah, war Sergiolino sofort klar, dass hier etwas Ernstes passiert sein musste. Er versuchte zu telefonieren, hatte aber keinen Empfang und setzte sich wieder hinters Steuer. Bis zum Ort waren es noch drei Kilometer. Dort würde er um Hilfe bitten. Samueles Bar war seit sechs Uhr früh geöffnet, vielleicht wusste man dort auch bereits Bescheid. Ansonsten musste sofort die Polizei verständigt werden.
Sobald er erfahren hatte, was passiert war, machte Samuele seine Bar zu. Er wartete noch ab, bis der Fahrer seinen Bus auf dem Platz abgestellt hatte, der Endstation der Route, dann fuhren sie mit seinem Geländewagen zur Unfallstelle zurück. Das Unglück musste sich in der Nacht ereignet haben.
»Von hier aus können wir nichts ausrichten«, sagte Samuele sofort. »Wir müssen versuchen, von unten, vom Fluss Pardu, ranzukommen, und dann die andere Straße nach oben nehmen. Einen anderen Weg gibt es nicht.«
»Aber das sind noch mal sieben Kilometer Serpentinen, und die Straße wird überschwemmt sein«, wandte der Busfahrer ein.
»Und? Im besten Fall war das einer aus der Gegend, er hat sich nichts getan und ist zu Fuß nach Hause gelaufen. Von hier aus erkennt man nicht mal, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Auf jeden Fall gibt es keine andere Lösung, wenn wir sehen wollen, ob noch was zu retten ist. Steig ein, zum Mittagessen bist du wieder zu Hause.«
Sie brauchten fast eine Stunde für das Wegstück und mussten den Wagen in einer Straßenbucht abstellen, die der Fluss noch nicht erreicht hatte. Es regnete immer noch in Strömen, außerdem wehte ein Nordwind, und das machte das Unternehmen noch beschwerlicher.
Von dem Unfallauto waren nur das Fahrgestell und ein paar Motorteile zu sehen. Vieles, auch die Sitze, lag über die steile Böschung verstreut, einiges hatte sicher bereits der Fluss fortgetragen, es würde, falls überhaupt, erst im kommenden Juni mit der Trockenheit gefunden werden.
»Wenn das jemand überlebt hat, dann nur durch ein Wunder«, dachte Samuele bei diesem Anblick, er hatte in der Gegend schon viele Unfälle gesehen.
»Wenn du mich fragst, hat es den Typen aus dem Wagen geschleudert, Samuele, der wird hier irgendwo in der Böschung liegen … aber wie soll man ihn von hier aus finden? Wir müssen warten, bis es zu regnen aufhört, auch wenn dieses Wetter noch die ganze Woche anhalten soll, sagt zumindest der Wetterbericht«, bemerkte Sergiolino.
»Stimmt.«
Mittlerweile nieselte es heftig, und man konnte kaum die Augen offenhalten, weil der Nordwind einem die Tropfen ins Gesicht blies.
»Der Fahrer war nicht von hier. In Telévras fährt keiner einen Crossover. Schau dir mal das Fahrgestell an, das sieht mir nach einem koreanischen Fahrzeug aus. Und dort weiter oben, die Wagentür … die ist schwarz. Das war kein Geländewagen, sondern eine Kreuzung zwischen einem Jeep und einem Kleinwagen. Die Karosserie hat sich vollständig vom Gestell gelöst, der Wagen hat sich bestimmt dreißig Mal überschlagen, bevor er hier gelandet ist. Wie schnell wird er gefahren sein? Diese Kurve dort oben kann man höchstens mit fünfzig nehmen … wenn du zu schnell bist, trägt es dich sofort raus, auch ohne Regen. Meinst du, der hat noch gebremst?«
»Entweder war er besoffen, oder er kannte die Straße nicht. Wenn du langsam fährst, passiert nichts.«
»Verständigen wir die Polizei in Narghilè? Vielleicht wissen sie ja schon Bescheid«, sagte der Fahrer verwundert.
Mittlerweile waren sie bis auf die Knochen durchnässt und konnten kaum erwarten, endlich nach Hause ins Trockene zu kommen.
»Ruf sie an, aber vom Ort aus. Die sind glatt in der Lage, uns anzuordnen, hier auf sie zu warten. Ich habe keine Lust auf eine Lungenentzündung. Sollen die sich kümmern, wir haben unsere Bürgerpflicht getan. Der war nicht von hier, sonst wüsste ich es schon längst. Außerdem ist heute Sonntag …«
Eine knappe Stunde später traf die Polizei aus Narghilè am Unfallort ein, der Zivilschutz war ebenfalls dabei. Mittlerweile war der Fluss weiter angestiegen, und die Straße, die Samuele Baccanti und Sergiolino genommen hatten, unpassierbar. Man seilte sich von oben ab. So jedenfalls berichteten es um die Mittagszeit zwei Gäste, die man von der Bar dorthin geschickt hatte, damit sie sich umsahen und Samueles Stammgäste auf dem Laufenden hielten. Sie hatten auch einen Leichnam auf einer Bahre gesehen, den man, mit einer wasserdichten Plane bedeckt, in einen Krankenwagen schob. Mehr wussten sie nicht zu sagen, denn die Polizei ließ niemanden heran.
»Und ihr habt nicht mal gesehen, wer es war? Sie werden doch das Nummernschild geborgen haben«, fuhr Samuele sie an.
»Die haben uns nicht in die Nähe gelassen, Samuele. Da standen drei Polizeiautos, und man hat die Leiche sofort in den Krankenwagen geladen und weggebracht. Aber früher oder später werden wir es erfahren. Morgen steht es in der Zeitung. Der oder die war jedenfalls nicht aus Telévras, sonst …«
»Ihr habt auch keine Bremsspuren gesehen, oder?«, fragte Samuele.
»Wie sollten wir die bei dem Regen bemerkt haben?«, fragten die beiden im Chor.
»Naja, das stimmt … Aber ist es eurer Meinung nach wahrscheinlich, dass man an dieser Stelle von der Straße abkommt? Immerhin fahrt ihr die ja täglich.«
»Wenn man sich dumm genug anstellt …«, warf jemand ein.
»Naja«, sagte Samuele, während er den Sender einstellte, auf dem das Fußballspiel gegen Cagliari lief. »Die werden Sergiolino befragt haben, und bis heute Abend haben wir alles erfahren.«
»Genau, der wird uns alles erzählen, sobald er was weiß.«
Und damit warteten sie in der Bar auf den jungen Sergiolino.
Er war nämlich tatsächlich jung mit seinen nicht einmal vierzig Jahren.
Für die Verhältnisse der Provinz Ogliastra quasi noch ein Teenager.
5.
»Das war ’ne Frau, Samuele!«
Die Nachricht erreichte Samueles Bar um 13 Uhr 15, deutlich früher als vorausgesagt. Am Anfang nahm niemand der Anwesenden Notiz davon, denn Cagliari hatte trotz Heimspiel gerade ein drittes Tor vom Gegner einstecken müssen, und es herrschte nicht gerade Hochstimmung.
»Eine Frau? Bis du sicher, Sergiolino?«, rief Samuele Baccanti überrascht.
»Das hat mir der Polizist gesagt, der mich zu Hause vernommen hat. Morgen Vormittag muss ich nach Narghilè fahren, um das Protokoll zu unterschreiben. Er hat mich sogar gefragt, ob ich sie kenne oder sie schon mal gesehen habe. Aber sie stammt nicht aus unserer Gegend, und ihr Wagen ist auf ein französisches Unternehmen zugelassen. Ist dir hier schon mal eine Französin begegnet?«
»Französin? Im Leben nicht«, antwortete Samuele verblüfft. »Eine Französin? Was wollte die denn hier ausgerechnet im November?«
Samueles Frage blieb unbeantwortet, aber jemand stellte sofort die Fernsehnachrichten leiser. Er wiederholte seine Frage lauter: »Hat einer von euch irgendwann mal ein Fahrzeug mit einem französischen Kennzeichen gesehen, mit einer Frau hinterm Steuer?«
Schweigen.
Samuele überlegte laut weiter.
»Vielleicht war die Frau trotz des französischen Kennzeichens von hier. Vielleicht die Tochter von jemandem, der nach Frankreich emigriert ist, und sie wollte hier ihre Verwandten besuchen … Keine Ahnung … aber hier in Telévras sicher nicht. Hier ist niemand nach Frankreich emigriert. Vielleicht aus einem der Nachbarorte.«
»Die Frau war jedenfalls Französin. Das kannst du morgen in der Zeitung lesen«, gab Sergiolino sich gewiss.
Die Mannschaft aus Cagliari hatte soeben kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit das vierte Tor hinnehmen müssen. Samuele konnte es nicht länger mit ansehen und stellte den Fernseher ab. Keiner protestierte. Bei einem derart traurigen Spektakel verfielen die Gäste mitunter in Depression, man analysierte stundenlang die Tore oder hoffte bis zuletzt auf ein Wunder für Cagliari.
Auch die jungen Leute in der Bar interessierten sich für Sergiolinos Schilderungen, besonders was die Details zu dem Wrack in der Böschung anging, und wie er zusammen mit Samuele im Fluss alles in Augenschein genommen hatte. Der Regen hatte an Stärke weiter zugenommen, der Pardu drohte die natürlichen Deiche zu brechen. Und so war man in Sorge, dass wie schon so oft in der Vergangenheit die Katastrophe eintreten und das Wasser einen Bergrutsch verursachen würde. Dann wären sie noch weiter von der Nuova Orientale Sarda abgeschnitten, der einzigen Verbindung zum Rest der Welt.
Unter dem tröstlichen Einfluss des frisch gebrannten fil’e ferru, den Samuele an alle ausgab, wandte sich das allgemeine Geplauder aber bald anderen Themen zu. Samuele tat so, als sei der Schnaps von einigen Freunden heimlich und an der Finanzbehörde vorbei gebrannt worden. Aber selbst die alten Weiber vom Ort wussten, dass er selbst ihn illegal hergestellt hatte, denn obwohl er den Schnaps immer wieder verschnitt, kam er nie unter 67 Prozent Alkoholgehalt. Er füllte ihn immer in Flaschen bekannter Hersteller mit den entsprechenden Gütesiegeln ab, aber die Kennergaumen seiner Klientel konnte er damit nicht überlisten.
Am späten Sonntagnachmittag betrat Michelangelo Ambéssi die Bar. Draußen schüttete es immer noch. Man war allgemein verblüfft. Auf der Hauptstraße von Telévras hatte man seit mindestens einem Vierteljahr keinen Ureinwohner von Cuccureddu mehr zu Gesicht bekommen. Samuele fragte nicht nach, wie es Michelangelo gehe, auch nicht nach dem Grund für seinen unvermuteten Besuch, sondern schenkte ihm sofort abbardente, Schnaps, ein. Michelangelo leerte das Glas in einem Zug, stellte es ab und wartete auf die nächste Runde. Der berühmte Jockey musste sich trotz seiner 87 Jahre einen genehmigen. Und die Schocktherapie, zwei Gläser mit 65-prozentigem Schnaps, war, obgleich nicht nach gesetzlichen Vorschriften hergestellt, ein wahres Lebenselixier.
Michelangelo, gerade mal 153 Zentimeter groß, machte trotz seiner O-Beine und der zerschlissenen Reitstiefel immer noch eine gute Figur. Er bat um Ruhe und verkündete: »Wir müssen einen neuen Vorsitzenden für den Heimatverein wählen. Wer kandidiert? Du, Samuele?«
Schweigen ist oft die intelligenteste Antwort.
Schweigen mit Achselzucken hat dagegen schon beinahe etwas Metaphysisches.
»Dass sich bloß keiner vordrängelt«, kommentierte Michelangelo ironisch.
Samuele machte ihn höflich darauf aufmerksam, dass sich eigentlich immer die Einwohner von Cuccureddu um den Heimatverein gekümmert hätten, und dass dieser schönen Tradition auch nach dem Tod Venanzio Oréris nichts im Weg stehe.
»Wir brauchen junge Leute mit Elan und Unternehmergeist«, legte Michelangelo nach.
Himmlisches Schweigen.
Auf Michelangelo Ambéssi waren sie in Telévras alle stolz. Er hatte sogar die englische Queen kennengelernt und beim königlichen Rennen in Ascot eines ihrer Pferde geritten. Niemals hatte er die Peitsche eingesetzt, um sein Ross anzutreiben. Von seinen 153 Zentimetern aus betrachtete er jeden, der größer war als er, mit Argwohn. Er war stolz darauf, sich das Lesen und Schreiben selbst beigebracht zu haben und mehr über Pferde zu wissen als über Menschen. Und so wusste er, dass er seine Bitte um Mitarbeit nicht noch einmal stellen musste.
Er stellte sein Glas vor Samuele ab, der ein drittes Mal nachschenkte und auf Bezahlung verzichtete. Diesmal kippte Michelangelo seinen Schnaps nicht hinunter, sondern kostete ihn Schluck für Schluck aus. »Diese Menge hätte selbst ein Wildpferd niedergestreckt«, dachte Samuele bei sich, während sich der Blick des Alten trübte. Der bedankte sich für die Einladung.
»Hast du schon von der Toten bei dem Unfall gehört?«, erkundigte sich Samuele.
Samuele erzählte ihm von den Ereignissen, doch Michelangelo war in seine Gedanken versunken, die Unfalltragödie ließ ihn offenbar kalt.
Und das war keine Folge des Alkohols.
Er kannte jetzt die Antwort auf seine Frage.
Es lag auf der Hand, wer dieses Amt bekleiden würde.
Es war ein Schweigen, auf das Antworten folgen würden, auch ohne die entsprechenden Fragen.
Ein typisch sardisches Schweigen.
6.
Mit hartnäckigem Schweigen kannte sich Marzio Boccinu, Hauptkommissar bei der Polizei in Narghilè, bestens aus.
Und an einem Montagmorgen liebte er Schweigen ganz besonders.
In der Tageszeitung Unione stand eine Meldung zu dem Unfall, aber nur im Lokalteil der Provinz Ogliastra. Mehrmals las er den kurzen Artikel, der von einem Archivfoto des kleinen Tals geschmückt wurde, und verglich ihn mit dem Bericht, den sein Team nach dem Einsatz erstellt hatte. Die Identität des Opfers wurde nicht erwähnt, aber die Tatsache, dass es sich um einen Wagen mit französischem Kennzeichen handelte. Es lag damit auf der Hand, dass auch das Unfallopfer vom Festland stammte. Bislang hatte sich bei der Polizei allerdings noch niemand gemeldet, und es gab auch keine offizielle Anfrage potentieller Angehöriger.
Vom Fahrzeugschein abgesehen, der auf eine Versicherung mit Sitz in Paris ausgestellt war, hatte man keine persönlichen Dokumente gefunden. Die mussten verloren gegangen sein, als sich der Wagen mehrmals überschlagen hatte, und der Regen war immer noch zu stark für eine Suchaktion. Und so wartete der Kommissar in seinem Büro auf die kriminaltechnischen Ergebnisse aus Cagliari. Vielleicht würde eine Untersuchung der Fingerabdrücke Hinweise ergeben, vor allem für den Fall, dass niemand die Tote vermisste.
Er hatte das Polizeiprotokoll zur Durchsicht erhalten, bevor die Journaille informiert worden war. Und er hatte darauf Wert gelegt, dass Details zur Identität des Unfallopfers unerwähnt blieben, damit die Meldung bei möglichen Angehörigen keine Panik hervorrief. Das war halbwegs gelungen, nur die französische Herkunft stand im Raum. Und so war er überrascht, als ihm gegen elf Uhr von der Zentrale ein Anruf durchgestellt wurde. Es war ein Journalist der Unione, der ihn von seinem Handy aus anrief und ihn zwar freundlich, aber doch nachdrücklich kritisierte. »Was haben Sie sich dabei gedacht, Dottore? Wollten Sie uns verschweigen, dass das Unfallopfer weiblichen Geschlechts ist? Hier pfeifen das die Spatzen von den Dächern.«
»Was heißt hier?«, fragte der Kommissar verärgert.
»Hier in Telévras, wo sonst?«
»Woher wollen die wissen, dass es sich um eine Frau handelt? Woher haben die das?«
»Was meinen Sie damit? Hier geht man davon aus.«
»Kein Wort darüber, bevor das nicht offiziell ist«, legte der Kommissar ihm nahe.
»Soll das heißen … Sie bestätigen diese Nachricht?«
»Kein Stück. Wer hat Ihnen die übrigens gesteckt?«
»Nun regen Sie sich nicht auf, Dottore. Wir zwei sitzen doch im gleichen Boot. Wir fragen, und jemand antwortet … wenigstens hoffen wir beide das jeweils. Warum werden Sie gleich so wütend? Ich werde das jedenfalls so berichten.«
»Gar nichts werden Sie berichten, sonst haben Sie eine Anzeige am Hals.«
»Wollen Sie mich einschüchtern? Ich schreibe das, was die Leute hier laut denken.«
»Das werden Sie nicht tun, bis die Identität des Unfallopfers feststeht. Sonst, ich wiederhole mich, werden Sie eine Anzeige wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen bekommen. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie aus dem Journalistenverband fliegen.«
Die Leitung wurde still.
Marzio Boccinu holte tief Luft. Er war bekannt für seine Dickköpfigkeit, seinen Mangel an Diplomatie und dafür, dass er seinem Gegenüber bei Befragungen nie direkt ins Gesicht sah.
Aber diesmal hatte er den Bogen überspannt, wurde ihm klar.
Von welchen polizeilichen Ermittlungen hatte er eben gefaselt?
Es gab keine Ermittlungen, wenn man von den Routineuntersuchungen absah, wie sie bei jedem Verkehrsunfall üblich waren.
Der Staatsanwalt hatte darum gebeten, informiert zu werden, falls sich herausstellen sollte, dass die Tüchtigkeit des Fahrzeugs in irgendeiner Weise beeinträchtigt gewesen war. Nichts Ungewöhnliches, normaler Verwaltungskram. Ermittlungen? In welchem Delikt? Marzio Boccinu hörte das Telefon erneut klingeln. Es war wieder der Journalist.
»Entschuldigen Sie, die Leitung ist unterbrochen worden. Sie ermitteln also? In welchem Delikt?«, hörte er ihn fragen.
»Es gibt kein Delikt. Aber ich halte es für korrekt, dafür zu sorgen, dass mögliche nahe Verwandte des Opfers nicht aus der Zeitung von dem Unfall erfahren, sondern von uns, der Polizei. Das war’s.«
»Das war’s? Also kann ich schreiben, dass es sich bei dem Opfer um eine Frau handelt.«
»Ich habe Ihnen eben schon gesagt, das zu unterlassen. Falls Sie sich nicht dran halten, werden Sie nie wieder was von uns erfahren.«
Und dieses Mal wurde die Leitung nicht wegen eines technischen Defekts unterbrochen, sondern Marzio Boccinu legte auf.
Er verließ sein Büro und rief laut auf dem Korridor Franzinu und Melchiorri zu sich, die beiden Polizisten, die das Protokoll verfasst hatten. Er ließ die beiden nicht einmal Platz nehmen, sondern kam gleich zur Sache. »Wer hat denen in Telévras gesagt, dass es sich um eine Fahrerin handelte? Haben Sie die Frau mit eigenen Augen gesehen? Im Bericht steht, dass die vom Zivilschutz sie noch am Hang in einen Leichensack gesteckt haben. Wer von euch war so blöd? Ich habe euch doch gesagt, keine Details nach außen zu geben.«
Sowohl Melchiorri als auch Franzinu stritten jede Indiskretion ab. Und vom Zivilschutz konnte es auch niemand gewesen sein, denn die waren, ohne mit jemandem ein Wort gewechselt zu haben, nach Narghilè zurückgefahren.
»Also kommt nur der Busfahrer infrage.«
»Als Einziger«, sagten die beiden Polizisten wie aus einem Munde.
»Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke«, fuhr Franzinu fort, »fällt mir ein, dass ich den Fahrer gefragt habe, ob er in den letzten Tagen einen Wagen mit französischem Kennzeichen gesehen hat, mit einer Frau hinterm Steuer.«
»Wirklich eine Meisterleistung! Ich kann dir nicht mal androhen, dich nach Sardinien strafversetzen zu lassen, du bist ja schon hier.«
»Tut mir leid, Dottore, tut mir wirklich leid. Auch wenn …«
»Wenn was?«, brüllte ihm Marzio Boccinu ins Gesicht.
»Ich habe ihm nicht gesagt, dass das Unfallopfer eine Frau ist. Ich habe ihn nur gefragt, ob er irgendwann mal eine Frau oder jemand anderen hinterm Steuer von einem solchen Fahrzeug gesehen hat, denn er fährt die Strecke doch vier Mal am Tag. Und wem sonst wäre ein solches Nummernschild aufgefallen, wenn nicht ihm?«, versuchte Franzinu sich zu rechtfertigen.
»Ganz schön schlau! Du hast ihn einfach gefragt, ob er eine Frau hinterm Steuer gesehen hat. Aber man muss kein Genie in Mathematik sein, um eins und eins zusammenzuzählen. Ich lass dich ins Pustertal versetzen.«
Gaviano Franzinu hatte keine Ahnung, wo dieses Pustertal liegen sollte, aber er war trotzdem besorgt.
Er sagte in aller Unschuld: »Das mag sonst überall stimmen … aber hier in der Ogliastra kann eins und eins auch mal drei ergeben.«
»Raus!«, brüllte der Kommissar.
Und Gaviano Franzinu folgte dieser Aufforderung, indem er sich Schritt für Schritt rückwärts Richtung Tür bewegte.
Aber wie jemand, der genau wusste, wohin er als Nächstes gehen und wonach er suchen musste.
7.
Hauptkommissar Marzio Boccinu machte keine Fehler, zumindest behauptete er das gegenüber seinen Untergebenen. So war er zum Beispiel davon überzeugt, dass man einen Tatverdächtigen niemals sofort unter Druck setzen, sondern bei der Vernehmung mit ihm plaudern sollte, als spielten seine Aussagen keine Rolle.
»Man muss ihm das Gefühl geben, dass er hier als freier Mann und hoch erhobenen Hauptes herausspazieren und so weiterleben kann wie vorher. Er soll den Eindruck haben, dass er unbesorgt sein Handy benutzen kann, ohne dass sein Telefonat abgehört wird. Er darf sich nicht beobachtet fühlen. Schweigen besiegt man nur durch Schweigen.«