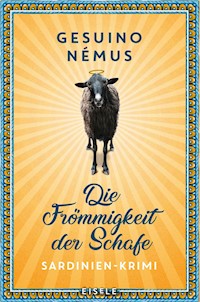Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein-Sardinien-Krimi
- Sprache: Deutsch
Heiliges Wildschwein! Juli 1969. Im beschaulichen sardischen Bergdorf Telévras kommt Unruhe auf, als einer seiner Bewohner erst verschwindet und dann ermordet aufgefunden wird. Carabiniere De Stefani, ein Piemonteser, der es als Neuling in der verschworenen Gemeinschaft ohnehin schon schwer genug hat, versucht verzweifelt, die ungeschriebenen Gesetze und gut gehüteten Geheimnisse des sardischen Bergdorfs zu lüften. Dabei ist er auf die Hilfe des Dorfpfarrers Don Cossu angewiesen – doch am Ende kommt die Auflösung von gänzlich unerwarteter Seite ... Ein originell erzählter Krimi voller sardischer Gerüche, Geschmäcker und üppigem Lokalkolorit, der ein traditionelles Sardinien an der Schwelle zur Moderne zeigt und mit Humor und Ironie seinen skurrilen Bewohnern ein Denkmal setzt. "Dieser Krimi ist anders, und er ist mit einer Nonchalance und Leichtigkeit erzählt, die typisch für Sardinien ist. Spannend, humorvoll, aus immer wieder neuen Perspektiven erzählt, und mit überraschendem Ende." Ruhr Nachrichten
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Juli 1969. Während die Nachrichten der ersten Mondlandung um die Welt gehen, passiert im Süden Sardiniens wenig Spektakuläres. Im Bergdorf Telévras hütet Pfarrer Don Cossu seine mehr oder weniger braven Schäfchen, genießt die von seiner Schwester vorzüglich zubereiteten culurgiónes, trinkt dabei zuweilen ein Gläschen fil’e ferru zu viel und geht am Wochenende auf notorisch erfolglose Wildschweinjagd. Bis eines Tages der Vater seines hochbegabten Schützlings Matteo Trudìnu ermordet aufgefunden wird. Carabiniere De Stefani, ein Piemonteser, der es als Neuling in der verschworenen Dorfgemeinschaft ohnehin schon schwer genug hat, versucht verzweifelt, die ungeschriebenen Gesetze des sardischen Bergdorfs zu lüften. Dabei ist er dringend auf die Hilfe Don Cossus angewiesen – doch am Ende kommt die Auflösung von gänzlich unerwarteter Seite ...
Der Autor
GESUINO NÉMUS (der mit richtigem Namen Matteo Locci heißt) wurde 1958 in Jerzu geboren, einem kleinen Dorf auf Sardinien. Heute lebt er in Mailand.
Die Theologie des Wildschweins ist sein Debütroman, für den er in Italien mit fünf Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, u.a. dem Premio Campiello und dem John-Fante-Preis. Mittlerweile sind in seinem Heimatland bereits fünf Sardinien-Krimis um das Dorf Telévras erschienen.
Die Originalausgabe »La teologia del cinghiale«
erschien 2015 bei Lit Edizioni Srl, Rom.
ISBN 978-3-96161-101-0
© 2015 Gesuino Némus
© 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
Julia Eisele Verlags GmbH, München
This translation of La teologia del cinghiale is published by arrangement with Ampi Margini Literary Agency and with the authorization of Lit Edizioni.
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagillustration: © Shutterstock
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
I
Is lùnis di Antoni EsulòguDer Montag im Leben von Antoni Esulògu
Telévras, Juli 1969
Manchmal dachte er stundenlang über Unwichtiges nach. Über einen altbekannten Reim, ein Sprichwort, ein Wiegenlied oder einen Zungenbrecher. Seit Wochen beschäftigte ihn vor allem folgender: »Apu bittu s’oppài ’e Putzu scorrovèndu cussu fussu, a piccu, a panga e a trebùssu.« (Ich habe Putzus Kumpan gesehen, wie er mit Hacke, Spaten und Gabel einen Graben aushob.)
An sich kein Satz von Bedeutung, andererseits auch nicht unwichtig, weil der einzige Augenzeuge des Mordes an Bachisio Trudìnu genau diese Aussage in Form eines Bänkelliedes machte, wann immer der Maresciallo De Stefani ihn vernahm.
Antoni Esulògu, muss man dazu wissen, hatte die Wochentage nicht so parat. Bestenfalls einen, die anderen vergingen in einem Kreislauf der Zeit, und auch Samstag und Sonntag waren für ihn nichts Besonderes. Allein der Montag war für ihn, im Gegensatz zum Rest der Welt, ein Fest- und Fresstag.
Montags zog er sich fein an, ging mit seinem Proviant, zwei, drei noch warmen Stücken casu agédu, einem kalten gegrillten Schafsschenkel, ein paar Scheiben pistóccu und einem Liter Cannonau hinunter ins Dorf und setzte sich vor die Kirche.
Während alle anderen sich mit dem trostlosesten Tag der Woche herumschlugen, feierte er, wenn auch auf seine Weise.
Don Cossu, der Dorfpfarrer, gewöhnte sich langsam an den Anblick, der sich seit drei Wochen jeden Montag wiederholte. Am Anfang schimpfte er mit Antoni, aber als er sah, dass der andere ganz friedlich auf dem Kirchplatz unter dem uralten Feigenbaum saß und auch die alten Weiber beim Gang zur Morgenandacht nicht erschreckte, ließ er sogar Wasser in den Brunnen, der eigentlich nur zu Sankt Anton und anderen Festtagen im Juni in Betrieb war. So konnte Antoni dort seine pistóccu einweichen, die sonst gänzlich ungenießbar gewesen wären.
Er hatte auch versucht, ihm die Beichte abzunehmen, was Antoni aber offenbar dermaßen aufwühlte, dass er ihn von nun an von einem Fensterchen im niedrigen Kirchturm aus bespitzelte, das aussah wie eine Imitation. Von dort aus konnte man aber alles sehen, und Don Cossu nutzte es gern, um all jenen auf die Schliche zu kommen, die am Sonntag ihre Ehefrauen zur Elf-Uhr-Messe begleiteten, sich dann aber vor der Kirche zum Rauchen und Schwatzen versammelten.
»Te genti, te genti, dieses Volk, dieses Volk, dem geht es nur um den schönen Schein.Falsch wie die Nacht … auf geht’s, Matte’, bereite den Altar vor.«
Auch Matteo war etwas seltsam.
Im Alter von zwölf erfüllte er, hier aufgezählt nach ihrer Relevanz, folgende Aufgaben: Organist, Obermessdiener, er trug beim Gottesdienst die Lesungen vor, stimmte den Chor ein, zündete die Hundert-Lire-Kerzen an, läutete wegen seiner geringen Körpergröße die Glocken, sang bei den freudigen Mysterien die erste Stimme, bei den glorreichen die zweite, schwenkte bei Beerdigungen das Weihrauchfass, sang offiziell die Weihnachtsnovene und probierte von dem Muskatellerwein, den die Gläubigen der Kirche für die besonderen Festtage spendeten.
Mithin ein wahrer Profi der Sakramente, und dafür erhielt er Bücher, regelmäßige Mahlzeiten, Lateinunterricht, die Zusage, weiterhin auf Don Cossus Kosten die Schule besuchen zu dürfen, sowie monatlich fünftausend Lire, die er aber zu Hause bei seiner Mama abgab. Geld wurde dort immer gebraucht, und die Mama legte ganz bestimmt einen Teil davon für ein Studium zurück, vielleicht bei den Jesuiten, womit sie ihm seinen Traum erfüllt hätte.
Auf jeden Fall war Don Cossu nach dem Versuch, Antoni Esulògu die Beichte abzunehmen, ernstlich besorgt, denn danach nahm er wieder Kontakt zu Maresciallo De Stefani auf, den er ironisch su geniòsu nannte, einen Pfundskerl.
Wirklich zerstritten waren sie eigentlich nicht, aber Don Cossu war es irgendwann auf die Nerven gegangen, bei jedem Vorfall zu hören: »Wenn diese Sarden doch nur den Mund aufmachen würden.« Oder: »Ich sag’s Ihnen, da hat wieder keiner was gesehen.« Oder: »Ich sag’s Ihnen, die waren wieder alle bei Tore zum Kartenspielen.«
Don Cossu hatte in seinem Priesterleben schon Banditen die Beichte abgenommen, die allen Grund hatten, vor dem Gesetz zu flüchten, war aber von Berufs wegen an die Omertà, die Schweigepflicht, gebunden. Von der Formulierung »diese Sarden« fühlte er sich allerdings angegriffen. Als Matteo einmal eine neue Marke Weihrauch ausprobierte, die ein Vertreter aus Nuoro zur Probe dagelassen hatte, bekam er mit, wie Don Cossu der Kragen platzte.
»Genug davon, Maresciallo! Was wollen Sie eigentlich? Hier sind alle aus der Ogliastra oder der Barbagia, was wollen Sie sonst noch hören? Dass ein Cousin einem anderen Schafe gestohlen hat? Hier ist jeder mit jedem verwandt. Im Zweifelsfall bleibt der Diebstahl in der Familie. Zu Ostern isst man die Schafe, die zu Weihnachten gestohlen wurden, und zu Weihnachten die, die Ostern gestohlen wurden. Man lädt sich eben gegenseitig ein, so muss man sich nicht gegenseitig umbringen.«
»Wie schön, ein richtiges Familienessen.«
»Ob Familie oder nicht, so läuft das hier. Sie verschwenden Ihre Zeit, Maresciallo.«
»Ach, ich verschwende meine Zeit?«
»Jetzt vergessen Sie mal ihre piemontesische Heimat und kommen von Ihrem hohen Ross runter, Sie wissen ganz genau, dass ich Ihnen nichts sagen darf.«
»Ich will nicht am Beichtgeheimnis rütteln, aber versuchen Sie doch zu verstehen … sagen Sie mir wenigstens, ob er ihn gesehen hat …«
»Wen?«
»Nun kommen Sie schon, Sie wissen genau, von wem die Rede ist, der Typ hat zwei Carabinieri verletzt. Alle Welt weiß, dass er in die Kirche gekommen ist …«
»Dass ich nicht lache, Peppinu Golòvru soll zu mir gekommen sein? Der marschiert Ihrer Meinung nach fünfzig Kilometer zu Fuß durch den Wald, um mich im Pfarrhaus zu besuchen, und weil ihm natürlich keiner auf den Fersen ist, trinken wir ganz gemütlich einen kalten Kaffee zusammen und dann noch einen fil’e ferru, einen Schnaps, hinterher … na, Sie haben vielleicht Vorstellungen.«
»Das erzählt man sich im Dorf.«
»Na, dann vernehmen Sie doch mal alle. Man wird Ihnen sicher gerne eine Antwort geben. Wahrscheinlich müssen Sie für Ihre Vernehmungen noch Verstärkung aus Nuoro anfordern. An Ihrer Stelle würde ich auch noch pistòccu und casu marzu bereithalten, dann stehen sicher alle Schlange.«
»Lassen wir das, Don Cossu … der Junge schläft wirklich hier bei Ihnen?«
»Lassen Sie bloß Matteo aus dem Spiel. Er schläft hier, weil bei ihm zu Hause kein Platz ist, dort wohnen alle in einem Zimmer, und ein Klo gibt es auch nicht.«
»Er ist doch ein Einzelkind. Es ist bestimmt Platz für ein Bett.«
»Er schläft hier. Er schläft bei meiner Schwester Matilde im Zimmer, außerdem bekommt er etwas zu essen, spielt Orgel und geht mir zur Hand.«
»Ist schon recht, Don Cossu, ich habe nur nachgefragt, weil wir uns in der Polizeikaserne schon mal darüber gewundert haben. Naja, nachdem doch der Vater weg ist … geradezu unauffindbar. Der Viehmarkt dauert doch nur drei Tage und nicht …«
»Das hängt davon ab, Maresciallo. Vielleicht gab es eine Menge Vieh zu verkaufen. Ein Cousin von mir aus Desulo ist einmal zwei Monate von zu Hause fortgeblieben, Sie haben doch keine Ahnung …«
»Ich wollte nur sagen, nach allem, was man so hört, sind Peppino Golòvru und der Vater miteinander befreundet, und nach dem Verschwinden des Vaters, wollen wir es mal so nennen, soll die Mutter an ein bisschen Geld gekommen sein, angeblich Lösegeld aus der letzten Entführung. Jetzt können sie sich sogar zwei Mal in der Woche Fleisch leisten. Vielleicht hat der Junge in seiner Unbedarftheit … ich wollte ja nur ein paar kurze Fragen …«
»Lassen Sie die Kinder aus dem Spiel, Maresciallo! Das Geld fürs Fleisch bekommt er von mir. Was fällt Ihnen ein! Raus mit Ihnen!«
»Aber Don Cossu, ich wollte wirklich nicht … nun kommen Sie schon, entschuldigen Sie …«
Aber Don Cossu war auf hundertachtzig, und als er bemerkte, dass Matteo das Gespräch belauscht hatte, fuhr er ihn in einem Ton an, der keinerlei Widerspruch zuließ, außer den typisch sardischen: Schweigen und eine Mordswut im Blick.
»Und du, hau ab, du hast nichts gehört! Vergiss alles und halt die Ohren steif beim Maresciallo! Der kommt aus dem Piemont.«
»Was soll ich denn gehört haben?«
»Das, was Maresciallo De Stefani gerade alles gesagt hat.«
»Der Maresciallo De Stefani? Ich war mir ganz sicher, dass Ihr gerade Selbstgespräche geführt habt.«
»Habt? Hättet, meinst du wohl? Dass Ihr Selbstgespräche geführt hättet.«
»Habt, Don Cossu, da darf kein Konjunktiv hin, so steht es in dem Buch geschrieben, das Ihr mir geschenkt habt.«
Typisch Don Cossu. Anstatt sich über die Omertà, das Stillschweigen von Matteo zu freuen, hängte er sich daran auf, dass man ihn beim falschen Gebrauch des Konjunktivs erwischt hatte.
Er konnte diese in der Kirche übliche Besserwisserei nicht ausstehen.
»Auf jeden Fall ist es falsch, die zweite Person Plural zu verwenden, Signorino Naseweis, das ist hier in der Gegend schon seit dreißig Jahren aus der Mode. Aber ein verzeihlicher Fehler.«
»Das war kein verzeihlicher Fehler, Don Cossu, das war richtig.«
»Richtig, jetzt hör sich das einer an! Die zweite Person Plural ist nur für die Fremden! Jetzt mach dich davon und bereite alles für die Abendandacht vor. Los, marsch, auf geht’s. Tiàlu chi t’at criàu, dich hat der Teufel erschaffen.«
Man hatte Bachisio Trudìno tatsächlich noch nicht gefunden.
Seit fast einem Monat behaupteten manche, er sei bei einem Feuergefecht in der Nähe von Corr’e Boi angeschossen worden. Im Dorf sagte man, er sei nicht auf der Stelle tot gewesen, sondern habe sich noch wie ein angeschossenes Wildschwein in den Wald geschleppt, um allein in einem Versteck zu verenden und so der Gefahr zu entgehen, etwas auszuplaudern, denn die Bande um Peppinu Golòvru verzieh keine Verstöße gegen den Ehrenkodex und hätte sich an der Familie gerächt.
Man war sich einig, dass er nicht mehr am Leben war. Allerdings zog man es in dieser Gegend vor, es dabei zu belassen und nicht weiter nachzuforschen. Auch die Polizei strengte sich nicht über Gebühr an, der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Dabei ging es weniger um die Omertà, sondern vielmehr um die Armut der Leute. Eine Beerdigung kostete Geld, und ein Vorbestrafter, der spurlos verschwand, erwies seiner Familie gleich einen doppelten Gefallen: Spurloses Verschwinden nährte die Hoffnung, dass er doch noch am Leben sei, und begründete zugleich den Mythos, dass er sich dem Zugriff der Justiz zu entziehen wüsste. Von Letzterem konnte eine Familie glatt bis in alle Ewigkeit zehren. Wer also unauffindbar blieb, sparte den Hinterbliebenen Geld und auch der Kirche. Denn bei unnatürlichen Todesfällen, die zugegebenermaßen selten vorkamen, steuerte Don Cossu etwas zur Beerdigung bei, aber das Geld aus dem Klingelbeutel reichte nicht mal für einen Sarg aus Span.
Somit war Don Cossu ganz und gar nicht unglücklich, wenn man den Leichnam Bachisio Trudìnus niemals finden würde, und zwar aus zwei schwerwiegenden Gründen: Zum einen hätte er sich das Geld für den Sarg gern gespart, zum anderen – ein etwas ehrenwerteres Motiv – war Bachisio Matteos Vater.
II
Jedes Wildschwein ist wie ein Gebet
Maresciallo De Stefani ging seit einer gefühlten Ewigkeit auf die Jagd, und Signorina Matilde behauptete, er leide am »sardischen Weh«. Wie alle, die Gelegenheit hatten, Sardinien in den fünfziger oder sechziger Jahren kennenzulernen, wusste der Maresciallo nicht recht, ob man ihn ins Paradies oder die Hölle versetzt hatte.
Don Cossu erzählte gerne, wie er nach einer sechsstündigen Busfahrt von Porto Torres im Dorf angekommen war, und zuweilen ahmte er ihn nach: »Oh je, oh je … 280 Kilometer über Sandstraßen. Ist das hier etwa schon Afrika? Von der Überfahrt ganz zu schweigen.«
Matteo lachte lauthals, sobald er einen norditalienischen Akzent hörte, und wenn Don Cossu mit seinen Erzählungen loslegte und schilderte, wie er den Maresciallo dem örtlichen Tierarzt vorgestellt hatte, liefen ihm die Tränen über die Wangen.
»Das ist der Arzt am Ort«, hatte er todernst zum Maresciallo gesagt.
»Ah, ausgezeichnet. Entschuldigen Sie, dass ich da gleich von Ihnen Gebrauch mache. Ich bin gestern aus Porto Torres hier angekommen. Eine Reise, sage ich Ihnen …«
»Ja, das kennen wir …«, pflichtete Tierarzt Pòddighe ihm bei.
»Ich glaube, ich habe leichtes Fieber. Vielleicht könnten Sie mir eine kleine Spritze geben, nur zur Sicherheit.«
»Aber selbstverständlich, Maresciallo.« Und schon zog er eine Spritze heraus, die er sonst einsetzte, um Pferde zu impfen.
Dem Maresciallo fielen fast die Augen aus dem Kopf, und er hielt das Ganze für einen Scherz, aber Don Cossu beruhigte ihn sofort: »Wir haben hier keinen Amtsarzt, Maresciallo, und so springt Dottore Pòddighe ein. Hat Ihnen das Carabiniere Piras nicht gesagt? Ob es darum geht, einen Zahn zu ziehen, einen Bruch zu schienen, um eine Geburt oder die Spanische Grippe … alle im Dorf wenden sich an Dottore Pòddighe, denn bis Nuoro ist es zu weit, da ist man bereits tot.«
»Alles nur eine Frage der richtigen Dosierung. Ein Dreißigstel von dem, was ich einem Pferd verabreichen würde … und voilà!«, fügte Dottore Pòddighe bedächtig hinzu.
Aber der Maresciallo traute selbst einer solch bescheidenen Dosis in einer zwanzig Zentimeter langen Spritze nicht und ertrug lieber weiter sein leichtes Fieber.
Drei Tage später war er wieder auf den Beinen, und nach der Messe am Ostersonntag stellte Don Cossu ihn den anderen ehrenwerten Persönlichkeiten im Dorf vor: dem Grundschullehrer Signor Usai, dem Großgrundbesitzer Cavaliere Cherchi, dem Fahrer des einzigen Busses vor Ort, Signor Maxia, dem Inhaber des Bestattungsunternehmens, Signor Pulighéddu, und Signor Tranàga, auch Pinotto genannt, der das örtliche Kino betrieb, wenn auch nach zwei Jahren, in denen nur Ben Hur auf dem Programm stand, alle Dorfbewohner die Lust verloren hatten.
Jagd hin oder her, instinktbegabt oder nicht, Maresciallo De Stefani hatte in all den Jahren noch nie etwas gefangen, weder Wildschweine noch Verbrecher.
Hier die Liste der Vorfälle, die sich seit seiner Ankunft vier Jahre zuvor, im April ’65, in seinem Bezirk ereignet hatten: zwei Entführungen ohne Freilassung der Geisel, mehr als fünfzig Viehdiebstähle, ungefähr dreißig Handgreiflichkeiten mit Verletzungen, die von einer pattadèsa, einem Messer, herrührten, sieben Selbstmorde durch Erhängen, und, das noch ungewisse Schicksal von Bachisio Trudìno nicht mitgerechnet, drei Morde ohne Leichnam.
Im Ganzen: 62 schwere Delikte (die Selbstmorde mit eingerechnet).
Überführte: 0 (die Selbstmorde nicht mit eingerechnet).
Verdächtige: 2873, also von Don Cossu abgesehen, so gut wie alle Einwohner von Telévras.
Eine zu magere Erfolgsquote, um auf eine Beförderung oder eine Versetzung aufs Festland hoffen zu dürfen. Und genau deshalb fand Signorina Matilde, dass der Maresciallo vom »sardischen Weh« befallen sei.
In jenen vier Jahren kehrte er nur einmal ins Piemont zurück, nämlich als sein Vater gestorben war.
In den Ferien und an den freien Tagen ging er am liebsten in den Bergen auf die Jagd, mit einem Tarnanzug bekleidet. Dazu benutzte er sein Dienstfahrzeug, einen kleinen Jeep; Begleiter zu finden, die ihn durch die Wälder an den zerklüfteten Kalksteinhügeln der Ogliastra kutschierten, war ein Leichtes.
Don Cossu war vor seinem Wutausbruch im Pfarrhaus selbst oft mit von der Partie gewesen, obwohl ihm das sein Bischof verboten hatte.
Matteo hatte jeden Mittwoch mitbekommen, wie sie bei Morgenanbruch losgefahren waren, ein angenehmer Ritus, der sich in den letzten zwei Jahren wöchentlich wiederholt hatte: Der Motor des Jeeps tuckerte leise vor sich hin, während Don Cossu das Gebräu trank, das sich Kaffee nannte und das die Signorina Matilde ihm zwischen fünf und Viertel nach fünf vorsetzte. Dann stolperte er unter Höllenlärm, die bèrtula um den Hals und das vorsorglich geladene Doppelgewehr im Arm, in den Springerstiefeln, die ihm Carabiniere Piras geschenkt hatte, die Treppe zwischen Pfarrhaus und Kirchplatz hinunter.
Matteo stellte sich schlafend, damit er beobachten konnte, wie Signorina Matilde den Männern am geschlossenen Fenster mit den ersten drei Fingern ihrer Rechten einen ländlichen Segen auf den Weg mitgab und sich dann wieder ins Bett legte.
Im Sommer tanzten die ersten Sonnenstrahlen im Gegenlicht, ein Spiel aus weichen, fast durchsichtigen Konturen, die bei Matteo eine Illusion von Nacktheit erzeugten, denn die Signorina Matilde trug selbst an heißen Julitagen einen flauschigen Morgenrock. Sommers wie winters war das bis sechs Uhr früh, wenn Matteo ihr dabei half, die schwere Kirchentür zu öffnen, ihre Berufskleidung.
Wie bei allen ländlichen Traditionen wurde ein Jagdtag, wie es sich gehörte, mit der Aufteilung der Beute beschlossen.
Don Cossu wusste, wie man Hasen zerlegte, der einfache Carabiniere Piras Rebhühner, und Maresciallo De Stefani, der nicht mal eine einfache Drossel vor die Flinte bekam, Wildschweine. Jedenfalls behauptete er das, um die Tatsache zu verschleiern, dass er wieder keinen einzigen Schuss abgegeben hatte.
»Es war kein einziges zu sehen, zum Henker«, sagte er zu Signorina Matilde, die mit der pattadesìna gerade einem Hasen das Fell über die Ohren zog, den sie Matteo später für die Mutter zum Abendessen mitgeben wollte.
»Jetzt ist gerade nicht die richtige Jahreszeit«, tröstete ihn die Signorina.
»Tja … dann warten wir eben bis zum Winter. Dann möchte ich ein deftiges Wildschweinragout essen, wie das, was Sie im März gekocht haben. Aber dieses Mal sorge ich für die Hauptzutat.«
Es war bereits die dritte Jagdsaison, in der er das versprach.
Tatsache war, dass die Wildbrände die Weidegründe der is sirbònis, der Wildschweine, immer weiter nach Norden verlagert hatten, und um einem über den Weg zu laufen, hätten sie fast einen ganzen Tag marschieren müssen. Außerdem hätten sie stehendes Gewässer finden, den Wildwechsel mit Eicheln und Trockenfrüchten präparieren, das Tier auf eine Fährte locken und sich gegen den Wind auf einer Eiche verstecken müssen, um vor der Wut eines angeschossenen Tiers geschützt zu sein, sie hätten die Nacht abwarten und eine Taschenlampe auf dem Gewehr befestigen müssen und vor der Jagd drei Tage lang auf keinen Fall Zahnpasta, Deodorant oder Seife benützen dürfen.
Letzteres konnte sich bestenfalls Antoni Esulògu leisten, der seit seiner Geburt in seiner Kate wohnte, aber sicher nicht ein Hüter der öffentlichen Ordnung oder ein Priester.
Dafür waren sie die einzigen Jäger, die keine Hunde einsetzten, und dafür bewunderte Matteo sie sehr.
Das Wildschwein ist wie ein Gebet. Mit Hunden ist es ein Rosenkranz. Ohne Hunde ein Te Deum. Und ohne Hunde, nachts und ohne Jagdschein, ein Hosianna.
So lautete mehr oder weniger das Incipit zu dem Text in dem schwarzen Heft mit rotem Rand, dem er den Arbeitstitel Die Theologie des Wildschweins (nach Cossu Don Egisto) gegeben hatte.
Ein einmaliges Werk in Tagebuchform, das den Pfarrer zu anderen Zeiten auf den Scheiterhaufen gebracht hätte.
Aber so war er eben.
Eine Mischung aus Instinkt und Intelligenz. Und auf seine Art versuchte er, es dem Jäger bei seinem Handwerk so schwer wie möglich zu machen.
Wenn es nach Don Cossu gegangen wäre, hätte man mit Pfeil und Bogen gejagt oder bestenfalls mit einer Armbrust, aber als er sich darin versuchte, machten sich die Leute im Dorf über ihn lustig und gaben ihm den Spitznamen »Robin«, was ihn sehr aufbrachte.
Dottore Pòddighe hatte ihn danach wieder zum Gewehr überredet, und Don Cossu wandte sich ohne Reue von seiner These ab und jagte einem Vierzig-Kilo-Schwein ohne fremde Hilfe eine Kugel in den Körper. Eine ganze Woche lang taten sich Matteo, seine Familie, die Signorina Matilde und Dottore Pòddighe an dem Fleisch gütlich und aßen gegrilltes Wildschwein, Wildschwein mit Soße, Wildschweinragout, mit weißen Bohnen, mit Saubohnen, mit Pasta, Gemüse, Erbsen und Essig, bis es ihnen zu den Ohren rauskam.
Don Cossu besaß zwar eine Gefriertruhe, aber er musste trotzdem ein bisschen was von seinem Wildschwein an alte Frauen verschenken, die von ihrer mageren Kriegsrente lebten, denn die Truhe erwies sich als zu klein.
Hätte er eine größere besessen, hätte Matteo sich über seine Großzügigkeit sehr gewundert, denn er kannte die tiefe Zuneigung, die Don Cossu gegenüber diesem Wildtier hegte, nur zu gut.
Die einzige Metzgerei am Ort hatte Don Cossu nur ein einziges Mal betreten.
Aber das erzählte er niemandem, nicht einmal der Signorina Matilde.
Auch im Sommer ist es schön, ein Feuer prasseln zu hören, darüber ein Spieß, und zwar bestiù de sirbòni, »von Wildschwein umkleidet«.
Mit der Hilfe von Carabiniere Piras hatte Don Cossu im Innenhof des Pfarrhauses, in unmittelbarer Nähe des uralten Feigenbaums, der dort den einzigen Schatten spendete und das Feuer vor dem Mistral schützte, einen kuppelförmigen Ofen errichtet, und zwar um Brot zu backen, pàrdulas und amaretti, um culurgiónes zu braten und ein fettes Wildschwein zu »opfern«.
Genauso drückte er sich aus: »opfern«.
Am Abend des 21. Juli 1969, jenem Tag, der schon bei Tagesanbruch ganz im Zeichen der ersten Mondlandung stand, erlaubte Don Cossu auch Matteo bis spätnachts aufzubleiben, und gestattete ihm sogar zwei Gläser Cannonau. Matteo hörte, wie er sich zusammen mit Carabiniere Piras und Dottore Pòddighe unter dem verlegenen Kichern Signorina Matildes über den Maresciallo De Stefani lustig machte.
»Der ist viel zu groß für das Leben hier«, fing Don Cossu an.
»Klar, dass er nichts schießt. Bei seinem Anblick fliegen sogar die Turteltauben weg«, legte Piras nach.
»Aber wie groß ist er denn? Bestimmt ein Meter achtzig«, sagte Signorina Matilde.
»Nein, nein, größer … der passt nicht mal richtig in den Jeep«, fuhr Piras lachend fort.
»Largària o artària nudda di fàidi. Sa tontèsa est piemontesa! Ob groß oder klein, das ist egal. Seine Dummheit ist typisch fürs Piemont«, witzelte Dottore Pòddighe, der sich mit der ersten Flasche Cannonau etwas Gemeinheit angetrunken hatte.
In seinen Worten äußerten sich Groll und Häme gegenüber der Herrschaft des Piemont, der piemontesischen Behäbigkeit, der Zerstörung jahrhundertealter Wälder und der gewaltsamen Unterdrückung jeglicher Unabhängigkeitsbestrebungen. In den Augen Don Cossus waren alle Piemontesen nach wie vor Savoyer, was kümmerte es ihn, dass seit der Gründung des italienischen Nationalstaats bereits hundert Jahre vergangen waren: Savoyer waren sie, und Savoyer blieben sie.
»Für die stinken wir nach Schaf, und wir halten sie unsererseits für Idioten, für den Inbegriff von Blödheit. Und der Maresciallo kommt hierher und meint, er kann uns seine vorgefertigte Meinungen um die Ohren hauen? Soll er mit seiner Flinte mal gelegentlich ein Wildschwein treffen … für wen hält der sich eigentlich?«, ereiferte sich Don Cossu, auch er vom Cannonau beflügelt.
Sein Zorn verwandelte sich aber schnell wieder in Belustigung, als er perfekt »die falsche Höflichkeit« im piemontesischen Akzent des Maresciallos mimte, wenn dieser ihm Informationen zu Entführten oder Banditen zu entlocken versuchte.
»Den Tag oder die Uhrzeit will ich gar nicht wissen, nur die Woche. Ich und meine Männer legen uns dann auf die Lauer, und niemand wird Sie verdächtigen«, flehte ihn der Maresciallo an.
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts weiß, und wenn ich etwas wüsste, wäre es meine oberste Pflicht als Hüter meiner Herde, den Sünder davon zu überzeugen, sich in die Hände eines irdischen Gerichts zu begeben.«
»Genau … wer hofft, wird selig!«
»Maresciallo … Sie sind jetzt schon seit Jahren auf dieser Insel und haben immer noch nicht begriffen, dass bereits mindestens ein Monat ins Land gegangen ist, bevor eine Familie eine Entführung zur Anzeige bringt? Vielleicht ist sogar schon das Lösegeld überwiesen worden. Wahrscheinlich ist der Ärmste schon gar nicht mehr am Leben und ruht fünf Meter unter der Erde, und die Familie erstattet nur Anzeige, weil sie darauf hofft, dass man den Leichnam findet und sie nicht bis in alle Ewigkeit auf den Totenschein warten muss, um das Erbe unter sich aufzuteilen. Lassen Sie’s, Maresciallo, Sie sind dazu verdammt, bis zu Ihrer Pensionierung an diesem Ort zu bleiben, wer weiß, vielleicht heiraten Sie ja sogar eine Einheimische.«
»Eine Ehefrau von hier, nun wirklich nicht, Don Cossu! Aber wie kommen Sie darauf? Warum, gäbe es denn eine Frau zum Heiraten?«
»Naja, Maresciallo, Sie sind eine Attraktion. Sie wissen schon, die Faszination des Fremden …«
»Ach, wirklich? Sie machen Witze. Die Frauen hier verlassen doch höchstens mal zu Sankt Anton das Haus und wenn es hoch kommt vielleicht noch zu Mariä Himmelfahrt. Hat man in diesem Dorf überhaupt schon mal eine Frau auf der Straße gesehen?«
»Aber die Frauen kommen am Samstagabend, wenn Sie im Dienst sind, zur Beichte in die Kirche, Maresciallo. Sie kommen zu mir und schütten ihr Herz aus … und wie sie ihr Herz ausschütten.«
»Und was sagen sie so? Reden sie etwa über mich?«
»Wenn ich es Ihnen doch sage … was sie wohl an Ihnen finden! Vielleicht ist es Ihr Schnurrbart oder Ihre Bezüge als Staatsdiener, aber machen Sie sich keine falschen Vorstellungen, Maresciallo!«
»Sie machen sich lustig über mich!«
»Genug! Ich habe Ihnen schon viel zu viel verraten. Aber ich habe ein ruhiges Gewissen, denn Namen habe ich nicht genannt. Aber sagen Sie mir doch, welche Ihnen gefallen könnte, und wir verbandeln Sie mit einer Einheimischen, so wird Ihnen alles begreiflich, und Sie können sich Ihre Fragerei sparen.«
Und schon folgte eine Liste mit Namen von Frauen, von denen Don Cossu wusste, dass sie bereits Banditen versprochen waren, die überhaupt kein Problem damit gehabt hätten, einem Carabiniere einen ordentlichen Schrecken einzujagen, noch dazu, wenn dieser aus dem Piemont stammte.
Darauf kehrte De Stefani wohlgemut in die Polizeikaserne zurück und verzichtete ein paar Tage lang darauf, Fragen zu stellen.
Alle lachten aus vollem Halse, aber später, vor dem Einschlafen, fiel Matteo der melancholische Blick von Signorina Matilde wieder ein. Er hatte bereits den Verdacht gehabt, dass sie heimlich in den Maresciallo verliebt war, jetzt war er davon überzeugt.
Im Halbschlaf grübelte er über Don Cossus bemerkenswerten Mangel an Einfühlungsvermögen nach.
Er war Jesuit und ging mit der Wahrheit auf seine eigene Weise um. Sollten die anderen ruhig das verstehen, was ihm selbst am bequemsten war; und schlechte Nachrichten überbrachte er gerne mit einem Scherz und einem Lächeln auf den Lippen.
Und doch kam es Matteo komisch vor, dass Don Cossu nicht begriff, dass seine Schwester an Jagdtagen nicht am Fenster stand, um ihm nachzuwinken, sondern sehr wahrscheinlich, um den Maresciallo zu sehen.
Aber eigentlich waren diese Gedanken zu kompliziert für einen Jungen seines Alters, auch wenn Matteo schon sehr reif war. Und so gab er sich dem Schlaf unter dem Feigenbaum hin, denn es war Sommer und ein Sonntag, und der Cannonau wiegte ihn in eine glückselige Benommenheit.
Aus der Ferne drangen die letzten Lachsalven von Carabiniere Piras an sein Ohr und riefen in ihm ein Dilemma wach, das ihn seit einiger Zeit umtrieb: lieber die Jesuiten oder doch die Salesianer?
III
Càstia su mortu e pentza a su pappòngiuSchau dir den Toten an und denk ans Essen
Don Cossu, man hat die Leiche gefunden, wachen Sie auf, Don Co’… ssssss!«
»Wo? Wie spät ist es denn? Was machst du denn hier, Jache’? Kein Wein mehr da, Jache’… Wein ist alle.«
»Man hat ihn an einem Ort gefunden, wo ihn keiner vermutet hätte. In Cort’e Porcus, beim Schafstall von Antoni Esulògu. Kommen Sie mit, Don Cossu, der Maresciallo braucht Sie für eine offizielle Identifizierung.«
»Was … das darf nicht wahr sein! Warte hier auf mich, Jache’, ich komme gleich, nein, besser du rufst sofort Dottore Pòddighe.«
»Hab ich schon versucht, ist aber besser, ich lasse es, der kotzt immer noch.«
»Madonna ’e Gonare, wie viel Wein haben wir gestern Abend eigentlich getrunken? Und dir geht es gut?«
»Es geht so, Don Cossu, ich hatte mich gerade hingelegt, da hat der Maresciallo mich wieder aus dem Bett geholt.«
»Um diese Uhrzeit? Um fünf Uhr morgens? Wer hat ihn eigentlich gefunden?«
»Keine Ahnung, Don Co. Mir geht es auch nicht so gut.«
»Um diese Uhrzeit, um fünf … wer könnte das nur gewesen sein?«
Giacomo Piras, auch Jacheddu genannt, seit einigen Tagen offiziell Carabiniere im untersten Dienstrang, hatte an jenem Morgen das Pfarrhaus ohne Anklopfen betreten. Er wusste, dass Don Cossu ab Mitte Juni die Eingangstür immer halboffen stehen ließ, damit der Durchzug wenigstens für eine Andeutung von Kühle sorgte. In jenem Juli 1969 herrschte eine geradezu höllische Hitze, der Mistral verwandelte sich jede Nacht in Schirokko, und selbst auf dem Friedhof suchte man vergeblich nach Seelenruhe.
Die Nacht hatte der Pfarrer auf einem Feldbett verbracht, eine freundliche Gabe des Maresciallo. Im Unterhemd und das Gewand bis zum Gürtel geöffnet, hatte er in dem Durchgang zwischen der Tür zur Wohnung und der Tür zum Kirchhof geschlafen, wo Matteo und die Signorina Matilde immer noch auf zwei Liegen unter dem Feigenbaum schlummerten, denn ihnen taten die Mücken nichts.
Er brauchte eine Weile, bis er sich auf den Beinen halten und sich das Gesicht waschen konnte. Dann setzte er den Krug mit Quellwasser, den er immer unter der Küchenspüle stehen hatte, an die Lippen und ließ das Wasser die Kehle hinunterrinnen, ohne auch nur einmal Luft zu holen.
Das meiste lief daneben und über sein Gewand, aber wie man weiß, lassen sich die Folgen des Cannonau eben nicht so leicht vertreiben.
Darauf ging er, immer noch barfuß, zur Signorina Matilde, die wie immer um diese Uhrzeit aufgewacht war, und führte sie in die Küche, wo er ihr flüsternd das Vorgefallene erklärte.
»Hör gut zu, Matilde … sag nichts zu Matteo, behalte ihn hier, heute ist Dienstag und keine Andacht. Sag ihm, er soll an dem Geburten- und Sterberegister weiterarbeiten, er weiß, was er zu tun hat. Kein Wort … schhhh … ich möchte erst sicher sein, dass es wirklich er ist.«
»Aber was ist denn passiert?«
»Man hat seinen Vater gefunden, Matilde … in den Bergen bei Cort’e Porcus.«
»Tot?«
»Nein, Matilde, wie im Karneval als Hamlet verkleidet … was glaubst du, wie man ihn gefunden hat?«
»So nah am Dorf? Der arme Junge, seine arme Mama. Aber dir geht’s nicht so gut, sehe ich.«
»Ich hole mir kalten Kaffee aus dem Kühlschrank. Sei ganz leise und lass den Jungen schlafen. Du hast nichts gesehen und gehört und schweigst wie ein Grab, hörst du?«
Carabiniere Piras, der sich in der Zwischenzeit dazugesellt hatte, nickte. Während Don Cossu ein paar Schluck von dem kalten Kaffee trank, trat Signorina Matilde zu Piras und fragte: »Stimmt das? Wer hat euch gerufen, Jacheddu?«
»Keine Ahnung, Signorina Matilde. Ich war um drei zurück in der Polizeikaserne. Der Maresciallo war nicht da, sein Jeep auch nicht. Ich dachte, vielleicht ist er allein auf die Jagd gegangen.«
»An einem Dienstag? Das ist doch verboten, und noch dazu bei dieser Hitze … Vielleicht wollte er die Gegend nach Anzeichen von Brandstiftung absuchen, morgen bläst der Mistral … schau dir nur den Himmel an. Seitdem der Mensch auf dem Mond war, fìncias e su témpus s’esti ammacchiàu.«
»Was hat dieses verrückte Wetter mit der Mondlandung zu tun, Matilde, ma po praxéri!«, platzte es aus Don Cossu heraus.
»Aber das kann schon sein. Außerdem schläft auch der Maresciallo so gut wie nicht bei dieser Hitze, und er war auch schon letzte Nacht wegen der Mondlandung wach, und der Mistral ist auch nicht mehr …«, seufzte Jacheddu, aber er wurde von Don Cossu unterbrochen: »Aiò, Jacheddu, jetzt fängst du auch noch mit diesen chicchionate, diesem Unsinn an, auf geht’s! Und du, Matilde, hältst deinen Mund, hörst du?«
Im Morgengrauen des 22. Juli 1969 durchquerten Carabiniere Piras Giacomo, auch Jacheddu genannt, und Cossu Don Egisto, auch Don Co’ genannt und seit dreizehn Jahren Pfarrer der Gemeinde Telévras, keuchend das Dorf und verwünschten den Cannonau von Tore Baccanti, den steilen Anstieg über Kopfsteinpflaster, auf dem man sogar an Ferragosto, am 15. August, leicht ausrutschte, und überhaupt den Höhenunterschied zwischen Pfarrhaus und Polizeikaserne, Ersteres lag auf 600 Meter, Letztere auf 800 Meter über dem Meeresspiegel. Das alles in diesem von Gott und dem Teufel vergessenen Dorf, das aussah, als hätte ein Alpinist es entworfen, der genauso besoffen gewesen war wie sie beide an jenem Morgen. Sie marschierten vor sich hin, ohne einen Gedanken an den Leichnam von Bachisio Trudìnu zu verschwenden oder daran, wie Matteo sich wohl fühlen würde, wenn sie ihm alles erzählt hatten, oder daran, dass sie nicht einmal ein Auto besaßen, um schneller voranzukommen, und dass man sich auch um die Familie kümmern musste.
Sie verwünschten und überlegten alles Mögliche, aber sie fragten sich nicht, wie es dem Leichnam von Bachisio Trudìnu eigentlich gelungen war, sich derart leicht auffinden zu lassen, was in der Folge einen gerade mal zwölfjährigen Jungen in Verzweiflung stürzen und offiziell eine weitere Ehefrau zur Witwe erklären würde, schon die zweiundzwanzigste in einem Dorf, in dem es ohnehin mehr Witwen als Ehemänner gab.
Als sie bei der Polizeikaserne eintrafen, wartete bereits der Jeep mit laufendem Motor, an einem Hinterrad einen Dreißig-Kilo-Felsbrocken, der als Handbremse fungierte, und sie hörten den Maresciallo De Stefani vom Dach aus rufen: »Ich komme sofort, Don Cossu. Piras, eine Sekunde, hol mir meine Maschinenpistole.«
Nach einer durchzechten Nacht mit Cannonau war es eine wahre Heldentat, den Kopf in den Nacken zu legen und den Blick nach oben zu richten. Der Brauch wollte es eigentlich, dass man sich auf den Bauch bettete und den Kopf auf den Zipfel eines Kissens niederlegte, das wenn möglich mit Drossel- oder Amselfedern gestopft war, und aus dieser Position richtete man dann den Blick nach Osten, von wo an manchen Tagen eine frische Meeresbrise angeweht kam.
Das galt natürlich nur, wenn man den Mistral im Rücken und den Ostwind im Gesicht hatte. Die Leute in Alghero oder Oristano hatten da wirklich Pech, pflegte Don Cossu zu sagen und erheiterte damit Matteo und Dottore Pòddighe, denn diesen armen Bewohnern blies der Mistral auch im Sommer mit achtzig Stundenkilometern mitten ins Gesicht, und die Frisur sah immer aus wie streng nach hinten gebürstet.
Aber Don Cossu hatte an jenem Morgen keine Lust, den Helden zu spielen, öffnete, um den Maresciallo auf dem Dach zu sehen, die Fahrertür und streckte sich behelfsmäßig auf den beiden Vordersitzen aus.
So hatte er De Stefani gerade so im Blick, wie er mit seinem Dienstfernglas den Horizont absuchte, ein Verb, das er sehr gerne verwendete. Doch dann zwang Don Cossu ein unwiderstehlicher und plötzlicher Brechreiz aus seiner liegenden Position.
Carabiniere Piras kotzte ebenfalls eine Runde, denn Brechreiz ist fast so ansteckend wie Gähnen, und betete zum Himmel, dass der Maresciallo nicht von der nächtlichen Zecherei erfahren würde, die ohne ihn stattgefunden hatte.
Signorina Matilde hatte wie so oft richtig gelegen.