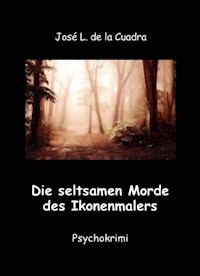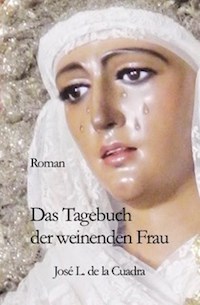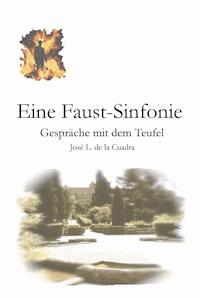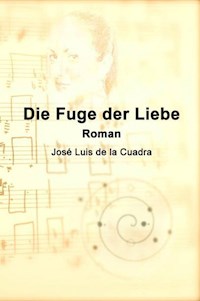
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Schweizer Arzt Josch Vonstahl begibt sich auf eine Urlaubsreise nach Berlin. Er will seinen früheren Klavierlehrer und Freund, den renommierten Musikpädagogen und Nachfahren Robert Schumanns, Professor Siegfried Gottesmann, besuchen. Bereits während der Bahnreise erfährt Vonstahl vom unerwarteten Tod Gottesmanns, zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum zweihundertsten Geburtstag Schumanns. Ohne zu zögern beschliesst der Arzt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und reist von Berlin nach Zwickau weiter. Dort erfährt er an einem Konzert, dass der verstorbene Professor an der Tonfolge einer verschollen geglaubten Fuge Schumanns gearbeitet hat, an einer Klangschöpfung des Komponisten aus der Zeit seiner letzten zwei Lebensjahre in der Irrenanstalt Endenich bei Bonn. Während des Konzerts steckt ihm eine junge Frau einen Zettel mit einer rätselhaften Notenschrift zu. Er erkennt in der Gestalt flüchtig die Enkelin des verstorbenen Musikprofessors. Als er realisiert, dass nicht nur die bezaubernde Enkelin, sondern auch zwei zwielichtige Agenten eines renommierten Notenverlags und schliesslich sogar das Kriminalkommissariat Berlin Mitte hinter der Fuge her sind, befindet er sich bereits in einem Strudel seltsamster Ereignisse, die ihn in eine Welt aussergewöhnlicher Erfahrungen und schliesslich an den Rand des Wahnsinns treiben. Zu spät kommt er zur Einsicht, dass er die Liebe nicht in der Wirklichkeit sondern nur in der eigenen Wahrheit finden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Handlung
Der junge Schweizer Arzt Josch Vonstahl begibt sich auf eine Urlaubsreise nach Berlin. Er will seinen früheren Klavierlehrer und Freund, den renommierten Musikpädagogen Professor Siegfried Gottesmann besuchen. Bereits während der Bahnreise erfährt Vonstahl vom unerwarteten Tod Gottesmanns, zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum zweihundertsten Geburtstag Schumanns. Ohne zu zögern beschliesst der Arzt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und reist von Berlin nach Zwickau weiter. Dort erfährt er an einem Konzert, dass der verstorbene Professor an der Tonfolge einer verschollen geglaubten Fuge Schumanns gearbeitet hat, an einer Klangschöpfung des Komponisten aus der Zeit seiner Internierung in der Irrenanstalt Endenich bei Bonn. Während des Konzerts steckt ihm eine junge Frau einen Zettel mit einer rätselhaften Notenschrift zu. Er erkennt in der Gestalt flüchtig die Enkelin des verstorbenen Musikprofessors. Zurück in Berlin informiert er sich über Schumanns Aufenthalt in der Nervenheilanstalt. Die Lektüre der Dokumente aus der damaligen Zeit und die erneute Begegnung mit der Enkelin beflügeln den Arzt, sich auf die Suche nach der Fuge zu begeben. Als er realisiert, dass nicht nur die bezaubernde Enkelin, sondern auch zwei zwielichtige Agenten eines renommierten Notenverlags und schliesslich sogar das Kriminalkommissariat Berlin Mitte hinter der Fuge her sind, befindet er sich bereits in einem Strudel verwirrender Ereignisse, die ihn in eine Welt aussergewöhnlicher Erfahrungen und schliesslich an den Rand des Wahnsinns treiben werden.
Zum Autor
J.L. de la Cuadra wurde 1948 in Bern, Schweiz, geboren. Nach einer missglückten Ausbildung zum Konzertpianisten in Paris entschied er sich als zweite Berufswahl zu einem Studium in Humanmedizin. Er doktorierte in Psychiatrie und betrieb eine internistisch-hämatologische Arztpraxis in Bern. Seine Liebe zur Musik ist ihm erhalten geblieben.
Die Fuge der Liebe
Roman
Für Cristina
Impressum
Fuge der Liebe
José Luis de la Cuadra
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2014 José Luis de la Cuadra
ISBN 978-3-8442-9654-9
Teil 1
Düsseldorf, 27. Februar 1854
Es regnet in Strömen. Der Mann irrt wankenden Schrittes durch die Gassen. Er ist durchnässt. Die Regentropfen perlen über sein verzerrtes Gesicht. Der Wind bläht das lose Hemd. Eine schäbige Hose klebt wie Pappe an den stolpernden Beinen. Er trägt Hausschuhe. Sie klatschen und spritzen in den Pfützen. Unbeirrt humpelt der Mann seinem Ziel entgegen, das Gesicht entstellt. Speichelfäden rinnen über seine aufgeschwollenen Lippen. Der Ausdruck seiner Züge verrät Wahnsinn. In seinem Kopf dröhnt Lärm. Irre Klänge, quälende Gesänge, tosende Orchester. Dazwischen Engelsstimmen, die in seinem Innern eine unwiderstehliche Sehnsucht auslösen. Todessehnsucht.
Es muss sein. Welche Freude, seiner Verzweiflung zu entkommen, von seinem unerträglichen Leben erlöst zu werden! Welch ein erbauliches Gefühl, alles zurück zu lassen und den unheimlichen Stimmen zu entrinnen, die ihn verfolgen, sein Gehirn zermartern und seine Kompositionen zerstören!
Sinnestäuschungen bedrohen ihn und seine Familie, seine Kinder, seine Frau. Sie ist die Botschafterin seines Schaffens, die Frau, die ihn über die Landesgrenzen hinaus berühmt gemacht hat, eine begabte Pianistin, die seine Werke versteht. Er muss sie verlassen, trotz der Liebe, die er für sie empfindet. Oder gerade deshalb. Seine Gewaltausbrüche sind Bedrohung und Schande, und ... sie will ihn nicht mehr.
In der vorigen Nacht hat ihm ein Engel eine wundervolle Melodie überbracht, ein Thema, weich im Ton und lieblich im Klang. Es war ein entrückender Augenblick. Der sanfte Engel rührte ihn zu Tränen. Er musste die Tonfolge sofort festhalten und Variationen darüber schreiben, das Werk zur Vollkommenheit bringen.
Und dann, mitten in seinem Schaffen übermächtige Dämonen. Sie befahlen ihm, sein Leben zu beenden.
Welche Erniedrigung, welche Demütigung für den grossen Komponisten und viel bewunderten Musiker! Es ist das Ende. Sein Schädel ist übervoll, er schmerzt und droht zu bersten. Schwindelanfälle brechen seine Würde. Unerträgliches Schwirren, Durcheinander von Lärm und Wohlklang. Ueberwältigende Sehnsucht nach Erlösung. Es muss sein.
Der Wind erhebt sich zum Sturm. Der Regen trommelt wild. Heftige Donnerschläge bringen die Luft zum Beben. Es ist Nacht. Passanten blicken erstaunt auf die merkwürdige Gestalt, die zu sich selber spricht und plötzlich schreit und krächzt. Niemand erkennt den Mann. Er hält seinen linken Arm schützend vor sein schmerzverzerrtes Gesicht. Die wenigen Strassenlaternen werfen nur wenig Licht und spiegeln sich in den Pfützen. Der Mann ist geblendet, er sieht Blitze. Wo ist die Brücke, die ihn zum Ende dieses Albtraums führen wird?
Sein Schritt verlangsamt sich. Der Regen peitscht das Wasser wie Nadeln in die Augen. Durch das Blinzeln seiner Lider hindurch kann er in der Ferne knapp die Schiffsbrücke über den Rhein erkennen. Oder ist es wieder eine Sinnestäuschung? Er kennt die Wirklichkeit nicht mehr. Sein Leben scheint sich aufzulösen. Alles fliesst übereinander und ineinander. Die Melodien seiner Kompositionen vernetzen und verkeilen sich. Sie wachsen zu bedrohlichen Klangkörpern. Die Musik teilt sich in Fragmente. Er erkennt sein eigenes Schaffen nicht mehr, ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Fremde Stimmen treiben ihn voran. Sie rauben seinen Willen und geben Befehle.
Noch letzte Woche hat er sich mit dem Verlagshaus H. und B. über den Preis seiner letzten Klavierstücke geeinigt. Sie sollen gedruckt werden. Seine liebe Frau hat die Kompositionen bereits seinen Freunden vorgetragen. Man war sich einig, dass hier etwas Neues und Einzigartiges entstanden war. Und nun? Abschied nehmen, alles zurücklassen. Ein verkrampfter Schrei entweicht seiner Kehle und löst einen kräftigen Schüttelanfall aus. Der Mann stürzt beinahe. Passanten wollen ihm helfen. Er wehrt ab. Nur weiter. Noch bis zur Brücke.
„Helft mir, Dämonen, die ihr mein Ende verlangt! Ich bin euer gehorsamer Diener. Ich bin auf dem Weg, meine Pflicht zu erfüllen.“
Wildes Rauschen vom nahenden Rhein vermischt sich mit der dröhnenden Musik in seinem Kopf. Die Erlösung naht. Der Mann steht nun vor dem Zollbeamten der Schiffsbrücke. Er hält inne.
Plötzliche Ruhe. Die Engelsmelodie bahnt sich ihren Weg. Verzückung. Das Thema, verführerisch und unwiderstehlich! Seine Frau hat es als wundervoll rührend und fromm empfunden. Sie versteht ihn, kann bis tief in seine Seele blicken und glaubt an ihn. Aber sie hat nur Zugang zum Guten. Wie kann sie wissen, was in seinem Inneren geschieht? Er kann es selbst nicht verstehen. Alle diese fremden Kräfte, die in ihn eindringen und seine heile Welt bedrohen! Immerzu fordernd, quengelnd, drängend. Er hat lange gegen sie angekämpft. Er wollte sie verbannen, wieder zurückfinden zu seinem früheren Leben. Aber sie waren übermächtig. Sie gebärdeten sich wie klebrige Kreaturen, liessen sich nicht mehr abschütteln. Sie drängten sich in seine Träume, krallten sich an sein Bewusstsein. Und wehe, er gehorchte nicht. Sofort bestraften sie ihn mit einem Schüttelanfall. Dann quoll das Böse in Form wilder Schreie aus seiner Kehle. Es muss ein Ende haben!
Der Zollbeamte fuchtelt mit den Armen. Was will er? Geld? Der Mann hat kein Geld, nicht eine Münze. Soll er für seine tödliche Mission bezahlen? Das Engelsthema drängt ihn vorwärts. Es will ihn seiner Erlösung zuführen. So soll es sein. Er winkt dem Zollbeamten mit einem weissen Taschentuch zu, wie zum Gruss, zum Abschiedsgruss, und dann betritt er die in den Wellen tanzende Schiffsbrücke.
Die Fischer, die am Rand des Rheins bei ihren Booten stehen, staunen ob dem eigenartigen Geschehen. Was will der Mann zu dieser späten Zeit auf der Schiffsbrücke? Sie wird bald geöffnet, um ein Schiff passieren zu lassen.
Der Zollbeamte steht an seinem Wachposten und fuchtelt unaufhörlich mit den Armen, als wollte er die guten Geister zu Hilfe rufen. Und überhaupt, ist das nicht ... ? Nein, das kann nicht sein! Und doch gibt es kaum einen Zweifel, dass dort der Kompositeur von der Bilkerstrasse auf der Schiffsbrücke dahintorkelt. Herrje, er springt in die reissenden Fluten!
Schnell ergreifen die Fischer einen Kahn und schieben ihn mit kräftiger Wucht in den Rhein. Gegen Wind und Wellen ankämpfend nähern sich die Männer der Stelle, wo der Mann gesprungen ist. Im Lichtschein eines Blitzes erkennen sie den Schopf des Unglücklichen, der von Wasser umspült wird. Mit ihren Armen fassen sie den Ertrinkenden und hieven ihn in den Kahn. Er wehrt sich, will nicht geborgen werden. Er flucht und schreit, beschimpft sie auf die übelste Weise. Nennt sie Teufel und Gesandte der Hölle. Er speit und spuckt, versetzt ihnen wilde Schläge.
Schon versucht er wieder, sich in die reissenden Fluten zu stürzen. Die Fischer packen zu und halten ihn fest. Er gebärdet sich wie ein Ungeheuer, wie ein wütender Krake. Sein Gesicht ist zur Fratze entstellt, der Atem stockt. Er spricht wirres Zeug. Beginnt plötzlich zu zittern. Seine Glieder versteifen sich, Schaum quillt aus seinem Mund. Nach heftigen Zuckungen tritt unerwartet eine seltsame Ruhe ein, gefolgt von Stöhnen. Der Körper erschlafft.
Der Kahn fährt ans Ufer. Die Fischer tragen den Mann an Land und legen ihn auf eine Wiese am Rand des Flusses. Eine riesige Menschenmenge hat sich inzwischen um den Brückenkopf herum gesammelt. Ein Raunen erfüllt die Nacht. Man munkelt und flüstert. Ja, es ist der geschätzte und verehrte Meister. Was ist aus ihm geworden? Man hat ihn lange nicht gesehen und es wurde berichtet, dass er seit Längerem an Hörstörungen litt, gewalttätig war, zu viel trank, seine Frau zur Verzweiflung brachte. Es soll einen riesigen Ehekrach gegeben haben.
Schon regt sich der Mann wieder und beginnt zu schimpfen. Die Fischer stürzen sich erneut auf ihn, stellen ihn auf die Beine und packen ihn von allen Seiten. Er darf nicht entwischen. Er gehört nach Hause zu Frau und Kinder. Sie müssen sich schrecklich sorgen und bestimmt suchen sie ihn. Welche Schande für die angesehene Familie!
Und so setzt sich der Menschenzug in Gang. Zuvorderst der verwilderte Mann, gehalten und geführt durch die Fischer, gefolgt von der teils entsetzten, teils belustigten Masse des Volkes. Die Szene hat etwas Unwirkliches an sich.
Der Regen hat aufgehört. Eine frische Brise schleicht sich durch die Gassen. Der Mond bahnt sich einen Weg durch die sich teilenden Wolken. Es herrscht eine eigenartige Ruhe. Gespenstischer Friede. Das Raunen der Stimmen und die regelmässigen Schritte des Menschentrosses belegen die Gassen Düsseldorfs mit einer sanften Rhythmik.
Der Mann hat sich beruhigt und folgt willig den Anordnungen seiner Retter. Er fügt sich in das Unausweichliche, leise zitternd. Die Scham ist ihm ins Gesicht geschrieben. Jetzt sind es Tränen, die zu Boden kullern. Tränen der Resignation und des Schmerzes. Er hat die Treue zu seiner Frau verraten. Vor dem Sprung ins Wasser hat er seinen Ehering in die tosenden Fluten geworfen. Eine schändliche Tat. Ein Akt der Vergeltung angesichts der Zurückweisungen seiner Frau. Sie würde sofort merken, dass der Ring an seinem Finger fehlt. Ein stechender Schmerz durchfährt seinen Körper. Er knickt ein und schwankt so heftig, dass seine Begleiter fürchten, er könnte wieder davonlaufen. Sie halten ihn mit aller Kraft fest.
Nein, nicht weiterhin diese Qualen durchleben! Nicht nochmals die Schande des Scheiterns. Es muss einen anderen Weg geben, um Frau und Kinder zu schützen. Die bösen Geister verlangen Gewalt von ihm. Er will das nicht. Ein schrecklicher Kampf.
Der Engel hat ihm das liebliche Thema geschenkt, als wollte er ihn beruhigen und friedlich stimmen. Er war bereits an der Reinschrift der Variationen, als ihn plötzlich diese Todessehnsucht überfiel.
Jetzt muss zu Ende geführt werden, was ihm der Engel aufgetragen hat. Er muss die Kraft seiner Musikschöpfung noch einmal spüren, das Thema weiter bearbeiten, es zur Fuge steigern. Ein krönendes Opus posthum. Eine Erinnerung an den grossen Komponisten! Ein Vermächtnis.
Ein Hauch von Glückseligkeit durchströmt ihn.
Er muss sich in eine Anstalt für Irre und Nervenkranke einweisen lassen. Dort kann er zur Ruhe kommen, seine Kompositionen zu neuem Leben erwecken. Sicher vor sich und seine Familie vor ihm. Was heute geschehen ist, ist mehr als eine Gehörsstörung, mehr als Sinnestäuschung, mehr als die unsägliche Melancholie, die ihn schon seit Jahren begleitet.
Er wird mit seinem Arzt, dem guten Dr. Haslebner sprechen und ihm vorschlagen, ihn einzuliefern. Wie oft hat er ihn schon darum gebeten! Aber seine Frau hat sich bisher dagegen gewehrt. Sie will ihn nicht loslassen, obwohl sie seiner überdrüssig ist, obwohl er ihren Ambitionen, ihrer Pianistenkarriere im Wege steht. Sie bangt um ihren Ruf. Die Ehe ist am Ende. Diesmal wollte er sich selbst richten, aber ein nächstes Mal könnte sich die Wut an ihr entladen. Das darf er nicht zulassen! Er muss in Sicherheit gebracht und weggesperrt werden. Für immer und ewig. Bis der Tod ihn befreit und sein Werk wieder in vollem Glanze erscheinen kann.
Hier steht der Mann nun vor seinem Heim. Der Volkstross ist angekommen und wartet gespannt auf die weiteren Ereignisse. Gestalten bewegen sich hinter den Jalousien der beleuchteten Zimmer. Die Türe öffnet sich und Dr. Haslebner schreitet dem Zurückgekehrten mit ernster Miene entgegen. Sorgenfalten und Entsetzen - oder ist es Mitleid? - in seinem Gesicht. Er drückt ihn an sich und führt ihn ins Haus. Retter und Meute bleiben zurück und beginnen sich wild gestikulierend zu entfernen.
Im Innern des Hauses legt Dr. Haslebner den erschöpften und durchnässten Musiker ins Bett. Ein Wärter wird neben ihm wachen. Seine Frau und seine Kinder werden nicht zu ihm gelassen, um ihn nicht weiter zu erregen. Sie sind ausgezogen und werden andernorts nächtigen. Welche Schande, welche Verachtung! Ist es die gerechte Strafe für sein Tun?
Die tiefe Nacht des Schlafes umarmt ihn.
Der Morgen beginnt friedlich. Der Mann liegt in Gedanken versunken im Bett, das Gesicht verklärt, die Augen geschlossen. Er hört die Schritte seines Wärters in der knarrenden Diele. Sie geben ihm Sicherheit, man bewacht ihn. Es wird leise geflüstert. Ein schmaler Sonnenstrahl drängt sich in die Stube und wärmt seine Stirne. In seinem Kopf erklingen süsse Klänge, dann verzerrte Melodien, wirr und ungeordnet. Erinnerungsfetzen spalten die Harmonien und durchmischen sich mit lauten Stimmen. Noten kreisen umher, entweichen in schwindelnde Höhen und senken sich in tiefe Abgründe. Rauschen bemächtigt sich seiner Ohren und steigert sich zur Unerträglichkeit. Heftige Aufregung, Angst, Verzweiflung. Dann Aufwallen von Gefühlen, Aufbäumen starker Emotionen.
Plötzlich erhebt sich ein riesiger Klangkörper und will ihn, gleich einem Strom, fortreissen. Das Engelsthema ergreift in gläserner Klarheit von ihm Besitz. Mit Tränen in den Augen und halb benommen setzt sich der Mann an die Bettkante und begibt sich zu seinem Schreibtisch. Er setzt sich vor die begonnene Reinschrift seiner Komposition und führt zu Ende, was er sich vorgenommen hat. Sein letztes Werk.
Nach der Vollendung der Notenschrift stellt sich eine unbeschreibliche Plastizität seines Bewusstseins ein. Es entsteht etwas Neues, noch nie Dagewesenes in seinem Innern. Die Engelsmusik entlockt ihm die höchsten Gefühle und eine tiefe Glückseligkeit. Nun sieht er es ganz klar: Es ist der Wahnsinn seiner Gedanken, der ihn zum Höhenflug seines Schaffens führt.
Wo steckt das Geheimnis? Ist es die Tonfolge dieses ihm vom Himmel gesandten Themas? Ist es die Spannung zwischen den Klängen? Oder ist es die Spreizung der Harmonien, die er plötzlich wahrzunehmen glaubt?
Und auf einmal liegt es auf der Hand, wohin ihn seine Verrücktheit führen wird und wo der Sinn seiner Seelenstörung verborgen ist. Seine Musik birgt eine okkulte Kraft, die sowohl zerstörerisch als auch schöpferisch wirkt. Er muss diesen gefährlichen Weg gehen und das Schöpferische über das Zerstörerische siegen lassen. Er muss die Tonfolge seines geliebten Themas zur Fuge weiterentwickeln, bis er die nötige Kraft und Macht erlangt, um die Dämonen dieser Welt zu zerstören. Und dazu braucht er die Ruhe und Geborgenheit einer Nervenanstalt. Das Irresein soll zum Triumph der Musik werden!
Der Drang zur Eile steigert sich plötzlich ins Unermessliche. Eine freudige Erregtheit überfällt den Mann. Er zeichnet die ins Reine geschriebenen Variationen mit einer Widmung an seine Frau, ruft den Wärter und bittet ihn, die Schrift möglichst rasch seiner Gattin zu überbringen. Er führt jetzt Höheres im Schilde. Er will seiner Frau wieder würdig sein. Er will ihre Liebe zurückerobern und ihr seine Liebe zurückgeben, die er ihr geraubt hat.
Der Musiker hat sich ermüdet und er legt sich hin. Er ist sich gewiss, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln werden. Es scheint, dass nun alles geregelt ist. Ruhe und Ordnung sind eingekehrt. Herrliche Musikklänge begleiten einen erholsamen Schlaf.
Pochen, wildes Pochen, krächzende Stimmen, verzerrte Bässe wecken den Mann. Er schreckt auf, schreit wild nach dem Wärter und verlangt nach Dr. Haslebner. In wenigen Minuten steht dieser vor ihm und muss eine Schimpftirade über sich ergehen lassen. Dabei versteht er kaum ein Wort des Erregten. Endlich begreift Dr. Haslebner, worum es geht. Der Kompositeur will unbedingt in eine Irrenanstalt eingewiesen werden. Und zwar möglichst unverzüglich, ohne Rücksichtnahme auf seine Familie. Er soll seine Frau benachrichtigen.
Schweren Herzens macht sich der Arzt und Freund der Familie auf, diesen schwierigen Auftrag zu erfüllen. Er nimmt seinen Patienten nochmals in die Arme, drückt ihn heftig an sich und verlässt das Haus mit feuchten Augen.
Es ist herrliches Wetter und die Sonne scheint warm, ein richtiger Vorfrühlingstag, als Dr. Haslebner mit einer Droschke vorfährt und sich mit zögerndem Schritt der Haustüre an der Bilkerstrasse nähert. Er hält inne, als müsste er sein Vorhaben nochmals überdenken. Er hat am Vortag mit seinem Freund und allseits gerühmten Nervenarzt Doktor Ferdinand Reichherz, dem Direktor der neulich eröffneten Privatheilanstalt in der Nähe von Bonn, gesprochen und ihm die bedauerliche Verschlechterung des Geisteszustandes seines Patienten geschildert. Dr. Reichherz hat viele Arbeiten über Hirnerweichung und „Paralysie générale“ verfasst und ist der Ueberzeugung, dem Musiker helfen zu können. Er will ihn in seiner Anstalt isolieren, von allen äusseren Einflüssen abschirmen und auch die Familie von ihm fernhalten, damit sein Geist wieder zur Ruhe kommt. Er wird sich zusammen mit seinem Assistenten Dr. Ulrich Sperreisen mit aller Kraft und von Herzen für den berühmten Patienten einsetzen. Die Frau des Komponisten ist in ihrer Verzweiflung in Panik ausgebrochen, als er ihr die konkreten Schritte erklärt hat. Es war eine seiner schwierigsten Handlungen in seinem Arztsein.
Nun muss er die Türe öffnen und das Unvermeidliche zu Ende führen. In der Hand trägt er einen Blumenstrauss, den ihm die Frau des Musikers übergeben hat. Ein Liebesgruss an ihren Gatten.
Die Türe öffnet sich von innen und der Mann steht vor ihm, erhobenen Hauptes, ohne Rock und in Hausschuhen. Sein Gesichtsausdruck ist verklärt. Den Blumenstrauss nimmt er lächelnd entgegen. Dann schreitet er zur Kutsche, der Arzt hinterher.
Die Türen schliessen sich und der Kutscher treibt die Pferde in den Trab. Die Droschkenräder hinterlassen ein ächzendes Knarren und das Gefährt entschwindet im Staub. Eine graue Wolke legt sich vor die Sonne und die Stimmung verdüstert sich.
Berlin, Charlottenstrasse, 6. Juni 2010
Ein warmer Frühlingstag kündigte sich an. Die ersten Sonnenstrahlen drängten sich zwischen die Häuserreihen. Am Gendarmenmarkt strich ein leiser Wind durch die Bäume und die Vögel ermunterten sich gegenseitig in ihrem Morgenkonzert. Unweit davon, in Richtung Unter den Linden, bewegte sich im 2. Stock eines gutbürgerlichen Wohnhauses ein offenes Fenster sanft hin und her, als wollte es den neuen Tag willkommen heissen. Die anderen Fenster waren noch fest verschlossen. Es war Sonntag und die geschäftigen Bewohner Berlins genossen noch ihre verdiente Nachtruhe.
Ein Vogel hatte es sich auf dem Fenstersims des offenen Fensters bequem gemacht und blickte unruhig nach allen Seiten. Er schien den seltsamen Geruch wahrzunehmen, der dem Zimmer entwich. Und auch das leise Schluchzen, das im frühmorgendlichen Vogelgezwitscher beinahe unterging. Mit einem sanften Flügelschlag hob der Vogel ab und suchte das Weite.
Eli sass zusammengekauert in einer Ecke des Musikzimmers und weinte, den Kopf vornüber, gleich einem Häufchen Elend. Ihr Körper zitterte. Trotz ihrer 24 Jahre hätte eine aussenstehende Person die zusammengekrümmte Gestalt für ein Kind halten können. Eli war nur mit einem ausgefransten T-Shirt und einer ausgelaugten Jeans-Hose bekleidet. Die Füsse waren nackt und schmutzig. An einem Ohrläppchen hingen drei Piercings und ebenso war der linke Lippenwinkel mit einem schillernden Ring durchstossen. Wenn Eli den Kopf anhob, erkannte man ein schlankes, feines Gesicht mit tiefgründigen, grünen Augen. Der Blick wirkte verloren, in die Unendlichkeit gerichtet, als gebe es keine Grenzen.
Eli weinte um ihren Grossvater. Ohne aufzublicken sah sie ihn deutlich vor sich, wie er, bäuchlings ausgestreckt, von der Klavierbank bis über die Tasten und weit in den offenen Flügel hinein dalag. Seine Finger hatten sich tief in die Saiten des Pianofortes verkrallt, als wollten sie nach etwas greifen. Die Notenbank lag am Boden. Ein Durcheinander von Notenheften türmte sich daneben wie hingeschmissen.
Eine offene Wunde an der Schläfe des Toten war rot gefärbt und eine dünne Blutspur suchte sich einen Weg über den Resonanzboden des alten Musikinstruments. Es war eine Szene wie aus einer anderen Welt, aus einer alten, vergangenen Welt. Ein Toter, der sich nicht von seinem Klavier trennen konnte, der sich dagegen wehrte, die Welt seiner Musik zu verlassen, sich verzweifelt an die Saiten klammerte, denen er während seines Lebens Klänge entlockt hatte.
Es war Musikprofessor Siegfried Gottesmann von der Musikhochschule Berlin, der Erbe einer wahren Dynastie von Musikern. War es nicht ein schöner Tod für einen Pianisten, inmitten der Klänge seines Instruments zu sterben? Und doch zeichneten die groteske Haltung des Mannes und seine verkrampfte Gestik ein Bild voller Dramatik. Ein Gemälde aus den finsteren Tiefen menschlicher Existenz. Man konnte den Aufschrei der umklammerten Klaviersaiten beinahe hören. Als wollten die drahtigen Klangkörper ein Geheimnis zurückhalten.
Eli schluchzte leise vor sich hin.
„Ich habe ihn umgebracht. Wie konnte es geschehen? Was ist in mich gefahren? Diese Wut. Ja, er hat mich gequält. Mit seiner Geheimnistuerei. Mit seiner Besserwisserei. Mit seinem Anspruch, über mich zu bestimmen und zu richten. Diese Erniedrigungen. Ich bin eine erwachsene Frau, promovierte Kunsthistorikerin. Er hatte kein Recht, mich wie ein Mündel zu behandeln, auch wenn er mich grossgezogen hat.
Ist es meine Schuld, dass sich meine Mutter aus Verzweiflung das Leben genommen hat? Dass sie die Paranoia ihres Mannes nicht mehr verkraften konnte? Auch sie hast du, Grossvater, erniedrigt, weil du mit ihrer Heirat nicht einverstanden warst. Du warst schuld an der Familientragödie, die mich zur Waise gemacht hat als mein wahnsinniger Vater in der Irrenanstalt starb.
Ich entschuldige mich für alle Quengeleien und all den Aerger. Ich weiss, dass ich eine Versagerin bin, zu einer wahren Beziehung nicht fähig. Ein Luder ohne Gewissen und Perspektiven. Unmusikalisch, wie du sagtest. Trotz eines Ahnenstamms voller glänzender Starmusiker, so wie du! Deshalb hast du mich derart geknechtet, dass ich ausreissen musste und immer wieder in der Gosse gelandet bin. Und doch bin ich stets zu dir zurückgekehrt, habe für dich gesorgt.
Ich habe dich bewundert und geliebt. Stundenlang bin ich in der Küche gesessen und habe deinem Klavierspiel gelauscht, mich in deine Klänge hineinzufühlen versucht. Ich habe mich in deiner Musik verloren. Oft glaubte ich mich in einer anderen Welt, fühlte diese andere Seite in mir, die heile Seite. Oh, diese wunderschöne, tiefsinnige Welt, die mir deine Tonschöpfungen bedeutet haben! Wie oft haben sie mich vor dem sicheren Absturz bewahrt! Vor dem Abgleiten in die tiefsten Schichten meines zerstörerischen Wesens. Du hast das nie wahrnehmen wollen und mich immer wieder zurückgestossen. Nur deine Musik hast du gehört. Es gab nur dieses Eine in deiner Welt. Deshalb hat dich auch deine Frau verlassen. Nur ich bin dir treu geblieben und habe deinen Verletzungen standgehalten. Welche Kraft musste ich aufbringen, um meine inneren Gegensätze zu versöhnen! Die heile Gefühlswelt der Musik gegen die zerstörerischen Triebe meiner Schattenwelt.
Nun sitze ich hier und muss meine Tat rechtfertigen. Ein einziges Mal wollte ich mich selbst sein. Ein einziges Mal wollte ich dir sagen, dass ich ein Mensch bin. Dass du mich respektieren, mich an deinem Leben teilnehmen lassen musst. Ich habe sonst niemanden auf dieser Welt. Du warst immer meine Welt. Es gibt keine andere. Nur mein Alter Ego, vor dem ich mich dermassen fürchte, vor dem ich immerzu flüchten muss, welches mich bedrängt und mich in archaische Tiefen zieht.
Deine Musik, die du deinem Instrument zu entlocken wusstest, haben mich oft vor dem Absturz bewahrt. Warum wolltest du nichts begreifen? Warum musste ich so laut werden, bis ich meiner selbst nicht mehr Herr war? Warum hast du zugelassen, dass ich die Kontrolle verloren habe? Wie konnte es geschehen, dass ich dich soweit getrieben habe, bis du bäuchlings über dein Instrument gestürzt bist? Mein Freund, welche Hand hat dich gerichtet“?
Es klingelte an der Türe. Doktor Edmund Jachertz wusste, dass die Wohnung nie verschlossen war. Durch das Klingeln kündigte er jeweils seinen ärztlichen Besuch an, der ihn einmal pro Woche zu seinem Freund und Patienten führte. Der Musiker war schon lange herzkrank. Ein schwieriger, eigenwilliger Patient, der seine Medikamente selten so einnahm, wie er sie ihm verschrieben hatte. Seine Gesundheit interessierte den Komponisten und Lehrer überhaupt nicht. Er hatte seine eigenen Ideen über Sinn und Unsinn des menschlichen Lebens. Für ihn gab es nur die eine Passion, die seine Existenz erträglich machte: seine tägliche Arbeit am Klavier.
Meistens hörte der Professor die Türklingel nicht, ging sie doch in seinen brillanten Läufen unter. Wenn er in seine Musik vertieft war konnte ihn kein Erdbeben vom Spielen abhalten. Einmal hatte der Patient ihm erklärt, dass sein Flügel ein ganz spezielles Instrument sei, ohne näher darauf einzugehen. Und wirklich, ein vergleichbares Pianoforte hatte der Arzt noch nie gesehen.
Heute war es ganz still. Dies wunderte Dr. Jackertz nicht, hatte er den Patienten doch bereits gestern besucht. Es war eine Notfallvisite gewesen. Professor Gottesmann hatte einen erstmaligen Angina pectoris Anfall und er musste dem herzkranken Musiker, der sonst eher unter Herzasthma litt, dringend zur Hospitalisation raten. Es hatte ihn nicht erstaunt, dass der eigenwillige Meister dies sofort ablehnte. Dies war auch der Grund, weshalb er ihn sogar an einem Sonntagmorgen besuchte.
Er hatte sich Vorwürfe gemacht und schlecht geschlafen. Er hätte mehr insistieren oder einfach die Ambulanz bestellen sollen. Die Situation war gefährlich. Seine Ausbildung als Arzt hatte ihn immer gelehrt, dass ein erstmaliger Angina pectoris Anfall zu einem Herzinfarkt führen konnte. Deshalb beschlich ihn nun ein ungutes Gefühl.
Nach seiner Weigerung, sich einweisen zu lassen, hatte er ihm eingeschärft, sich ruhig zu verhalten und viel zu liegen. Und die Enkelin Elisabeth Schrag hatte ihm versprochen, bei ihrem Grossvater über Nacht zu bleiben. Er wusste zwar, dass die beiden immer wieder heftig aneinander gerieten, hatte aber doch der sanften und fürsorglichen Seite der Enkelin vertraut. Er mochte sie. Sie hatte etwas Faszinierendes an sich, ohne dass er sich erklären konnte, was es war. Etwas Volatiles und zugleich Tiefgründiges. Wenn man in ihre grünen Augen sah, glaubte man, darin zu versinken oder die Ewigkeit zu erblicken.
Mit seinen 67 Jahren durfte er sich solche Ueberlegungen erlauben. Erstaunt war er, dass die junge Frau immer noch die Nähe zu ihrem Grossvater suchte und nie in Begleitung eines jungen Herrn gesehen wurde. Wohl spielte ihre schwierige Jugend eine Rolle.
„Eli, was um Himmels Willen ...“. Dr. Jachertz’ Augen weiteten sich, als er auf die Gestalt am Boden starrte. Sie schien zu schlafen. Ihre Hände waren zu einem Krampf erstarrt und zwischen ihren blassen Fingern hielt sie ein Stück Papier fest umklammert. Sie atmete unregelmässig, und jedesmal beim Ausatmen quälte sich ein ächzendes Geräusch aus ihren Lungen. Dr. Jachertz ärztliches Gehör registrierte ein Bronchialasthma.
„Eli, wach auf! Was ist los?“ Er schubste sie leicht. Ein tiefer Seufzer entwich. Dann schlug Eli die Augen auf, nur einen kurzen Augenblick, um sie sogleich wieder zu schliessen. Der Arzt erkannte für einen kurzen Augenblick das Entsetzen in ihren Augen. Und plötzlich nahm er den seltsamen Geruch war, der sich vom anderen Ende des Musikzimmers her ausbreitete. Ein ihm bekannter Geruch. Wie ein Blitz traf ihn die Vorahnung. Er hatte es befürchtet.
Er stürzte zum Flügel und sah seinen Freund in den Saiten seines Instruments verkrallt liegend. Er war tot. Mitten in seiner Lieblingstätigkeit aus dem Leben gerissen! Der Arzt bemerkte die klaffende Wunde an der Schläfe, offenbar durch Aufprall des Kopfes am Flügelrahmen verursacht. Er berührte die Stirne seines Patienten. Sie war kalt. Die Augen am seitlich abgedrehten Kopf waren weit aufgerissen, wie von Panik erfüllt. Dr. Jachertz versuchte, die weissblau verfärbten Finger von den Saiten zu lösen. Unmöglich, vollständige Leichenstarre! Man würde warten müssen, bis die Zersetzung des Muskelkrampfes einsetzte. Der Tod musste wenige Stunden zuvor eingetreten sein, erst nachdem der Musiker mit dem Kopf aufgeschlagen war, da sich eine Blutstrasse auf dem Resonanzboden abzeichnete. Es schien dem Arzt klar: terminales Kammerflimmern nach fatalem Herzinfarkt.
Betroffen richtete sich Dr.Jachertz auf, um Fassung ringend. Es war unglaublich. Der Tod hatte den Musikprofessor nur Tage vor dem 200-Jahr-Jubiläum zum Geburtstag seines berühmtesten Vorfahren, des Komponisten Robert Schumann ereilt. Die Feier in Anwesenheit zahlreicher Grössen aus Politik und Kunst sollte am 8. Juni dieses Jahres in seiner Geburtstadt Zwickau stattfinden. Siegfried hatte sich so darauf gefreut! Es wäre der krönende Abschluss eines Wirkens gewesen, das ganz der Aufarbeitung des lange unterschätzten, kompositorischen Klavierwerks seines Ahnen gewidmet war. Es würde ihm nun nicht mehr vergönnt sein, diesen Augenblick zu erleben.
„Eli, es tut mir so leid!“
Die Ecke war leer! Eli war fort. Noch glaubte er, ihre Umrisse wahrzunehmen, ihre Gestalt zu spüren. Nichts! Er hatte sie nicht hinausgehen hören. Hatte ihn sein beruflicher Stress in eine Sinnestäuschung getrieben? Er wusste, dass Menschen in Ausnahmesituationen halluzinatorische Vorstellungen entwickeln konnten. Hatte die Sorge um seinen Freund und Patienten seine Wahrnehmung dermassen gestört, dass er sich eingebildet hatte, Eli am Boden kauernd zu sehen? Oder war er durch den Toten am Klavier so in Anspruch genommen, dass er den Türschlag nicht hörte, als Eli die Wohnung verliess? Und warum wäre sie überhaupt geflohen?
Dr.Jachertz schritt leicht benommen zum Telefon und bestellte den Leichenwagen für morgen. Bis dahin sollte es möglich sein, die verkrallten Finger von den Saiten zu lösen. Sicherheitshalber schloss er das Fenster, um die Innentemperatur des Zimmers hoch zu halten. Dies würde die Zersetzung der Muskulatur beschleunigen. Dann nahm er den Wohnungsschlüssel und schloss die Türe hinter sich ab. Die warme Vorsommerluft und das Kindergeschrei in den Strassen holten den Arzt in das normale Leben zurück.
In einiger Entfernung, im Stadtteil Kreuzberg, irrte eine junge Frau durch die Gassen. An fröhlichen Sonntagsmarktständen vorbei, gedankenverloren und sich vor den Blicken der Passanten verbergend, die schwarze Mähne tief im Gesicht. Sie trug keine Schuhe und hatte schmutzige Füsse. In einem nahen Park setzte sie sich auf den Boden und vergrub ihren Kopf zwischen den Knien. In den Fingern hielt sie verkrampft ein Stück Papier. Ein Passant blieb stehen.
„Brauchen Sie Hilfe, junge Frau?“
Ein Grunzen. Die Frau hob langsam den Kopf und blickte den Fremden an.
„Scheren Sie sich zum Teufel!“
Der Passant staunte ob der Antwort und noch wegen etwas anderem: die junge Frau hatte grüne Augen. So grüne Augen hatte er noch nie gesehen. Verstört entfernte er sich.
Eine Stunde später stand die junge Frau vor der Haustüre eines baufälligen, mehrstöckigen Hauses. Sie drückte stürmisch auf die Klingel neben einem Schild, auf dem stand: Frau Eliane Weingarth, Doktor für Psychiatrie und Psychotherapie, Schwerpunkt dissoziative Störungen. Nachdem der Türöffner das Schloss entriegelt hatte, stürmte die Frau die Treppe hoch. Plötzlich hielt sie inne, bemerkte den Zettel in ihrer Hand und verstaute ihn in der Seitentasche der Jeans-Hose.
Endenich bei Bonn, Irrenanstalt, ab 4.März 1854
Herrliche Musik erklingt. Engelsflöten, zarte Violinen, dazwischen choralartige Gesänge, welche seine Gedanken umjubeln. Der Mann fühlt sich am Ende seiner Reise angekommen. Hier ist ihm wohl. Er wird umsorgt von Aerzten und Wärtern. Vor allem Johannes, sein bevorzugter Wärter, hat es ihm angetan. Ein Jüngling fast, mit lieben und freundlichen Augen. Er sorgt sich um ihn, wie seine Ehefrau es getan hätte. Dies gibt ihm Sicherheit. Der Wärter liest jeden Wunsch von seinen Lippen. Er ist umtriebig und will ihm den Aufenthalt in der Nervenheilklinik des Doktor Ferdinand Reichherz so angenehm wie möglich gestalten.
Der andere Aufpasser, der Franz, der gefällt ihm gar nicht. Er ist älter, autoritär und mit zu starkem Ego ausgestattet. Diese Haare, wild und lang, ölig und ungepflegt. Er hat den bösen Blick. Seine Augen starren ihn an. Als wisse er etwas von ihm, als hege er niederträchtige Gedanken. Er will ihm seinen Willen aufdrängen. Ja, dieser Wärter hat ihn erkannt, das ist es. Er weiss, wo er herkommt und wer er ist. Er weiss um seine Schande, um seine Erniedrigung. Er kennt seinen Schmerz und seine Sehnsucht nach Erlösung. Der Mann ist immer erleichtert, wenn sich Franz wieder entfernt. Er möchte ihn am allerliebsten nicht mehr sehen.
Der Patient ist froh, dass er seine Familie durch die unberechenbaren Sinnestäuschungen nicht mehr gefährdet. Er weiss seine Nächsten in Sicherheit. Sein Entscheid, alles hinter sich zu lassen und seinen eigenen Weg zu gehen, erweist sich als richtig. Seine Liebe, die er für Frau und Kinder empfindet, ist nicht erloschen. Im Gegenteil, sie ist fast bis zur Unerträglichkeit gewachsen und droht ihn zu erdrücken. Seine Familie braucht Ruhe nach den Aufregungen der letzten Zeit, seinem Umhertigern, seinen Gewaltausbrüchen und seinen Verzweiflungsschreien.
Er hat Vertrauen zu seinen Aerzten. Er will alles zu seiner Genesung beitragen. Mit seinem Thema, der Engelsmelodie, will er die teuflischen Kräfte der Sinnestäuschungen besiegen. Die Musik wird über das Böse triumphieren.
Eine grandiose Komposition: die Erhöhung des Guten durch eine gewaltige Fuge. In bisher unerreichtem Kontrapunkt. Eine Armee synchroner Klänge. Die mächtigste instrumentale Waffe, welche die Menschheit je gekannt hat. Ein Weg zum inneren Frieden und zur Freisetzung schöpferischer Energien. Eine vollkommen neue Art des Seins!
Das Umfeld ist ideal. Im Gesellschaftszimmer nebenan steht ein Flügel, ein schöner Pleyel. Er möchte, dass er gestimmt wird. Die Ruhe und Idylle der Privatklinik, die ihn beherbergt, ist kaum zu übertreffen. Die Nervenanstalt ist ein wahres Kleinod. Sie liegt in einem prächtigen Park. Gestern hat er sich in Begleitung seines ‚guten’ Wärters, Johannes, dort umgesehen. Schatten spendende Bäume, gepflegte Hecken, lauschige Bänke an kühlenden Teichen inmitten von Weinreben. Und diese Aussicht! Er kann das ganze Siebengebirge sehen. In der Ferne erhebt sich der Kreuzberg mit dem Kreuz und der Barockkirche.
Der Mann weiss, dass er sich in unmittelbarer Nähe von Bonn befindet. Dort wurde für sein grosses Vorbild Ludwig van Beethoven ein Denkmal errichtet. Er wird um Erlaubnis bitten, das Monument auf dem Münsterplatz zu besuchen.
Viele Gedanken kreisen im Kopf des Patienten. Endlich, nach Tagen, vielleicht einigen Wochen seit seiner Ankunft in der Klinik ist er voller Tatendrang, ein Zeichen, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet.
‚Wo könnte ich mein Werk besser vollenden als hier? Hier kann ich die Tonfolge des himmlischen Themas weiter bearbeiten und den Schlüssel zur Verwirklichung der Fuge finden. Ich brauche Noten, viele Noten!’
Warum kriegt er keine Noten? Morgen wird der Patient seiner Frau einen Brief schreiben und sie um Notenblätter bitten. Erstmals nach seiner Abreise von zu Hause wird er sich an sie wenden, ihr ein Lebenszeichen senden. Ihm ist unbegreiflich, weshalb man ihm den Kontakt mit der Aussenwelt und seiner Familie verbietet. Die Befürchtung eines Rückfalls bei der geringsten Aufregung scheint ihm übertrieben. Will seine Frau ihn nicht mehr? Soll er weggeschlossen werden?
Er fühlt sich genug stark, um seine Vorhaben durchzusetzen. Seine Ehe steht auf dem Spiel. Die Zusammenarbeit mit seiner Gattin ist äusserst wichtig. Sie muss die Kontakte zu seinen Verlegern aufrecht halten. Sie muss seine Werke dem Publikum vorstellen. Sie ist seine Botschafterin.
Im Aerztezimmer der Anstalt für Behandlung und Pflege von Gemütskrankheiten und Irren sitzen Dr. Ferdinand Reichherz und sein Assistent Dr. Ulrich Sperreisen an einem Tisch. Die Stimmung ist ernst. Beide tragen dunkle Anzüge, den weissen Hemdkragen um den Hals geschlossen, verziert mit einer schwarzen Kragenbinde.
Die Gestalt von Dr. Reichherz ist von feiner und nobler Art, der Ausdruck seiner Augen verrät analytische Schärfe. Dr. Sperreisens Gesichtszüge sind gröber. Er hat eine Glatze und zwei Haarbüschel über den leicht abstehenden Ohren. Er hat die Krankenakte des neuen Patienten vor sich aufgeschlagen.
„Ich begreife dieses Krankheitsbild einfach nicht“, beginnt der Assistent mit der Diskussion.
„Ich habe den Musiker jetzt viele Tage beobachtet und mit ihm etliche Gespräche geführt. Natürlich vor allem an seinen guten Tagen. Du weisst ja, dass er zeitweise gar nicht zugänglich ist. Es gibt Tage, an denen er sperrig und mürrisch, ja abweisend sein kann. Man darf ihm dann nicht zu nahe kommen, weil er sich leicht erregt und wirres Zeug spricht. Er klagt oft über ihn verfolgende Stimmen, üble, dämonische Gestalten und über lärmige Musik in seinem Kopf. Andererseits scheint er Momente des Glücks zu erleben, lächelt und berichtet über schönste und lieblichste Klänge, die sein Inneres überfluten. Es wird berichtet, dass er schon seit seiner Jugend unter Stimmungsschwankungen bis hin zur Melancholie gelitten hat. Daneben soll er immer wieder durch höchst inspirierende Eingebungen beseelt worden sein.
Sag mir, was soll ich von den wahnhaften Vorstellungen halten, welche er in seinen guten Phasen als Sinnestäuschungen klar erkennt? Steht das nicht in krassem Widerspruch zu der gängigen Lehrmeinung, dass ein wirklicher Wahn durch den Patienten eben gerade nicht als solcher erkannt wird? Auch die akustischen Missempfindungen in Form von quälenden Klangbildern kann er klar von den schöpferischen Melodien abgrenzen, die ihn ein Leben lang begleitet haben und die wohl Voraussetzung für sein unermüdliches Schaffen sind. Ich kenne keine Geisteskrankheit, die einem solchen Bild entspricht!“
„Mein Lieber, natürlich hast du in gewisser Weise Recht, dass das Krankheitsbild des Meisters schwierig einzuordnen ist. Aber auch ein manisch-depressives Zustandsbild kann wahnhafte Formen annehmen. Die Grenzen zum Wahn sind keinesfalls scharf. Ein Wahn kann in lichten Momenten durchaus als Irreführung erkannt werden. Ein Musiker verfügt über eine Empfindungsgabe, die - entschuldige die Anmassung - weit über die Deine hinausgeht. Es erstaunt daher nicht, dass unser Patient seine Sinnestäuschungen in luziden Momenten als solche erkennt und klangliche Halluzinationen als schöpferisch empfindet. Es könnte auch sein, dass er seine Musik innerlich hört, bevor er sie niederschreibt. In diesem Fall wären es gar keine Halluzinationen.
Ich gebe zu, dass sein Geisteszustand in keines der uns bekannten Krankheitsschemen passt. Allerdings wissen wir, dass Genialität und Geisteskrankheit nicht immer klar voneinander getrennt werden können. Was wäre die Welt ohne Wahnsinn? Ich meine, sie wäre eine Einöde!“
„Du meinst also, unser Patient müsste in weitestem Sinne als normal gelten?“
„Nun, was heisst hier normal? Bist du normal? Bin ich normal? Ist ein Komponist, der nahezu Uebermenschliches leistet, normal? Nach meiner jahrelangen Erfahrung mit Geisteskrankheiten und sogenanntem Irresein bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass es keine strikte Grenze zur Normalität gibt. Viel mehr kann sich diese Grenze mit zunehmender Schöpfungskraft und Genialität eines Menschen sogar auflösen.“
„Und weshalb - gestatte die ketzerische Frage - befindet sich dieser geniale Mensch überhaupt in unserer Klinik, der Anstalt für Geisteskrankheiten und Irresein?“
„Nun, mich beunruhigt etwas ganz Anderes: es sind die über Jahre zunehmenden Erscheinungen wie körperlicher Zerfall, Schwindelzustände, Schwerfälligkeit der Sprache, Schüttelanfälle und innere Unruhe mit unkontrolliertem Bewegungsmuster. Auch die Veränderungen der Persönlichkeit mit den bis zur Aggressivität führenden Erregtheitszuständen machen mir Sorgen.
Es ist, wie wenn sich hier eine Krankheit über die andere schieben würde. Es wird unsere Aufgabe sein, sehr differenziert nach den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten zu suchen. Ich möchte Dich bitten, täglich Buch zu führen über Bewusstheitszustand, Temperatur, Puls und Beschaffenheit der Exkremente. Lass dem Patienten grösstmögliche Freiheit bezüglich Bewegung, musikalischem Schaffen und Ernährung. Lass ihn aber für längere Spaziergänge, vor allem ausserhalb des Klinikgeländes, von einem Wärter begleiten. Direkte Familienkontakte müssen vermieden werden. Zwischen den Eheleuten könnten erneut Konflikte ausbrechen. Du kennst die Ueberforderung der Gattin in letzter Zeit. Sie beansprucht Zeit für ihre eigene Karriere. Der Meister muss absolute Ruhe haben und von jeglicher Aufregung abgeschirmt sein. Und fast hätte ich es vergessen: beobachte peinlichst genau seine Pupillen auf ihre Grösse und auf Unregelmässigkeiten der Form!“
„Ich nehme an, dass du einverstanden bist, wenn ich zur Reinigung der Körpersäfte wirksame Abführmittel wie Bitterholz und Kolombowurzel verabreiche. Bei Tobsuchtsanfällen gedenke ich, Brechwurzeltee einzusetzen. Zur Ableitung der inneren, fehlgeleiteten Strömungen schiene mir das Anlegen einer künstlichen Eiterwunde, einer Fontanelle, nützlich.“
„Du hast mein vollstes Vertrauen. Ich schlage vor, dass wir uns wöchentlich zu einer Besprechung treffen. Und noch etwas: Anfragen seiner Ehefrau bezüglich des Gesundheitszustandes ihres Gatten solltest du nur nach Rücksprache mit mir beantworten. Sie ist begreiflicherweise sehr besorgt und es ist ihr peinlich, dass der geniale Musiker an einem so hässlichen Leiden erkrankt ist. Sie fürchtet um seinen - und wie mir scheint auch um ihren Ruf. Sie will sogar seine letzte Komposition, deren Thema er als von einem Engel eingegeben glaubt, unter Verschluss halten. Es ist verständlich, dass sie sein kompositorisches Werk durch sein Leiden beeinträchtigt sieht.“
„Alles klar. Nur noch ein Letztes: wir sollten im Aufnahmebuch eine vorläufige Diagnose vermerken.“
„Schreib: Melancholie mit Wahn. Auch wenn ich da meine Zweifel habe.“
Der Wärter Johannes steht an der Schwelle zum Gesellschaftszimmer und lauscht den Klängen, die vom Flügel her die Anstalt durchfluten. Schon stundenlang sitzt der Meister am Klavier und bearbeitet die Klaviatur in beängstigender Art und Weise. Noch nie hat der Pfleger Derartiges gehört. Sanfte und leise Töne, schwingende Melodien, dann abrupte und gewaltige Ausbrüche, dissonante Akkorde in gegenläufigen Skalen. Dabei scheint die gebückte Gestalt das Instrument überwältigen zu wollen. Bedrohlich kracht es in der Klavierbank und Johannes befürchtet, der Musiker könnte das Gleichgewicht verlieren und zu Boden stürzen. Die Szene gleicht einem Kampf gegen Titanen.
Wilde Schreie durchschneiden die Harmonien. Ungepflegte Haare wirbeln durch die Luft und Schweisstropfen besprinkeln die Tasten. Eine unangenehme Ausdünstung breitet sich aus. Dazwischen greift der Meister in ausfahrenden Bewegungen zur Feder und kritzelt Zeichen in die Notenblätter, die ihm seine Gattin zugesandt hat. Der Wächter macht sich Sorgen. Sein Patient hat heute weder gegessen noch getrunken. Den Tee hat er als vergiftet bezeichnet und das Glas zu Boden geworfen.
Nach unverständlichen Selbstgesprächen und stereotypem Wippen des Oberkörpers ist er heute Morgen plötzlich von seinem Bett aufgestanden und ins Gesellschaftszimmer gestürzt. Dort hat er sich an das Instrument gesetzt und vornüber gebeugt geweint. Mehrmals sind seine kräftigen Finger über die Tasten geglitten, ohne sie zu berühren, um dann in verzweifelter Gestik in den Schoss zurückzufallen. Erst nach mehreren Weinkrämpfen hat sich der Künstler beruhigt. Dann, nach einem unverständlichen Wortschwall, dieser deutlich artikulierte Satz:
„Oh himmlische Engel, leitet meine Kraft in dieses Werk“!
Und seit diesem Moment hat der Komponist das Instrument ohne Unterbruch bearbeitet und die Irrenanstalt in Schwingung versetzt.
Mit einem Satz stürzt Johannes nach vorne und kann den rhythmisch krampfenden und wild um sich schlagenden Musiker gerade noch auffangen. Der Wächter ist stark. Er kann den Patienten mit seinen Armen umschlingen und ihn sanft zu Boden legen. Dort hält er ihn fest, damit er sich nicht verletzt, bis der Mann in einen tiefen Schlaf fällt. Er hebt ihn auf und trägt ihn liebevoll ins Bett. Johannes hat Tränen in den Augen und holt sich einen Stuhl. Dort wacht er bis sein Patient die Augen aufschlägt. Er holt ein Glas Tee und setzt es dem Meister an die Lippen. Diesmal trinkt er. Auf seinem Gesicht breitet sich ein Lächeln aus. Johannes lächelt auch.
Zug Basel-Berlin, Zwickau (Robert Schumann Haus), 7. und 8. Juni 2010
Ich hatte mir eine dreiwöchige Auszeit genommen. Nach Beendigung meines Medizinstudiums war ich ausgelaugt und ausserstande, ohne Unterbruch meine berufliche Karriere fortzusetzen. Ich wollte nochmals zurück nach Berlin. Dort hatte mir damals Professor Siegfried Gottesmann wichtige Impulse gegeben. Er hatte mir in seinen Kursen der Berufs- Klavierklasse beigebracht, wie man die Kraft eines einfachen Tastentones ins tiefste Innere des eigenen Wesens überträgt. Trotzdem hatte ich damals entschieden, meinen Berufsweg zu ändern und mich der Medizin zuzuwenden.
Die Musik schien sich in letzter Zeit wieder vermehrt in mein Leben zu drängen. Und so diente meine Reise nach Berlin einer eigentlichen Reinigung meines Gemützustandes.
Ich hatte bewusst darauf verzichtet, das Flugzeug zu nehmen und wollte mich während der Zugreise in Ruhe auf den Aufenthalt in dieser sich stark wandelnden Stadt vorbereiten. Berlin war damals das Gefäss für meine jugendliche Sturm- und Drangzeit gewesen und ich war neugierig darauf, wie die Stadt mich empfangen, welche Gefühle sie in mir auslösen würde, nachdem ich sie vor sieben Jahren Hals über Kopf verlassen hatte. In der Zwischenzeit hatten sich die Emotionen beruhigt. Mein Interesse galt während der Ausbildung zum Arzt mehr den mentalen als den organischen Aspekten der Medizin. Mehrere Monate hatte ich in psychiatrischen Kliniken zugebracht.
Ich war fasziniert von den grenzenlosen Spielarten der menschlichen Psyche. Viel hatte ich über die archaischen Strukturen im tiefsten Innern des menschlichen Geistes gelernt, welche über Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder ihre schöpferische und regulierende Wirkung zeigten. In den letzten Jahren hatten Untersuchungen der Magnetresonanztomographie Strukturen der Musik wie Rhythmus, Takt und Tonintervalle in speziellen Domänen des menschlichen Gehirns nachgewiesen. Man konnte Emotionen, welche von Musikklängen ausgelöst wurden in primitiven Hirnzentren darstellen.
Bezeichnend war die Tatsache, dass kompositorische Elemente alter Meister körperliche und geistige Reaktionen auslösten. Die Frage war: Gab es charakteristische Tonfolgen in der Musik, die in neuralen Strukturen des menschlichen Gehirns unbekannte Kräfte und Energien freisetzten? Schliesslich hatte Musik, wie längst nachgewiesen, eine therapeutische Wirkung bei hirngeschädigten und dementen Patienten.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich nicht bemerkte, wie mir gegenüber ein Herr mittleren Alters mit ausgesprochen melancholischem Blick Platz genommen hatte. Er trug einen dunklen, etwas altertümlichen Anzug mit Kragenschlaufe. Seinen Kopf hatte er auf seiner abgewinkelten linken Hand aufgestützt. Der Ellbogen ruhte auf der Armstütze seines Sitzes.
„Geht es Ihnen gut?“ fragte er mich.
Es war mir peinlich, denn ich hatte mich selbst dabei ertappt, wie ich meine Lippen bewegte und Selbstgespräche führte.
„Es geht ... mir gut“, stammelte ich, „bitte, ich war nur in Gedanken versunken“.
„Hm!“ Er versteckte seinen Kopf hinter dem Berliner Tagblatt und setzte seine Lektüre fort. Und dann durchfuhr es mich wie ein Blitz. Auf der mir zugewandten Frontseite der Zeitung stand in grossen Buchstaben: Unerwarteter Tod von Professor Siegfried Gottesmann, bekannter Musiker und entfernter Nachfahre des Komponisten Robert Schumann. Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200sten Geburtstag Schumanns an seinem Geburtsort in Zwickau verlieren den wichtigsten Teilnehmer.
Mein Atem beschleunigte sich. Hände und Füsse fühlten sich gelähmt an. Konnte es wirklich sein? In Berlin sollte die Person, die ich aufzusuchen gedachte, gestorben sein? Die Jubiläumsfeier zu Ehren Schumanns war mir völlig entgangen! Sie sollte bereits morgen stattfinden.
Es war mir sofort klar, dass ich die Jubiläumsfeier auf keinen Fall verpassen durfte. Die Verehrung für diesen Meister hatte das gesamte Lebenswerk meines damaligen Lehrers und Mentors massgeblich beeinflusst. Und jetzt war er tot. Es war eine moralische Verpflichtung für mich, an dieser Feier teilzunehmen. Auch wenn dies bedeutete, dass ich nach meiner Ankunft in Berlin die Stadt morgen bereits wieder in Richtung Zwickau verlassen musste. Schumann hatte in mir tiefe Spuren hinterlassen. Es war immer seine Musik gewesen, die in mir diese seltsamen seelischen und körperlichen Reaktionen ausgelöst hatte.
„Entschuldigung nochmals, aber ich glaube wirklich, es geht ihnen nicht gut.“
Die Zeitung senkte sich und offenbarte den tiefen und traurigen Blick meines Gegenübers. Wer war dieser Mann?
„Nein wirklich, es ist alles in Ordnung, ich danke Ihnen.“
Benommen lehnte ich mich zurück und schloss die Augen. Ich musste meine Pläne ändern. Als erstes wollte ich in Berlin wie vorgesehen mein Pensionszimmer im Stadtteil Kreuzberg beziehen. Ich würde früh zu Bett gehen und ausgeruht am nächsten Morgen die Reise nach Zwickau fortsetzen. Ich wollte noch heute in Berlin ein Bahnbillett lösen.
Eine leise Vorahnung bemächtigte sich meiner Aufmerksamkeit, ohne dass ich den flüchtigen Gedanken in seiner Bedeutung fassen konnte. Viel weniger noch konnte ich wissen, welch schicksalshafte Wendung meine Auszeit nehmen sollte und welch dramatische Tage mich erwarteten.
Ich blickte auf. Der Zug musste bald in Berlin einfahren. Mein Gegenüber war weg. Auf seinem Sitz lag zusammengefaltet die Zeitung mit der erschütternden Nachricht. War der traurige Herr ausgestiegen? Hatte der Zug in der Zwischenzeit angehalten? War ich einer Sinnestäuschung erlegen oder hatte ich einfach nur geträumt? Irgendwie erinnerte mich der verschwundene Zugnachbar an ein Portrait ..., ja, er erinnerte mich an ein Portrait Robert Schumanns, welches mir von einem früheren Besuch seines Geburtshauses her vertraut war.
Ich kannte mich gut aus in Berlin, nahm nach meiner Ankunft die U-Bahn und trug meinen Koffer durch die belebten Strassen des Stadtteils Kreuzberg. Die kleine Pension befand sich am Rand eines hübschen Parkes beim Oranienplatz wo noch viele Menschen die untergehende Abendsonne genossen. Ich meldete mich bei Frau Rosenblum, die mir meine Reservation per Internet zugesagt hatte. Sie war eine ältere, pummelige und freundliche Frau.
„Mein Name ist Josch Vonstahl.“
„Natürlich, willkommen gnädiger Herr, sicher sind Sie müde von der Reise.“
Sie wies mich zu einem gemütlichen Zimmer mit eigenem Bad und einer Terrasse, die direkt über dem Park lag. Erschöpft und ohne meinen Koffer auszupacken sank ich ins Bett. Im Traum erschien mir nochmals der traurige Herr mit dem melancholischen Blick. Er sprach wirres Zeug und unverständliche Worte. Eine Melodie begleitete mich danach durch die Nacht.
Und so befand ich mich am nächsten Tag bereits wieder im Zug. Das Frühstück war köstlich gewesen und Frau Rosenblum hatte nicht schlecht gestaunt, als ich ihr eröffnete, dass ich die nächste Nacht in Zwickau verbringen würde. Freundlicherweise gab sie mir die Adresse einer Absteige bei einer guten Freundin in der Nähe der Gedenkstätte, wo sich die illustre Gesellschaft in der Konzerthalle des heutigen Robert Schumann - Hauses zu einem Konzert der Staatskapelle Berlin einfinden sollte. Anschliessend würde ein Fest auf dem Hauptmarkt stattfinden.
„Gnädiger Herr“, sagte sie beim Abschied noch „ich kann sehr gut verstehen, dass Ihnen dieser Anlass am Herzen liegt. Ich war auch völlig erschüttert vom Tod des geschätzten Professors. Ich bin regelmässig in seine Konzerte gegangen. Er hat die Werke seines berühmten Vorfahren so ergreifend vorgetragen. Mir sind jeweils die Tränen gekommen. Und wenn ich jetzt bedenke, dass seine Enkelin, die er grossgezogen hat - ein wahrlich schwieriges Kind - nun ganz auf sich allein gestellt ist ..., wie schrecklich, was wird auch aus ihr werden?“
Ich konnte mich noch vage an die Enkelin meines Lehrers erinnern. Sie war damals ein Kind gewesen, etwa vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Oft sass sie während des Klavierunterrichts ihres Grossvaters in einer Ecke des Musikzimmers, die Hände um ihre Knie geschlungen und den Kopf eingerollt. Ich hatte mich immer gefragt, was wohl in ihr vorging während dieser Musikstunden. Der Professor erwähnte einmal, dass sie sich weigerte, ans Klavier zu sitzen, dass er aber glaubte, dass sie ein sensibles und für Musik empfängliches Gehör besass. Sie sei sehr introvertiert und bewahre alle intensiven Eindrücke in ihrem Inneren. Ich hatte sie als schmächtiges Kind in Erinnerung, als wortkarg und nie lachend. Und eine Besonderheit kam mir jetzt wieder in den Sinn: Sie hatte seltsam durchscheinende, grüne Augen. Ob ich Eli heute noch erkennen würde?
Ich hatte mir von Berlin aus eine Eintrittskarte für das Gedenkkonzert reservieren lassen, und als der Zug im Bahnhof Zwickau ankam, begab ich mich mit einem Taxi zum Geburtshaus des Komponisten, wo die Leute vor der Kasse des Konzertsaales bereits Schlange standen. Mit viel Geduld besorgte ich das Billett und begab mich in die Eingangshalle, wo die Besucher ihre Drinks an Stehtischen genossen. Ich erwartete einige bekannte Gesichter aus meiner Studienzeit bei Professor Gottesmann, konnte jedoch vorerst niemanden erkennen. An einem Tisch ganz hinten schienen mir allerdings einige Gesichter vertraut, und ich glaubte zwei Verlagsagenten des Notenhauses H. und B. zu erkennen, die beim Professor immer ein und aus gegangen waren. Der Musiker hatte eine Neuausgabe des gesamten Klavierwerks von Schumann vorbereitet und, so nahm ich an, später auch herausgegeben.
Im Programmheft des heutigen Abends wurde im Anschluss an das Konzert eine Ansprache angekündigt. Anstelle des vorgesehenen Professors würde der Direktor der Musikschule Zwickau, ein guter Freund des Verstorbenen, einige Worte an das Publikum richten. Man konnte gespannt sein, was er in der unvorhergesehenen Situation mitteilen würde.
Ueberrascht war ich von der Auswahl der Darbietungen, alles Werke des Jubilars. So standen fast ausschliesslich Interpretationen seiner Frühwerke auf dem Programm, mit Ausnahme einer sehr umstrittenen und fast nie in Konzertsälen gehörten Komposition: seine letzten Variationen für Klavier, die sogenannten Geistervariationen, die seine Ehefrau unter Verschluss gehalten hatte. Sie befürchtete, das Werk könnte durch die Erkrankung ihres Gatten beeinflusst worden sein und seinem Ruf schaden. Die Komposition wurde erst in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts veröffentlicht, und die Musikwelt war sich bezüglich des kompositorischen Gehalts des Werks uneinig. Hatten die umstrittenen Variationen am Schluss des Konzertes eine tiefere Bedeutung?
Der Gong erklang und die Leute begaben sich in den Konzertsaal. Ich hatte einen Platz am hinteren Ende des Saals, wo sich mir ein guter Ueberblick bis in die seitlichen Logenplätze bot. Mein Interesse galt nebst dem musikalischen Ereignis auch den anwesenden Musikfreunden.
Der Dirigent eröffnete den sinfonischen Teil des Konzertes, nachdem sich das übliche Husten und Stühlerücken des Publikums gelegt hatte. Ich liess mich mit geschlossenen Augen in die Tiefen der wunderschönen Musik herabgleiten und erschrak förmlich, als der tosende Applaus einsetzte und ich den Ellbogen meines Nachbars in meiner Flanke spürte. Offenbar hatte ich ihn gestossen. Ich wollte mich soeben entschuldigen, als ich den traurigen Herrn mit dem melancholischen Blick zu erkennen glaubte, der, seinen Arm auf der Lehne abgestützt, mit der linken Hand seinen Kopf hielt. Er erhob sich jedoch in diesem Moment, nickte mir freundlich zu und entfernte sich zwischen den Stuhlreihen des noch halb abgedunkelten Saals.
Ich blickte mich um und dann sah ich sie: in einem der Logenplätze. Ganz sicher war ich allerdings nicht. Aber dann begegneten sich für einen kurzen Augenblick unsere Augen. Ich erkannte in ihren Mundwinkeln ein kurzes, scheues Lächeln und den tiefen, durchscheinenden Blick ihrer Pupillen. Es war Eli, die Enkelin des verstorbenen Professors. Ich wusste nicht warum, aber mein Pulsschlag beschleunigte sich und es überlief mich ein prickelnder Schauer. Ich wagte nicht, noch einmal hinauf zu blicken und war froh, als der Saal sich wieder abdunkelte und ich mich in die Anonymität des Konzertsaals verkriechen konnte. Hatte ich Angst vor dieser Begegnung?
Schon als Kind war mir Eli etwas unheimlich gewesen. Man wusste nie so recht, was in ihr vorging. Sie konnte recht borstig sein, hatte aber auch ihre lieblichen Seiten. Man konnte ihre innere Reife schlecht abschätzen, einesteils war sie Kind, andernteils erschien sie altklug und erwachsen.
In dem kurzen Augenblick der Begegnung unserer Augen glaubte ich wieder dasselbe, undefinierbare Wesen zu erkennen. Es konnte durchaus sein, dass das Bild, das ich mir von Eli machte einer in mir schlummernden Vorstellung entsprach.
Ich wandte mich zum Sitz neben mir. Er war leer.
Der zweite Teil des Konzertes bestand ausschliesslich aus Klavierwerken. Sie waren mir grösstenteils bekannt. Der wohl beste Schüler des verstorbenen Professors interpretierte sie gut und mit tiefem Empfinden. Man konnte spüren, wie Gottesmann seine volle Hingabe an das Werk Schumanns auf seinen Schüler übertragen hatte.
Dann, just vor der Wiedergabe der letzten, noch wenig bekannten Variationen geschah etwas Merkwürdiges. Beim Nachstellen der Notenbank geriet dem Pianisten, der sich kurz erhoben hatte, versehentlich die Brille zwischen die Saiten. Er musste sich nach vorne beugen, schien kurz zu schwanken und verlor beinahe das Gleichgewicht. Es war nicht auszumachen, ob das Loslösen der Brille aus den Saiten die Ursache war. Jedenfalls entwich ein grässliches, dissonantes, fast stöhnendes Geräusch dem prächtigen Flügel, sodass ein dumpfes Raunen durch den Zuschauerraum ging.
Der Pianist war sichtlich irritiert, als er sich wieder setzte und holte ein weisses Taschentuch aus der Hose, um sich den Schweiss von der Stirne zu wischen. Dann legte sich Stille über den Saal. Die Luft war zum Zerreissen gespannt, kein Husten, kein Stühlerücken. Während der nachfolgenden Wiedergabe der Variationen nahm ich starke Gefühle wahr. Unruhe, Erwartungsangst, Sehnsucht.
Berührt liess ich mich durch den tosenden Applaus von der Unwirklichkeit der seltsamen Empfindungen erlösen.
Noch bevor ich mich dem Beifall anschliessen konnte, spürte ich wieder einen Ellbogen in meiner Flanke. Kleine Finger krabbelten zu meiner linken Hand und verstauten ein zerknülltes Stück Papier darin. Instinktiv ergriff ich den Zettel und umschloss ihn fest. Als ich mich umsah, hatte sich Eli bereits vom Nachbarssitz erhoben und entfernte sich zwischen den Stuhlreihen zum Ausgang hin. Sie blickte kurz zurück und rief mir zu:
„Wir kennen uns.“
Dann war sie verschwunden. Ich schob das Papier in meine Jackentasche.
In der Pause begab ich mich in die Vorhalle und griff nach dem Papierknäuel in meiner Jacke. Ich musste ihn glätten, um zu erkennen was darauf stand.
Es war eine Notenspirale mit zwölf Notenköpfen: vier unausgefüllte, acht gefüllte, zwei davon punktiert:
Ich stand vor einem Rätsel. Zum einen konnte ich mit dieser Tonfolge nichts anfangen. Es fehlten der Notenschlüssel, die Notenhälse, der Rhythmus und die Taktstriche. Zum anderen hatte ich keine Ahnung, weshalb mir Eli diese Notiz hatte zukommen lassen. Es blieb jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken. Die Anwesenden strömten wieder zu den Saaleingängen. Zudem waren meine Gedanken bereits bei der bevorstehenden Ansprache des Musikdirektors. Ich steckte den Zettel ein. Von Eli keine Spur.
Im Konzertsaal betrat ein grauhaariger, leicht korpulenter Herr die Bühne. Er wirkte gehemmt und war sichtlich gerührt. Nachdem er seine Lesebrille aufgesetzt hatte, begrüsste er die Anwesenden und drückte seine tiefe Trauer über den Tod seines Freundes aus. Seine Stimme schien zu versagen. Er konnte sich aber rasch wieder auffangen, wischte sich mit einem weissen Taschentuch über die Wangen und begann mit einem Rückblick auf das Leben des Komponisten.
Schumann wurde in Zwickau geboren, erlebte seine Ehejahre in Leipzig und Dresden, bis er sich mit seiner Familie als städtischer Musikdirektor in Düsseldorf niederliess. Leider waren seine letzten Lebensjahre von einer seelischen Krankheit geprägt, und er musste nach einem Selbstmordversuch die Zeit bis zu seinem Tod in einer Irrenanstalt verbringen. Alles bekannte Fakten. Man konnte durch das zunehmende Gehuste und Flüstern spüren, dass das Publikum leicht gelangweilt war. Die Spannung nahm jedoch abrupt zu, als der Referent noch kurz auf das Schaffen des verstorbenen Nachfahren zu sprechen kam:
„Meine geschätzten Musikfreunde! Sie alle wissen, dass ich dem Verstorbenen aus tiefstem Herzen verbunden war. Sein Wirken und sein Bemühen, die kompositorische Hinterlassenschaft seines Ahnen ins richtige Licht zu stellen, kann niemand vergessen. Insbesondere war er in seinen letzten Jahren mit ungebrochener Hartnäckigkeit damit beschäftigt, die letzten Werke des grossen Meisters neu zu bewerten. In vielen Gesprächen, die ich mit ihm führen durfte, hat er immer wieder auf seine Ueberzeugung hingewiesen, dass das kompositorische Schaffen Schumanns in seinen letzten Jahren, entgegen der herkömmlichen Meinung, durch das Auftreten seiner seelischen Probleme keinesfalls beeinträchtigt war. Im Gegenteil hätten seine letzten Kompositionen deutlich an Kraft gewonnen und zeigten sogar Aspekte eines übersteigerten musikalischen Bewusstseins.