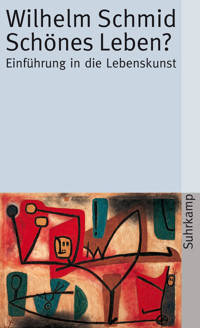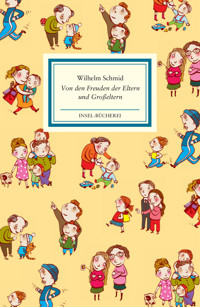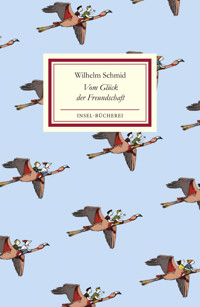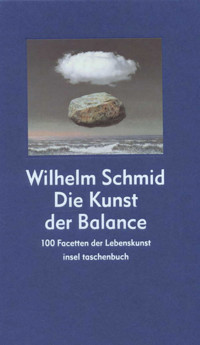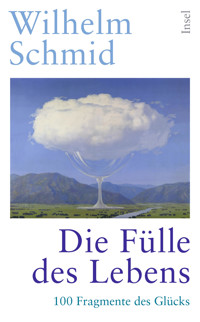
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle reden vom Glück. Nicht wenige Menschen aber werden unglücklich, nur weil sie glauben, immer glücklich sein zu müssen. Mit diesem Buch wird die Sehnsucht nach Glück in nachdenklichere Bahnen gelenkt. Es geht nicht ums Ganze, sondern um »Fragmente des Glücks«. Sie tragen letztlich zu einer Fülle des Lebens bei, die auch Widersprüche nicht ausschließt. Und die alltäglichen Kuriositäten schätzt.
Der Alltag kommt wieder zu seinem Recht: Was trägt es zu unserem Glück bei, auf einem Stuhl zu sitzen, einen Regenmantel überzustreifen, Weißwürste zu essen und »romantisch« zu sein? Nicht ignoriert werden der alltägliche Ärger, die Einsamkeit und Verletzlichkeit. Aber der Autor entfacht auch die Liebe zum Gedankenstrich, schildert das Glück des Zappens, schickt ein Gelassenheits-Gebet zum Himmel und gibt Antwort auf die Frage, was uns trösten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wilhelm Schmid
Die Fülle des Lebens
100 Fragmente des Glücks
Insel Verlag
Inhalt
Vorwort
Frühlingsmorgen: Die Fülle der Sinne
1 | Aufstehen und Auferstehung · 2 | Gelassenheits-Gebet · 3 | Zeitung lesen · 4 | Moderne Einsamkeit · 5 | In welcher Zeit leben wir? · 6 | Sozusagen · 7 | Die Wahrheit sagen · 8 | Den Duft von Veilchen trinken · 9 | Die eigene Haut retten · 10 | Reise nach Iliolumbale · 11 | Olympische Körper · 12 | Wellness? Igitt! · 13 | Was ist Arbeit? · 14 | Suche nach Exzellenz · 15 | Macht Geld glücklich? · 16 | Stadtspaziergang · 17 | Der Queen zuwinken · 18 | Mein Stuhl · 19 | Ewige Lust! · 20 | Ewige Lust? · 21 | Tyrannei der Intimität · 22 | Ich bin am Ende · 23 | Am schönen Rhein · 24 | Meister des Alltags · 25 | Drei weiße Birken
Sommertag: Die Fülle des Fühlens
26 | Die Seele, fortissimo, pianissimo · 27 | Völlig schwerelos · 28 | Reif für die Insel · 29 | Philosophie des Regenmantels · 30 | Kann ein Rausch denn Sünde sein? · 31 | Es ist des Teufels · 32 | Alles falsch machen! · 33 | Lieben Sie Volksmusik? · 34 | Zeigen Sie mal Ihre Socken! · 35 | Wie ärgerlich! · 36 | Die Balance halten · 37 | Hymnen hören · 38 | Die Liebe zur Natur · 39 | Begegnung mit Seneca · 40 | Carmen lebt! · 41 | Romantisch sein · 42 | In Gefühlen schwelgen · 43 | Eine Jacke lieben · 44 | Verdrießlich sein · 45 | Vom Glück der Kinder · 46 | Ich bin ein Simulant! · 47 | Für immer treu · 48 | Ein bisschen Misstrauen · 49 | Rachegefühle · 50 | Dumm, aber glücklich
Herbstabend: Die Fülle des Denkens
51 | Ein Recht auf Melancholie · 52 | Leben nach dem 11. September · 53 | Kritik üben · 54 | Was ist ein Lebenskünstler? · 55 | Nur ein Gedanke · 56 | Philosophenweg · 57 | Weißwurst zuzeln · 58 | Vom Sinn des Knödels · 59 | Ehrenrettung · 60 | Feuer unterm Hintern · 61 | Die Liebe zum Gedankenstrich · 62 | Herbstspaziergang · 63 | In der Skylobby · 64 | Kennen Sie Knigge? · 65 | »Streetwise« · 66 | Wolken anschauen · 67 | Vom Glück des Zappens · 68 | Oh, wie peinlich! · 69 | Grenzen der Kommunikation · 70 | Im nackten Beton · 71 | Abschied nehmen · 72 | Der kleine Tod · 73 | Die Kunst des Älterwerdens · 74 | Begegnung mit dem Tod · 75 | Wenn der Tod stirbt
Winternacht: Die Fülle des Darüberhinaus
76 | So langsam wie möglich · 77 | Japanisches Glück · 78 | Der Trägheit frönen · 79 | Haben Sie geträumt? · 80 | Furchtbar fruchtbar · 81 | Abschied vom Copyshop · 82 | Im blühenden Garten · 83 | Liebeserklärung · 84 | Schmerzen fühlen · 85 | Unstillbare Sehnsucht · 86 | Was macht süchtig? · 87 | Schokopathie · 88 | »Christmas to go« · 89 | Flug zum Mars · 90 | Vom Segen der Stille · 91 | Hinter den Kulissen · 92 | Ohne jede Chance · 93 | Einsam sein · 94 | Kosmisches Gefühl · 95 | Wenn die Erde bebt · 96 | Planetare Solidarität · 97 | Was kann uns trösten? · 98 | Mit Fingerspitzengefühl · 99 | Haben Sie eine Philosophie? · 100 | Gelingendes Leben
Vorwort
Am Glück, so scheint es, führt kein Weg vorbei. Wer sich nicht vorsätzlich dagegen sperrt, wird mitgerissen, jedenfalls von der Flut der Bücher mit ihrer je eigenen »Glücksformel«, die manche glücklich macht und manche auch nicht. Am Beginn des 21. Jahrhunderts konnte man noch darauf hoffen, dass die UNO sich vielleicht der Sache annehmen würde. Denn weltweit lenkt sie die Aufmerksamkeit der Menschen durch die Benennung der Jahre: »Jahr des Kindes«, »Jahr der Frau«, »Jahr des Waldes« etc. – Wäre es nicht denkbar gewesen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und das gesamte 21. Jahrhundert zum Jahrhundert des Schweigens über das Glück zu erklären? Anstelle der Glückshysterie wäre ausreichend Zeit gewonnen worden für eine ruhigere Nachdenklichkeit darüber, was mit »Glück« eigentlich gemeint ist. Es hätte eine lange Zeit des Experiments beginnen können, ob und welches Glück Menschen für ihr Leben überhaupt brauchen. Und ob sie möglicherweise unglücklich werden, nur weil sie glauben, glücklich sein zu müssen.
Vorbei. Die Jagd nach Glück geht weiter. So bleibt nur, über die moderne Glücksverheißung hinaus noch ein anderes, fragmentarisches, widersprüchliches Glück ins Spiel zu bringen. Keine der geläufigen Arten des Glücks soll dabei außer Acht gelassen werden. Eine Rolle spielt weiterhin das Zufallsglück : Auch wenn es unverfügbar bleibt, so hängt doch einiges davon ab, ob es auf eine Haltung der Offenheit oder der Verschlossenheit trifft. Bedeutung beansprucht ebenso das Wohlfühlglück, das in moderner Zeit den Begriff des Glücks fast allein definiert: Menschen können wissen, wo, wie und mit wem sie es finden, aber es bleibt gebunden an einzelne schöne Momente und lässt sich nicht auf Dauer stellen. Daher soll hier vor allem vom dritten Glück die Rede sein, dem Glück der Fülle, jenem umfassenden Glück, das sich der Erfahrung der gesamten Fülle des Lebens verdankt. Ist dieses Glück, um dessen »Fragmente« es hier geht, erklärungsbedürftig? Es umfasst das Leben in all seiner Widersprüchlichkeit zwischen Freuden und Ängsten, Macht und Ohnmacht, Tun und Lassen, Gelingen und Misslingen, Hoffnung und Enttäuschung, Gemeinsamkeit und Einsamkeit, Liebe und Lieblosigkeit, Werden und Vergehen, Unendlichkeit und Endlichkeit, Sinn und Sinnlosigkeit, Glück und – Unglück. Die gesamte Fülle des Lebens kann nur im Besitz eines Gottes, nicht eines Menschen sein. Dem einzelnen Menschen bleiben jedoch Fragmente übrig, einzelne Stücke des Glücks, mehr oder weniger groß, die auf das Ganze verweisen, auf der glücklichen wie auf der unglücklichen Seite des Glücks. Fragmente der Fülle eines glücklichen Augenblicks. Fragmente als Vorboten eines künftigen Glücks. Fragmente als Fragezeichen eines möglichen oder unmöglichen Glücks. Fragmente als Splitter eines zerbrochenen Glücks. Fragmente bis hin zur Fragwürdigkeit. Dass das Leben überhaupt nur fragmentarisch zu haben sei, davon waren Romantiker wie Novalis und Friedrich Schlegel überzeugt: Daher pflegten sie eine Kunst des Fragments. Fragmente, so wussten sie, offerieren keine endgültigen Wahrheiten, sondern sind Provisorien »bis auf weiteres«. Sie lassen Fragen offen und geben vorläufige Antworten. Widersprüchliches und Unvereinbares koexistiert in ihnen ohne Mühe. Ein Menschsein kommt darin zum Ausdruck, das sich selbst als fragmentarisch erfährt. An diese Tradition will das vorliegende Buch wieder anknüpfen, aufmerksam auf die Polarität des Lebens, die in jedem Fragment erfahrbar ist; hingerissen von der Öffnung des Endlichen ins Unendliche, auf die jedes Fragment verweist. Dass das Leben eines Menschen zu einer stattlichen Sammlung von Fragmenten wird, ist wohl die einzige irdische Möglichkeit, die Erfüllung der Verheißung des Evangeliums nach Johannes 10, 10 zu erleben: Das Leben »in Fülle« (perissón im Griechischen) zu haben, wie dies auch unter romantischen Vorzeichen als erstrebenswert erscheint.
Die Texte erschienen ursprünglich als Kolumnen zur Lebenskunst im Rahmen der Gesellschaft in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Die kleinen Stücke laden ein zu einer Tagesreise und führen zugleich durch den Kreislauf der Jahreszeiten, wie es einer Pflege der zyklischen Zeit inmitten der linearen Zeit der Moderne entspricht: Frühlingsmorgen, Sommertag, Herbstabend, Winternacht; mit Anklängen an die frühlingshafte Fülle der Sinne, Eindrücken von der sommerlichen Fülle des Fühlens, einigen Gedanken aus der herbstlichen Fülle des Denkens, sowie winterlichen Überlegungen zur Fülle eines Darüberhinaus. Das Gewöhnliche kann dabei zur ungewöhnlichen Angelegenheit werden: Morgens aufzustehen, auf einem Stuhl zu sitzen, Socken anzuziehen, eine alte Jacke auszusortieren. Nicht ausgespart werden die alltäglichen Mühen mit der Wahrheit, dem Misstrauen, dem Ärger, dem Verdrießlichsein. Eigenarten des Sprachgebrauchs fallen auf: Das Leiden des Genitivs am Dativ und die Inflation des Wörtchens »sozusagen«. Es kommt zu merkwürdigen Begegnungen: Mit der Queen in Berlin, mit Seneca in Córdoba, mit Carmen in Sevilla. Unbeachtete Tiere und Pflanzen geraten unversehens ins Blickfeld: Eichelhäher, Birken, Veilchen, Hauswurz. Keine noch so große Kleinigkeit des Lebens wird hier missachtet, selbst eine Anleitung zum »Auszuzeln« von Weißwürsten wird dem Leser noch mitgegeben.
Spürbar werden soll in jeder Zeile der Blick auf die Dinge »mit Liebe«, dieser romantische Akt schlechthin. Das »Negative« wird dabei nicht gemieden: Der Schmerz, das Abschiednehmen, das Altern, der Tod. Unendlich lustvoll ist das Leben. Und es schmerzt unendlich. Mag es in seiner Leere, Überfülle, Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit zuweilen auch als sinnlos verworren erscheinen – durch die Fragmente hindurch sollen Zusammenhänge erkennbar werden, die eine Erfahrung von Sinn vermitteln können.
Frühlingsmorgen: Die Fülle der Sinne
1 | Aufstehen und Auferstehung
Aufwachen, aufstehen: Wie schwer das immer wieder fällt, heute Morgen zum Beispiel. Als würden Klötze an den Gliedern hängen, auch an den Gedanken: So früh am Morgen bin ich geistig unzurechnungsfähig. Sie kennen das? Warum ist das so?
Vielleicht, weil wir beim Aufwachen aus einer anderen Welt kommen: Aus der Welt der Möglichkeiten, unendlich weit und reich wie die Träume, die uns Nacht für Nacht dorthin entführen. Jeden Morgen fallen wir zurück in die Welt der Wirklichkeit: Die ist, wie sie ist, mit eng begrenzten Spielräumen für ein Anderssein. Möglich ist prinzipiell alles, wirklich hingegen nur das, was ist. Der Wechsel der Welten könnte dramatischer nicht sein.
Aufwachen und Aufstehen sind an dieser Schnittstelle, diesem Interface angesiedelt, und das ist das Problem. Es handelt sich um keine Kleinigkeit, sondern um den Übergang von einer Dimension des Seins zu einer anderen. Was uns morgens abverlangt wird, ist nichts anderes als die immer neue Inkarnation, ganz im Wortsinne: Wir müssen wieder ins Fleisch, das von dieser Welt ist, während wir seelisch und geistig noch in jener Welt weilen, die voller Möglichkeiten ist.
Die Lebenskunst kann dabei behilflich sein, den Übergang zu bewältigen, vor allem mithilfe von Ritualen: Wenn es »so wie immer« abläuft. Beispielsweise langsam sich aufzurichten, nur allmählich sich daran zu gewöhnen, dass der Tag bestimmter und begrenzter ist als die diffuse, nebulöse Welt der Nacht. Laut und vernehmlich zu ächzen und zu stöhnen, damit die Mühsal adäquaten Ausdruck findet. Sich ausgiebig der Körperpflege im Bad zu widmen, sich auch fürs Frühstück alle Zeit der Welt zu nehmen, ganz allein vielleicht mit der Zeitung. Der immer gleiche Ablauf, die eingeübte Reihenfolge sorgen dafür, nichts neu entscheiden zu müssen, sich einfach nur hingeben zu können. Das kostet zu viel Zeit? Zumindest am Sonntag haben wir sie. Eine andere Art des Aufstehens aber ist die Auferstehung. Was an Ostern eigentlich gefeiert wird, wieder mit einem Ritual, ist der umgekehrte Übergang, nämlich von der Wirklichkeit zurück zur Welt der Möglichkeiten, der göttliche Weg zu einem neuen und anderen Leben. So weit sind wir Menschen freilich jetzt noch nicht. Durch das wirkliche Leben müssen wir erst noch hindurch. Also noch etliche Male aufstehen.
2 | Gelassenheits-Gebet
»Lebenskunst«, klingt gut. Aber kann man wirklich über sein eigenes Leben bestimmen? Immer aktiv am Leben arbeiten? Stets mit seiner Gestaltung beschäftigt sein? »Ach«, stöhnen Sie, »schön wär’s!« Sie haben keine Zeit dafür. Andere Dinge drängen sich vor, Geldverdienen zum Beispiel, Ärger mit der Familie. Aber könnte ein Problem auch darin liegen, die Dinge stets anders haben zu wollen, als sie sind? Was wäre, wenn wir beliebig über unser Leben verfügen könnten? Es wäre anstrengend.
Lebenskunst kann daher nicht nur aus Selbstbestimmung bestehen. Die Gestaltung des Lebens kann nicht nur eine Aktivität sein. Ergänzend zum weit verbreiteten Aktivismus wäre eher ein »Passivismus« zu pflegen: Nicht immer alles beeinflussen zu wollen, vielmehr einiges auch auf sich beruhen lassen zu können. Es ist das Lassen, das für die Gelassenheit sorgt, ohne die eine Lebenskunst nicht denkbar ist: Offen lassen, zulassen, geschehen lassen, wachsen lassen, jemandem etwas überlassen, und, wenn möglich, auch auf andere sich verlassen.
Die Gelassenheit ist, wie so vieles, eine Frage der Übung: Sich immer wieder versuchsweise dem Leben zu überlassen, diesem unentwirrbaren Durcheinander von Freuden und Ängsten, Begegnungen und Erfahrungen, Ereignissen und Überraschungen, äußeren Notwendigkeiten und eigenen Ideen, Schicksalhaftigkeit und Widersprüchlichkeit. In der Lage zu sein, Dinge auf sich zukommen zu lassen, wenngleich nach sorgfältiger Vorbereitung auf das, was bevorsteht oder auch nur bevorstehen könnte. Und wenn es dann ganz anders kommt? Dann kommt es eben anders. Nicht alles können wir bedenken. Nicht alle Probleme der Welt können wir lösen. Nicht jetzt. So gestalten wir unser Leben nicht nur selbst, sondern lassen es auch gestalten – vom Leben.
Endlich vergeuden wir unsere Kräfte nicht mehr, sondern konzentrieren sie dort, wo sie etwas bewirken können. Souverän ist nicht der, der über alles bestimmen kann, sondern der, der relative Klarheit darüber gewinnt, wo dies möglich und sinnvoll ist und wo nicht. Ganz so, wie dies im »Gelassenheits-Gebet« zum Ausdruck kommt, das einen Gedanken des antiken Philosophen Epiktet aus dessen Handbüchlein aufgreift (Encheirídion, Aphorismus 1) und das der deutsch-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr 1943 so formuliert hat: »Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.«
3 | Zeitung lesen
Vertrautes Ritual: Die ersten tiefen Atemzüge, der erste Gang am Morgen, ein paar Schritte hinaus in die Welt, um sich die Welt ins Haus zu holen. Von größter Wichtigkeit ist diese tägliche Wiederkehr, dieses zyklische Element, das die Zeitung als Ganzes bereits verkörpert: Täglich kehrt sie im selben Format wieder, täglich zur selben Zeit, und sobald sie zu Ende gelesen ist, wird sie selbst komplett der Rezyklierung anvertraut. Betont wird das zyklische Element noch durch die regelmäßig wiederkehrenden Kolumnen. So gewinnt das moderne Leben, das die Zeit nur als vergehende kennt, wieder ein Stück der vormodernen, kreisförmigen Zeitauffassung zurück.
Welche Seite lesen Sie am liebsten in Ihrer Zeitung? Ich selbst beginne gerne mit der letzten Seite. Von hinten ist es immer am schönsten. Oder ich bewahre mir die letzte Seite bis zum Schluss auf, sozusagen als Höhepunkt der Lektüre. Die letzte Seite steht bei den meisten Zeitungen in einem starken Kontrast zur ersten. Auf der Frontpage findet sich das, was Journalisten und Politiker für das Wichtigste halten. Zuguterletzt aber (bei manchen Zeitungen nicht ganz zuletzt) ist unter »Weltspiegel«, »Vermischte Meldungen«, »Aus aller Welt« all das zu finden, was wirklich wichtig fürs Leben ist: Klatsch und Tratsch, Kuriositäten und Absurditäten, Geschichten von menschlichen Schicksalen, spektakuläre Unfälle, auch Detailinformationen zu Naturkatastrophen und ökologischen Zerstörungen. Meist aufgemacht mit Fotos von den neuesten Verliebtheiten, Trennungen, tiefsten Dekolletés. Eben all das, womit man im vorderen Teil der Zeitung nichts anzufangen weiß, sei es aus Verlegenheit oder aus Scham, sodass es nach hinten geschoben wird: Ein Fortsetzungsroman der »großen Geschichte« in Gestalt vieler kleiner Geschichten, das macht die Lektüre so spannend.
Aber das Wesentliche an der Zeitung ist, dass sie die Welt, die sie ins Haus bringt, zugleich ordnet. Die Kunst des Zeitungmachens besteht darin, die Wirklichkeit nicht einfach nur abzubilden, sondern ihr eine Form zu geben. Zeitung ist Ordnung, sonst hat sie keinen Sinn. Täglich wird diese Ordnung neu hergestellt und festgeschrieben. Daher kann morgens um sieben die Welt noch in Ordnung sein. Wenn wir mit der Lektüre fertig sind, kann dann das Chaos ruhig wieder um sich greifen.
4 | Moderne Einsamkeit
Die Morgensonne bricht durchs geöffnete Fenster herein. Eine Frau sitzt allein auf dem Bett und starrt mit leerem Blick hinaus. Draußen ist nur die obere Etage einer Fabrik zu sehen, darüber wölbt sich der blaue Himmel: Das ist Morning Sun, ein Bild des amerikanischen Malers Edward Hopper (1882 bis 1967) von 1952. Wie sehr es dem Maler auf die Haltung der Frau und ihren Gesichtsausdruck ankommt, zeigen die Studien, die er dazu gemacht hat: Sie variieren die Linie des Rückens, den Faltenwurf des Nachtkleids, die Haltung der Hände, die Neigung des Kopfes. Bis der Ausdruck der Verlorenheit gefunden ist, der offenkundig entscheidend ist: Das soll »das Leben« sein!
So hat Hopper die Befindlichkeit von Menschen in moderner Zeit dargestellt: Menschen, die in keiner Beziehung zueinander mehr leben. Menschen, die ihrer Einsamkeit preisgegeben sind. Darüber, dass Hopper der Maler der modernen Einsamkeit ist, haben viele geschrieben; schwieriger zu erklären ist jedoch, woher diese Einsamkeit rührt. Aber sie ist wohl die zwangsläufige Folge des modernen Traums von einer uneingeschränkten Freiheit: Frei von allen einschränkenden Bindungen und Beziehungen zu sein. Eine stets wachsende Zahl von Menschen will diese Freiheit genießen, die der Idee nach glücklich macht. Erst im Laufe der Zeit bemerken sie, wie unglücklich sie werden, da diese Freiheit sie einsam macht.
Auf Hoppers Bildern erscheinen verhärmte Gesichter, die keinen Trost mehr finden können. Menschen, die keinen erkennbaren Lebenszweck mehr haben. Ihre Sinnlosigkeit springt förmlich aus dem Rahmen. Die auf dem Bett ins Leere starrende Frau ist geradezu ein Monument der Hoffnungslosigkeit. Hopper hat lange überlegt, welches Spiel von Licht und Schatten den Eindruck größtmöglicher Kälte vermittelt. Das warme Licht berührt diese menschliche Gestalt nicht. Da ist kein menschlicher Blick, der sie anregen, vielleicht sogar erregen könnte. Es fehlt der modernen Zeit an Wärme, Hopper hat das frühzeitig bemerkt. Die vielen Menschen, die seine Bilder bewundern, etwa bei der ihm gewidmeten Retrospektive 2004 in Köln im Museum Ludwig, legen Zeugnis davon ab, in welchem Maße das zu einer verbreiteten Erfahrung geworden ist. Ob sich das jemals noch ändern lässt? Und von wem, wenn nicht von den einzelnen Menschen selbst?
Edward Hopper: Morgensonne (Morning Sun), 1952
Öl auf Leinwand, 71,4 × 101,9 cm, Columbus Museum of Art,
Columbus/Ohio, Howald Fund Purchase
5 | In welcher Zeit leben wir?
So individuell, wie es scheint, ist unser Leben nicht immer. Es bewegt sich immer auch in dem Rahmen, den die jeweilige Zeit ihm vorgibt. Die Zeit eröffnet Möglichkeiten und zieht zugleich Grenzen, innerhalb derer sich das individuelle Leben entfalten kann. Und in welcher Zeit leben wir jetzt? Das verrät der häufige Gebrauch einer unscheinbaren Vorsilbe: Alles ist irgendwie Re. Man kann geradezu von einer Re-Zeit sprechen.
Reformen, die als schmerzlich empfunden werden, rauben dieser Zeit jegliche Beliebtheit. Sie dienen einer Re organisation der Gesellschaft und einigen grundlegenden Neuerungen, vorausgesetzt, diese können refinanziert werden, denn wirtschaftlich droht die Re zession. Ein Vorbote der Re-Zeit war Jahre zuvor schon das Recycling von Stoffen und Materialien. Mit dieser Re zyklierung wurden Zyklen wieder eingeführt, die dem linearen Fortschritt der Moderne die Spitze brachen. Auch die Renaturierung, etwa von Flüssen, die Reduktion, etwa von Schadstoffen, die Rekonstruktion, etwa von historischen Gebäuden, hat dazu beigetragen. Und nun folgt eine Renaissance auf die andere, zuweilen ist es auch nur ein Remake. Es häufen sich die Retros, die Rückblicke; der Retro-Look ist »in«.
Währenddessen sorgt Wellness für die erforderliche Re vitalisierung, Regeneration, Rekonvaleszenz. Ressourcen aller Art werden dringend gesucht. Bei manchen macht sich schon Resignation breit, und doch ist die Re-Zeit auch eine Zeit der Reflexion, der Besinnung etwa auf verloren gegangene Werte. Selbst das neuerliche Nachdenken über die Lebenskunst dient nur einer Rekonstruktion all dessen, was existenziell wichtig ist. So kommt es in dieser Zeit zur Wiedererinnerung, Wiederentdeckung, Wiederherstellung von vielem, und einiges von dem, was voreilig als »alt« über Bord geworfen wurde, wird nun wieder zurückgeholt, repariert und reinstalliert, nicht zuletzt die Religion. Rückschau und Rückbesinnung: Die Re-Zeit löst das Pro-Zeitalter ab, das nur Vorausschau und Vorwärtsbewegung kannte, immer nur Progress und Progression, Programme, Prognosen, Projekte, Prospekte, Prozesse, Profite, Produktivität, Profanität. Pro und Re: Die Zeit, in der wir leben, wird zu einem Schaukeln zwischen zwei Vorsilben. Allerdings reicht schon die vage Erinnerung an die eigene Kindheit aus, um zu wissen: Allzu heftiges Schaukeln erzeugt Schwindelgefühle.
6 | Sozusagen
Manche Worte gebrauchen wir einfach so. Sie passieren uns, Ihnen ebenso wie mir. In verschiedener Hinsicht unterlaufen sie uns sozusagen,. Eben dieses »sozusagen« ist so ein Wort. Dermaßen häufig wird es benutzt, dass es beim Sprechen abgekürzt und schließlich ganz verschluckt wird: Sozusagen, sozsagn, szagn, szn. Der Zuhörer ist dankbar dafür, er kann es sowieso nicht mehr hören, dieses Unwort in jedem zweiten, dritten Satz.
Warum der häufige Gebrauch? Worin liegt das Ärgernis? »Sozusagen« heißt: Es wird nicht wirklich gesagt. Etwas Gesagtes wird von vornherein wieder relativiert. Sozusagen muss alles ein wenig in der Schwebe bleiben. Weil wir nicht recht wissen, was wir eigentlich sagen wollen, »das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt«. Weil wir zu nichts mehr stehen können, »ich provoziere jetzt mal ein bisschen«. Weil wir auf diese Weise eine frühzeitige Festlegung unserer Meinung zu vermeiden hoffen – denn wir könnten einen Konsens verletzen und dann »nicht mehr dazugehören«.
Mit der Formel »sozusagen« beschwören wir das Sagen, während es schon völlig nichtssagend geworden ist. Wir gehen auf Distanz zu dem, was wir sagen, und die Zuhörer auch. Vielleicht ist es langweilig geworden, etwas zu sagen, ebenso etwas zu hören. Denn alles ist bereits irgendwo, irgendwann, irgendwie von irgendwem gesagt worden; es gibt sozusagen nichts Neues mehr. Wir sprechen weiter aus reiner Gewohnheit. So implodiert der Diskurs. Schon Kant (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Paragraph 12) wusste um die Bedeutung der »Flickwörter«, wie er sie nannte: Es seien »Phrasen zu bloßer Ausfüllung der Leere an Gedanken«. Der Sprechende werde damit zu einer »Sprachmaschine«, und der Zuhörer sei »unaufhörlich besorgt, das Sprüchelchen wiederum hören zu müssen«. – Zur Abwechslung könnten wir uns anderer Formeln bedienen, »gewissermaßen« zum Beispiel. Vieles ist auch einfach nur »interessant, sehr interessant«. Vordergründig ist dies das flotte Design unseres Diskurses, im Hintergrund aber lauert das Nichts. In anderen Zeiten wäre von einer Selbstentfremdung die Rede gewesen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Trick, um Ballast abzuwerfen. Das Gewicht der Worte soll uns nicht länger belasten. Die Leichtigkeit des Seins allein soll übrig bleiben. Was aber, wenn sie unerträglich wird?
7 | Die Wahrheit sagen
Haben Sie heute schon gelogen? Entschuldigen Sie die Indiskretion. Aber es geht um die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es steht nicht gut um sie. Die Menschen sagen die Wahrheit nicht mehr. Die anderen sowieso, möglicherweise jedoch auch wir selbst. Wobei wir uns darauf beschränken, eventuell nicht immer die volle Wahrheit zu sagen; von Unwahrheit oder gar Lüge keine Spur. Manche meinen, etwas anderes als die volle Wahrheit komme niemals in Frage. Aber es genügt, sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn dem wirklich so wäre, zum Beispiel heute: Keine einzige Halbwahrheit soll über unsere Lippen kommen. Nur Mut!