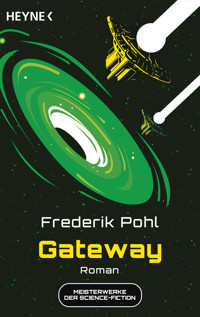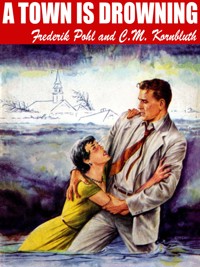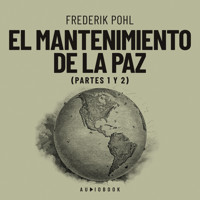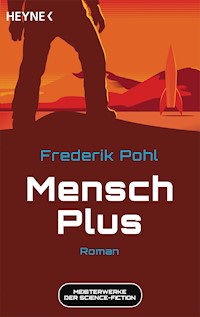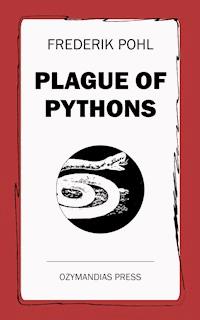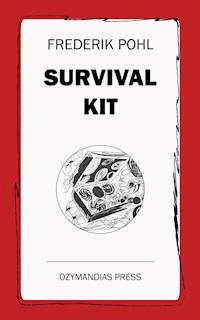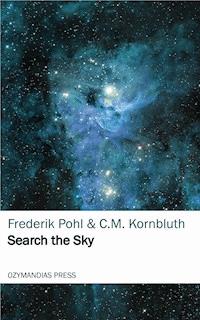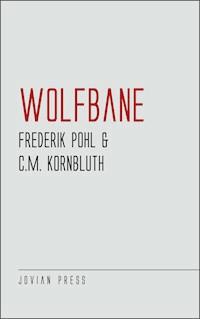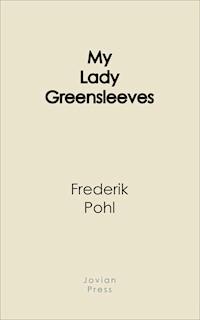5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Aufbruch ins Ungewisse
Gateway: Ein Asteroid, der in einem exzentrischen Orbit um die Sonne entdeckt wird. Von außen ein verkohlter Materieklumpen, von innen das Tor zum Universum: Gateway ist die Hinterlassenschaft, der Hitschi, einer außerirdischen Zivilisation, die vor langer Zeit ausgestorben ist. Gateway diente als Weltraumbahnhof und ist voller Schiffe, die darauf programmiert sind, mit Überlichtgeschwindigkeit in die entlegensten Winkel der Universums zu fliegen. Das Ganze hat nur einen Haken: Die Piloten wissen nicht, wo ihre Reise enden wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1359
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Gateway: Ein Asteroid, der in einem exzentrischen Orbit um die Sonne entdeckt wird. Von außen ein verkohlter Materieklumpen, von innen das Tor zum Universum. Denn Gateway ist die Hinterlassenschaft der Hitschi, einer geheimnisvollen außerirdischen Zivilisation, die offenbar vor langer Zeit ausgestorben ist. Der Asteroid diente ihr als Weltraumbahnhof, er ist gespickt mit zahllosen Raumschiffen, die darauf programmiert sind, mit Überlichtgeschwindigkeit in die entferntesten Winkel des Universums zu fliegen. Das Ganze hat nur einen Haken: Die Reisenden wissen nicht, wo ihre Reise endet. Als sich die ersten Piloten von der Erde auf den Weg machen, beginnt das größte Abenteuer in der Geschichte der Menschheit.
Ausgezeichnet mit dem Hugo Gernsback, dem Nebula und dem Locus Award, gilt Frederik Pohls »Gateway-Trilogie« heute nicht nur als Meilenstein der Science Fiction, sondern ist auch eines der beliebtesten SF-Bücher überhaupt.
»Eine zutiefst menschliche Geschichte vor dem Hintergrund der unendlichen Wunder und der rätselhaften Schönheit unseres Kosmos. Pohl hat der Science Fiction damit einen neuen Weg gewiesen.«
Ben Bova
Der Autor
Frederik Pohl zählt – neben Isaac Asimov, Robert A. Heinlein und Ray Bradbury – zu den legendären Gründervätern der amerikanischen Science Fiction. Geboren 1919 in New York, gehörte er zu den SF-Herausgebern der ersten Stunde und machte schnell auch mit eigenen Storys und Romanen von sich reden, darunter »Mensch+« und »Eine Handvoll Venus« (mit Cyril M. Kornbluth). Der Roman »Gateway«, Mitte der 70er Jahre erschienen, und die Fortsetzungsbände »Jenseits des blauen Horizonts« und »Rückkehr nach Gateway« gelten als sein bedeutendstes Werk. Pohl lebt mit seiner Familie in Illinois.
Inhaltsverzeichnis
Frederik Pohl war von Anfang an dabei – seit dem Urknall gewissermaßen, als das entstand, was heute ein weit ausgedehntes kommerzielles und kulturelles Universum (einige würden sagen: eine weit ausgedehnte Leere) aus Filmen und Fernsehserien, aus Büchern und Magazinen ist. Die Singularität, mit der alles begann, war allerdings reichlich kurios: Die Sehnsucht etwas frühreifer und etwas durchgeknallter Teenager nach einer neuen Art von »Literatur«, jener nämlich, wie sie in den so genannten Pulps, den billigen Groschenmagazinen, veröffentlicht wurde.
Zuerst nannte man es »Scientifiction«, doch der Name setzte sich nicht durch.
Dann nannte man es Science Fiction.
Es war 1935, in Brooklyn. Die Vereinigten Staaten lagen in der Agonie der »Großen Depression« (»groß« vielleicht deshalb, weil wir sie heute so sehr vermissen). Gegenwärtig ist Nostalgie das vorherrschende Gefühl in der US-amerikanischen Gesellschaft, aber damals war man gierig nach der Zukunft – und die Science Fiction hatte sich die Zukunft auf ihre Fahnen geschrieben.
Als Kunstform im weitesten Sinne gab es sie natürlich schon viel länger, seit Jules Verne und H. G. Wells, ja vielleicht seit Mary Shelley und ihrem melancholischen, mit einem elektrischen Funken zum Leben erweckten Monster (manche meinen, das Genre sei noch weitaus älter und gehe bis zu »Gullivers Reisen« oder sogar Aristophanes’ »Vögel« zurück). Als kommerzielles Produkt jedoch – und als literarische Kuriosität – gibt es die Science Fiction erst seit jener Zeit, den 20er und 30er Jahren, als überall in den USA die Pulp-Magazine an den Zeitungskiosken auftauchten, mit ihren grell-bunten Covermotiven, ihren dröhnenden Raketen, gefährlichen Laserwaffen und natürlich den vollbusigen Frauen, die von ekelhaften Außerirdischen bedroht wurden. All das war, wie die Titel dieser Magazine versprachen, Amazing, Astounding, Thrilling. In seinen Erinnerungen »The Way the Future Was« beschreibt Pohl diese aufregende Zeit so: »Mein Kopf quoll geradezu über vor Raumschiffen, Robotermädchen und unsichtbar machenden Strahlen – und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte.«
Das sollte nicht lange so bleiben. Denn die Science Fiction machte Jagd auf Leser. Und wenn die grellen Cover dabei die Köder waren und die abgedruckten Storys die Haken, dann waren die Netze die SF-Clubs, die die Magazine ins Leben riefen: die »Science Fiction League« und ihre zahllosen Abkömmlinge. Mehr als außergewöhnlich war schließlich der Fang: Pohl, sein Freund und späterer Co-Autor Cyril Kornbluth, Isaac Asimov (auch aus Brooklyn), James Blish, Judith Merril, Donald Wollheim und jede Menge anderer, darunter Ray Bradbury und Jack Williamson, die zu den ersten SF-Conventions, den gemeinsamen Fan-Treffen, kamen.
»Die meisten Leute wollten darüber reden, was sie so aßen oder einkauften oder sonst den ganzen Tag über taten«, erinnert sich Pohl. »Wir aber wollten darüber reden, was wir gelesen hatten!« Und sie redeten nicht nur. Bald gaben sie ihre eigenen Magazine heraus und veröffentlichten ihre eigenen Storys – und schufen damit das, was wir heute als Science-Fiction-Genre kennen.
Frederik Pohl war ein echtes Wunderkind. Schon als Teenager betreute er das Magazin der »International Scientific Society« (die weder besonders international noch besonders wissenschaftlich war, wie er später bemerkte), er schlief nur sporadisch, schrieb die restliche Zeit oder hing mit seinen Kumpeln von den »Futurians« herum, der ersten Fan-Abspaltung in der bald reichlich fragmentierten Science-Fiction-Szene, und redete über Raumschiffe und Robotermädchen. Er machte sich nicht die Mühe, die High School abzuschließen – er war einfach zu beschäftigt. Mit neunzehn, in den späten 30ern, hatte er zwei weitere Magazine unter seiner Ägide: Astonishing Stories und Super Science Stories. Außerdem veröffentlichte er selbst Geschichten – unter einer ganzen Palette von Pseudonymen –, vertrat seine schriftstellernden Freunde (und seine Pseudonyme) als Agent und organisierte – und boykottierte zuweilen – zahllose SF-Conventions.
Dann kam der Zweite Weltkrieg, an dem Pohl in Italien und Frankreich teilnahm. Nach New York zurückgekehrt, entschied er sich endgültig, sein Geld in dem Genre zu verdienen, das er mit geschaffen hatte. Die Große Depression war vorbei; die amerikanische Wirtschaft – und damit auch die Science Fiction – boomte; die Leser waren nicht mehr nur Jugendliche und auch nicht mehr nur Jungs. Und die Pulp-Storys genügten ihnen längst nicht mehr – sie wollten nun Romane. Also schrieb Pohl Romane, teilweise in Zusammenarbeit mit Kornbluth und Williamson und nach Maßgabe eines strengen, selbstauferlegten Regimes: vier Seiten pro Tag, wie ein Uhrwerk. Nebenbei sorgte er dafür, dass die Magazine, die er herausgab (darunter Galaxy und If), immer besser und professioneller wurden und reichlich Preise einheimsten. Eine Karriere, die den meisten von uns voll und ganz genügen würde. Nicht aber Frederik Pohl.
In den 70er Jahren stellte er fest, dass ihn die Tätigkeit als Herausgeber und Agent nicht mehr ausfüllte. Er begann, mehr zu schreiben und ernsthafter zu schreiben. Auch die Science Fiction insgesamt, die britische vor allem, war zu dieser Zeit dabei, sich bisher unbeachtete literarische Möglichkeiten anzueignen – plötzlich wurde die Sprache, der Stil, wichtig, plötzlich waren die Protagonisten wirkliche Menschen, plötzlich gab es so etwas wie Sexualität. Beides zusammen, Pohls persönliche Neuerfindung als »seriöser« SF-Schriftsteller und die Neuerfindung des gesamten Genres in Form der »New Wave«, führte zu einem in der amerikanischen Literatur äußerst seltenen Phänomen: ein zweiter Akt – und ein überaus faszinierender dazu.
Und Frederik Pohl, der immer schon ein hell leuchtender Stern war, wurde zur Nova.
Ein Merkmal von Pohls satirischem Genie ist es, dass in »Gateway« die ersten Expeditionen der Menschheit in die Weiten des Universums nicht aus wissenschaftlichen Gründen und auch nicht für Ruhm und Ehre unternommen werden, sondern aus rein kommerziellen Erwägungen.
Es geht einfach darum, Beute zu machen.
Gateway ist ein Asteroid, den man in einer exzentrischen Umlaufbahn um die Sonne entdeckt hat. Er ist von weitläufigen Tunneln durchzogen und mit zahllosen Raumschiffen gespickt, die darauf programmiert sind, ihre Passagiere zu bestimmten Orten in den Tiefen des Weltalls zu befördern, unbekannte und zuweilen sehr gefährliche Orte. Alles, was man tun muss, ist, an Bord zu gehen und loszufliegen. Die Schiffe – und der honigwabenartige Asteroid insgesamt – sind die Hinterlassenschaften einer mysteriösen und offenbar ausgestorbenen außerirdischen Zivilisation, die einst große Teile des Universums kolonisiert hatte: die Hitschi.
Die Menschen lassen sich nicht zweimal bitten. Und tatsächlich kommen einige der Gateway-Prospektoren von ihren abenteuerlichen Reisen als Millionäre zurück, die Schiffe voll beladen mit wertvollen Objekten aus der Hitschi-Kultur. Andere dagegen haben weniger Glück: Ihr Inneres wird nach außen gekehrt, oder sie verlieren den Verstand. Wieder andere kehren überhaupt nicht zurück.
Den Hitschi allerdings begegnen sie nie. Pohl, der seine Science-Fiction-Ideen schon immer auf wissenschaftlicher Plausibilität gründete, nahm an, dass selbst wenn andere Zivilisationen im Universum existieren, es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass sich ihre Lebensdauer mit der unseren überschneidet. Die Geschichte der Menschheit beginnt also zu einem Zeitpunkt, als die der Hitschi schon lange beendet ist. Ungefähr jedenfalls.
»Gateway« schlug in der Science-Fiction-Szene ein wie ein Komet. Viele konnten nicht glauben, dass der Roman von einem der bekanntesten Vertreter dieser Szene geschrieben worden war, zu ausgefeilt der Stil, zu komplex der Aufbau, verglichen jedenfalls mit den damals üblichen amerikanischen SF-Büchern. Der Text – voller Anspielungen, zart und erotisch, gewürzt mit reichlich trockenem Humor – machte außerdem Pohls Misstrauen gegenüber jeder Art von Autorität deutlich, seine Verachtung für die Exzesse des Kapitalismus und seine materialistische (also marxistische) Interpretation davon, wie Geschichte »gemacht« wird und wie Geschichte uns »macht«. All dies erinnerte an die Ursprünge der Science Fiction zur Zeit der Depression. Doch »Gateway« war auch ein Neubeginn: der erste amerikanische SF-Roman, der die psychologischen und literarischen Obsessionen der »New Wave« zu seinen Obsessionen machte, der erste, der dieses bisher unentdeckte Land betrat.
So sind die Reisen des Prospektors Robinette Broadhead in die Tiefen des Alls nichts anderes als Reisen in sein eigenes Selbst. Und so wird seine Geschichte auch elliptisch erzählt, zum großen Teil in Form eines Gesprächs mit seinem psychoanalytischen Therapieprogramm. Denn Broadhead muss damit fertig werden, dass sein enormer Erfolg als Prospektor den Verlust der Frau, die er liebt, zur Folge hatte. In Frederik Pohls Universum – so wie in Einsteins – ist eben nichts umsonst.
»Gateway« gewann alle bedeutenden SF-Preise, die es gibt: den Hugo Gernsback Award (zwar nicht Pohls erster, aber sein erster für einen Roman), den Nebula Award, den Locus Award. Damit jedoch war die Geschichte längst nicht zu Ende.
»Jenseits des blauen Horizonts«, der zweite Band, ist, wie der Titel schon vermuten lässt, noch kühner, noch komplexer: Broadhead kommt zwar noch vor, aber nur am Rande, im Mittelpunkt steht nun eine ganze Reihe anderer Figuren, darunter ein hormongeplagter Teenager, ein nervtötender alter Mann und ein nicht ganz so unschuldiges Waisenkind. Und eines der mysteriösen »Geschenke« der Hitschi ist ein periodisch auftretender, weltweiter Wahnsinn, der verheerende Folgen für die Menschheit hat.
Im dritten Teil, »Rückkehr nach Gateway«, tauchen die Hitschi dann schließlich doch auf, in all ihrer verschrobenen Größe, einen leichten Salmiakduft verbreitend, ihrer unendlichen Weisheit müde und von uns – obwohl sie uns seit der Morgenröte der menschlichen Zivilisation kennen – offenbar ebenso verwirrt wie wir von ihnen. Verwirrt insbesondere von dem, was wir Geld nennen … Das ist natürlich reinster Pohl.
Alle drei Romane haben eine begeisterte Leserschaft gefunden und etliche Epigonen nach sich gezogen. »Gateway« diente sogar als Grundlage eines sehr erfolgreichen Spiels, was eine gewisse Logik hat, sind die Reisen der Prospektoren ins Unbekannte ja selbst eine Art Spiel – eine Art Russisches Roulette, um genau zu sein.
Als Autor, Redakteur und Herausgeber war Frederik Pohl maßgeblich daran beteiligt, die Science Fiction zu schaffen, wie wir sie heute kennen; er hat etliche junge Talente zu Star-Autoren gemacht; und er hat solche Klassiker des Genres wie »Mensch+« und »Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute« geschrieben. Seine größte Errungenschaft jedoch war es, sich als Schriftsteller neu zu erschaffen, mit der Gateway-Trilogie. Sie ist selbst eine Art »Gateway« – in eine ebenso unerschöpfliche wie überzeugende Welt, eine Welt der Kugelblitze, Assassinen, die Krieg als Selbstzweck führen, Traumcouches, Albert-Einstein-Programme und CHON-Nahrung.
Eine Welt, die noch genauso begeistert, überrascht und provoziert wie zu jener Zeit, als sie entstanden ist.
Terry Bisson ist ein bekannter amerikanischer SF- und Fantasy-Autor. Zuletzt ist von ihm bei Heyne die Kurzgeschichtensammlung »Die Bären entdecken das Feuer« erschienen.
Gateway
Mein ganzes Leben lang, so weit ich zurückdenken kann, wollte ich Prospektor werden. Ich kann nicht mehr als sechs gewesen sein, als mein Vater und meine Mutter mich in Cheyenne zu einem Jahrmarkt mitnahmen. Hot Dogs und Puffsoja, Wasserstoffballons aus buntem Papier, ein Zirkus mit Hunden und Pferden, Glücksrädern, Spielen, Karussells. Und es gab ein Druckzelt mit undurchsichtigen Wänden, ein Dollar Eintritt, und im Inneren hatte jemand Importe aus den Hitschi-Tunnels auf der Venus aufgebaut. Gebetsfächer und Feuerperlen, echte Hitschi-Metallspiegel, die man für fünfundzwanzig Dollar das Stück kaufen konnte. Papa sagte, sie seien nicht echt, aber für mich waren sie echt. Wir konnten uns fünfundzwanzig Dollar für das Stück nicht leisten. Und wenn man es genau nahm, brauchte ich eigentlich auch keinen Spiegel. Sommersprossiges Gesicht, vorstehende Zähne, Haare, die ich glatt zurückkämmte und festband. Man hatte Gateway gerade erst entdeckt. Als wir an diesem Abend mit dem Flugbus heimfuhren, hörte ich meinen Vater davon sprechen. Sie dachten wohl, ich schliefe, aber der sehnsüchtige Ton in seiner Stimme hielt mich wach.
DAS HITSCHI-HAUS
Direkt aus den Verlorenen Tunnels der Venus! Seltene religiöse Artikel Kostbare Juwelen, einst von der Geheimen Rasse getragen Verblüffende wissenschaftliche Entdeckungen ALLES GARANTIERT AUTHENTISCH!
Sonderrabatt für wissenschaftliche Gruppen und Studenten DIESE PHANTASTISCHEN GEGENSTÄNDE SIND ÄLTER ALS DIE MENSCHHEIT!
Jetzt erstmals zu volkstümlichen PreisenErwachsene $ 2,50 Kinder $ 1,00 Besitzer: Dr. phil., Dr. theol. Delbert Guyne
Wären meine Mutter und ich nicht gewesen, er hätte vielleicht einen Weg gefunden, aber er bekam nie Gelegenheit dazu. Ein Jahr später war er tot. Alles, was ich von ihm erbte, war sein Posten – sobald ich groß genug war, ihn einzunehmen.
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in den Nahrungsgruben gearbeitet haben, aber Sie haben sicher schon davon gehört. Viel Freude gibt es da nicht. Ich fing, halbtags und mit halbem Lohn, als Zwölfjähriger an. Bis ich sechzehn war, hatte ich die Einstufung meines Vaters: Beschickungsbohrer – gute Bezahlung, harte Arbeit.
Aber was kann man mit dem Geld anfangen? Für medizinischen Vollschutz reicht es nicht. Es genügt nicht einmal, um damit aus den Gruben herauszukommen, was schon eine Art lokaler Erfolgsstory wäre. Man arbeitet sechs Stunden innen und zehn Stunden außen. Acht Stunden Schlaf, dann fängt man wieder an, und die Kleidung stinkt unaufhörlich nach Schiefer. Man kann nicht rauchen, außer in abgedichteten Räumen. Der Öldunst lagert sich überall ab. Die Mädchen sind so stinkig und glitschig und übermüdet wie man selbst.
So taten wir alle das Gleiche, wir arbeiteten und jagten uns gegenseitig die Frauen ab und spielten in der Lotterie. Und wir tranken in großen Mengen den billigen, starken Schnaps, der keine zehn Meilen entfernt gebrannt wurde. Manchmal hieß er Scotch, manchmal Wodka oder Bourbon, aber er stammte immer von denselben Schlammdestillier-Säulen. Ich unterschied mich nicht von den anderen … außer dass ich einmal in der Lotterie gewann. Und das war mein Freifahrtschein.
Bis dahin lebte ich einfach dahin.
Meine Mutter war auch Grubenarbeiterin. Nachdem mein Vater bei dem Schachtbrand umgekommen war, zog sie mich mithilfe der Firmenkrippe auf. Wir kamen gut miteinander aus, bis zu meiner Psychosenzeit. Ich war damals sechsundzwanzig. Ich hatte Probleme mit meinem Mädchen, dann kam ich eine Weile morgens nicht mehr aus dem Bett. Man brachte mich unter. Ich war fast ein Jahr aus dem Verkehr gezogen, und als man mich aus dem Psychotank wieder herausließ, war meine Mutter gestorben.
Man muss ehrlich sein: Das war meine Schuld. Ich meine damit nicht, dass ich das geplant hatte; ich meine, sie wäre am Leben geblieben, wenn sie nicht meinetwegen solche Sorgen gehabt hätte. Es war nicht genug Geld da, um die Behandlungskosten für uns beide zu bezahlen. Ich brauchte Psychotherapie. Sie brauchte eine neue Lunge. Sie bekam sie nicht, also starb sie.
Es war mir verhasst, in unserer Wohnung zu bleiben, nachdem sie tot war, aber entweder das oder Junggesellenunterkünfte. Der Gedanke, mit vielen Männern so eng zusammenzuleben, gefiel mir nicht. Natürlich hätte ich heiraten können. Ich tat es nicht – Sylvia, das Mädchen, mit dem ich die Probleme gehabt hatte, war inzwischen längst fort –, aber es lag nicht daran, dass ich etwas gegen die Ehe gehabt hätte. Vielleicht möchte man das meinen, wenn man an meine psychiatrische Vorgeschichte denkt und noch berücksichtigt, dass ich mit meiner Mutter zusammenlebte, solange sie am Leben war. Aber es ist nicht wahr. Ich mochte Mädchen sehr. Ich wäre sehr glücklich gewesen, eines heiraten und ein Kind aufziehen zu können.
Aber nicht in den Gruben. Ich wollte einen Sohn nicht so zurücklassen, wie mein Vater mich zurückgelassen hatte.
Beschickungsbohren ist eine verdammt harte Arbeit. Jetzt verwendet man Dampfbrenner mit Hitschi-Heizspulen, und der Schiefer splittert ganz gefügig, als hätte man Wachswürfel vor sich. Aber damals bohrten und sprengten wir. Man fuhr zu Beginn der Schicht mit dem Schnelllift den Schacht hinunter. Die Schachtwand war glitschig und stank, zwanzig Zentimeter von deiner Schulter entfernt und relativ zu dir mit sechzig Stundenkilometern unterwegs; ich habe Grubenarbeiter, die etwas getrunken hatten, stolpern und die Hand ausstrecken sehen, um sich abzustützen, worauf sie einen Stumpf zurückzogen. Dann steigt man aus dem Eimer und rutscht und stolpert einen Kilometer weit oder länger über die Laufbretter, bis man zum Flöz kommt. Man bohrt seinen Schacht. Man schiebt die Ladung hinein. Dann verdrückt man sich in einen toten Schacht, während sie sprengen, und hofft, dass man alles richtig berechnet hat und nicht die ganze stinkende, ölige Masse herunterbricht. (Wenn du lebendig begraben wirst, kannst du im losen Schiefer bis zu einer Woche überleben. Das ist vorgekommen. Wenn man nach dem dritten Tag erst gerettet wird, taugt man meistens für nichts mehr.) Wenn dann alles gut gegangen ist, weichst du den Verladern aus, die auf ihren Raupen daherkommen, während du zum nächsten Flöz gehst.
Die Masken, heißt es, entfernen das meiste an Kohlenwasserstoffen und halten den Gesteinsstaub fern. Dem Gestank können sie nichts anhaben. Ich bin auch nicht sicher, dass alle Kohlenwasserstoffe wegfiltriert werden. Meine Mutter ist nicht die Einzige in den Gruben, die eine neue Lunge brauchte – und auch nicht die Einzige, die sie nicht bezahlen konnte.
Und dann, wenn deine Schicht vorbei ist, wohin gehst du dann?
Du gehst in eine Bar. Du gehst mit einem Mädchen in ein Zimmer. Du gehst in einen Erholungsraum und spielst Karten. Du siehst fern.
Ins Freie kommst du nicht viel. Es gibt keinen Grund. Man hat ein paar kleine Parks, sorgsam gepflegt, bepflanzt, wieder bepflanzt; Rock Park hat sogar Hecken und einen Rasen. Ich wette, Sie haben noch nie einen Rasen gesehen, der jede Woche gewaschen, (mit Reinigungsmitteln) geschrubbt und geformt werden muss, weil er sonst eingeht. Die Parks überlassen wir deshalb meistens den Kindern.
Abgesehen von den Parks gibt es nur die Landschaft von Wyoming, und so weit man blicken kann, sieht sie aus wie die Oberfläche des Mondes. Nirgends Grün. Nichts am Leben. Keine Vögel, keine Eichhörnchen, keine Haustiere. Ein paar träge Bäche, die aus irgendeinem Grund unter der Ölschicht immer die Farbe eines grellen Ockerrot haben. Dabei sagt man uns, wir hätten noch Glück gehabt, weil Wyoming nur Untertagebau kannte. In Colorado, wo es Tagebau gab, war es noch schlimmer.
Mir fiel es immer schwer, das zu glauben, und daran hat sich nichts geändert, aber ich bin nie hingegangen, um selbst nachzusehen.
Und abgesehen von allem anderem sind da der Geruch und der Lärm der Arbeit. Und Sonnenuntergänge, orangebräunlich im Dunst. Der ständige Geruch. Den ganzen Tag und die ganze Nacht das Brüllen der Extraktoröfen, die den Mergel erhitzen und mahlen, um das Kerogen herauszupressen, und das Rattern der Langstrecken-Förderbänder, die den ausgelaugten Schiefer wegtransportieren, um ihn irgendwo aufzuhäufen.
Man muss nämlich das Gestein erhitzen, um das Öl herauszuholen. Wenn man es erhitzt, dehnt es sich aus wie Puffreis. Man weiß also nicht, wohin damit. Man kann es nicht wieder in den Schacht quetschen, aus dem man es herausgeholt hat; es ist zu viel davon da. Wenn man einen Berg Schiefer ausgräbt und das Öl entzieht, reicht der ausgelaugte Schiefer für zwei Berge. Und das macht man auch damit. Man baut neue Berge.
Die Abwärme der Extraktoren wärmt die Kultivierungsschuppen, und das Öl lässt seinen Schlamm wachsen, während es durch den Schuppen rinnt, und die Schlammschöpfer schöpfen es ab und trocknen und pressen es … und wir essen es, oder etwas davon, am nächsten Morgen zum Frühstück.
Komisch. Früher einmal gluckerte das Öl direkt aus dem Boden! Und alles, was die Leute damit anfingen, war, es in ihre Automobile zu schütten und zu verbrennen.
In allen Fernsehsendungen gibt es aufmunternde Werbespots, die uns mitteilen, wie wichtig unsere Arbeit ist, dass die Ernährung der ganzen Welt von uns abhängt. Alles wahr. Sie brauchen uns nicht dauernd daran zu erinnern. Wenn wir nicht täten, was wir tun, gäbe es Hunger in Texas und Kwashiorkor unter den Säuglingen in Oregon. Das wissen wir alle. Wir liefern für den Welt-Speiseplan fünf Billionen Kalorien am Tag, die Hälfte der Eiweißration für etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung. Alles aus den Hefen und Bakterien, die wir, zusammen mit den Gruben von Utah und Colorado, aus dem Schieferöl von Wyoming züchten. Die Welt braucht diese Nahrung. Aber bis jetzt hat uns das fast ganz Wyoming, die Hälfte von Appalachia, einen großen Teil des Teersandgebietes von Athabasca gekostet … und was machen wir mit all den Menschen, wenn der letzte Tropfen Kohlenwasserstoff in Hefe verwandelt ist?
Nicht mein Problem, aber ich denke trotzdem daran.
Es hörte auf, mein Problem zu sein, als ich am Tag nach Weihnachten, in dem Jahr, als ich sechsundzwanzig wurde, in der Lotterie gewann.
Der Gewinn betrug zweihundertfünfzigtausend Dollar. Genug, um ein Jahr lang wie ein König zu leben. Genug, um zu heiraten und eine Familie zu versorgen, vorausgesetzt, wir arbeiteten beide und leisteten uns nicht zu viel.
Oder genug für einen einfachen Flug nach Gateway.
Ich ging mit dem Lotterieschein zum Reisebüro und tauschte ihn gegen eine Fahrkarte. Sie waren froh, mich zu sehen; viel Geschäft machten sie dort nicht, vor allem nicht auf diesem Gebiet. Als Wechselgeld blieben mir ungefähr zehntausend Dollar. Gezählt habe ich es nicht. Ich kaufte Getränke für meine ganze Schicht, soweit es reichte. Mit den fünfzig Leuten meiner Schicht und all den Freunden und Nassauern, die sich einfanden, reichte es ungefähr vierundzwanzig Stunden. Dann wankte ich durch einen Wyoming-Schneesturm zurück zum Reisebüro. Fünf Monate später näherte ich mich dem Asteroiden und starrte durch die Bullaugen auf den brasilianischen Raumkreuzer, der uns rief. Ich war endlich auf dem Weg, Prospektor zu werden.
Sigfrid schließt nie ein Thema ab. Er sagt nie: ›Tja, Bob, ich glaube, darüber haben wir genug gesprochen.‹ Aber manchmal, wenn ich lange Zeit auf der Matte gelegen habe, ohne viel zu reagieren, Witze reißend oder durch die Nase summend, sagt er nach einer Weile: »Ich glaube, wir könnten zu einem anderen Gebiet zurückkehren, Bob. Vor einiger Zeit hast du etwas gesagt, dem wir nachgehen könnten. Kannst du dich noch erinnern, als du das letzte Mal …«
»Als ich das letzte Mal mit Klara gesprochen habe?«
»Ja, Bob.«
»Sigfrid, ich weiß immer, was du sagen willst.«
»Das macht nichts, Bob. Wie ist es? Willst du darüber reden, was du damals empfunden hast?«
»Warum nicht?« Ich säubere den Nagel meines rechten Mittelfingers, indem ich ihn zwischen den beiden unteren Vorderzähnen hindurchziehe. Ich betrachte ihn und sage: »Es ist mir klar, dass es eine wichtige Zeit war. Vielleicht der schlimmste Augenblick meines Lebens. Sogar noch schlimmer als das mit Sylvia, oder der Augenblick, als ich vom Tod meiner Mutter erfuhr.«
»Soll das heißen, dass du lieber von diesen Dingen sprechen willst, Rob?«
»Durchaus nicht. Wenn du sagst, ich soll von Klara sprechen, sprechen wir von Klara.«
Und ich lege mich auf der Schaummatte zurecht und denke eine Weile nach. Transzendentale Einsicht hat mich sehr interessiert, und manchmal, wenn ich meinem Verstand ein Problem stelle und einfach damit anfange, unablässig mein Mantra herunterzubeten, tauche ich mit der Lösung des Problems wieder auf: Verkauf die Fischfarm-Aktien in Baja und kauf an der Warenbörse Installationsartikel. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Oder: Fahr mit Rachel nach Merida, zum Wasserskifahren in der Bucht von Campeche. Damit bekam ich sie erstmals in mein Bett, nachdem ich alles andere vergeblich versucht hatte.
Und dann sagt Sigfrid: »Du reagierst nicht, Rob.«
»Ich denke über das nach, was du gesagt hast.«
»Bitte, denk nicht darüber nach, Rob. Du sollst reden. Sag mir jetzt, was du für Klara empfindest.«
Ich versuche, ehrlich darüber nachzudenken. Sigfrid lässt mich dazu nicht in TE gehen, und so suche ich in meinem Gemüt nach unterdrückten Gefühlen.
»Tja, nicht viel«, sage ich. »Jedenfalls nicht viel an der Oberfläche.«
»Erinnerst du dich an das damalige Gefühl, Bob?«
»Natürlich.«
»Versuch zu empfinden, was du damals empfunden hast, Bob.«
»Gut.« Gehorsam rekonstruiere ich in meinem Inneren die Situation. Da bin ich und spreche über Funk mit Klara. Dane schreit etwas in der Landekapsel. Wir sind alle halb verrückt vor Angst. Unter uns öffnet sich der blaue Nebel, und ich sehe zum ersten Mal den verschwommenen Skelettstern. Das Dreier-Schiff – nein, es war ein Fünfer … Jedenfalls stinkt es nach Erbrochenem und Schweiß. Mein Körper schmerzt.
Ich kann mich genau erinnern, obwohl ich lügen würde, wenn ich sagen wollte, ich ließe meine Gefühle zu.
Ich sage leichthin, halb glucksend: »Sigfrid, da sind Schmerz und Schuld und Elend von einer Heftigkeit, mit der ich einfach nicht fertig werde.« Manchmal versuche ich das bei ihm und spreche eine Art schmerzhafter Wahrheit in dem Tonfall aus, mit dem man bei einer Cocktailparty einen Kellner bittet, noch einen Rumpunsch zu bringen. Das mache ich, wenn ich seinen Angriff ablenken will. Ich glaube nicht, dass es wirkt. Sigfrid hat eine Menge Hitschi-Schaltungen in sich. Er ist viel besser, als es die Maschinen im Institut waren, zur Zeit meiner Psychose. Er misst fortwährend alle meine physischen Lebensäußerungen: Hautleitfähigkeit, Puls, Betawellenaktivität und so weiter. Er erhält Anzeigen von den Gurten, die mich auf der Matte festhalten, registriert, wie heftig ich mich herumwerfe. Er überwacht mein Stimmvolumen und sucht das Stimmmuster nach Untertönen ab. Und er versteht auch, was die Worte bedeuten. Sigfrid ist außerordentlich schlau, wenn man bedenkt, wie dumm er ist.
Manchmal ist es sehr schwer, ihn zu übertölpeln. Am Ende einer Sitzung bin ich völlig ausgelaugt und habe das Gefühl, dass ich, wäre ich nur noch eine Minute bei ihm geblieben, unmittelbar in diesen Schmerz hinabgestürzt wäre und er mich vernichtet hätte.
Oder geheilt. Vielleicht ist das dasselbe.
Da war also Gateway und wurde hinter den Bullaugen des von der Erde gekommenen Schiffes immer größer und größer.
Ein Asteroid. Oder vielleicht der Kern eines Kometen. Durchmesser etwa zehn Kilometer. Birnenförmig. Von außen sieht er aus wie ein verkohlter Klumpen mit blauen Glitzerstellen. Im Inneren ist er das Tor zum Universum.
Sheri Loffat lehnte an meiner Schulter, während der Rest unseres Haufens von Möchtegern-Prospektoren sich hinter uns drängte und die Augen aufriss.
»Mensch, Bob! Schau dir die Kreuzer an!«
»Wenn ihnen irgendetwas nicht passt, sprengen sie uns«, sagte jemand hinter uns.
»Es stimmt ja alles bei uns«, meinte Sheri, gab ihrer Bemerkung aber einen fragenden Unterton. Die Kreuzer sahen wirklich bedrohlich aus, eifersüchtig den Asteroiden umkreisend, darauf achtend, dass niemand, der hierher kam, die Geheimnisse stiehlt, die mehr wert sind, als jemals einer bezahlen könnte.
Wir klammerten uns an die Bullaugenstützen, um sie anzugaffen. Narretei war das. Wir hätten getötet werden können. Es sprach zwar nicht viel dafür, dass die Kursangleichung unseres Schiffs an Gateway oder der brasilianische Kreuzer eine größere Menge an Delta-V erfordern würde, aber es bedurfte nur einer schnellen Kurskorrektur, um uns zu zerfetzen. Und es bestand stets die Möglichkeit, dass unser Schiff eine Vierteldrehung machen und wir plötzlich in die nackte, nahe Sonne starren würden. Das hieß Blindheit für immer, aus dieser Nähe. Aber wir wollten sehen.
Der brasilianische Kreuzer ersparte sich die Mühe des Andockens. Wir sahen Blitze hin und her zucken und wussten, dass sie unser Schiffsmanifest mit Laserstrahlen prüften. Das war normal. Ich sagte, die Kreuzer hätten Ausschau nach Dieben gehalten, aber in Wirklichkeit sollten sie sich eher gegenseitig bewachen, als sich um andere Gedanken machen, uns eingeschlossen. Die Russen verdächtigten die Chinesen, die Chinesen die Russen, die Brasilianer die Venusianer. Alle verdächtigten die Amerikaner.
So beobachteten die vier anderen Kreuzer gewiss die Brasilianer schärfer als uns. Aber wir alle wussten, wenn unsere verschlüsselten Geleitscheine nicht dem entsprochen hätten, was die fünf verschiedenen Konsulate am Abflughafen auf der Erde übermittelt hatten, wäre der nächste Schritt kein Einspruch gewesen, sondern ein Torpedo.
Es ist komisch. Ich konnte mir diesen Torpedo vorstellen. Ich konnte mir den Soldaten mit dem kalten Blick vorstellen, der zielen und feuern würde, und wie unser Schiff als eine Fackel aus orangerotem Licht aufflammen und wir alle in Atome zerlegt würden … Nur war der Torpedoschütze auf diesem Schiff damals ein Waffenmaat namens Francy Hereira, da bin ich ziemlich sicher. Wir wurden später recht gute Freunde. Er war nicht das, was man ernsthaft einen eiskalten Killer nennen würde. Ich weinte nach meiner Rückkehr von meinem letzten Flug in meinem Hospitalzimmer den ganzen Tag in seinen Armen, während er mich eigentlich nach Schmuggelgut durchsuchen sollte. Und Francy weinte mit.
Der brasilianische Kreuzer flog davon, und wir drückten uns an allen erreichbaren Bullaugen die Nasen platt, dann zogen wir uns ans Fenster mit den Griffen zurück, als unser Schiff sich Gateway näherte.
»Sieht aus wie ein Pockenfall«, sagte jemand aus der Gruppe.
So war es, und manche der Pockennarben waren offen. Das waren die Docks für die Schiffe, die zu einer Mission unterwegs waren. Manche würden für immer offen bleiben, weil die Schiffe nicht zurückkommen würden. Aber die meisten der Pockennarben waren überwölbt von Buckeln, die aussahen wie Pilzkappen.
Diese Kappen waren die Schiffe selbst, das, worum es bei Gateway überhaupt ging.
Die Schiffe waren nicht leicht zu sehen. Gateway selbst übrigens auch nicht. Der Asteroid hatte schon von Haus aus eine niedrige Albedo und war nicht sehr groß: wie gesagt, in der Längsachse etwa zehn Kilometer, die Hälfte davon am Rotationsäquator. Aber man hätte ihn entdecken können. Nachdem diese erste Tunnelratte sie hingeführt hatte, begannen die Astronomen einander zu fragen, weshalb er nicht schon hundert Jahre früher bemerkt worden war. Jetzt, wo sie wissen, wo sie suchen müssen, finden sie ihn. Manchmal erreicht er, von der Erde aus gesehen, die Lichtstärke eines Sterns siebzehnter Größe. Das ist hell. Man möchte glauben, er wäre bei einem routinemäßigen Vermessungsprogramm entdeckt worden.
Die Sache ist die: Es gab nicht so viele routinemäßige Vermessungsprogramme in dieser Richtung, und Gateway war offenkundig nicht da, wo sie suchten, wenn sie suchten.
Die Stellarastronomie richtete ihr Augenmerk gewöhnlich von der Sonne fort. Die Solarastronomie blieb gewöhnlich in der Ekliptikebene – und Gateway hat eine rechtwinklige Umlaufbahn. So fiel es durch das Sieb.
Das Piezophon schnalzte und sagte: »Andocken in fünf Minuten. Zurück in die Kojen. Gurtnetz anlegen.«
Wir waren fast da.
Sheri Loffat streckte die Hand aus und hielt die meine unter dem Netz. Ich drückte die ihre. Wir waren nie miteinander im Bett gewesen – sie hatte auf dem Schiff gleich die Koje neben mir belegt, aber das, was zwischen uns ablief, war beinahe sexuell. So, als vereinten wir uns auf die großartigste, beste Weise, die es überhaupt geben konnte; doch es war nicht Sex, es war Gateway.
Als die Menschen auf der Venusoberfläche herumzustochern begannen, fanden sie die Hitschi-Grabungen.
Sie fanden keine Hitschi. Wer immer die Hitschi auch gewesen sein, wann immer sie auf der Venus gewesen sein mochten, sie waren fort. Nicht einmal eine Leiche in einem Grab war zurückgeblieben, damit man sie hätte ausgraben und sezieren können. Alles was es gab, waren die Tunnels, die Höhlen, die wenigen, armseligen kleinen Artefakte, die technologischen Wunderdinge, über die menschliche Wesen sich die Köpfe zerbrachen, bemüht, sie nachzubauen.
(Niederschrift von Fragen und Antworten, Vortrag Professor Hegramet.)
Frage: Wie sahen die Hitschi aus?
Professor Hegramet: Das weiß niemand. Wir haben nie etwas gefunden, was einer Fotografie oder einer Zeichnung gleicht, abgesehen von zwei oder drei Karten. Oder einem Buch.
F: Hatten sie nicht irgendein System der Wissensspeicherung, wie die Schrift?
Professor Hegramet: Nun, das muss natürlich der Fall gewesen sein. Aber worin es bestand, weiß ich nicht. Ich habe eine Vermutung … na, mehr ist es auch nicht.
F: Nämlich?
Professor Hegramet: Tja, denken Sie an unsere eigenen Speichermethoden, und wie sie in vor-technologischen Zeiten aufgenommen worden wären. Hätten wir, sagen wir, Euklid ein Buch gegeben, dann hätte er dahinter kommen können, was es war, selbst wenn er nicht verstanden hätte, was darin stand. Aber was wäre, wenn wir ihm eine Tonbandkassette gegeben hätten? Er hätte nicht gewusst, was er damit anfangen soll. Ich habe den Verdacht, nein, die Gewissheit, dass wir Hitschi-›Bücher‹ besitzen, die wir einfach nicht erkennen. Ein Barren Hitschi-Metall. Vielleicht die Q-Spirale in den Schiffen, deren Funktion wir nicht verstehen. Das ist kein neuer Gedanke. Sie sind alle nach Magnetkodes untersucht worden, nach Mikrorillen, nach chemischen Mustern – nichts hat sich ergeben. Aber wir besitzen vielleicht das Instrument nicht, das wir brauchen, um die Botschaften zu entschlüsseln.
F: Etwas begreife ich an den Hitschi einfach nicht. Warum haben sie diese ganzen Tunnels und Höhlen hinterlassen? Wohin sind sie gegangen?
Professor Hegramet: Junge Dame, da bin ich ebenso überfragt wie Sie.
Dann fand jemand eine Hitschi-Karte des Sonnensystems. Da waren Jupiter mit seinen Monden, Mars, die äußeren Planeten und das Paar Erde-Mond. Und die Venus, auf der schimmernden blauen Fläche der Hitschi-Metallkarte schwarz eingezeichnet. Und der Merkur, und noch etwas, das Einzige, was außer der Venus schwarz markiert war: ein Umlaufkörper, der seine Bahn diesseits des Perihels von Merkur und außerhalb der Umlaufbahn der Venus zog, im rechten Winkel zur Ekliptikebene, sodass er beiden nie wirklich nahe kam. Ein Körper, der von irdischen Astronomen nie entdeckt worden war. Mutmaßung: ein Asteroid oder ein Komet – der Unterschied war nur semantischer Art –, der für die Hitschi aus irgendeinem Grund von besonderer Bedeutung gewesen war.
Wahrscheinlich hätte früher oder später eine Teleskopsonde diesen Hinweis weiter verfolgt, aber das war nicht notwendig. Der berühmte Sylvester Macklen – der bis dahin nicht im Mindesten berühmt, sondern nur eine von vielen Tunnelratten auf der Venus war – fand ein Hitschi-Schiff, verfügte sich nach Gateway und starb dort. Es gelang ihm jedoch, den Leuten zu zeigen, dass er dort war, indem er sein Schiff auf geschickte Weise in die Luft sprengte. Man lenkte eine NASA-Sonde von der Chromosphäre der Sonne hinüber, und Gateway wurde vom Menschen erreicht und geöffnet.
Im Inneren befanden sich die Sterne.
Im Inneren, um weniger poetisch zu sein und mehr dem Wortsinn zu entsprechen, befanden sich fast tausend kleine Raumfahrzeuge, die so ähnlich aussahen wie dicke Pilze. Es gab sie in mehreren Formen und Größen. Die kleinsten trugen oben kleine Knöpfe, wie die Pilze, die man in den Tunnels von Wyoming züchtet, wenn der ganze Schiefer abgebaut ist, und dann im Supermarkt verkauft. Die größten waren spitz wie Morcheln. In den Kappen der Pilze befanden sich Unterkünfte und eine Energiequelle, die niemand verstand. Die Stiele waren chemische Raketen, wie die der alten Mondlandefahrzeuge der ersten Weltraumprogramme.
Niemand war je dahinter gekommen, wie die Kappen angetrieben wurden oder wie man sie lenken konnte.
Das war eines der Dinge, die uns alle nervös machten: die Tatsache, dass wir uns auf etwas einlassen würden, das niemand verstand. Man hatte buchstäblich keine Kontrolle, sobald man mit einem Hitschi-Schiff fortflog. Der Kurs war in ihr Lenksystem einprogrammiert, auf eine Weise, die niemand zu begreifen vermochte; man konnte sich einen Kurs aussuchen, aber dann war auch schon Schluss – man wusste nicht, wohin er einen führen würde, wenn man ihn sich ausgesucht hatte, so wenig, wie man weiß, was in einer Wundertüte steckt, bevor man sie aufmacht.
Aber sie funktionierten. Sie funktionierten immer noch, nach, wie es heißt, vielleicht einer halben Million Jahren.
Der Erste, der den Mut hatte, in ein solches Schiff zu steigen und damit loszufliegen, hatte Erfolg. Das Schiff erhob sich aus seinem Krater auf der Oberfläche des Asteroiden. Es wurde verschwommen und grell, dann verschwand es.
Und drei Monate später war es wieder da, mit einem halb verhungerten, glotzenden Astronauten, der vor Triumph glühte. Er war bei einem anderen Stern gewesen! Er hatte einen großen, grauen Planeten mit wirbelnden, gelben Wolken umflogen, hatte die Steuerung zurückstellen können und war von den eingebauten Lenksystemen zu genau derselben Pockennarbe zurückgebracht worden.
Man schickte ein zweites Schiff hinaus, diesmal eines der großen, spitzen, morchelartigen, mit einer Besatzung von vier Mann und vielen Rationen und Instrumenten. Sie waren nur etwa fünfzig Tage unterwegs. In dieser Zeit hatten sie nicht nur ein anderes Sonnensystem erreicht, sondern sogar die Landekapsel benutzt, um zur Oberfläche eines Planeten hinunterzufliegen. Dort unten lebte nichts … aber früher einmal hatte dort etwas gelebt.
Sie fanden die Überreste. Nicht sehr viel. Ein paar demolierte Trümmer auf einem Berggipfel, welcher der allgemeinen Verwüstung des Planeten entgangen war. Aus dem radioaktiven Staub hatten sie einen Ziegel geholt, eine Keramikstange, ein halb zerschmolzenes Ding, das so aussah, als wäre es einmal eine Chromflöte gewesen.
Dann begann der Ansturm auf die Sterne … und wir nahmen daran teil.
Sigfrid ist eine sehr schlaue Maschine, aber manchmal komme ich nicht dahinter, was bei ihm nicht stimmt. Er verlangt dauernd, dass ich ihm meine Träume schildere. Und dann erscheine ich, ganz erfüllt von einem Traum, bei dem ich überzeugt bin, dass er begeistert sein wird, ein Großer-roter-Apfel-für-den-Lehrer-Traum, voller Penissymbole und Fetischismus und Schuldverdrängung – und er enttäuscht mich. Er kommt auf irgendetwas ganz Verrücktes zu sprechen, das überhaupt nichts mit dem Traum zu tun hat. Ich erzähle ihm alles, und er sitzt da und rattert und surrt und summt eine Weile – das tut er zwar gar nicht, aber ich bilde es mir ein, während ich warte –, und schließlich sagt er: »Kommen wir auf etwas anderes zurück, Bob. Mich interessieren manche der Dinge, die du über diese Frau, Gelle-Klara Moynlin, gesagt hast.«
»Sigfrid, du jagst wieder Hirngespinsten nach«, antworte ich.
»Das glaube ich nicht, Bob.«
»Aber der Traum! Mein Gott, siehst du denn nicht, wie wichtig er ist? Was hältst du von der Mutterfigur darin?«
»Wie wäre es, wenn du zulassen würdest, dass ich meine Aufgabe erfülle, Bob?«
»Habe ich die Wahl?«, frage ich mürrisch.
»Du hast immer eine Wahl, Bob, aber ich möchte sehr gerne etwas zitieren, was du vor einiger Zeit gesagt hast.« Er verstummt, und ich höre meine eigene Stimme, die er aufgezeichnet hat: »Sigfrid, da sind Schmerz und Schuld und Elend von einer Heftigkeit, mit der ich einfach nicht fertig werde.«
Er wartet darauf, dass ich etwas sage. Nach einer kurzen Pause äußere ich mich.
»Hübsche Aufzeichnung«, räume ich ein, »aber ich möchte lieber darüber reden, wie meine Mutterfixierung in meinem Traum zum Tragen kommt.«
»Ich glaube, es wäre produktiver, der anderen Sache nachzugehen, Bob. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in einer inneren Beziehung stehen.«
»Wirklich?« Ich bin genau in der richtigen Verfassung, diese theoretische Möglichkeit auf distanzierte und philosophische Weise zu besprechen, aber er kommt mir zuvor: »Dein letztes Gespräch mit Klara, Bob. Bitte, sag mir, was du dabei empfindest.«
»Das habe ich dir schon gesagt.« Mir macht das alles gar keinen Spaß, es ist reine Zeitverschwendung, und ich sorge dafür, dass er das durch den Tonfall meiner Stimme und die Gespanntheit meines Körpers unter den Gurten erfährt. »Es war noch schlimmer als bei meiner Mutter.«
»Ich weiß, dass du lieber über deine Mutter reden würdest, Rob, aber bitte, nicht gerade jetzt. Erzähl mir von damals mit Klara. Was empfindest du dabei in diesem Augenblick?«
Ich versuche, ehrlich darüber nachzudenken. So viel kann ich schließlich tun. Ich brauche es ja nicht unbedingt auszusprechen. Aber alles, was ich zu sagen vermag, ist: »Nicht viel.«
Nach kurzem Warten sagt er: »Ist das alles, ›nicht viel‹?«
»Das ist alles. Nicht viel.« Jedenfalls nicht viel an der Oberfläche. Ich erinnere mich aber, was ich damals gefühlt habe. Ich öffne diese Erinnerung ganz langsam, um zu sehen, wie es gewesen ist. Hinab in diesen blauen Nebel. Den trüben Geisterstern zum ersten Mal sehen. Mit Klara über Funk sprechen, während Dane mir ins Ohr flüstert … Ich schließe sie schnell wieder.
»Das tut alles sehr weh, Sigfrid«, sage ich im Gesprächston. Manchmal versuche ich, ihn hereinzulegen, indem ich emotionell belastete Dinge auf die Art und Weise sage, wie man eine Tasse Kaffee bestellt, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Sigfrid achtet auf Volumen und Untertöne, aber auch auf Atmung und Pausen, nicht nur auf den Tonfall der Stimme. Er ist außerordentlich schlau, wenn man bedenkt, wie dumm er ist.
Fünf Unteroffiziere, von jedem Kreuzer einer, tasteten uns ab, prüften unsere Ausweise und übergaben uns einer Sichtungsangestellten der Gesellschaft. Sheri kicherte, als der Russe eine empfindliche Stelle berührte, und flüsterte: »Was glauben sie denn, dass wir einschmuggeln, Rob?«
Ich winkte ab. Die Frau aus der Verwaltung hatte unsere Landekarten von dem chinesischen Feldwebel übernommen, der den Trupp anführte, und rief unsere Namen auf. Wir waren insgesamt acht.
»Willkommen an Bord«, sagte sie. »Jeder von euch Fischen bekommt einen Proktor zugeteilt. Er wird euch helfen, euch einzuleben, eure Fragen beantworten, euch erklären, wo ihr euch zur Untersuchung und zum Unterricht einfinden müsst. Außerdem wird er euch einen Durchschlag des Vertrages zum Unterschreiben geben. Jedem von euch sind von dem Bargeld, das ihr in eurem Schiff deponiert habt, elfhundertfünfzig Dollar abgezogen worden; das ist eure Lebenserhaltungs-Steuer für die ersten zehn Tage. Über den Rest könnt ihr jederzeit mit einem P-Scheck verfügen. Euer Proktor zeigt euch das. Linscott!«
Der ältere Farbige aus Baja California hob die Hand.
»Ihr Proktor ist Shota Taraswili. Broadhead!«
»Hier.«
»Dane Metschnikow«, sagte die Angestellte.
Ich wollte mich umsehen, aber die Person, die Dane Metschnikow sein musste, kam schon auf mich zu. Er packte mich am Arm, begann mich wegzuführen und sagte dann erst: »Hallo.«
Ich zögerte. »Ich möchte mich von meinen Freunden verabschieden …«
»Ihr seid alle im gleichen Bereich«, knurrte er. »Los!«
So hatte ich zwei Stunden nach meiner Ankunft auf Gateway ein Zimmer, einen Proktor und einen Vertrag. Die Vereinbarung unterschrieb ich sofort. Ich las sie nicht einmal durch. Metschnikow sah mich erstaunt an.
»Wollen Sie denn nicht wissen, was da steht?«
»Jetzt nicht.« Ich meine, wo war der Vorteil? Wenn mir nicht gefallen hätte, was da stand, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt, und welche Wahl blieb mir eigentlich noch? Ein Prospektor zu sein, ist ziemlich unheimlich. Ich hasse den Gedanken, getötet zu werden. Ich hasse den Gedanken, überhaupt jemals sterben zu müssen, nicht mehr am Leben zu sein, zu wissen, dass alles aufhört, dass all die anderen Menschen weiterleben und Sex und Spaß haben, während ich nicht mehr dabei bin. Aber ich hasste das nicht so sehr wie die Vorstellung, in die Nahrungsgruben zurückzukehren.
Metschnikow hängte sich mit dem Kragen an einen Wandhaken, um mir nicht im Weg zu sein, während ich meine Sachen verstaute. Er war ein gedrungener, blasser Mann, nicht sehr gesprächig. Er schien nicht sehr sympathisch zu sein, aber wenigstens lachte er mich nicht aus, weil ich ein ungeschickter junger Fisch war. Auf Gateway herrscht nahezu Schwerelosigkeit. Ich hatte nie zuvor niedrige Schwerkraft erlebt; in Wyoming gibt es nicht viel davon, und so verschätzte ich mich immer wieder. Als ich ihm das sagte, meinte Metschnikow: »Sie gewöhnen sich daran. Haben Sie was zu essen?«
»Leider nicht.«
Er seufzte und sah ein wenig aus wie ein an die Wand gehängter Buddha, die Beine angezogen. Er blickte auf seine Zeitskala und sagte: »Später führe ich Sie auf einen Drink aus. Das ist der Brauch. Nur wird es vor zweiundzwanzig Uhr nicht sehr interessant. Die ›Blaue Hölle‹ ist erst dann voller Leute, und ich werde Sie mit einigen bekannt machen. Sehen Sie selbst, was Sie finden können. Was sind Sie, normal, homo, was?«
»Ziemlich normal.«
»Auch gut. Aber darum müssen Sie sich selber kümmern. Ich stelle Sie den Leuten vor, die ich kenne, alles Weitere müssen Sie selber machen. Daran sollten Sie sich gleich gewöhnen. Haben Sie Ihre Karte?«
»Karte?«
Vereinbarung