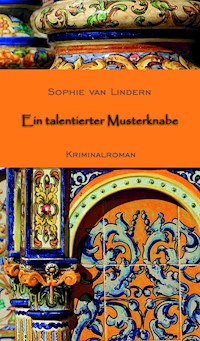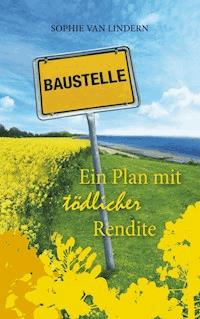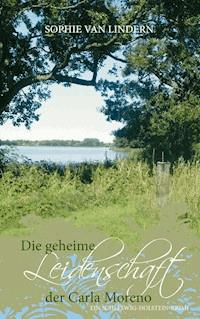
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das liebliche Angeln im Norden Schleswig-Holsteins ist nicht nur der Rahmen für sommerliche Musikfeste auf dem Dorf. Hier gibt es hinter geharkten Wegen und gerafften Gardinen auch Betrug, Zwietracht und, an einem heißen Augusttag, Mord, und das vor der Haustür von Carla Moreno, die eine Schwäche für Geheimnisse hat. Die Außenseiterin auf dem Dorf kommt dabei dem ermittelnden Kriminalhauptkommissar Stefan Kleyn in die Quere – und dem Mörder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es ist ein schwüler Tag im August. Auf Gut Langen in Angeln trifft sich die Prominenz zu einem Sommerkonzert. Doch ehe die Musik beginnt, wird in einem Salon des Herrenhauses ein junges Mädchen tot aufgefunden – vergiftet. Die Polizei ist ratlos. Zumal niemand weiß, ob das Gift dem Mädchen oder einem der Gutsbewohner gegolten hat, die heillos zerstritten sind.
Carla Moreno, Hotelbesitzerin und Künstlerin, die nach Jahren in Spanien in ihre Heimat Schleswig-Holstein zurückkehrte, nimmt, sehr zum Ärger des eitlen Kriminalhauptkommissars Stefan Kleyn, die Fährte auf. Denn Geheimnisse sind ihre Leidenschaft.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
1.
Carla Moreno fluchte: »Verdammt! Ausgerechnet heute!« Sie sah zum Himmel. Die Wolken hingen tiefschwarz über dem See. Und sie hatte noch einen Weg von gut zehn Minuten bis nach Hause, denn sie musste das Fahrrad schieben: einen Korb mit Kartoffeln auf dem Gepäckträger, Taschen mit Gemüse und Obst am Lenker – unmöglich zu fahren. Und die Dorfstraße ging stetig bergauf. Es war schwül an diesem August-Sonnabend. Carla schwitzte. »Verdammt, warum habe ich nicht das Auto genommen!«
Eigentlich wollte sie nur ein paar Kleinigkeiten im Supermarkt auf der Südseite des Dorfes besorgen und war locker bergab geradelt – um auf dem Weg schnell noch ein paar Kalorien zu verbrennen. Denn Carla hatte in der Frühe bei der Bilanz vor dem Badezimmerspiegel festgestellt, dass sie sich im Hinblick auf den Taillenumfang demnächst auf der Zielgeraden zur Matrone befinden würde, wenn sie nicht entweder die Essensrationen entschieden kürzte oder die Bewegung massiv ausweitete. Weil der Gedanke an Diät ihre Laune empfindlich beeinträchtigte, entschied sie sich für die Bewegung.
Leider im falschen Augenblick. Voller Enthusiasmus war sie losgeradelt, hatte großzügig eingekauft in der Gewissheit, dass sie das Mahl, das sie für den Abend plante, ja schon präventiv auf der Dorfstraße abstrampelte. Aber jetzt zog ein schweres Gewitter über dem Langensee auf. Schon jagten erste Windböen über die kopfsteingepflasterte Dorfstraße und wirbelten Sand auf. Carla Moreno blieb stehen, streckte den angestrengten Rücken und nahm den restlichen Weg in Angriff.
Ein Pritschenwagen fuhr haarscharf an ihr vorbei. Die Reifen ratterten über die Steine, und der Fahrer hupte und winkte fröhlich – Klaus Möller, der Gastwirt und Bürgermeister. »Schwachkopf«, schimpfte Carla, »hätte mich doch mitnehmen können.« Sie schob mürrisch das Fahrrad weiter, sah, wie Lisa, die Kellnerin im Gasthaus »Seewirt«, die Sonnenschirme auf der Terrasse zusammenklappte und wie Henriette, die Frau des Pastors Josua Blunck, im Haus neben der Kirche in der Küche hantierte. »Wahrscheinlich bereitet sie gerade einen ihrer gesunden Gemüseaufläufe«, dachte Carla. »Dem armen Mann wachsen bald Hasenzähne.«
Nach Westen hinüber jenseits des Sees sah sie eine Kolonne von Wagen langsam über den Feldweg rangieren, und da fiel ihr ein, dass am Nachmittag ein Konzert auf Gut Langen stattfinden sollte, eine der Veranstaltungen, mit denen sich der Ort Langenbek am Langensee in das Programm der Norddeutschen Musikfeste auf dem Lande reihte – der Stolz des Gutsherrn und die Hoffnung der Gemeinde, die sich für die Gegenwart kulturellen Glanz und für die Zukunft noch mehr Ausflügler und Touristen erhoffte. Aber bei dem Wetter ...
Die Gäste, die sich ganz nach britisch edler Glyndebourne-Manier bereits auf dem Rasen vor dem Gutshaus zum Picknick niedergelassen hatten, mussten wieder einpacken. Weg mit dem Champagner oder dem Supermarktsekt, dem teuren Picknickkorb im Nostalgielook oder dem Käsegebäck und den Salzstangen. Die Wolldecken eingerollt mit dem Blick zum Himmel und der Hoffnung, dass in der Konzertpause das Wetter abgezogen sein würde und man dann die zweite Flasche Champagner würde entkorken können; es war natürlich immer von Champagner die Rede bei den Schlosskonzerten, auch wenn es sich nur um billigen Schaumwein handelte.
Langenbek. Das ist ein Ort, der nur ein paar Kilometer entfernt von der Geltinger Bucht im Land Angeln liegt, rund 25 Kilometer von Flensburg und der dänischen Grenze entfernt. Ein Dorf, das noch hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt, dessen Bauern sich überwiegend beizeiten für ökologischen Anbau und Viehzucht entschieden und so die letzten Krisen von Rinderwahnsinn bis Maul- und Klauenseuche erstaunlich glatt überstanden hatten. Die Landschaft ist leicht hügelig. Am schönsten ist es hier im späten Frühjahr, wenn, so weit das Auge reicht, die Rapsfelder blühen. Es gibt einen historischen Ortskern mit einer behäbigen Backsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert, mit einem mächtigen Feldsteinsockel und einem hölzernen Westturm. Daneben steht ein gründerzeitliches Pfarrhaus aus Backstein, in dem der Pastor Josua Blunck mit seiner Gattin residiert, ein plumper Bau mit holzverkleidetem, grün gestrichenem Obergeschoss und Balkon. An der Dorfstraße entlang reihen sich die geduckten Angeliter Katen, zum Teil noch mit Reetdach. Und um den Kern fügt sich auf Abstand eine Reihe der landestypischen Dreiseithöfe mit dem mehr oder weniger repräsentativen Bauernhaus in der Mitte und Scheune und Ställen rechts und links.
Der Ort zieht sich an der Ostseite des Langensees entlang. Auf die Nordseite hatten die Grafen von Erben-Werthern im 18. Jahrhundert auf angemessene Distanz zu den Bauern ihr Herrenhaus gebaut, eine der typischen schleswig-holsteinischen Gutsanlagen mit Torhaus und im Rücken des Herrenhauses landwirtschaftlichen Gebäuden, die dem Landadel die Existenz sicherten und das Geld für barocke Vergnügungen einbrachten – für Treffen mit Dichtern und Denkern, für Gartenfeste und Musik. Eine malerische Kulisse, breit gelagert, mit repräsentativer Front und Terrasse zum Garten und sachlicher Fassade nach Norden, zur Arbeitsseite. Dort lag zwar die Vorfahrt, die um ein Blumenrondell kreiste, daneben standen Stallungen und Scheune, die Sonntagsseite des Herrenhauses aber wandte sich mit der spätbarocken Putzfassade und den Mansardendächern mit zahllosen Schornsteinen zum Wasser.
Die aktuellen ländlichen Konzerte stehen in der Tradition des vergangenen Glanzes, nur dass die Grafenfamilie heutenicht mehr mit Dichtern und Denkern Hof hielt und dazu die Adelsverwandtschaft aus der weiteren Umgebung einlud, sondern dass bürgerliche Besucher für das Vergnügen zahlten, sich im Glanz der Geschichte sonnen zu dürfen.
Bislang ging die Rechnung auf; zwar noch nicht für das Dorf, aber wenigstens für Eberhardt von Erben, der das Gut verwaltete, obwohl es eigentlich noch seinem Vater Johannes gehörte. Doch der alte Graf widmete sich unterdessen lieber der Jagd, den teuren Flaschen aus dem Keller des Hauses, handgewickelten Havannas, und der einen oder anderen Dorfschönheit, hieß es, sei er auch nicht abgeneigt. Unbestritten war, dass er die größtmögliche Distanz zu seiner Gattin Friederike Elisabeth suchte, die das Hauswesen mit eiserner Hand und dem Willen absolutistischer Monarchen regierte und zur Not ihre Ziele auch mit Hilfe sorgsam inszenierter Herzattacken durchsetzte. Das wirkte immer, auch wenn der Dorfarzt Dr. Fred Muncke ihr mürrisch eine eiserne Gesundheit attestierte, wenn er wieder einmal wegen eines dieser Zusammenbrüche gerufen wurde. Weshalb sie ihn wiederum einen unsensiblen Viehdoktor schimpfte. Der alte Graf konterte die Klagen über den unfähigen Mediziner mit der scheinheiligen Empfehlung, doch eine Fachklinik aufzusuchen, was die Gräfin wiederum überhörte.
Vier Kinder hatten die von Erben-Wertherns – neben dem 48-jährigen Eberhardt, dem Gutserben, waren das Heinrich, Liebling der Gräfin und dauernd in Geldnöten, Dietrich, der als Architekt nach München gezogen war, um dem Joch der Familie zu entkommen, dort im Bauamt arbeitete und sich selten sehen ließ, und Katharina, mit 40 Jahren die Jüngste, die einen steinalten und steinreichen Pelzhändler geheiratet hatte und ihren Ehrgeiz daransetzte, in der vornehmen Welt zu glänzen.
»Arrogante Bagage«, dachte Carla, als sie jetzt mit wehem Kreuz an der Straße stand und zum Gut hinübersah. »So eine schöne Anlage mit den Gebäuden am See, aber die Leute!« Dann schob sie ihr Fahrrad entschlossen weiter. Als sie das Ende des Dorfes erreichte, klatschten dicke Tropfen aufs Kopfsteinpflaster. In Sekunden entwickelte sich der Regen zu einem Stakkato, das, vom Wind gepeitscht, Carla scharf ins Gesicht stach. Einen halben Kilometer weiter, dort wo der Knickweg von der Hauptstraße nach links zu ihrem Haus abzweigte, war sie klatschnass. »Was für ein Glück, dass das Wasser warm ist«, dachte sie sarkastisch. Und: »Vielleicht verbraucht Fahrradschieben bei Regen ja mehr Kalorien als Radeln bei Sonne.« Sie war zu Hause.
Carla Moreno, seit gut einem Jahr verwitwet, lebte mit ihrer 14-jährigen Tochter Sara in einer gründerzeitlichen Villa, einem romantischen Haus mit Balkon, Türmchen und Fensterläden, vollkommen asymmetrisch, weiß getüncht wie das benachbarte Herrenhaus und mit rotem Mansardendach. Es war das frühere Witwenhaus des Gutes, das irgendwann einmal verkauft worden war. Carla hatte es von ihrer Tante Tatiana geerbt, der Schwester ihres Vaters, die kinderlos gestorben war. Als sie das Rad den Gartenweg hinaufschob, öfnete sich schon die Tür: Sara steckte den Kopf heraus und rief: »Gott sei Dank, dass du da bist, Mama. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob du es vor dem Gewitter schaffst. Tee ist fertig. Warte, ich helfe dir.« Und so schleppten sie zusammen Kartoffeln und Waschpulver, Tomaten und Brot. Und Carla betrachtete ihre Tochter stolz. Sara war ein selbstständiges Mädchen, umsichtig und unkompliziert. Sie schrieb es der Tatsache zu, dass sie einerseits in einer außerordentlich harmonischen Umgebung aufgewachsen war, andererseits früh den Vater verloren hatte und notgedrungen rasch erwachsen geworden war.
Carla Moreno war der Papierform nach Spanierin, und so sah sie auch aus: kaum größer als 1,60 Meter, kräftig, nicht wirklich schlank, mit dunkelbraunen, welligen, jungenhaft kurz geschnittenen Haaren. Doch in Wirklichkeit stammte sie aus Schleswig-Holstein, war aufgewachsen in einer noblen, aber unpersönlichen Umgebung auf dem Land, und das auf Ahrenberg, einem Gut, das in der Gegend von Lübeck lag. Mit Geburtsnamen hieß sie Charlotte Baronesse von Roehl. Ihre Mutter, Luise von Roehl, die einen ausgeprägten Dünkel pflegte und eine tief verwurzelte Angst vor Armut hatte, interessierte sich vorzugsweise für den äußeren Schein, wollte die Tochter in die besten Adelskreise einschleusen, als Debütantin präsentieren und möglichst schnell reich und adlig verheiraten. Aber Luises antiquierte Lebensplanungen für die Tochter gingen nicht auf. Charlotte entwickelte sich nicht nach Plan. Sie wurde keine langbeinige, blonde Debütantin, sondern eine sportliche, eher kleine Brünette, die das von der Mutter erwartete Gardemaß von mindestens 1,70 Metern nicht erreichte. Die Ballettstunden schwänzte sie, um zu reiten; statt an Handarbeiten zu sticheln und Chopin zu klimpern, wie die Mutter es gewünscht hatte, malte sie. Und statt sich im feineren Smalltalk zu üben, fluchte sie wie ein Kutscher. »Von mir hast du das nicht«, pflegte Luise missbilligend festzustellen, wenn sie ihre ungebärdige Tochter musterte. Mutter und Tochter waren einander fremd. Luise verstand nicht, dass ihre Tochter an Schmuck und Designergarderobe kein Interesse hatte, Carla gingen das ausschließliche Streben nach materiellen Dingen und die gezierten Manieren ihrer Mutter auf die Nerven.
Da fügte es sich nicht eben ideal, dass die Geschäfte von Luises Gatten nicht erwartungsgemäß gediehen und der Baron Friedrich von Roehl sein Gut Ahrenberg an einen reichen Baulöwen aus Hamburg veräußern musste, nachdem er sich gewaltig verspekuliert hatte. Als der neue Eigentümer dem Baron eines der Gesindehäuser gratis als Domizil überließ und damit seinem Anwesen die adelige Staffage erhielt, begann für Luise ein Albtraum. Sie war eine geborene de Lancelot. Die Vorfahren hatten angeblich während der französischen Revolution ihren Hals nach Hamburg gerettet. Das überlieferte gewaltige Vermögen hatte sich dann irgendwann verflüchtigt. Und auch den sagenhaften Stammbaum hatte Carla noch nie zu sehen bekommen. Aber ihre Mutter pflegte die Erinnerung an die noble Herkunft aus dem Land des savoir vivre, als hätte es die Revolution nie gegeben. Dass der klangvolle Name ihren Vater nicht davon abgehalten hatte, sein Geld als ganz normaler Streifenpolizist zu verdienen, war ihr äußerst peinlich. Schlimmer noch: Der Beruf hatte Heinrich de Lancelot Freude gemacht. Sie warf dem Vater mangelnden Ehrgeiz vor. Und damit er nach der standesgemäßen Heirat mit dem Gutsherrn von Ahrenberg ihr Image nicht gefährdete, hatte sie ihn nach der Pensionierung in einem kostengünstigen Altersheim, sie nannte es Seniorenresidenz, einquartiert und vergessen.
Aber die Prüfungen für die dünkelhafte Luise de Lancelot, verheiratete von Roehl, waren noch nicht zu Ende. Die Tochter machte ihr Sorgen. Die geplante Verbindung zwischen Charlotte und einem schon etwas angejahrten Bankier kam nicht zu Stande, weil das junge Mädchen sich weigerte »einen 55-jährigen Geldsack mit zwei Töchtern« zu ehelichen. Luise hatte genug von Mann und Kind. Sie erhörte ihren langjährigen, zwar nicht standesgemäßen, aber außerordentlich gut betuchten Anbeter Arthur Brommauer aus Niederbayern, der mit dem Kräuterhandel und Tees unterschiedlichster Geschmacksrichtungen ein Vermögen gemacht hatte. Carla fand ihn übrigens nett.
Luise wechselte den Wohnsitz und zog also aus dem Gesindehaus des bankrotten Gutes bei Lübeck in eine Luxusvilla am Starnberger See mit Blick auf Schloss Possenhofen, nahm ihren Mädchennamen wieder an, genoss das Leben in der Münchner Schickeria, brachte ihrem reichen Gatten Manieren bei, und weil der ein gutmütiger Kerl war, ließ er sie gewähren.
Und Carla ging an die Universität Hamburg, um Kunstgeschichte zu studieren. Den Lebensunterhalt verdiente sie sich mit Kellnern und Putzen. Ihr Vater konnte sie nicht unterstützen. Ihre Mutter lehnte es ab. Bald lernte sie Joan Moreno-Serna kennen, Hotelierssohn aus Palma de Mallorca, der in Hamburg ebenfalls als Kellner jobbte, um sich auf die spätere Übernahme des väterlichen Unternehmens vorzubereiten. Joan, der Bilderbuchspanier mit dunklen Locken, gefiel ihr von der ersten Sekunde an, und er verliebte sich in ihre Tatkraft und Bodenständigkeit. Ihre Eltern waren schockiert, als sie von der Liaison hörten. Als sie erfuhren, dass ihr Schwiegersohn in spe als Kellner im Hamburger Restaurant »Gente« in der Nachbarschaft der Michaeliskirche arbeitete, wo ihn Carla bei Paella und Rotwein kennengelernt hatte, waren sie fassungslos. Sie beklagten das Faible für Dienstboten und das mangelnde Standesbewusstsein der Tochter und drohten mit Konsequenzen. Doch Carla war volljährig und zu erben gab es beim Vater ohnehin nichts mehr. Joans Eltern waren zunächst ebenso wenig begeistert von der deutschen Liebe ihres Sohnes. Sie hatten auf eine tatkräftige Mallorquinerin als Schwiegertochter gehofft, die im Geschäft mit anpackte, und nicht auf eine norddeutsche Baronesse. Nur bei Tante Tatiana fand Carla Rückhalt. Und die empfahl ihr: »Pfeift auf die Verwandtschaft. Heiratet, wenn ihr euch liebt.« Tatiana vermittelte den beiden die alte Finca Seis Torres auf Mallorca, und so zogen Carla und Joan nach Spanien und bauten sich ihr eigenes Hotel auf.
Das historische Bauwerk mit mittelalterlichen Grundmauern lag am Berg, nicht weit von Deià entfernt – ein breit gelagerter Komplex mit hoher Beletage und großen Salons. Leider baufällig. Joans Eltern, die Carla schnell ins Herz geschlossen hatten, halfen mit Geld, Carlas Familie distanzierte sich bargeldlos. Carla hatte seit Jahren nichts von ihren Eltern gehört. Joan und Carla entwickelten handwerkliches Geschick. Sie verputzten und verkachelten, strichen und zimmerten. Und immer, wenn Gäste die Kasse gefüllt hatten, wurde ein neuer Raum ausgebaut. Auch in den Nebengebäuden brachten die Morenos Appartements unter.
Sie bauten Seis Torres nach und nach zu einem exquisiten kleinen Landhotel aus, das von üppiger Vegetation und Palmen eingefasst war. Es gab einen Pool. Zum Meer war es nicht zu weit. Mehrere Golfplätze lagen in der Nähe. Und mit zwei benachbarten Bauern gab es die Vereinbarung, dass die Gäste dort zu romantischen Spezialitäten-Menüs einkehren konnten – von Paella bis zum Kaninchenragout mit Zwiebeln, dessen Hauptbestandteil dem Bauern unvorsichtigerweise vor die Flinte geraten war.
Carla kaufte die Möbel für die Finca, stellte die Einrichtung zusammen, nutzte ihre kunsthistorischen Kenntnisse und restaurierte Bilder und Schränke und schuf ein exquisites Ambiente. Weil ihr das immer besser gelang, kaufte sie bald mehr Antiquitäten, als sie selbst brauchten, arbeitete die Sachen auf, erneuerte Firnisse, besserte Intarsien aus, verkaufte mit Gewinn und schrieb nebenbei noch für Sammler Expertisen über Gemälde und Grafik. Joan organisierte den Hotelbetrieb.
Carla erwarb bei Keramikern der Region Kacheln, gab Vasen und Töpfe in Auftrag, fand in Santa Maria mitten auf der Insel eine kleine Weberei, die von Hand Stoffe fabrizierte, mit denen sie die Polstermöbel bezog. Sie kaufte Lampen in der Glasbläserei von Campanet, Antiquitäten in einem winzigen Laden in Artà. Und um die Wände zu dekorieren, fing Carla wieder an zu malen. Erst idyllische Aquarelle, das ging schnell und gefiel, dann Landschaften in einem ganz eigenen Stilgemisch aus altmeisterlichen Formen und Abstraktion. Bilder, die schnell auch unter den Hotelgästen Käufer fanden, die die Arbeiten von der Wand weg erwarben, sodass Carla für das Hotel immer wieder neue malen musste.
So gab es für Seis Torres schon nach kurzer Zeit eine lange Anmeldungsliste. Dann kam Sara zur Welt. Joan und Carla waren erfolgreich und glücklich. Auch wenn Carlas Eltern nicht einmal auf die Hochzeits- und Geburtsnachrichten reagiert hatten. So erfuhren der bankrotte Baron und seine vornehme Ex-Gattin auch nicht, dass Heinrich de Lancelot das kostengünstige Altenheim in Pinneberg bei Hamburg längst verlassen hatte und zu Carla und Joan nach Mallorca gezogen und dort eine Stütze des Hotelbetriebs geworden war.
Nach 18 Jahren, in denen Carla ihr Zuhause in Norddeutschland fast vergessen hatte, passierte das mit Joan. Anfangs war er nur ein bisschen müde und schwach gewesen. Eine verschleppte Erkältung, dachte er. Aber es war Leukämie. Die Ärzte in Palma im Klinikum Son Dureta hatten kaum eine Chance, eine Therapie zu beginnen und ihm Mut zu machen, da starb er schon nach wenigen Wochen. Carla hatte nicht einmal Zeit gehabt, sich an sein Leiden zu gewöhnen. Es war unwirklich, Joan, der immer kräftig und gesund und braun gebrannt gewesen war, blass und schwach im Bett liegen zu sehen. Und dann wurde er von Tag zu Tag schwächer und starb. Schlief einfach ein. Er war gerade 40 Jahre alt geworden.
Carla war wie gelähmt. Sie ließ Joan auf einem Friedhof in der Nähe von Seis Torres begraben, mit Blick aufs Meer. Sie ordnete die Hotelgeschäfte, übergab die Küche an den Oberkellner Gabriel und legte die Führung des Hauses in die Hände ihres Großvaters, der Anfang 80 und sehr rüstig war. Zudem hatte er die Unterstützung der überaus resoluten Maria, die in Deià einen Lebensmittelladen betrieb und mit den Touristen glänzende Geschäfte machte.
»Ich passe auf, dass sie dein schönes Hotel nicht in Grund und Boden wirtschaften«, sagte der Großvater, als Carla ihre Malsachen zusammenpackte und mit Sara nach Hamburg flog. Sie mietete ein Auto, inspizierte das Haus, das ihr Tante Tatiana in Langenbek hinterlassen hatte und das seit Jahren leer stand. Sie beschloss zu bleiben. Der Ortswechsel, die Flucht nach Schleswig-Holstein und die Arbeit waren für Carla Therapie, um den Tod ihres Mannes zu verarbeiten.
Sara war ohne Protest mitgekommen. Sie beklagte sich nicht über Regenwetter, den Verlust von Freunden oder über die neuen Klassenkameraden, die sie wie ein sozialhilfebedürftiges Gastarbeiterkind behandelten, nur weil sie in Spanien aufgewachsen war.
2.
Annika Pedersen war glücklich. Sie hatte es geschafft. Sie stand im Salon oder genauer gesagt in einem der Salons von Gut Langen und schaute auf den See. Vielleicht schon in wenig mehr als einem Jahr würde sie eine Gräfin sein, die Gattin von Eberhardt. »Nicht schlecht für eine Tankwartstochter«, dachte sie und kokettierte mit ihrem Spiegelbild in der Fensterscheibe. Die Schwiegermutter würde sich giften, Eberhardts gegenwärtige Frau Dorothea, »die hysterische Ziege«, wahrscheinlich in der Psychiatrie landen, und ihre Tochter, die 13-jährige Margarethe, könnte man wunderbar in ein kostspieliges Internat abschieben. Sie selbst würde mühelos in kürzester Zeit ihrem Eberhardt den erwünschten Erben zur Welt bringen und hätte sich damit sicher etabliert in dem Haus am See. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn sie sich beizeiten einen neuen, eher adelstauglichen Vornamen zulegte, der besser zu von Erben-Werthern passte. »Vielleicht Alexandra?« sagte sie laut. Oder etwas ähnlich Nobles, das den letzten bürgerlichen Hauch beseitigte. Annika sog die Luft ein. Wie gut es roch im Salon. Ein bisschen nach Vanille. Und was noch? Lavendel? Orange? Eine Silberschale mit getrockneten Kräutern und Früchten stand neben dem Kamin und verströmte den Duft. Annika sah sich weiter um. Auf einem Tischchen mit gedrechselten Beinen und einem vergoldeten Rand waren wohl zwei Dutzend Kristall-Karaffen und Flaschen angeordnet, in denen helle, bernstein-, bronzefarbene und rötliche Flüssigkeiten schimmerten – Wodka, Cognac, Whisky? An den Farben allein konnte Annika die Unterschiede nicht erkennen. Sie kannte nur Bacardi-Cola von den dörflichen Discos und Scheunenfesten. Aber die Flaschen hatten noble Etiketten und die Karaffen trugen silberne Schürzen – als Adelsnachweis gleichermaßen: Armagnac, Wodka, Cognac, Whisky, Martini, natürlich alles vom Besten. Sie schloss die Augen, drehte eine Pirouette auf dem Absatz und dachte: »Alles meines.« Die getäfelten Wände, der riesige Teppich, ein alter Keschan mit dunkelblauem Grund, die gobelinbezogenen Sessel, die Gebirgslandschaft von Josef Anton Koch, ein Museumsstück, das sie für spießig hielt, das Rokoko-Tischchen mit den Flaschen und natürlich der Blick auf den See.
Und das alles hatte ihr das Schicksal nur durch einen glücklichen Zufall beschert.
Bislang waren das schöne Mädchen und ihr Vater, der Tankwart Hein Pedersen, für die Bewohner von Gut Langen sowie die besser betuchten Dörfler nur Verlierer gewesen. Sie gehörten nicht wirklich zur Dorfgemeinschaft und lebten in einer niedrigen Kate neben der Tankstelle. Es war ein Ziegelhaus, freundlich von Blumenbeeten eingefasst, aber ein bescheidenes Gebäude. Hein Pedersen galt im Dorf als Unglücksrabe. Er war ein liebenswürdiger Mann. Aber die Nachbarn betrachteten ihn mitleidig. Seine Frau war ihm davongelaufen, und das Geschäft ging nicht gut. Hier in Langenbek tankten selten Ausflügler, denn das Dorf lag etliche Kilometer entfernt von den wichtigen Durchgangsstraßen hier im Norden, und die großen Bauernhöfe hatten die Dieselzapfsäule hinter dem Haus. Dort versorgten sie nicht nur die Landmaschinen, sondern regelwidrig auch ihre eleganten Geländewagen. Schlechte Aussichten für Hein, auch für Annika. Sie lebten bescheiden.
Jetzt hatte Annika die Hoffnung, dass sich das bessern könnte. Vor gut drei Monaten, genau war es am 22. April gewesen, war sie morgens früh um 8 Uhr quer über die Wiesen nach Barsbek gerannt, weil der Hund der Pedersens, wie sie glaubte, Gift gefressen hatte. Tierarzt Joachim Lorenzen sollte kommen. Aber der ging nicht ans Telefon, weil er Sprechstunde hatte. Also wollte Annika ihn holen. Sie hing an ihrem Hund und fürchtete um sein Leben.
Dort wo die Langenbeker Aue aus dem Wald zwischen den Feldern hindurchfließt, kam es beinahe zum Unfall: Eberhardt von Erben auf dem Morgenritt im Galopp am Waldrand hätte Annika fast überrannt. Sie stürzte, unterdrückte aber geistesgegenwärtig alle Flüche, die ihr in den Sinn kamen. Stattdessen lächelte sie lieblich. Sie war mit fast 1,75 Metern ein großes Mädchen, aber dennoch anmutig mit einem feinen Puppengesicht, dazu hüftlangen blonden Haaren. Sie war nicht sonderlich intelligent, besaß aber einen ausgeprägten Hausverstand und, wenn es um ihre Interessen ging, eine Zielstrebigkeit und Gerissenheit, die sie mit scheinbarer Arglosigkeit zu tarnen wusste. So hatte sie auch den Unfall instinktiv als Chance begriffen. Sie fluchte nicht, obwohl sie gezetert hätte wie ein Fischweib, wenn der forsche Reiter nicht der Graf, sondern einer der Bauernsöhne aus dem Dorf gewesen wäre. So aber lächelte sie und hauchte: »Nichts passiert.« Sie klopfte sich geziert und sorgsam die Erde und das Gras von den Jeans, als seien die gerade von Versace geliefert worden. Eberhardt von Erben sprang vom Pferd, sah Annika fasziniert an und sagte: »Ich habe Sie nicht gesehen. Entschuldigen Sie, ich hoffe, Sie haben sich nichts getan.« Und dann nach einer kleinen Pause: »Kennen wir uns nicht?«
Die Szene lief genauso ab, wie Annika es in Dutzenden von Heftromanen gelesen hatte, in denen Ärzte sich in schöne Krankenschwestern und Grafen in reizende Dienstmädchen verlieben. Natürlich mit glücklichem Ende. Von Erben nahm mit gespielter Eleganz ihre Hand und putzte etwas Sand fort, eine herablassende Geste dem Mädchen gegenüber, das er jetzt erst als die Tankwartstochter erkannte und das er soeben fast über den Haufen geritten hatte. Doch Annika spürte den Spott nicht. Sie fühlte sich geehrt und sagte klar und ohne Spur von ländlichem Akzent fast ebenso geziert wie er: »Ich bitte Sie, nichts ist passiert. Machen Sie sich keine Gedanken.« Und sie wandte sich mit einer graziösen Drehung zum Gehen.
Einwandfreies Benehmen – das hatte sie in Hamburg in der Kaufmannsfamilie Berking gelernt, bei der sie in Blankenese gut ein Jahr lang die Kinder gehütet und im Haus geholfen hatte – für wenig Geld, aber viele gute Ratschläge. Die Frau des Hauses, Angelika Berking, hatte darauf geachtet, dass Annika klares Hochdeutsch sprach und sich gewählt ausdrückte, und sie hatte ihr Grundbegriffe der gepflegten Haushaltsführung beigebracht. Leider endete das Blankeneser Idyll abrupt, als Angelika Berking Annika in den Armen des Hausherrn überraschte. Während Ludwig Berking mit einer handfesten Szene davonkam, musste das Kindermädchen unverzüglich die Koffer packen. Damals war Annikas Strategie für den Weg zu einem besseren Leben noch nicht aufgegangen.
Aber sie hatte ihre Lektion gelernt. Jetzt, dachte sie, würde sie die Erfahrungen aus dem Hause Berking gut brauchen können und schlauer vorgehen. Denn so wie die Kaufmannsfamilie, das hatte sie damals beschlossen, wollte sie auch einmal leben. Ohne Geldsorgen und mit Dienstboten, die man schlecht behandeln konnte. Durch den Zusammenstoß mit Eberhardt von Erben hatte sie die Chance, sogar noch besser zu leben als die Berkings. Deshalb drehte sie sich noch einmal geziert nach dem Grafen um und wiederholte: »Mir ist wirklich nichts passiert.« Und nach einer kleinen Pause: »Ich hoffe, Ihr Pferd hat sich nichts getan.« Zufrieden mit sich und ihrer Reaktion ging sie weiter.
Eberhardt von Erben war bezaubert. Seine Gattin hätte ihm vermutlich eine psychodramatische Szene geliefert, wenn ihr ein ähnliches Unglück widerfahren wäre, seine Tochter hätte geweint, seine Mutter ihm eine handfeste Standpauke gehalten. Und dieses Mädchen sorgte sich um sein Lieblingspferd. Eberhardt war hingerissen. Und Annika wusste genau, dass ihr ein kluger Schachzug gelungen war.
Zwei Tage später fuhr Eberhardt von Erben an der Tankstelle vor und bat, als er zahlte, nochmals um Pardon. »Es war nichts«, sagte Annika scheinbar kühl. Und ehe er sich versah, hatte er sie auf einen Kaffee eingeladen, obwohl er das gar nicht vorgehabt hatte. Wenigstens war er geistesgegenwärtig genug, sich mit dem Mädchen in angemessener Entfernung vom Gut und vom Dorf und von seiner Gattin zu treffen – in Flensburg, in einer Einkaufspassage, versteht sich. Annika lehnte zunächst ab, zögerte und zierte sich. Ließ sich dann aber doch überreden. Vier Wochen und sieben heimliche Treffen später lag sie in seinen Armen. Nach zwei Monaten versprach er, auf alle Konventionen zu pfeifen und sie zu heiraten. Seine Ehe, sagte er, sei ohnehin zerrüttet, die Gattin mehr in der Psychotherapie als daheim. An ihm hänge die ganze Verantwortung für den Gutsbetrieb, und niemand nehme Rücksicht auf ihn. Wie aus dem Heftroman. Und weil Annika sich mit dieser Art Lektüre und den Dialogen zwischen den Liebenden auskannte, sagte sie: »Mein armer Eberhardt«, und strich ihm übers Haar.
Allein dafür war er zu jedem Opfer bereit und überzeugt, die Damen der Gesellschaft würden Annika wegen ihrer Liebenswürdigkeit schnell ins Herz schließen, die Herren ihn um das schöne Mädchen beneiden.
Als Lohn für gut drei Monate taktische Perfektion stand Annika jetzt auf Gut Langen, in ihrer zukünftigen Heimat, wie sie glaubte. Die Begegnung mit der neuen Familie schreckte sie nicht. Sie hatte das Kämpfen gelernt, sich in der Dorfschule erfolgreich gegen die Rüpel durchgesetzt, im Gasthof als Aushilfskellnerin betrunkene Dörfler auf Distanz gehalten, sie würde auch mit den Eltern und Geschwistern des Grafen fertigwerden.
Annika drehte sich im Salon und genoss das Ambiente. Aber sie fühlte sich fremd, auch wenn sie ihre Anwesenheit als Sieg sah. »Ich brauche dringend neue Klamotten«, dachte sie und sah missmutig an ihrem knappen, hellblauen T-Shirt, dem kurzen schwarzen Stretchrock und den Plateauschuhen hinunter. Auf den ersten Blick ganz hübsch, aber alles auf einen Blick als Kaufhauschick niedriger Preiskategorie erkennbar. Auch die akkuraten Steppnähte im Rhombenmuster ließen ihre Handtasche, die sie lässig in den Sessel geworfen hatte, nicht die Spur nach Chanel aussehen. Der schwarze Kunststoff wollte einfach nicht wie Leder wirken.
Annika stolzierte zu dem Tischchen mit den Drechselbeinen, den Kristallkaraffen und den Flaschen. »Was haben wir denn da. Ich denke, ich werde mir einen Drink genehmigen.« Sie musterte die Farben und Flüssigkeiten und entschied sich für ein tiefes, warmes Braunrot. »Duoro« stand auf dem Etikett. Sie öffnete den Verschluss und goss den Portwein in einen Whiskybecher. Sie schnupperte an dem Getränk. »Riecht ein bisschen streng«, dachte sie. Der Geruch wirkte stechend. »Ach was. Runter damit. Ist bestimmt sündhaft teuer.« Annika nahm einen Schluck und schaute auf den See, während ihr der Portwein in der Kehle brannte. »Alles meines«, sagte sie laut. Und: »Gleich wird es ein Gewitter geben. Hier im Haus auch.« Sie kicherte und kippte den Rest Portwein hinunter. Das Getränk brannte ihr im Hals. Sie schüttelte sich, schnappte nach Luft. »Ich wusste nicht, dass Portwein so scharf ist und so bitter«, dachte sie noch. Ihr Hals schnürte sich zusammen. Sie riss den Mund auf, dachte, dass sie sich verschluckt haben müsste, und bekam keine Luft. Aber sie konnte nicht husten. Dann fühlte sie Schwäche. Ihre Beine wurden schlaff. Ihr Kreislauf brach zusammen. Sie wollte rufen oder nach dem Butler klingeln, den sie in der Halle getroffen hatte. Aber sie war wie gelähmt. Die Kraft schien aus ihrem Körper zu fließen. Ein eisiges Gefühl ergriff sie. Der Atem stockte. Angst würgte sie. Ihre Hand wurde schlaff. Sie ließ das Glas fallen. Die letzten Tropfen Portwein rannen auf den Teppich. Annika fühlte, wie sie fiel, sah ihre eigene Bewegung, hatte aber keine Gewalt mehr über ihren Körper. Sie sank in die Knie, griff nach einem Halt, fand aber nichts, woran sie sich festklammern konnte. Sie hätte auch gar nicht mehr die Kraft dazu gehabt. Sie sackte auf den Boden, fiel vornüber gegen einen Gobelinsessel und schlug mit dem Kopf auf den Teppich, aber das spürte sie schon nicht mehr. Die Tankwartstochter lag im Salon von Gut Langen auf einem kostbaren, alten Keschan, die langen blonden Haare auf dem Boden malerisch ausgebreitet, wie auf Sir John Everett Millais’ Gemälde von der ertrunkenen Ophelia. Annika war tot. Vergiftet.
3.
Du musst verrückt geworden sein«, sagte Friederike von Erben-Werthern zu ihrem Sohn Eberhardt. Sie saß im Sessel am Fenster ihres Salons im ersten Stock des Herrenhauses und starrte fassungslos in das Gesicht des Gutserben. Der hatte ihr soeben mitgeteilt, dass er sich von seiner Gattin zu trennen gedachte und dass er schon ein neues Glück gefunden hatte – Annika Pedersen. Sie war schon im Haus, wartete im Salon und würde ihn auf das Konzert begleiten, das demnächst beginnen sollte. Die alte Gräfin war schockiert. Dass ihr Sohn eine Liaison hatte, wusste sie schon. Das hatte sie nicht gestört. Jetzt aber wollte er sich von seiner Gattin Dorothea trennen, sich scheiden lassen und eine junge Frau ins Haus bringen, die sie auf der Straße nicht einmal zur Kenntnis nehmen würde. Und das Ganze vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Vorstellungen von Friederike von Erben-Werthern über passende Verbindungen, Freundschaften und Bekanntschaften waren elitärer als am britischen Königshof. Sie pflegte ihren Dünkel. Bei dem Gedanken an Eberhardts Pläne wurde ihr übel.
»Das dulde ich nicht«, sagte sie folglich knapp. »Ich lasse dieses Weibsbild verschwinden.« Eberhardt von Erben zuckte zusammen, während seine Mutter eine lange Liste von Drohungen ausstieß – Trennung von der Familie, Streichung aus dem Testament. Und er hatte keinen Zweifel, dass es ihr damit ernst war. Denn es war nicht die erste nicht standesgemäße Liebe, die seine Mutter aus dem Leben ihrer vier Kinder entfernte. Aber ihr Sohn ließ sich dieses Mal nicht einschüchtern. »Ich werde auch ohne deine Hilfe durchkommen«, sagte er kühl. »Wie du weißt, habe ich eine gute Ausbildung genossen und bin ein sehr erfolgreicher Gutsverwalter.«
Er betrachtete seine Mutter distanziert. Sie war wie immer tipptopp frisiert, saß aufrecht im Sessel und war so gekleidet, wie sie es für sich als optimal betrachtete, seit sie Johannes von Erben geheiratet hatte: Sie bevorzugte Kostüme, streng geschnitten wie Herrenanzüge, in Grau und Braun, Anthrazit und Schwarz, mit schmalen oder breiten Revers, aus feinster Wolle oder Leinen, je nach Jahreszeit und Mode. Sie saßen an ihr wie Uniformen. Im Winter trug sie unter den Kostümen feine, dünne Rollkragenpullover aus Kaschmir, im Sommer Hemdblusen. Und so herrisch wie ihre Kleidung wirkte auch der Salon der Gräfin. Dunkelgrüne Samtvorhänge mit goldenen Fransen bestimmten das Bild, die Wände waren eichenholzgetäfelt, ein mächtiger Aufsatzsekretär aus der Kaiserzeit diente der Hausherrin zur Erledigung der Post. Kurios fand der Sohn die mächtigen, ledernen Polstermöbel, die eigentlich hätten bequem sein können, aber seine Mutter setzte sich stets kerzengerade nur auf die Sesselkanten: Als er sie jetzt betrachtete, stellte er fest, dass sie ihm fremd war. Sie erschien ihm eher als Chefin des Unternehmens Langen denn als seine engste Verwandte.
Friederike Elisabeth von Erben-Werthern war mehr als standesbewusst. Als hätte die Revolution von 1918 niemals stattgefunden, war es ihr unvorstellbar und unerträglich, wenn eines ihrer Kinder sich einen nichtadeligen Lebenspartner suchte. Dass sie selbst zwar aus wohlhabendem, aber gänzlich unadeligem Haus stammte, hatte sie verdrängt. Undenkbar, in engeren Kontakt mit einem Menschen zu treten, der nicht wenigstens ein kleines »Von« im Namen führte. Auch gesellschaftliche Veranstaltungen, bei denen der Geldadel den Ton angab, gingen ihr gegen den Strich. Nicht einmal akademische Ehren konnten ihr imponieren. Deshalb behagte es ihr auch nicht, dass Gut Langen, selbstverständlich sprach sie stets vom Schloss, obwohl es kein Fürstensitz war, sich an den sommerlichen Konzerten beteiligte, bei denen die Massen in die Scheune neben dem Herrenhaus strömten. Aber das diente wenigstens der Erhaltung der Anlage. Und glücklicherweise kamen diese Leute, wie sie sagte, ja auch nur in die Scheune und nicht ins Haus. Der Sohn hatte sich mit Hinblick auf die hohen Ausgaben für die Anlage mit seinem Konzertprojekt durchgesetzt. »Wir brauchen das Geld, Mama«, sagte er, während der alte Graf wortlos seine Gewehre gereinigt hatte. Von ihm, das wusste sie, konnte sie in dieser Sache keine Unterstützung erwarten. Er billigte die Geschäftsmodelle seines Sohnes, und er hatte kein Standesbewusstsein. Johannes von Erben trank zuweilen sogar, das hatte man ihr erzählt, im Dorfgasthaus mit den Bauern ein Bier. Schon bei der Vorstellung fühlte sich die Gräfin elend. Wie der Vater, so der Sohn, dachte sie.
Eberhardt unterbrach ihre Grübeleien. »Ist das dein letztes Wort, Mama?« »Absolut«, sagte sie und betrachtete ihren Sohn kühl. Er war immer ein Weichling gewesen. Er hatte sich nicht gegen seine Frau durchsetzen können. Friederike war fest überzeugt, dass Autorität die Neigungen ihrer Schwiegertochter zu teuren Boutiquen-Besuchen, zu Champagner und Beruhigungspillen eingedämmt hätte. Sie gab ihrem Sohn die Schuld für die Probleme. Auch dafür, dass er zur Fortsetzung des gräflichen Stammbaums bislang nur ein Mädchen beigesteuert hatte, das sie nicht einmal sonderlich mochte. Und Dorothea war inzwischen 42. Höchste Zeit also für männlichen Nachwuchs. »Tu deine Pflicht!«, herrschte sie Eberhardt an.
Doch der blieb stur. »Ich habe dir gerade mitgeteilt, dass ich meine Frau verlasse. Von einer gemeinsamen Familienplanung mit Dorothea kann also keine Rede mehr sein. Vielleicht kannst du dich mit mir und meiner zukünftigen Frau dann auf männlichen Nachwuchs freuen.«
Friederike von Erben musterte ihren Sohn kalt. Er war nicht groß, sah nicht wirklich gut aus. Er hatte blonde Haare, die schon recht schütter wurden, einen gut geformten Schädel, ein hageres Gesicht und braune Augen. Das gab ihm etwas Markiges, und er hätte ein attraktiver Mann sein können, wenn er nicht um das Kinn einen weichlichen Zug gehabt hätte. »Du warst schon immer ein Schwächling«, sagte seine Mutter. »Dann musst du eben die Konsequenzen tragen.« Sie stand auf, ging zu ihrem Sekretär und schlug das Kontobuch auf.
4.
Anatol Abel schrieb. Bedächtig setzte er Zeile hinter Zeile in ein Schulheft. Mit Bleistift. Hin und wieder sah er sich um, als erwarte er Besuch. Eine alte Angewohnheit: Vorsicht. Anatol Abel war 85 Jahre alt und ein Fremder in Langenbek, obwohl er hier seit über zwei Jahren wohnte. Er hatte sich das alte Jagdhaus am Forst Hagen gekauft, einen Holzbau mit hohem Giebel und dunklen Fensterläden. Wenn die geschlossen waren, und das geschah häufig, dann sah das Haus verlassen aus. Finster. Der alte Mann lebte allein. Er war ungemein rüstig, ging aufrecht, bewältigte die Gartenarbeit selbst. Sein Gesicht war zerfurcht, von der Sonne geprägt und er hatte einen dichten, weißen Haarschopf.
Die Kinder im Dorf fanden Abel unheimlich. Sie schlichen manchmal durch den Garten, um zu spionieren, was der alte Mann tat. Aber sie fanden nichts heraus. Man wusste nicht genau, woher er kam, man kannte seine Einkommensquelle nicht, man wusste nicht, wie er das Jagdhaus hatte bezahlen können. So dauerte es nicht lange, bis man ihn als Hunde- und Katzenfänger diffamierte und in seinem Haus schwarze Messen vermutete. Angeblich war er bei Kriegsende aus Ostpreußen geflüchtet. »Er ist vor den Russen abgehauen«, erzählte Meta Diederichsen, die im Ort eigentlich alles wusste. Vielleicht war er selbst Russe. Bei seinem harten Akzent hielt der Wirt Klaus Möller das durchaus für möglich. Oder war er ein untergetauchter Nazi? Zu fragen traute sich niemand. Warum Abel gerade jetzt ins Dorf gezogen war, kurz bevor Carla und ihre Tochter sich hier niedergelassen hatten, konnte auch Meta Diederichsen nicht in Erfahrung bringen, die für nähere Erkenntnisse gern einen Hunderter gegeben hätte. Vielleicht sogar mehr. Sie würde es schon noch herausbekommen, dachte sie.