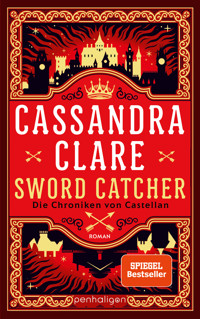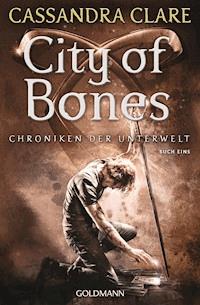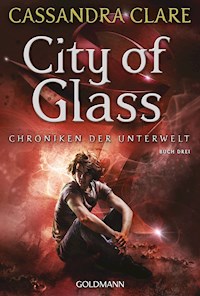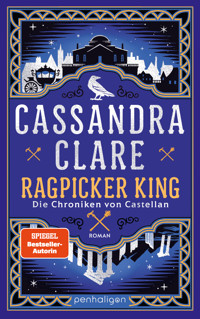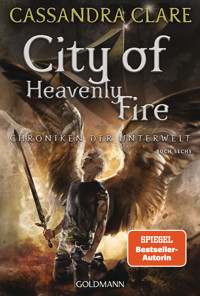5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Schattenmarkt ist Treffpunkt für Feenwesen, Werwölfe, Hexenwesen und Vampire. Hier handeln sie mit magischen Dingen und flüstern sich Geheimnisse zu, von denen die Nephilim nie erfahren sollen. Gestört werden sie dabei immer wieder von einem der Großen unter den Schattenjägern: Bruder Zachariah, der an diesem für ihn verbotenen Ort nach der Lösung eines bedeutsamen Rätsels sucht. Auf seinen Spuren begegnet der Leser den berühmten Figuren der Nephilim und der Schattenwelt – die es irgendwann alle einmal in die geheimnisvolle, magische Welt der dunklen Märkte zieht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Der Schattenmarkt: In jeder großen Stadt dieser Welt gibt es einen solchen geheimen, vor den Augen gewöhnlicher Menschen verborgenen Ort. Hier handeln die Bewohner der Schattenwelt mit magischen Artefakten, treffen allerlei zwielichtige Absprachen. Und obwohl den Nephilim der Zutritt verboten ist, sucht über fast hundert Jahre hinweg einer der Schattenjäger diese Märkte immer wieder auf. Dabei sollte gerade er als Stiller Bruder ein Hüter der Gesetze sein. Doch einst war auch Bruder Zachariah ein einfacher Schattenjäger namens Jem Carstairs, und die Liebe seines Lebens war die Hexe Tessa Gray. Zwar scheinen diese Liebe und dieses Leben auf ewig für ihn verloren, dennoch gelingt Jem es nicht, beidem ganz zu entsagen. So sucht er nun auf den Schattenmärkten dieser Welt die Lösung für ein Rätsel, das nicht nur über seine, sondern über die Zukunft seines ganzen Volkes entscheiden wird. Auf Jems Spuren begegnet der Leser dabei in zehn aufregenden Erzählungen – zwei davon exklusiv in dieser Sammlung erhältlich – den großen Figuren der Nephilim und der Schattenwelt. Denn sie alle zieht es irgendwann einmal in die verbotene Welt des Schattenmarktes …
Weitere Informationen zu den Autorinnen
sowie zu den lieferbaren Titeln von Cassandra Clare im Goldmann Verlag finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare / Sarah Rees Brennan Maureen Johnson / Kelly Link Robin Wasserman
DIE GEHEIMNISSE DES SCHATTENMARKTES
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Ghosts of the Shadow Market« bei Margaret McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon und Nick Sciacca
Umschlagmotiv: © 2019 by Cliff Nielsen
TH · Herstellung: ik
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-23818-6V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Inhalt
1. Ein langer Schatten
2. Alles Erlesene dieser Welt
3. Verlust
4. Eine tiefere Liebe
5. Die Bösen
6. Sohn der Dämmerung
7. Mein verlorenes Land
8. Durch Blut und Feuer
9. Die verlorene Welt
10. Gestürzt!
Für unsere wundervollen Leser
Wer oder was ihr auch immer seid – männlich oder weiblich, stark oder schwach, krank oder gesund … all diese Dinge sind weniger wichtig als das, was in euren Herzen ist. Wenn ihr die Seele eines Kriegers besitzt, dann seid ihr Krieger. Ganz gleich welche Farbe, Form oder Gestalt eine Lampe besitzt, die Flamme darin ist die gleiche. Und ihr seid diese Flamme.
Cassandra Clare Sarah Rees Brennan
Ein langer Schatten
Alte Sünden werfen lange Schatten.
Englisches Sprichwort
London, 1901
Die Eisenbahnbrücke führte nur um Haaresbreite an St. Saviour vorbei. Die Verwaltung der Irdischen hatte darüber nachgedacht, die Kirche abzureißen, um Platz für die Bahntrasse zu schaffen, doch diese Pläne waren auf unerwartet heftigen Widerstand gestoßen. Stattdessen machte die Strecke jetzt einen kleinen Schlenker, und die Kirchturmspitze ragte noch immer wie ein silberner Dolch in den Nachthimmel auf.
Bei Tag fand unter den Eisenbahnbögen ein Markt statt – der größte Lebensmittelmarkt der Stadt. Doch in der Nacht gehörte der Marktplatz der Schattenwelt.
Vampire und Werwölfe, Hexen und Feenwesen: Sie alle trafen sich unter den Sternen und dem Zauberglanz, der sie vor den Augen der Irdischen verbarg. Ihre Marktstände folgten der Anordnung der irdischen Lebensmittelhändler, sie drängten sich unter der Brücke und reichten bis in die umliegenden, winzigen Gassen hinein. Allerdings fand man hier keine Äpfel oder Rüben. Im Schatten der dunklen Bahnbögen boten die Stände Waren wie Schellen und Bänder an, die in knallbunten Farben leuchteten: Schlangengrün, Fieberrot und flammendes Orange. Bruder Zachariah nahm den Duft von brennendem Weihrauch wahr, die Gesänge der Werwölfe, die die Schönheit des Monds priesen, und die Lockrufe der Feenwesen: »Kinder, Kinder, folgt uns doch – folgt uns fort von hier.«
Wenn man nach dem englischen Kalender ging, war dies der erste Schattenmarkt im neuen Jahr, während sich das Jahr nach chinesischer Zählung gerade erst dem Ende zuneigte. Zachariah hatte Shanghai als Kind verlassen und London im Alter von siebzehn Jahren den Rücken gekehrt, um in der Stadt der Stille zu leben. Dort deutete nichts auf das Verstreichen der Zeit hin – vielleicht abgesehen von der Asche immer neuer Krieger, die in den Mausoleen ihre letzte Ruhestätte fanden. Dennoch erinnerte Zachariah sich an die Silvesterfeiern während seines Lebens als Mensch: angefangen von Eierpunsch und Bleigießen in London bis hin zu lautem Feuerwerk und köstlichen, gedämpften Teigtaschen in Shanghai.
Jetzt rieselte Schnee auf London herab. Die Luft war klar und kalt wie ein frischer, knackiger Apfel und fühlte sich gut an auf seiner Haut. Die Stimmen der Bruderschaft waren nicht mehr als ein leises Brummen in seinem Kopf und gestatteten ihm etwas Abstand von der Stadt der Stille.
Ein besonderer Auftrag hatte ihn zum Schattenmarkt geführt, aber er nahm sich ein paar Minuten Zeit, um die Tatsache zu genießen, dass er wieder in London war und ausnahmsweise etwas anderes atmen konnte als die staubige Luft der Verblichenen. Hier auf dem Schattenmarkt hatte er immer den Eindruck, der Stadt der Stille für eine Weile entkommen und wieder jung und frei zu sein.
Zachariah genoss dieses Gefühl, was aber nicht bedeutete, dass die Standbetreiber und Besucher sich mit ihm freuten. Er hatte beobachtet, wie zahlreiche Schattenweltler und sogar Irdische mit dem Zweiten Gesicht ihm Blicke zuwarfen, die alles andere als einladend waren. Und ein dunkles Murren folgte jedem seiner Schritte, das er aus dem Stimmengewirr heraushören konnte.
Für die Schattenweltler stellten die Märkte einen kostbaren Zeitraum dar, den sie fernab aller Engel verbringen konnten, und seine Anwesenheit war definitiv nicht erwünscht. Denn Bruder Zachariah war ein Mitglied der Brüder der Stille, einer stummen Gemeinschaft, die sich uralten Mysterien und den Toten verschrieben hatte und in völliger Abgeschiedenheit inmitten alter Gebeine lebte. Man konnte von niemandem verlangen, dass er einen Stillen Bruder mit offenen Armen empfing, und die Besucher des Schattenmarktes hätten ohnehin gern auf das Erscheinen sämtlicher Schattenjäger verzichtet.
Doch während Zachariah noch über diese Tatsache nachdachte, bot sich ihm plötzlich ein außergewöhnlicher Anblick, mit dem er nun wirklich nicht gerechnet hatte.
Ein junger Schattenjäger tanzte mit drei Feenwesen einen Cancan: Charlotte und Henry Fairchilds jüngerer Sohn Matthew Fairchild. Er hatte den Kopf in den Nacken geworfen und lachte, während sein helles Haar im Schein der Fackeln leuchtete.
Zachariah fragte sich einen kurzen Moment, ob Matthew vielleicht unter einem Feenzauber stand. Doch dann erblickte der Junge ihn und hüpfte vom Podium, wo die Tänzer mit verwirrten Mienen zurückblieben. Die Feenwesen waren es nicht gewohnt, dass die Sterblichen sich ihren Reigen und Tänzen einfach entzogen.
Matthew schien das jedoch nicht zu bemerken. Er lief auf den Stillen Bruder zu, schlang ihm ausgelassen einen Arm um die Schultern und tauchte unter die Kapuze von Zachariahs Robe, um ihm einen Kuss auf die Wange zu drücken.
»Onkel Jem!«, rief Matthew erfreut. »Was machst du denn hier?«
Idris, 1899
Matthew Fairchild verlor nur selten die Beherrschung – aber wenn es geschah, dann sorgte er dafür, dass man den Anlass so schnell nicht wieder vergaß.
Das letzte Mal war vor zwei Jahren gewesen, während seines kurzen Intermezzos an der Schattenjäger-Akademie – einer Bildungsanstalt, die wie am Fließband perfekte, dämonenbekämpfende Langweiler hervorbrachte. Das Ganze hatte damit angefangen, dass sich nach einem tödlichen Vorfall mit einem Dämon in den umliegenden Wäldern die Hälfte der Schüler auf einem der hohen Türme versammelt hatte und beobachtete, wie ihre Eltern eintrafen.
Matthews normalerweise gute Laune war bereits auf eine harte Probe gestellt worden. Man hatte seinem besten Freund James die Schuld an der Geschichte gegeben, schlicht und einfach deshalb, weil durch James’ Adern eine winzige, unbedeutende Menge Dämonenblut strömte und er die – in Matthews Augen außerordentlich vorteilhafte – Fähigkeit besaß, sich in einen Schatten zu verwandeln. James sollte von der Schule verwiesen werden. Die eigentlichen Übeltäter dagegen durften bleiben: Alastair Carstairs – ein Warzenschwein durch und durch – und seine miesen Kumpel. Das Leben im Allgemeinen und die Akademie im Besonderen waren ein Paradebeispiel für die Ungerechtigkeit der Welt.
Matthew hatte noch nicht einmal die Chance gehabt, James zu fragen, ob er sein Parabatai werden wollte. Er hatte diese Frage auf eine so kunstvolle und elegante Weise unterbreiten wollen, dass James zu beeindruckt gewesen wäre, um den Kriegerbund abzulehnen.
Mr Herondale, James’ Vater, zählte zu den ersten Eltern, die an der Akademie eintrafen. Matthew und die anderen Schüler sahen, wie er mit entschlossenen Schritten zur Eingangstür eilte; seine schwarzen Haare wirkten von Wind und Wut zerzaust. Eines musste man ihm lassen: Er besaß zweifellos eine gewisse Ausstrahlung.
Die wenigen Mädchen, die an der Akademie zugelassen waren, warfen James gern einmal verstohlene Blicke zu: Er hatte zwar ständig die Nase in einem Buch vergraben und dazu einen unglücklichen Haarschnitt und ein bescheidenes Auftreten, besaß aber unverkennbare Ähnlichkeit mit seinem Vater.
James – der Erzengel segne seine ahnungslose Seele – bekam von der ganzen Aufmerksamkeit nichts mit: Er war so verzweifelt über den Schulverweis, dass er sich von allen zurückgezogen hatte.
»Du meine Güte«, sagte Eustace Larkspear, »stellt euch nur mal vor, so einen Vater zu haben.«
»Ich hab gehört, dass er verrückt sein soll«, sagte Alastair und brach in gehässiges Gelächter aus. »Man muss ja auch verrückt sein, um eine Kreatur mit Höllenblut zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, die …«
»Hör auf«, sagte der kleine Thomas leise. Und zur Überraschung aller Anwesenden verdrehte Alastair zwar die Augen, hielt aber den Mund.
Matthew hätte Alastair am liebsten selbst zum Schweigen gebracht. Doch da Thomas das bereits erledigt hatte, fiel Matthew nichts ein, wie er Alastair auf Dauer zum Schweigen bringen konnte – abgesehen von einem Duell. Allerdings war er sich nicht sicher, ob das irgendetwas ändern würde: Alastair war kein Feigling und würde die Herausforderung vermutlich annehmen und danach doppelt so viel Blödsinn erzählen wie zuvor. Außerdem war es nicht gerade Matthews Art, sich in einen Kampf verwickeln zu lassen. Natürlich konnte er kämpfen, aber seiner Meinung nach löste Gewalt nur selten Probleme.
Natürlich mit Ausnahme der Probleme, die Dämonen mit sich brachten, wenn sie in diese Welt eindrangen und sie in Schutt und Asche zu legen drohten.
Abrupt verließ Matthew den Turm und wanderte schlecht gelaunt durch die Korridore. Doch auch wenn er voll und ganz in seinen düsteren Grübeleien aufging, wusste er, dass er seine Pflichten nicht vernachlässigen und Christopher und Thomas Lightwood nicht aus den Augen verlieren durfte.
Während seiner Kindheit hatten sein älterer Bruder Charles Buford und seine Mutter einmal das Haus verlassen, um an einer Versammlung im Londoner Institut teilzunehmen. Charlotte Fairchild war die Konsulin, die wichtigste Amtsperson aller Schattenjäger, und Charles hatte sich schon immer für ihre Arbeit interessiert, statt es den lästigen Nephilim übel zu nehmen, dass diese so viel Zeit ihrer Mutter beanspruchten. Als die beiden aufbruchsbereit in der Eingangshalle gestanden hatten, hatte Matthew sich weinend an die Rockzipfel seiner Mutter geklammert.
Doch dann hatte Mama sich vor ihn gekniet und ihn gebeten, während ihrer Abwesenheit auf Papa aufzupassen.
Und Matthew hatte diese Aufgabe sehr ernst genommen, und daran hatte sich nichts geändert. Sein Vater war ein Genie und noch dazu etwas, das die meisten Menschen als körperbehindert bezeichnen würden, denn er konnte nicht gehen. Wenn man nicht sorgfältig auf ihn aufpasste, vergaß er im Eifer seiner Experimente, dass er auch etwas essen musste. Ohne Matthew kam er nicht zurecht – weswegen es völlig absurd gewesen war, dass man Matthew überhaupt auf die Akademie geschickt hatte.
Matthew kümmerte sich gern um andere. Er war sehr fürsorglich. Im Alter von acht Jahren hatte man Christopher Lightwood in Papas Labor gefunden, wo er ein sehr faszinierendes Experiment durchgeführt hatte – zumindest hatte sein Vater es damals so bezeichnet. Matthew war aufgefallen, dass dem Labor eine Wand fehlte, und er hatte daraufhin beschlossen, Christopher unter seine Fittiche zu nehmen.
Christopher und Thomas waren richtige Cousins, da ihre Väter Brüder waren. Matthew dagegen war nicht mit ihnen verwandt – er nannte die Eltern der beiden aus Höflichkeit Tante Cecily und Onkel Gabriel beziehungsweise Tante Sophie und Onkel Gideon. Ihre Eltern waren alle miteinander befreundet. Mama hatte keine engen Verwandten mehr, und Papas Familie gefiel es nicht, dass Mama als Konsulin arbeitete.
James wiederum war mit Christopher verwandt, da Tante Cecily Mr Herondales Schwester war. Mr Herondale leitete das Londoner Institut, und die Herondales lebten relativ zurückgezogen. Böse Zungen behaupteten, sie seien hochnäsig und würden sich für etwas Besseres halten. Aber Matthews Mutter meinte, diese Leute wären einfach nur dumm. Sie erklärte Matthew, dass die Herondales sich nur deshalb so selten in der Öffentlichkeit zeigten, weil sie aufgrund der Tatsache, dass Mrs Herondale ein Hexenwesen war, schlechte Erfahrungen gemacht hatten.
Trotzdem konnten sie als Leiter des Instituts nicht vollkommen unsichtbar leben. Matthew hatte James schon bei verschiedenen Feiern gesehen und versucht, ihn als Freund zu gewinnen. Aber seine Bemühungen waren dadurch behindert worden, dass er immer das Gefühl hatte, er sollte zum Erfolg einer Party beitragen, wohingegen James sich eher in eine Ecke verzogen und gelesen hatte.
Normalerweise fiel es Matthew nicht schwer, neue Freundschaften zu schließen, aber er konnte keinen Sinn darin erkennen – es sei denn, es handelte sich um eine Herausforderung. Leicht gewonnene Freunde konnte man genauso schnell wieder verlieren, und Matthew legte Wert auf feste, langfristige Beziehungen.
Deshalb hatte es ihn anfangs auch sehr getroffen, dass James ihn eindeutig nicht gemocht hatte. Doch Matthew hatte ihn umstimmen können. Zwar wusste er noch immer nicht, auf welche Weise ihm das gelungen war – was ihm etwas Unbehagen bereitete –, aber James hatte vor Kurzem Matthew, Christopher, Thomas und sich selbst als die drei Musketiere und d’Artagnan bezeichnet, nach den Hauptfiguren aus einem Buch, das er sehr mochte. Obwohl Matthew seinen Vater vermisste, war also im Grunde alles gut verlaufen. Doch jetzt hatte man James von der Schule verwiesen und damit alles ruiniert. Trotzdem durfte Matthew die Verantwortung, die er übernommen hatte, nicht vergessen.
Christopher unterhielt eine stürmische Beziehung zu den Naturwissenschaften, und nach dem letzten Vorfall hatte Professor Fell Matthew befohlen, Christopher nicht mehr in die Nähe von leicht entzündlichen Stoffen zu lassen. Dagegen war Thomas so still und klein, dass man ihn ständig aus dem Auge verlor wie eine menschliche Murmel. Und das Problem dabei war, dass er dann unweigerlich in die Nähe von Alastair Carstairs rollte.
Diese unschöne Situation hatte nur eine einzige gute Seite: Thomas ließ sich immer relativ leicht orten. Matthew brauchte nur dem Dröhnen von Alastairs nerviger Stimme zu folgen.
Bedauerlicherweise bedeutete das aber auch, dass er dann zwangsläufig Alastairs nerviges Gesicht zu sehen bekam.
Und tatsächlich fand er Alastair schon bald: Er blickte aus einem Fenster, wobei Thomas schüchtern an seiner Seite stand.
Thomas’ Heldenanbetung war Matthew ein Rätsel. Er selbst konnte an Alastair nur eine einzige positive Sache finden: seine außerordentlich ausdrucksstarken Augenbrauen. Aber Augenbrauen waren schließlich nicht alles.
»Bist du sehr traurig, Alastair?«, hörte er Thomas fragen, als er sich ihnen näherte.
»Geh mir nicht auf die Nerven, Winzling«, sagte Alastair, allerdings in nachsichtigem Ton. Nicht einmal er konnte allzu viel dagegen haben, verehrt zu werden.
»Du hast gehört, was die hinterhältige Schlange gesagt hat«, bemerkte Matthew. »Also, lass uns von hier verschwinden, Tom.«
»Ah, die Glucke Fairchild«, höhnte Alastair. »Eines Tages wirst du mal ein entzückendes Eheweib abgeben.«
Empört registrierte Matthew, dass Thomas leicht lächelte, obwohl er sein Lächeln aus Respekt vor Matthews Gefühlen rasch unterdrückte. Thomas war schmächtig und hatte unter seinen älteren Schwestern stark zu leiden. Offenbar verwechselte er Alastairs rüpelhafte Art mit Verwegenheit.
»Ich wünschte, ich könnte von dir das Gleiche behaupten«, erwiderte Matthew. »Ist es noch keiner gütigen Seele in den Sinn gekommen, dir mitzuteilen, dass deine Frisur – um es mit den freundlichsten mir zur Verfügung stehenden Worten zu sagen – unglücklich gewählt ist? Niemandem? Nicht einmal deinem Vater? Gibt es überhaupt irgendjemanden in deinem Umfeld, der sich hinreichend für dich interessiert, dass er dich daran hindert, dich zum Gespött der Leute zu machen? Oder bist du einfach nur zu sehr damit beschäftigt, niederträchtige Taten an Unschuldigen zu begehen, um dich um dein bedauernswertes Äußeres zu kümmern?«
»Matthew!«, sagte Thomas. »Sein Freund ist tot.«
Matthew hätte gern darauf hingewiesen, dass Alastair und seine Freunde schließlich diejenigen gewesen waren, die einen Dämon auf James losgelassen hatten, und es daher nur gerecht war, dass ihr hässlicher Streich einen von ihnen getroffen hatte. Allerdings war ihm klar, dass diese Antwort Thomas nur noch mehr aufgeregt hätte.
»Na schön. Komm, lass uns gehen«, sagte er. »Obwohl ich mich ja frage, wessen Idee dieser hässliche kleine Trick gewesen war.«
»Warte mal einen Moment, Fairchild«, fauchte Alastair. »Du kannst gehen, Lightwood.«
Thomas wirkte sehr beunruhigt, als er sich zum Gehen wandte, aber Matthew konnte ihm ansehen, dass er seinem Idol niemals widersprechen würde. Als Thomas seine besorgten nussbraunen Augen auf Matthew heftete, nickte er ihm zu, woraufhin Thomas sich widerstrebend entfernte.
Als er verschwunden war, baute Alastair sich vor Matthew auf. Matthew war klar, dass Alastair Thomas aus einem bestimmten Grund weggeschickt hatte. Er biss sich auf die Lippe und wappnete sich für eine Rauferei.
Doch stattdessen knurrte Alastair: »Für wen hältst du dich eigentlich, dass du hier den Moralprediger spielst und von Tricks und Vätern redest … wenn man die Umstände deiner eigenen Geburt bedenkt?«
Matthew runzelte die Stirn. »Was um alles in der Welt schwafelst du da, Carstairs?«
»Alle reden von deiner Mutter und ihrer undamenhaften Tätigkeit«, sagte der grässliche, unfassbare Wurm Alastair Carstairs. Matthew schnaubte nur verächtlich, doch Alastair fuhr mit erhobener Stimme fort: »Eine Frau kann das Amt des Konsuls nicht anständig bekleiden. Trotzdem verfolgt deine Mutter ihre Karriere einfach weiter, dank der tatkräftigen Unterstützung der mächtigen Lightwoods.«
»Es stimmt, dass unsere Familien befreundet sind«, sagte Matthew. »Dieses Phänomen gibt es: Freundschaft. Noch nie davon gehört, Carstairs? Wie tragisch für dich – wenn auch durchaus verständlich für alle anderen Bewohner dieses Universums.«
Alastair zog die Augenbrauen hoch. »Ja, großartige Freunde, zweifellos. Deine Mutter kann Freunde offensichtlich dringend gebrauchen, da dein Vater ja nicht in der Lage ist, den Pflichten eines Mannes nachzukommen.«
»Wie bitte?«, fragte Matthew.
»Es ist doch seltsam, dass du so lange nach dem schrecklichen Unfall deines Vaters zur Welt gekommen bist«, erwiderte Alastair – wobei nur noch fehlte, dass er einen imaginären Schnurrbart zwirbelte. »So seltsam, dass die Familie deines Vaters nichts mit euch zu tun haben will und sogar verlangt hat, dass deine Mutter ihren Ehenamen aufgibt. Und so bemerkenswert, dass du keinerlei Ähnlichkeit mit deinem Vater besitzt, aber dafür die gleiche Haarfarbe hast wie Gideon Lightwood.«
Gideon Lightwood war Thomas’ Vater. Kein Wunder, dass Alastair Thomas weggeschickt hatte, bevor er solch eine lächerliche Behauptung aufstellte.
Das Ganze war absurd. Ja, es stimmte, dass Matthew helle Haare hatte, während seine Mutter braune und sein Vater und Charles Buford rote Haare besaßen. Matthews Mutter war winzig, aber die Köchin war der Ansicht, dass Matthew seinen Bruder eines Tages überragen würde. Und Onkel Gideon begleitete seine Mutter regelmäßig. Matthew wusste, dass er bei Problemen mit dem Rat ihre Partei ergriffen hatte. Mama hatte ihn einst als ihren guten, zuverlässigen Freund bezeichnet – etwas, worauf Matthew bisher keinen einzigen Gedanken verschwendet hatte.
Seine Mutter sagte immer, dass sein Vater solch ein liebes, freundliches, sommersprossiges Gesicht hatte. Matthew hatte sich schon seit Jahren gewünscht, er würde aussehen wie er.
Aber das war nun mal nicht der Fall.
Als Matthew antwortete, klang seine Stimme in seinen eigenen Ohren fremd: »Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Henry Branwell ist nicht dein Vater«, stieß Alastair hervor. »Du bist Gideon Lightwoods Bastard. Das weiß schließlich jeder außer dir.«
In einem Anfall blinder Wut versetzte Matthew Alastair einen Kinnhaken. Dann machte er sich auf die Suche nach Christopher, räumte das Gelände und reichte ihm eine Packung Streichhölzer.
Wenige ereignisreiche Minuten später verließ Matthew die Schule, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Und in dieser kurzen Zeitspanne flog ein Gebäudeflügel der Akademie in die Luft.
Matthew war sich der Tatsache bewusst, dass das eine ziemlich schockierende Tat gewesen war. Aber noch während er sich in diesem wahnwitzigen Geisteszustand befunden hatte, hatte er James aufgefordert, sein Parabatai zu werden – und wundersamerweise hatte James zugestimmt. Matthew und sein Vater vereinbarten daraufhin, dass sie mehr Zeit in der Londoner Stadtvilla der Fairchilds verbringen würden, damit Matthew sowohl bei seinem Vater als auch bei seinem Parabatai sein konnte. Alles in allem hatte sich die ganze Situation also bestens gefügt, überlegte Matthew.
Wenn er jetzt doch nur noch vergessen könnte.
Londoner Schattenmarkt, 1901
Jem blieb inmitten der tanzenden Flammen und schwarzen Bahnbögen des Londoner Schattenmarktes abrupt stehen, verblüfft über den Anblick eines vertrauten Gesichts in einer unerwarteten Umgebung – und noch verblüffter über Matthews warmherzige Begrüßung.
Natürlich kannte er Charlottes Sohn. Ihr anderer Junge, Charles, war dagegen immer sehr kühl und reserviert, wenn er Bruder Zachariah im Rahmen offizieller Besuche begegnete. Zachariah wusste, dass die Brüder der Stille fernab der Welt leben sollten – Alastair, der Sohn seines Onkels Elias, hatte daran keinen Zweifel gelassen, als Zachariah Kontakt zu ihm aufgenommen hatte.
Und so sollte es auch sein, sagte die Bruderschaft in seinem Verstand. Er konnte ihre Stimmen nicht immer voneinander unterscheiden – sie klangen wie ein leiser Chor, ein stilles, allgegenwärtiges Lied.
Jem hätte es Matthew daher nicht übel genommen, wenn er die gleichen Gefühle gehegt hätte wie die meisten anderen. Doch das schien nicht der Fall zu sein. Sein leuchtendes, fein geschnittenes Gesicht zeigte stattdessen seine Bestürzung nur allzu deutlich.
»Bin ich zu aufdringlich?«, fragte er besorgt. »Ich habe nur gedacht, da ich James’ Parabatai bin und er dich ›Onkel Jem‹ nennt, dürfte ich dich vielleicht auch so nennen.«
Selbstverständlich darfst du das, sagte Zachariah.
Schließlich war James nicht der Einzige – auch seine Schwester Lucie und Alastairs Schwester Cordelia hatten diese Bezeichnung übernommen. Zachariah hielt die drei für die nettesten Kinder der Welt. Natürlich war er ein klein wenig voreingenommen, aber Vertrauen schuf nun einmal eigene Wahrheiten.
Matthew strahlte. Er erinnerte Zachariah an dessen Mutter und deren Güte, als sie drei Waisenkinder bei sich aufgenommen hatte, obwohl sie selbst fast noch ein Kind gewesen war.
»Im Londoner Institut reden alle ständig von dir«, vertraute Matthew ihm an. »James und Lucie, aber auch Onkel Will und Tante Tessa. Dadurch habe ich das Gefühl, ich würde dich bereits viel besser kennen als in Wirklichkeit … Deshalb bitte ich um Vergebung, falls ich dir zu nahe getreten bin.«
Du kannst mir nicht zu nahe treten, da du immer willkommen bist, sagte Jem.
Matthews Lächeln breitete sich über sein ganzes Gesicht aus – ein außerordentlich gewinnender Anblick. Seine Herzlichkeit war schneller sichtbar als bei Charlotte, überlegte Jem. Matthew hatte noch nicht gelernt, sich abzuschotten und sich nicht vertrauensvoll und voller Entzücken der Welt zu öffnen.
»Ich würde gern alles über die Abenteuer hören, die du, Onkel Will und Tante Tessa erlebt haben … natürlich aus deiner Sicht«, schlug Matthew vor. »Das müssen sehr aufregende Zeiten gewesen sein! Hier bei uns passiert dagegen überhaupt nichts. Nach allem, was ich gehört habe, könnte man meinen, dass du eine hochdramatische, zum Scheitern verurteilte Beziehung mit Tante Tessa hattest, bevor du der Bruderschaft beigetreten bist.« Matthew verstummte. »Tut mir leid! Meine Zunge war wieder mal schneller als mein Verstand. Aber das liegt nur daran, dass ich so aufgeregt bin, endlich richtig mit dir reden zu können. Bestimmt ist es seltsam für dich, an deine Vergangenheit zu denken. Hoffentlich habe ich dich nicht verletzt oder gekränkt. Ich bitte um Frieden.«
Frieden, wiederholte Zachariah belustigt.
»Ich bin mir sicher, du hättest mit jeder Dame eine inbrünstige Affäre haben können«, sagte Matthew. »Das sieht schließlich jeder. Oh, gütiger Gott, das war ebenfalls eine unbesonnene Bemerkung, oder?«
Es war eine sehr nette Bemerkung, erwiderte Zachariah. Ist heute nicht ein wundervoller Abend?
»Wie ich sehe, bist du ein sehr taktvoller Mann«, sagte Matthew und schlug Zachariah anerkennend auf den Rücken.
Dann schlenderten sie gemeinsam durch die Gassen des Schattenmarktes. Zachariah suchte einen bestimmten Hexenmeister, der ihm seine Hilfe angeboten hatte.
»Weiß Onkel Will, dass du in London bist?«, fragte Matthew. »Wirst du ihn nachher besuchen? Wenn Onkel Will herausfindet, dass du in der Stadt warst und ich davon gewusst habe, dann ist es aus mit mir! Ein junger Mann, dahingeschieden in der Blüte seiner Jugend. Eine strahlende Blume der Männlichkeit, vorzeitig verwelkt. Vielleicht könntest du ja einen Moment an mich und mein Schicksal denken, Onkel Jem.«
Könnte ich das?, fragte Zachariah.
Es war offensichtlich, worauf Matthew hinauswollte.
»Außerdem wäre es sehr nett, wenn du nicht erwähnen würdest, dass du mich auf dem Schattenmarkt getroffen hast«, sagte Matthew mit gewinnendem Lächeln, aber besorgtem Ausdruck in den Augen.
Die Brüder der Stille sind im Allgemeinen schreckliche Klatschmäuler, sagte Bruder Zachariah. Aber für dich, Matthew, werde ich eine Ausnahme machen.
»Danke, Onkel Jem!« Matthew hakte sich bei Jem unter. »Ich habe keinen Zweifel, dass wir großartige Freunde sein werden.«
Ihr Anblick musste für die Besucher des Schattenmarktes ein Schock sein, dachte Jem – ein krasser Kontrast zwischen dem aufgeweckten Jugendlichen und dem in Dunkelheit gehüllten, mönchsartigen Stillen Bruder. Matthew schien dieses Missverhältnis jedoch nicht wahrzunehmen.
Ich denke, da hast du recht, bestätigte Jem.
»Meine Cousine Anna sagt, dass man auf dem Schattenmarkt jede Menge Spaß haben kann«, fuhr Matthew strahlend fort. »Natürlich kennst du Anna. Mit ihr allein kann man schon jede Menge Spaß haben, und sie hat den exquisitesten Geschmack, was Westen betrifft. Ich habe ein paar sehr ansprechende Feenwesen kennengelernt, die mich zum Besuch des Schattenmarktes eingeladen haben. Und da dachte ich, ich schau mich mal um.«
Die Feenwesen, mit denen Matthew kurz zuvor getanzt hatte, flitzten an ihnen vorbei wie Leuchtspuren mit Blütenkronen. Ein Elbe hielt kurz inne, die Lippen vom Saft unbekannter Früchte dunkel gefärbt, und zwinkerte Matthew zu. Offensichtlich nahm er es ihm nicht übel, dass er aus ihrem Tanz ausgeschieden war, obwohl man sich bei den Feenwesen nur selten auf den äußeren Eindruck verlassen durfte. Matthew zögerte, warf Zachariah einen vorsichtigen Blick zu und erwiderte das Zwinkern.
Bruder Zachariah hatte das Gefühl, den Jungen warnen zu müssen: Deine Freunde führen möglicherweise Übles im Schilde. Das kommt bei Feenwesen oft vor.
Matthew lächelte, doch dann verwandelte sich sein Lächeln in ein schalkhaftes Grinsen. »Ich führe oft selbst Übles im Schilde.«
Das habe ich nicht gemeint. Und ich will auch keineswegs irgendwelche Schattenweltler beleidigen. Es gibt so viele vertrauenswürdige Schattenwesen, wie es vertrauenswürdige Schattenjäger gibt. Doch das Gleiche gilt auch umgekehrt. Vielleicht wäre es klüger, wenn du dich gelegentlich daran erinnerst, dass nicht alle Besucher des Schattenmarktes den Nephilim wohlgesinnt sind.
»Wer könnte es ihnen verübeln?«, sagte Matthew leichthin. »Ein stinklangweiliger Haufen. Anwesende natürlich ausgenommen, Onkel Jem. Mein Vater ist mit einem Hexenmeister befreundet, von dem er häufig erzählt. Sie haben gemeinsam die Portale erfunden, hast du das gewusst? Ich hätte auch gern einen Schattenweltler zum Freund.«
Magnus Bane wäre jedem ein wahrer Freund, pflichtete Zachariah ihm bei.
Er überlegte, ob er Matthew noch eindringlicher warnen sollte, entschied sich aber aus Respekt gegenüber Magnus dagegen. Der Hexenmeister war seinem Parabatai einst eine große Hilfe gewesen. Vielleicht war er selbst auch einfach nur übervorsichtig. Wahrscheinlich waren viele Schattenweltler von Matthews Charme sofort eingenommen.
Will hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Institut allen Hilfe suchenden Schattenweltlern offen stand – genau wie allen Irdischen und Schattenjägern. Vielleicht würde diese Generation ja in größerem Einklang mit den Schattenweltlern aufwachsen als jede andere vor ihr.
»Anna ist heute Abend nicht hier«, fuhr Matthew fort. »Aber du bist hier, also ist alles in bester Ordnung. Was haben wir jetzt vor? Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ich dachte, ich könnte Jamie und Lucie vielleicht ein Buch kaufen. Irgendein Buch. Sie lieben Bücher über alles.«
Die Zuneigung zu James und Lucie, die aus Matthews Worten sprach, bewirkte, dass Jem den Jungen noch stärker ins Herz schloss.
Wenn wir ein geeignetes Buch finden, sollten wir es für die beiden erstehen. Allerdings würde ich auf Wälzer mit gefährlichen Beschwörungsformeln lieber verzichten, sagte er.
»Beim Erzengel: auf keinen Fall«, pflichtete Matthew ihm bei. »Lucie würde es garantiert lesen. Unsere Lu ist eine kleine Draufgängerin, auch wenn man es ihr nicht ansieht.«
Und was mich betrifft: Ich habe einen Auftrag von jemandem erhalten, den ich sehr schätze, sagte Jem. Aus Respekt gegenüber dieser Person kann ich leider keine weiteren Auskünfte geben.
»Das verstehe ich vollkommen«, meinte Matthew. Er schien sich darüber zu freuen, dass Jem ihn überhaupt ins Vertrauen gezogen hatte. »Ich werde nicht weiter in dich dringen, aber kann ich dir vielleicht helfen? Du kannst auf mich zählen. Schließlich lieben wir die gleichen Menschen, oder?«
Danke für dein Angebot.
Natürlich bestand nicht die geringste Chance, dass der Junge ihm helfen konnte, jedenfalls nicht bei diesem Auftrag. Aber seine Anwesenheit schenkte Zachariah das Gefühl, als könnte er an Matthews Begeisterung teilhaben, während er sich auf dem Schattenmarkt umsah. Langsam gingen sie weiter und ließen die Geräusche und Bilder des Marktes auf sich wirken.
Ihr Weg führte an einem Stand mit Elbenfrüchten vorbei, an dem allerdings auch ein Werwolf stand und düstere Bemerkungen darüber machte, dass man ihn betrogen hätte und sie besser keine Geschäfte mit den Kobolden machen sollten. Ein Stand mit einer rot-weiß gestreiften Markise bot Karamellbonbons an, aber Zachariah hatte Bedenken bezüglich der Herkunft der Süßwaren. Plötzlich blieb Matthew stehen und lachte fröhlich, als eine blauhäutige Hexe mit Spielzeug-Einhörnern, Nixen-Muscheln und kleinen Feuerrädern jonglierte. Und dann flirtete er so lange mit ihr, bis sie ihm ihren Namen verriet: Catarina. Sie fügte zwar hinzu, dass er sich ganz gewiss nicht an sie wenden dürfe, doch als Matthew lächelte, erwiderte sie sein Lächeln. Wie vermutlich die meisten Leute, dachte Zachariah.
Der Junge schien die Besucher des Schattenmarktes irgendwie zu verwirren. Sie waren es gewohnt, dass die Schattenjäger sich nur dann auf ihrem Markt blicken ließen, wenn sie einen Zeugen oder Verdächtigen suchten und dabei wenig Begeisterung für die Stände zeigten.
Matthew applaudierte, als ihm ein weiterer Stand auf Hühnerfüßen entgegenkam. Eine Elfe mit pusteblumenartigen Haaren spähte hinter ihren Phiolen mit leuchtend bunten Flüssigkeiten hervor.
»Na, mein Hübscher«, sagte sie mit borkenrauer Stimme.
»Wen von uns beiden meinst du?«, fragte Matthew lachend und stützte seinen Ellbogen auf Bruder Zachariahs Schulter.
Die Elfe musterte Zachariah misstrauisch. »Ach, sieh an: ein Bruder der Stille auf unserem bescheidenen Markt. Die Nephilim würden das als eine besondere Ehre bezeichnen.«
Fühlst du dich denn geehrt?, fragte Zachariah und verlagerte sein Gewicht ein wenig, um sich schützend vor Matthew zu stellen.
Davon unbeirrt schob Matthew sich jedoch an Zachariah vorbei und betrachtete die ausgebreiteten Waren der Elfe.
»Rasend interessante Zaubertränke«, bemerkte er und schenkte der Frau sein strahlendes Lächeln. »Hast du die selbst zubereitet? Alle Achtung. Das macht dich zu einer Erfinderin, oder? Mein Vater ist auch ein Erfinder.«
»Ich freue mich über jeden auf dem Markt, der sich für meine Waren interessiert«, erwiderte die Frau und musterte Zachariah unbeugsam. Dann wandte sie sich an Matthew. »Wie ich sehe, passen deine honigsüßen Worte zum honiggoldenen Ton deiner Haare. Wie alt bist du?«
»Fünfzehn«, antwortete Matthew prompt.
Er nahm ein paar Phiolen prüfend in die Hand, wobei seine Ringe gegen das Glas und die mit Gold oder Silber verzierten hölzernen Stöpsel klirrten. Dabei erzählte er die ganze Zeit von seinem Vater und von den Feentränken, über die er in Büchern gelesen hatte.
»Ah, fünfzehn Sommer alt – und deinem Äußeren nach zu urteilen hat während der ganzen Zeit nur Sommer geherrscht. Manche würden ja sagen, dass nur ein seichter Fluss so hell glitzern kann«, sagte die Elfe, woraufhin Matthew sie ansah – ein argloses Kind, das auf jede Beleidigung mit Überraschung reagierte. Sein Lächeln erlosch für einen kurzen Moment.
Doch bevor Jem einschreiten konnte, lächelte der Junge bereits wieder.
»Ach, nun ja. ›Er hat nichts, aber er sieht nach allem aus. Was können Sie mehr wünschen?‹«, zitierte Matthew. »Das ist von Oscar Wilde. Kennst du seine Werke? Ich habe gehört, dass die Feenwesen gerne Dichter entführen. Ihr hättet wirklich versuchen sollen, ihn zu entführen.«
Die Frau lachte. »Vielleicht haben wir das ja. Möchtest du denn entführt werden, mein holder Knabe?«
»Ich glaube nicht, dass meiner Mutter, der Konsulin, das gefallen würde. Nein.«
Matthew strahlte sie weiterhin an. Die Elfe wirkte einen Moment lang enttäuscht, doch dann erwiderte sie sein Lächeln. Die Feenwesen konnten wie Dornen stechen, aber nicht weil sie Schaden anrichten wollten, sondern weil es in ihrer Natur lag.
»Das hier ist ein Liebestrank«, sagte die Elfe und deutete mit dem Kopf auf eine Phiole, in der eine rosa Flüssigkeit leicht glitzerte. »Doch das brauchst du ja nicht, mein Hübscher. Aber das hier … das würde in einem Kampf deinem Gegner das Augenlicht nehmen.«
Das kann ich mir gut vorstellen, sagte Bruder Zachariah und betrachtete die Phiole, die bis zum Rand mit anthrazitgrauem Sand gefüllt war.
Matthew war eindeutig erfreut, mehr über die Phiolen zu erfahren. Zachariah vermutete, dass Henrys Junge beim Abendessen wieder und wieder Geschichten über die verschiedenen Elemente gehört hatte.
»Und was ist hiermit?«, fragte Matthew und zeigte auf eine violette Phiole.
»Ach, ein weiterer Zaubertrank, der für die Nephilim nicht von Interesse ist«, erwiderte die Frau abschätzig. »Welchen Nutzen hättet ihr von einem Mittel, das jeden zum Sprechen der Wahrheit veranlasst? Wie ich gehört habe, kennt ihr Schattenjäger ja keine Geheimnisse voreinander. Außerdem habt ihr doch dieses Engelsschwert, um nachzuprüfen, ob jemand die Wahrheit sagt. Allerdings würde ich das als eine ziemlich brutale Methode bezeichnen.«
»Das ist in der Tat brutal«, pflichtete Matthew ihr eifrig bei.
Die Elfe wirkte fast ein wenig traurig. »Du entstammst einem brutalen Volk, mein liebes Kind.«
»Nein, ich nicht«, sagte Matthew. »Ich glaube an die Kunst und die Schönheit.«
»Und dennoch könntest du eines Tages erbarmungslos sein.«
»Nein, niemals«, beharrte Matthew. »Ich interessiere mich nicht für die Gepflogenheiten der Schattenjäger. Die der Schattenweltler sind mir viel lieber.«
»Ach, du schmeichelst einem alten Weib«, sagte die Elfe und machte eine abschätzige Handbewegung. Aber ihr Gesicht verzog sich wie ein runzliger Apfel, als sie erneut lächelte.
»Aber da du so ein lieber Junge bist, will ich dir etwas ganz Besonderes zeigen. Was hältst du von einer Phiole mit destilliertem Sternenstaub, der seinem Träger ein langes Leben garantiert?«
Genug!, riefen die Stimmen in Zachariahs Kopf.
Schattenjäger machen keinen Kuhhandel um ihr eigenes Leben, sagte Bruder Zachariah, packte Matthew am Ärmel und zog ihn mit sich.
Matthew protestierte und ruderte mit den Armen.
Die Phiolen der Elfe waren sehr wahrscheinlich nur mit gefärbtem Wasser und Sand gefüllt, sagte Zachariah. Du solltest dein Geld nicht dafür verschwenden und auch sonst keine Geschäfte mit den Feenwesen machen. Auf dem Schattenmarkt muss man immer auf der Hut sein. Die Feenwesen handeln nicht nur mit Träumen, sondern auch mit großem Leid.
»Also gut«, sagte Matthew. »Sieh mal, Onkel Jem! Die Werwölfin dort drüben betreibt einen Bücherstand. Werwölfe sind überraschend eifrige Leser, musst du wissen.«
Er lief zu dem Stand und bombardierte die Standbesitzerin – eine Dame in einem züchtigen Kleid – mit naiven Fragen, bis sie sich an die Haare fasste und über seinen Unsinn lachte. Zachariahs Aufmerksamkeit war einen Moment lang abgelenkt, als er den Hexenmeister entdeckte, nach dem er die ganze Zeit gesucht hatte.
Warte hier auf mich, wandte er sich kurz an Matthew und ging zu Ragnor Fell, der bei einer Feuerstelle unter einem der Eisenbahnbögen stand.
Als er näher kam, sprühten die Flammen grüne Funken. Sie passten zur Gesichtsfarbe des Hexenmeisters und ließen seine schneeweißen Haare aufleuchten, die sich um die gezwirbelten Hörner auf seiner Stirn wanden.
»Bruder Zachariah«, sagte er und nickte. »Es ist mir eine Freude. Aber ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für dich. Nun denn. Schlechte Nachrichten wehen wie Regen heran, aber gute Nachrichten schlagen ein wie ein Blitz – kaum sieht man sie, schon sind sie da.«
Ein erheiternder Gedanke, sagte Zachariah, dem der Mut sank.
»Ich habe verschiedene Informationsquellen aufgesucht, um die von dir gewünschten Hinweise zu bekommen«, berichtete Ragnor. »Inzwischen habe ich eine heiße Spur, aber du musst Folgendes wissen: Man hat mich gewarnt, dass dieser Auftrag tödlich enden könnte … und dass er bereits bei mehr als nur einer Person zum Tode geführt hat. Möchtest du wirklich, dass ich dieser Spur weiterhin nachgehe?«
Ja, bitte, sagte Zachariah.
Er hatte sich mehr erhofft. Bei seinem letzten Treffen mit Tessa hatte sie sehr besorgt gewirkt. Ein grauer Tag hatte über der Stadt gelegen, und der Wind auf der Brücke hatte ihr die braunen Haare aus dem Gesicht geweht – ihr Gesicht, dem die Zeit nichts anhaben konnte, auf dem die Sorgen aber ihre Spuren hinterlassen hatten. Manchmal hatte Zachariah das Gefühl, dass ihr Gesicht das einzige Herz war, das er noch besaß. Zwar konnte er nicht viel für sie tun, aber er hatte ihr einst versprochen, dass er sie sein ganzes Leben lang vor den Winden des Himmels bewahren würde.
Und zumindest dieses Versprechen wollte er halten.
Ragnor Fell nickte. »Dann werde ich weitersuchen.«
Und ich ebenfalls, sagte Zachariah.
Plötzlich wirkte Ragnor extrem beunruhigt. Zachariah drehte sich um und sah Matthew, der zu der Elfe mit den Zaubertränken zurückgekehrt war.
Matthew!, rief Bruder Zachariah. Komm her.
Der Junge nickte, glättete seine Weste und schlenderte widerstrebend auf Zachariah zu.
Der beunruhigte Ausdruck auf Ragnors Gesicht verstärkte sich. »Warum kommt er jetzt hierher? Wieso tust du mir das an? Ich hatte dich immer für einen der vernünftigeren Schattenjäger gehalten – nicht dass das viel heißen will!«
Zachariah musterte Ragnor. Es war ungewöhnlich, den Hexenmeister so aufgewühlt zu sehen; normalerweise war er sehr diskret und professionell.
Ich dachte, dich würde eine lange und geschätzte Beziehung mit den Fairchilds verbinden, sagte Zachariah.
»Oh ja, sicher doch«, erwiderte Ragnor. »Und mich verbindet auch eine lange und geschätzte Beziehung mit dem Bestreben, mich nicht in die Luft jagen zu lassen.«
Wie bitte?, fragte Zachariah.
Das Rätsel klärte sich auf, als Matthew Ragnor entdeckte und übers ganze Gesicht strahlte.
»Ah, hallo, Professor Fell.« Er wandte sich Jem zu. »Professor Fell hat mich an der Akademie unterrichtet, bevor ich von der Schule geflogen bin. In hohem Bogen von der Schule geflogen bin.«
Jem hatte gewusst, dass man James von der Schule verwiesen hatte, aber es war ihm neu, dass die Schulleitung auch Matthew hinausgeworfen hatte. Bisher hatte er immer angenommen, dass Matthew einfach beschlossen hatte, seinem Parabatai zu folgen, so wie es nun mal üblich war.
»Ist dein Freund auch hier?«, fragte Ragnor Fell, und sein Augenlid zuckte. »Ist Christopher Lightwood in der Nähe? Wird unser Markt gleich in Flammen aufgehen?«
»Nein«, sagte Matthew in belustigtem Ton. »Christopher ist zu Hause.«
»Zu Hause in Idris?«
»Im Londoner Stadthaus der Lightwoods. Aber das ist weit weg.«
»Nicht weit genug!«, entgegnete Ragnor Fell. »Ich werde unverzüglich nach Paris aufbrechen.«
Er nickte Zachariah kurz zu, schauderte sichtlich, als er Matthew noch einmal ansah, und marschierte davon. Traurig winkte Matthew ihm nach.
»Auf Wiedersehen, Professor Fell!«, rief er und wandte sich dann Zachariah zu. »Christopher hatte keinen der Unfälle beabsichtigt, und die große Explosion war ausschließlich meine Schuld.«
Ich verstehe, sagte Zachariah.
Allerdings war er sich nicht ganz sicher, ob er es wirklich verstand.
»Bestimmt kennst du Gideon sehr gut«, bemerkte Matthew, dessen wacher Verstand blitzschnell ein anderes Thema aufgriff.
In der Tat, bestätigte Zachariah. Er ist ein guter Kerl … der beste, den man sich vorstellen kann.
Matthew zuckte die Achseln. »Wenn du meinst. Ich mag Onkel Gabriel ja lieber. Aber natürlich nicht so sehr wie Onkel Will.«
Will war auch mir schon immer der Liebste, pflichtete Jem ihm ernst bei.
Matthew biss sich auf die Unterlippe; offensichtlich dachte er über etwas nach. »Möchtest du eine Wette mit mir abschließen, Onkel Jem? Ich wette, dass ich mit einer Elle Abstand über dieses Feuer springen kann.«
Nein, das möchte ich nicht, sagte Zachariah entschlossen. Matthew, warte …
Doch Matthew stürmte bereits auf die jadegrünen Flammen zu und sprang. Dabei drehte sich sein schlanker, schwarz gekleideter Körper in der Luft – wie ein von Meisterhand geworfener Dolch – und landete im Schatten des Kirchturms auf beiden Füßen. Nach einem Moment klatschten mehrere Besucher des Schattenmarktes Beifall. Matthew tat so, als würde er einen imaginären Hut ziehen, und verbeugte sich dann tief.
Selbst im Schein der grünen Flammen schimmerten seine Haare golden, und sein Gesicht leuchtete sogar im Schatten. Zachariah sah ihn lachen, und eine dunkle Ahnung überkam ihn. Plötzlich hatte er Angst um Matthew und um alle Kinder seiner geliebten Freunde. Als er in Matthews Alter gewesen war, waren Will und er bereits durch Feuer und brennendes Silber gegangen. Seine Generation hatte gelitten, damit die nächste Generation in einer besseren Welt leben konnte. Doch jetzt wurde Jem bewusst, dass diese Kinder, die aufgrund ihrer Erziehung nur Liebe erwarteten und furchtlos durch die Schatten wandelten, angesichts einer Katastrophe geschockt reagieren und sich betrogen fühlen würden. Manche von ihnen würden vermutlich als gebrochene Menschen aus der Erfahrung hervorgehen.
Jem konnte nur hoffen, dass sich eine derartige Katastrophe nie ereignen würde.
Londoner Residenz der Fairchilds, 1901
Am nächsten Morgen dachte Matthew noch immer über seinen Besuch auf dem Schattenmarkt nach. In gewisser Hinsicht war es wirklich verdammtes Pech gewesen, dort ausgerechnet auf Onkel Jem zu stoßen, auch wenn er sich darüber gefreut hatte, ihn endlich etwas besser kennenzulernen. Vielleicht war Onkel Jem ja jetzt der Ansicht, dass James bei seinem Parabatai keine so schlechte Wahl getroffen hatte.
Matthew stand schnell auf, um der Köchin beim Backen zu helfen. Die alte Dame hatte Arthritis, und Mama hatte sie bereits gefragt, ob ihr das zunehmende Alter zu schaffen mache und ob sie sich nicht zur Ruhe setzen wolle. Doch die Köchin wollte davon nichts hören, und es brauchte ja niemand zu erfahren, dass er ihr morgens in der Küche half. Außerdem gefiel es ihm, dass seine Eltern und sogar Charles ein Frühstück aßen, das er zubereitet hatte. Seine Mutter arbeitete so hart, und die Sorgenfalten auf ihrer Stirn und an ihren Mundwinkeln waren auch dann noch zu sehen, wenn es Matthew gelang, sie zum Lachen zu bringen. Da sie Cranberry-Scones besonders mochte, versuchte er, dieses Gebäck für sie zu backen, wann immer er Gelegenheit dazu hatte. Schließlich konnte er sonst kaum etwas für sie tun. Er war ihr keine große Stütze, im Gegensatz zu seinem Bruder Charles.
»Charles Buford ist ja so ernsthaft und zuverlässig«, hatte eine von Mamas Freundinnen mal beim Tee in Idris gesagt und in eines der speziell für seine Mutter gebackenen Scones gebissen. »Und Matthew, nun ja, er ist … charmant.«
Am Frühstückstisch streckte Charles Buford die Hand nach dem Teller mit Mamas Gebäck aus. Matthew lächelte ihn an, schüttelte aber entschieden den Kopf und schob den Teller neben den Ellbogen seiner Mutter. Charles Buford verzog das Gesicht, sagte jedoch nichts.
Charlotte schenkte Matthew ein geistesabwesendes Lächeln und starrte dann wieder auf die Tischdecke. Sie schien ihren Gedanken nachzuhängen. Matthew wünschte, er könnte behaupten, dass das die Ausnahme war. Aber leider kam es in letzter Zeit öfter vor. Seit Monaten lag irgendetwas in der Luft, und nicht nur seine Mutter, sondern auch sein Vater und sogar Charles Buford wirkten abgelenkt und hatten Matthew gelegentlich sogar angefaucht. Insgeheim fürchtete Matthew sich vor dem, was man ihm vielleicht mitteilen würde: Es war Zeit, dass er die Wahrheit erfuhr. Seine Mutter würde sie für immer verlassen. Manchmal dachte er, wenn man ihm nur endlich reinen Wein einschenken würde, könnte er das Ganze besser ertragen.
»Geht es dir gut, meine Liebe?«, fragte sein Vater.
»Ausgezeichnet, Henry«, sagte Mama.
Matthew liebte seinen Vater über alle Maßen, doch er kannte ihn nur zu gut. Es gab Zeiten, da hätte statt der Familie eine Schar Wellensittiche am Frühstückstisch sitzen können, und Papa hätte den Vögeln einfach von seinen jüngsten Experimenten berichtet.
Doch jetzt musterte sein Vater Mama mit besorgtem Blick. Matthew glaubte, ihn fast sagen zu hören: Bitte, Charlotte. Bitte verlass mich nicht.
Sein Herz verkrampfte sich in der Brust. Matthew faltete die Serviette dreimal und räusperte sich. »Könnte mir vielleicht mal einer sagen …«
In dem Moment ging die Tür auf, und Gideon Lightwood betrat das Speisezimmer. Mr Lightwood. Matthew weigerte sich, ihn noch länger als Onkel Gideon zu bezeichnen.
»Was wollen Sie denn hier?«, fragte er.
»Sir!«, verbesserte Mama ihn scharf. »Also wirklich, Matthew, nenn ihn Sir.«
»Was wollen Sie denn hier?«, fragte Matthew. »Sir.«
Mr Gideon Lightwood besaß tatsächlich die Frechheit, Matthew kurz anzulächeln, bevor er zu Mama ging und ihr eine Hand auf die Schulter legte. Vor Papas Augen!
»Es ist mir wie immer eine Freude, Sie zu sehen, Sir«, sagte Charles Buford, dieser Mistkerl. »Kann ich Ihnen vielleicht etwas Räucherfisch anbieten?«
»Nein, nein, vielen Dank. Ich habe bereits gefrühstückt«, sagte Mr Lightwood. »Ich habe nur gedacht, ich könnte Charlotte vielleicht auf der Portalreise nach Idris begleiten.«
Mama schenkte Mr Lightwood ein richtiges Lächeln, das sie zuvor für Matthew nicht hatte erübrigen können. »Das ist sehr nett von dir, Gideon, aber wirklich nicht nötig.«
»Ganz im Gegenteil«, erwiderte Mr Lightwood. »Eine Dame sollte immer in Begleitung eines Gentlemans reisen.«
Sein Tonfall klang scherzend. Normalerweise wartete Matthew bis nach dem Frühstück, um seinen Vater in seinem Rollstuhl ins Labor zu bringen, aber er konnte die Szene keine Sekunde länger ertragen.
»Ich muss dringend zu James!«, verkündete er und sprang von seinem Stuhl hoch.
Dann knallte er die Tür des Speisezimmers hinter sich zu, hörte aber noch, wie seine Mutter sich für ihn entschuldigte und Mr Lightwood antwortete: »Ach, ist schon in Ordnung. Der Junge ist in einem schwierigen Alter. Glaub mir, ich erinnere mich noch gut daran.«
Matthew lief in sein Zimmer und überprüfte den Sitz seiner Haare und seiner Kleidung vor dem Spiegel. Während er seine neue grüne Weste glatt strich, starrte er in sein goldgerahmtes Gesicht. Ein hübsches Gesicht, das aber nicht so intelligent wirkte wie die Gesichter der restlichen Familie. Er erinnerte sich an die Worte der Elfe: Manche würden ja sagen, dass nur ein seichter Fluss so hell glitzern kann.
Während er in den Spiegel blickte, legte er den Kopf auf die Seite. Viele Leute glaubten, seine Augen wären so dunkel wie die seiner Mutter. Aber das stimmte nicht. Stattdessen waren sie so dunkelgrün, dass die meisten Menschen darauf hereinfielen – nur wenn das Licht in einem bestimmten Winkel darauf traf, blitzten sie in der Tiefe smaragdgrün auf. Seine Augen waren nur ein Trick, genau wie der Rest von ihm.
Vorsichtig zog er die Phiole mit dem Wahrheitstrank aus dem Ärmel. Onkel Jem hatte nicht gesehen, wie er sie gekauft hatte. Und selbst wenn er einen Verdacht hatte, würde er ihn nicht verpfeifen. Wenn Onkel Jem etwas sagte, dann konnte man ihm glauben – er war diese Art von Mann.
Matthew hatte beschlossen, James gegenüber nichts von Gideon zu erzählen, weil er selbst zwar die Diskretion in Person war, Jamie aber gelegentlich ein schreckliches Temperament an den Tag legte. Erst im letzten Sommer war ein durchaus liebenswürdiger Schattenjäger namens Augustus Pounceby auf der Durchreise ins Londoner Institut gekommen, und Matthew hatte Pounceby nicht einmal eine halbe Stunde mit James allein gelassen. Bei seiner Rückkehr hatte Matthew feststellen müssen, dass Jamie Pounceby in die Themse geworfen hatte. James hatte zu dem Vorfall nur gesagt, dass Pounceby ihn beleidigt habe. Das Ganze war eine ordentliche Leistung gewesen, da Pounceby damals ein erwachsener Schattenjäger, Jamie aber gerade einmal vierzehn gewesen war. Trotzdem: So beeindruckend diese Tat an sich sein mochte, konnte man sie wohl kaum als gutes Benehmen bezeichnen.
Weder James noch Onkel Jem würden jemals heimlich Zaubertränke kaufen oder darüber nachdenken, diese jemandem zu verabreichen. Andererseits: Was konnte es schon schaden, endlich die Wahrheit zu erfahren? Matthew hatte überlegt, ein paar Tropfen aus der Phiole in den Frühstückstee zu geben – dann hätten seine Eltern ihm erzählen müssen, was eigentlich los war. Und jetzt, da Mr Gideon Lightwood einfach hereingeschneit war, wünschte er wirklich, er hätte seinen Plan in die Tat umgesetzt.
Beim Anblick seines Gesichts im Spiegel schüttelte Matthew den Kopf und beschloss, Melancholie und trübe Gedanken beiseitezuschieben.
»Seh ich elegant aus?«, wandte er sich an Mr Oscar Wilde. »Seh ich fesch und verwegen aus?«
Der Angesprochene leckte ihm die Nase, denn Mr Oscar Wilde war ein Welpe, den Jamie Matthew zum Geburtstag geschenkt hatte. Matthew wertete das als Zustimmung.
Er deutete auf sein Spiegelbild.
»Du magst zwar zu nichts zu gebrauchen sein«, teilte er sich selbst mit, »aber wenigstens sitzt deine Weste tadellos.«
Nach einem Blick auf seine Taschenuhr schob er diese zusammen mit der Phiole in seine Westentasche. Er durfte keine Zeit verschwenden – auf ihn wartete eine wichtige Verabredung in einem der exklusivsten Clubs.
Zunächst musste Matthew zum Londoner Institut, um James Herondale abzuholen. Da er eine Vorahnung hatte, wo James sich vermutlich aufhielt, befahl er Oscar, Sitz zu machen und den Laternenpfahl zu bewachen. Oscar gehorchte sofort. Für einen Welpen war er sehr wohlerzogen, und die Leute meinten oft, dass Matthew ihn gut abgerichtet habe. Dabei hatte Matthew ihn einfach nur lieb. Jetzt warf er einen Enterhaken hinauf zum Fenster der Bibliothek, kletterte hinauf – wobei er sorgfältig auf seine Hose achtete – und klopfte an die Glasscheibe.
James hockte auf der Fensterbank, das schwarze Haupt über ein – Überraschung! – Buch gebeugt. Als er das Klopfen hörte, hob er den Kopf und lächelte.
Sein Parabatai hatte Matthew eigentlich nie wirklich gebraucht. James war zwar schüchtern gewesen, und Matthew hatte sich um ihn kümmern wollen, doch jetzt, da James viel mehr in sich selbst zu ruhen schien und an die Gesellschaft dreier guter Freunde gewöhnt war, wirkte er bei gesellschaftlichen Anlässen deutlich umgänglicher. Trotz seiner Schüchternheit hatte er offenbar nie an sich selbst gezweifelt oder sich gewünscht, er könnte etwas an sich ändern. Außerdem hatte er nie darauf gehofft, dass Matthew ihn retten würde. Sein Parabatai strahlte eine ruhige Selbstgewissheit aus, von der Matthew wünschte, er besäße sie auch. Ihre Beziehung war erheblich ausgeglichener – sozusagen auf einer Ebene – als das Verhältnis zwischen Matthew und Thomas oder Christopher. Und das bewirkte, dass Matthew den Wunsch verspürte, sich James gegenüber zu beweisen. Denn er war sich nicht sicher, ob er das jemals getan hatte.
James wirkte bei Matthews Anblick nie erleichtert oder erwartungsvoll: Er wirkte einfach nur erfreut. Jetzt öffnete er das Fenster, woraufhin Matthew hineinkrabbelte und dabei sowohl James als auch das Buch von der Fensterbank schubste.
»Hallo, Matthew«, sagte James vom Fußboden aus in leicht sardonischem Tonfall.
»Hallo, Matthew!«, rief auch Lucie von ihrem Schreibtisch herüber.
Sie war ein Abbild anmutiger Zerzaustheit, völlig in ihr Schreiben vertieft. Ihre hellbraunen Locken hingen halb aus dem blauen Band heraus, und ein Schuh baumelte gefährlich von ihren bestrumpfhosten Zehen. Während Onkel Will häufig Anekdoten aus seinem Buch zum Thema Dämonenpocken vorlas, die immer sehr amüsant waren, zeigte Lucie das, was sie gerade verfasst hatte, nicht herum. Matthew hatte oft darüber nachgedacht, ob er sie bitten sollte, ihm vielleicht eine Seite vorzulesen. Doch ihm fiel kein Grund ein, warum Lucie für ihn eine Ausnahme machen sollte.
»Seid gegrüßt, meine Herondales«, sagte Matthew würdevoll, rappelte sich auf und verneigte sich vor Lucie. »Mich führen eilige Geschäfte zu euch. Aber sagt mir zuerst – und seid ehrlich! –, was ihr von meiner Weste haltet.«
Lucie lächelte. »Umwerfend.«
»Ganz Lucies Meinung«, pflichtete James ihr friedfertig bei.
»Nicht fantastisch?«, fragte Matthew. »Nicht absolut überwältigend?«
»Vermutlich bin ich überwältigt«, sagte James. »Um nicht zu sagen: sprachlos.«
»Bitte nimm Abstand davon, gegenüber deinem einzigen Parabatai grausame Wortspiele zu spielen«, forderte Matthew. »Kümmere dich lieber um deine eigene Kleidung. Und leg dieses grauenhafte Buch beiseite. Die Herren Lightwood erwarten uns. Wir müssen losziehen.«
»Kann ich denn nicht einfach so gehen?«, fragte James.
Er schaute Matthew vom Boden aus mit seinen großen goldenen Augen an. Seine pechschwarzen Haare standen in alle Richtungen ab, sein weißes Hemd war zerknittert, und er trug nicht einmal eine Weste. Matthew unterdrückte großmütig ein Schaudern.
»Du beliebst zu scherzen«, erwiderte er. »Ich weiß, dass du dergleichen nur sagst, um mich zu kränken. Und nun fort mit dir. Und kämm dir die Haare!«
»Die Haarbürsten-Meuterei steht unmittelbar bevor«, warnte James und ging zur Tür.
»Kehre siegreich zurück oder auf den Haarbürsten deiner Soldaten!«, rief Matthew ihm nach.
Nachdem Jamie das Zimmer verlassen hatte, wandte Matthew sich Lucie zu, die eifrig schrieb, dann jedoch aufschaute, als würde sie seinen Blick spüren. Sie lächelte. Matthew fragte sich, wie es wohl sein mochte, so in sich selbst gekehrt und zugleich einladend zu sein – wie ein Haus mit soliden Mauern, in dem immer ein Licht brannte.
»Soll ich meine Haare ebenfalls kämmen?«, neckte ihn Lucie.
»Du bist wie immer perfekt«, erwiderte Matthew.
Er wünschte, er könnte das Band ordentlich um ihre Haare binden, doch das würde bedeuten, dass er sich ihr gegenüber Freiheiten herausnahm.
»Möchtest du am Treffen unseres Geheimclubs teilnehmen?«, fragte er.
»Ich kann leider nicht, ich werde gleich zusammen mit meiner Mutter lernen. Mam und ich bringen uns selbst Persisch bei«, erklärte Lucie. »Schließlich sollte ich in der Lage sein, die Sprachen zu sprechen, die mein Parabatai spricht, findest du nicht?«
James hatte erst vor Kurzem damit begonnen, seine Eltern nicht mehr Mama und Papa zu nennen, sondern Mam und Dad, weil er das erwachsener fand. Und Lucie hatte ihn in dieser Hinsicht sofort kopiert. Matthew mochte dagegen den walisischen Einschlag, wenn sie mit ihren Eltern redeten, weil ihre Stimmen dann weich wie ein Lied und immer liebevoll klangen.
»Gewiss doch«, sagte Matthew, hüstelte und schwor sich, bald zu seinen Walisisch-Lektionen zurückzukehren.
Niemand hatte auch nur eine Sekunde daran gedacht, Lucie auf die Schattenjäger-Akademie zu schicken. Bisher hatten sich bei ihr zwar nicht die Fähigkeiten ihres Bruders gezeigt, aber die Welt war auch so schon grausam genug zu weiblichen Wesen, bei denen auch nur der Verdacht bestand, dass sie anders waren.
»Lucie Herondale ist ein entzückendes Mädchen, aber bei ihren Nachteilen … wer will sie da schon heiraten?«, hatte Lavinia Whitelaw Matthews Mutter einst beim Tee gefragt.
»Ich würde mich glücklich schätzen, wenn einer meiner Söhne den Wunsch verspüren sollte«, hatte Charlotte in ihrem konsulhaftesten Ton erwidert.
Matthew fand ja, dass James sehr glücklich sein musste, weil er Lucie zur Schwester hatte. Er selbst hatte sich immer eine kleine Schwester gewünscht.
Nicht dass er sich wünschte, dass Lucie seine Schwester wäre.
»Arbeitest du an deinem Buch, Luce?«, fragte er vorsichtig.
»Nein, ich schreibe einen Brief an Cordelia«, antwortete Lucie und machte damit Matthews ohnehin wackligen Plan im Ansatz zunichte. »Hoffentlich kommt sie uns bald mal besuchen«, fügte sie ernst hinzu. »Sie wird dir bestimmt gefallen, Matthew, das weiß ich genau.«
»Hm«, sagte Matthew.
Er hatte seine Bedenken, was Cordelia Carstairs betraf. Lucie und sie würden eines Tages Parabatai werden, sobald der Rat beschloss, dass sie erwachsene Frauen waren, die wussten, was sie wollten. Lucie und James kannten Cordelia aus gemeinsamen Abenteuern während ihrer Kindheit, an denen Matthew keinen Anteil hatte. Und manchmal war er deswegen ein wenig eifersüchtig. Cordelia musste irgendwelche positiven Eigenschaften besitzen, denn sonst würde Lucie sie nicht zur Parabatai wollen. Aber sie war auch die Schwester von Alastair Wurmgesicht Carstairs, deshalb konnte Matthew eigentlich davon ausgehen, dass sie nicht durch und durch liebenswürdig war.
»In ihrem letzten Brief hat sie ein Foto von sich mitgeschickt. Das hier ist Cordelia«, fuhr Lucie mit Stolz in der Stimme fort. »Ist sie nicht das hübscheste Mädchen, das du je gesehen hast?«
»Nun, ja … vielleicht«, sagte Matthew.
Insgeheim überraschte ihn das Foto. Er hatte angenommen, dass Alastairs Schwester dessen unattraktives Äußeres teilen würde – Alastair, der immer so aussah, als würde er Zitronen essen, die er als minderwertig verachtete. Doch seine Vermutung traf nicht zu. Stattdessen erinnerte ihr Anblick ihn an ein Gedicht über eine unerwiderte Liebe, das James ihm einst vorgelesen hatte: Strahlt mir in glänzend heller Pracht ihr liebes, süßes Bild. Diese Worte beschrieben das lebendige Gesicht, das ihm aus dem Rahmen entgegenlachte, sehr treffend.
»Ich weiß nur eines«, fuhr Matthew fort, »du übertriffst jedes andere Mädchen in London bei Weitem.«
Lucies Wangen färbten sich rosig. »Wie immer ziehst du mich nur auf, Matthew.«
»Hat Cordelia dich gefragt, ob du ihre Parabatai werden willst? Oder hast du sie gefragt?«, erkundigte Matthew sich beiläufig.
Lucie und Cordelia hatten den Parabatai-Bund noch vor Cordelias Abreise schließen wollen. Doch man hatte sie gewarnt, dass manche Schattenjäger einen in jungen Jahren eingegangenen Bund bereuten und der eine oder andere seine Meinung ändern würde. Zumal gerade die Damenwelt für ihre Flatterhaftigkeit bekannt war, hatte Laurence Ashdown betont.
Lucie war nicht flatterhaft. Sie und Cordelia schrieben sich jeden Tag. Einmal hatte Lucie Matthew erzählt, dass sie an einer langen Geschichte arbeitete, um Cordelia bei Laune zu halten, da sie doch immer so weit weg war. Deshalb wunderte es Matthew kein bisschen, dass jemand wie Lucie Schwierigkeiten hatte, jemanden wie Matthew ernst zu nehmen.
»Selbstverständlich habe ich sie gefragt«, erwiderte Lucie prompt. »Ich wollte meine einzige Chance doch nicht vertun.«
Matthew nickte, endgültig in dem Glauben bestärkt, dass Cordelia Carstairs wirklich jemand ganz Besonderes sein musste.
Wenn er James nicht gebeten hätte, sein Parabatai zu werden, hätten sie den Bund nicht geschlossen – denn James hätte diese Frage nie gestellt, da war Matthew sich ziemlich sicher.
Im nächsten Moment kehrte James in die Bibliothek zurück. »Zufrieden?«, fragte er.
»Das ist ein großes Wort, Jamie«, sagte Matthew. »Aber du darfst meine Westenwut als halbwegs besänftigt betrachten.«
Unter James’ Arm klemmte noch immer sein Buch, doch Matthew war nicht so dumm, einen zum Scheitern verurteilten Kampf austragen zu wollen. Während sie kurz darauf durch Londons Straßen spazierten, erzählte James ihm von seiner Lektüre. Matthew mochte moderne und humorvolle Unterhaltung, wie die Werke von Oscar Wilde oder die Musik von Gilbert und Sullivan, aber griechische Mythologie war gar nicht so uninteressant, wenn Jamie davon berichtete. In letzter Zeit las Matthew mehr und mehr antike Literatur – Geschichten von verbotener Liebe und hehren Schlachten. Zwar konnte er sich selbst nicht darin wiedererkennen, aber er sah James darin, und das reichte ihm.
Nach der Katastrophe an der Akademie war Matthew bemüht, James mehr Selbstbewusstsein einzuflößen. Deshalb bestand er darauf, dass sie nicht durch Zauberglanz getarnt durch die Stadt liefen. Eine junge, von Jamies Gesicht bezauberte Dame blieb mitten auf der Straße stehen. Matthew packte sie an der Hüfte, wirbelte sie von einem heranbrausenden Bus fort und tippte sich lächelnd an den Hut.
Jamie schien den gesamten Vorfall verpasst zu haben, denn er nestelte an seiner Manschette herum.
Vor dem Parlamentsgebäude hatte sich eine große Gruppe aufgebrachter Demonstranten versammelt und protestierte gegen einen irdischen Krieg.
»Der Buden-Krieg?«, fragte Matthew. »Das kann nicht stimmen.«
»Der Buren-Krieg«, berichtigte James. »Also ehrlich, Matthew.«
»Das ergibt schon mehr Sinn«, räumte Matthew ein.
Eine Frau mit einem Schlapphut hielt Matthew am Ärmel fest.
»Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Madam?«, fragte er.
»Die Regierung begeht ungeheuerliche Gräueltaten«, sagte die Frau. »Sie hat Frauen und Kinder in Lagern einsperren lassen. Man denke doch nur an die Kinder!«
James legte seine Hand auf Matthews Ärmel und zog ihn weiter, wobei er die Frau ansah und sich entschuldigend an den Hut tippte. Matthew warf einen Blick über die Schulter.
»Ich hoffe, dass sich für die Kinder alles zum Guten wendet«, rief er ihr zu.
Während sie weitergingen, machte James einen nachdenklichen Eindruck. Matthew wusste, dass sein Parabatai sich wünschte, die Schattenjäger könnten auch solche Probleme wie irdische Kriege lösen – obwohl Matthew ja eher das Gefühl hatte, dass sie mit den ganzen Dämonen schon ziemlich ausgelastet waren.
Um Jamie aufzuheitern, stibitzte er ihm den Hut, woraufhin sein Freund in Gelächter ausbrach und Matthew durch die Straße nachjagte. Dabei sprangen sie so hoch über Hindernisse, dass die Irdischen staunten. Matthews Welpe vergaß sein Hundetraining, lief ihnen zwischen den Füßen herum und bellte vor lauter Lebensfreude. Ihre hastigen Schritte ertönten schneller als das beständige Ticken des St. Stephen’s Tower, unter dessen Zifferblatt in dem von James so heiß geliebten Latein Gott schütze unsere Königin Victoria die Erste stand. Und ihr Gelächter mischte sich mit dem fröhlichen Läuten der Glocken.
Später sollte Matthew sich an diesen Tag als seinen letzten glücklichen Tag erinnern.
»Schlafe und träume ich etwa, oder habe ich vielleicht Visionen?«, wandte Matthew sich an Thomas. »Warum trinken Tante Sophie und deine beiden Schwestern im gleichen Etablissement Tee, in dem wir unseren privaten und höchst exklusiven Club haben?«
»Sie sind mir gefolgt«, räumte Thomas peinlich berührt ein. »Wenigstens hatte Mama Verständnis – sonst wären sie uns direkt in unseren Clubraum gefolgt.«