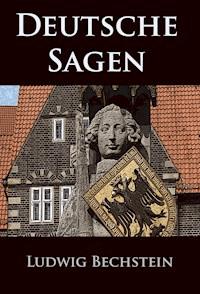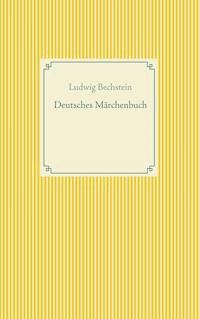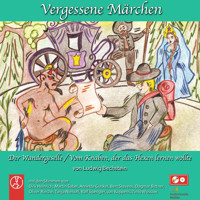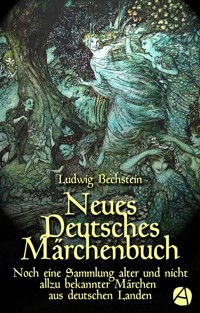Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geheimnisse eines Wundermannes ist die Geschichte eines Professors und seiner Studenten. Die Geschichte beginnt in einem wunderschönen botanischen Garten, wo die Schüler verschiedene Pflanzenarten kennenlernen. Als der Unterricht durch eine schöne Stimme und eine fremdländisch aussehende Frau mit goldenem Haar unterbrochen wird, nimmt die Geschichte eine komplizierte Wendung. Ist Liebe im Spiel? -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Bechstein
Die Geheimnisse eines Wundermannes
Saga
Die Geheimnisse eines Wundermannes
Combines:
Die Geheimnisse eines Wundermannse - Erster Teil
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Zweiter Teil
Die Geheimnisse eines Wundermannes - Dritter Teil
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1856, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997170
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Erster Teil
1. Das botanische Collegium.
Ein reizender Sommerabend des Jahres 1790 umfloß die Fluren Helmstädts. Der botanische Garten stand blumenvoll, und durch die Zweige seiner grünenden Bäume jagten sich zwitschernde Motazillen. Ueber frischgegrabenen Beeten tanzten Mücken im heitern Schwebereigen auf und nieder. Junge Studierende lustwandelten zu zweien und dreien mit ihren Mappen unterm Arme zwischen den Beeten, diese und jene Pflanze betrachtend. Unter einer Baumgruppe in der Nähe eines gegen den Garten sich öffnenden Pavillons, der den Hörsaal bildete, stand ein frischer Knabe, welcher eine Anzahl blühender Pflanzen in der Hand hielt, um diese dem Professor darzureichen, der Sohn des botanischen Gärtners, und ringsum waren Stühle gestellt.
Immer mehr Studenten traten in den Garten, begannen Gespräche, scherzten auch wohl oder trällerten beliebte Liederweisen; Manche setzten sich auch schon an ihre Plätze, es war warm, unter den Bäumen aber erfrischend kühl.
Die Uhren der Universitätsstadt schlugen die sechste Stunde, und mit ihrem Schlage nahte dem botanischen Garten ein Mann von mittler Größe, zartem Gliederbau, strammer, doch nicht gezwungener Haltung und von raschem Gang. Er hielt den kleinen dreieckigen Hut in der Hand und trug eigenes, leicht gepudertes Haar, fein toupirt, und in weichen Wellen an den Seiten des Hauptes anliegend. Rock und Beinkleider waren von grau-grünlicher Farbe, der Busenstreif von Brüßeler Kanten war blendend weiß, ebenso waren die Manschetten, welche lang über die zartgeformtesten Hände niederhingen. An einem Finger der rechten Hand trug dieser Mann einen Ring, dessen Stein völlig die Gestalt eines runden Auges zeigte. Die Schnallen der glänzendschwarzen Schuhe blitzten im Golde der Abendsonne, und ein Kenner konnte sogleich gewahren, daß diese Strahlen nicht von Markasit oder Bergkrystallen ausgingen, sondern aneinandergereihten wirklichen Brillanten entsprangen.
Einige Bürger der Stadt, welche zufällig zu beiden Seiten der Straße, die nach dem Garten führte, entgegenkamen, gingen dem Manne nicht mit flüchtigem Gruße vorbei, sondern sie blieben gegen ihn sich wendend stehen, mit ehrfurchtvoll abgezogenen Hüten in der Hand, bis derselbe an ihnen vorüber war, er aber dankte mit freundlichem Neigen des Hauptes, mit einem heitern Lächeln und einem Blick aus den hellen lichtgrauen Augen, der voll Wohlwollen und Güte war.
Gleich darauf betrat dieser Mann den botanischen Garten.
»Der Herr Professor!« rief der Knabe mit den Pflanzen in der Hand, und alsbald gruppirten sich die Studierenden entblößten Hauptes unter den Bäumen; die, welche saßen erhoben sich, und es bildete sich ungezwungen ein Halbkreis der Zuhörerschaar, der den nahenden gefeierten Lehrer mit allen Zeichen ehrfurchtvoller Aufmerksamkeit empfing. Dieser aber grüßte mit derselben freundlichen Leutseligkeit in Blick und Geberde, gab an den Knaben das dreieckte Hütchen und das spanische Rohr, auf welchem ein kunstvoll gearbeiteter Menschen-Schädel von Silber mit beweglicher Kinnlade als Knopf befindlich war, der bei der Bewegung etwas unheimlich klapperte, – nahm auf einem Stuhle Platz, zog einige Papiere hervor, und begann mit einer hellen und milden Stimme:
»Meine Herren!
»Lassen Sie uns auch heute wieder mit gesammeltem Ernst zunächst einen Blick zu dem richten, von dessen Ehre die Himmel erzählen, die lebenden Geschöpfe zeugen und dessen Ruhm die Bäume und Pflanzen, die Blüthen und Blumen verkündigen. Wir stehen hier mitten in einem Seiner Tempel, und Sie wissen, daß in diesem Tempel ich lieber zu Ihnen rede, als in ummauerten Räumen, hier wo uns frisch und kühl der Odem der Natur, der Hauch Gottes umweht. Immer ziemt dem Jünger, dem Priester der Natur der Ausblick nach oben, und wenn ich auch nicht die Frömmigkeit über die Wissenschaft stelle, so stelle ich sie dieser doch gleich. Darin folge ich nur einem hohen Vorbilde, dem Vater der Naturwissenschaft, dem großen Ritter Carl von Linné. Linné war der frömmste Mann. Mit erhebenden Betrachtungen über Gott und dessen Allmachtschöpfungen hat er seine unsterbliche Naturgeschichte begonnen, die unübertrefflich ist, obschon sie noch bereichert werden könnte. Sie wissen indeß, meine Herren, daß ich nicht für den Druck schreibe. Aber sehen Sie hier diese theuern Schriftzüge, sehen Sie, was Linné an mich geschrieben hat.«
Dabei entfaltete der Professor ein kleines vergilbtes Octavblättchen, an dessen Stirne mit großer Schrift die Anrede über seinem Namen prangte: Viro Celeberrimo, Clarissimo, und las, den Namen überspringend: Professori Helmstadiensi eruditissimo
Carolus Linnaeus.
»Tutum est quod nomen Tuum clarissimum percellit aures meos, licet ego Tibi etiam non ignotus sim. Plurima enim narravit Fama de Tua in Botanicis summa doctrina, quam confirmarunt tot egregia specimina plantarum exsiccatarum tot nova plantarum genera. Vidi enim in collectione celeberrima genera plura a Te communicata, ex China et Madagascar per Te forte delata, de quibus nil novi, nisi quae ipse scripsisti. Wie Dein berühmter Name zu meinen Ohren gelangte, so ist es schicklich, daß auch ich Dir nicht unbekannt sei. Vieles erzählte der Ruf von Deiner großen Gelehrsamkeit im Fache der Botanik, welches mir verschiedene getrocknete Species neuer Pflanzenarten bestätigten: denn in einer sehr berühmten Sammlung sah ich die von Dir mitgetheilten, aus China und Madagaskar durch Dich mitgebrachten Pflanzen, von denen ich nichts wußte, außer was Du selbst über sie geschrieben hast..«
Die Studenten umdrängten, von ihren Stühlen sich erhebend, in dichtem Kreis den Professor; aller Blicke richteten sich auf diese werthen Schriftzüge, die jener freundlich und mit leuchtenden Augen Jedem zum nähern Besichtigen darbot, und erst als Alle das Blatt betrachtet, ließ er dasselbe in einer Tasche verschwinden. Die Studenten nahmen ihre Plätze wieder ein und der Professor fuhr fort:
»Auch Linné liebte es, wie ich es liebe, im Freien zu lehren, und im Freien, mitten in einer seiner botanischen Vorlesungen traf ihn der erste nach ihm gesendete Pfeil des dunkeln, verhüllten Boten, der früher oder später sein Geschoß nach uns Allen richtet. Wohl dann allen Denen, die im Herrn sterben, durch und in welchem wir leben, weben und sind, die nicht dahin fahren, wie eine Ratte im Mist, deren Seelen dann der Teufel in die Hölle karrt, wie im letzten Herbst die des Erzketzers, des Abtes Jerusalem in Braunschweig.«
Dieser Uebersprung vom Erhabenen zum Gemeinen, dieses unerwartete harte, schonungslose Urtheil über einen Verstorbenen, welcher als ein denkender Theolog sich allgemeinster Achtung erfreut, vergesellschaftet mit einem rohen, unästhetischen Bilde – erregte unter der Zuhörerschaft des Professors einen allgemeinen Unwillen, der auch nicht säumte, sich durch starkes Murren und Scharren laut zu äußern.
Dieß änderte aber im Gesicht des Professors nicht einen Zug des freundlich heitern Gepräges desselben. Er hielt einige Augenblicke inne, bis jenes Gemurmel und jenes Scharren aufgehört hatte, und sprach dann ruhig weiter: »Sie mißbilligen, meine Herren, was ich so eben geäußert; Sie wissen, was ich auch weiß, daß Jerusalem unläugbare Verdienste hatte, daß er Begründer des Collegii Carolini in Braunschweig wurde, daß er Erzieher des Herzogs Friedrich Wilhelm war, daß man seine Predigten gern hörte, und daß sein Tod allgemeines Bedauern hervorrief. Sie wissen aber doch – dieß werden Sie zugeben müssen – nicht alles, was ich weiß, und ich sage Ihnen, daß Abt Jerusalem ein Erzketzer war, denn er läugnete den Sündenfall. Wer aber den Sündenfall läugnet, der läugnet folgerichtig die Erlösung, und wer die Erlösung läugnet, ist ein Erzketzer. Niemand, der die Natur kennt, wie ich sie kenne, wird bezweifeln, daß die Schlange wirklich zu Adam und Eva trat und sprach. Die Sprache ward ihr dann zur Strafe genommen. Ja meine Herren, es giebt eine Schlange mit einem Menschenangesicht, ja ich kann sagen, mit einem Teufelskopf, und ich kann dieselbe jedem Herrn, der sie sehen will, in meiner Sammlung zeigen, in der ich überhaupt alles Erdenkliche zeigen kann.«
Die überraschende Kühnheit dieser letzteren Behauptung wirkte so lähmend auf alle Hörer, daß sie die Erinnerung an die erstere völlig aufhob. Keiner wußte mehr, was er denken oder sagen sollte, und wie sehr man auch an dem alten Herrn, der bereits im sechzigsten Lebensjahre stand, Wunderlichkeiten und Seltsamkeiten in Fülle gewohnt war, so hatte man so Etwas doch nie vernommen. Er aber gönnte dem Grübeln über Wahrheit oder Unwahrheit seiner Behauptung weder Zeit noch Spielraum, sondern fuhr fort zu sprechen und mit Gewandheit auf andere, wenn auch wiederum heterogene, in das botanische Collegium kaum gehörende Dinge überzuspringen.
»Glaube doch ja Keiner von Ihnen, meine Herren, daß ich irgend ein wahres Verdienst verkenne. Das sei ferne von mir. In Mühlhausen, wo ich geboren wurde und wo mein Vater die beste Apotheke besaß, daher ich auch frühzeitig für die Stoffe der Natur, ihre Kraft und Wirkung Vorliebe gewann, und mit Neigung alles In- und Fremdländische kennen lernte, war es der Rektor der Schule, Magister Gottfried Böttcher, zugleich mein Pathe, dessen Andenken ich nicht dankbar genug verehren kann. Dieser würdige Mann war es, der mich denken lehrte, und meine Gedanken richtig ordnen, später habe ich es durch eigenen Fleiß dahin gebracht, wie Sie schon wissen, stets Zweierlei zugleich zu denken. Durch jenen Mann lernte ich die Kunst, im Augenblick auf alles einen Gedächtnißvers, sei es in deutscher, lateinischer, oder jeder andern Sprache zu dichten, und ist es in der lateinischen Sprache vornehmlich die Form des Distichons, die sich dem Gedanken voll sprachlichen Wohllautes anschmiegt, wie ein schönes Gewand einer jugendlichen Schönheit. So habe ich auf jedes der zahlreichen Gemälde meiner höchstwerthvollen Bildergallerie, welche Stücke von Rafael, Giulio Romano, Correggio, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Rubens, Lucas von Leiden und allen berühmtesten Malern aller Zeiten und Länder enthält – ein lateinisches Distichon geschrieben, zum Beispiel auf eine Venus mit dem Amor von Tizian dieses:
Cum puero Venerem pulchram pinxit Titianus
Ornans hanc tabulam peniculo Charitum.«
»Sie werden finden, daß es nicht wohl möglich ist, dieses lateinische Distichon ebenfalls als solches wort- und sinngetreu in deutscher Sprache wiederzugeben.«
»Indessen läßt sich auch in leoninischen Versen Hübsches sagen, auch zu diesen leitete mich jener wackere Rektor unserer Mühlhäuser Schule an!« fuhr der Professor fort, und wandte sich mit den Worten zu dem Knaben: »Bringe uns einmal eine Rose!«
Während der Knabe sich beeilte, dem Befehle Folge zu leisten, sprach der Professor: »Hören Sie zu, meine Herren, ich gebe Ihnen jetzt ein botanisches Räthsel in leoninischen Versen auf:
Sunt quinque sati,
Una nocte nati.
Duo sunt barbati,
Duo sunt semibarbati,
Unus est singulariter natus,
Nam hic est sine barba creatus.
Was ist dieß? – Sie sinnen vergebens darüber nach; ich will Ihnen das Räthsel noch einmal deutsch sagen:
Fünf Brüder erkoren
Sind in einer Nacht geboren.
Zwei sind voll gebartet,
Zwei sind halbgebartet,
Einer aber ist so geartet
Daß er den Bart im Werden schon verloren.«
Während der Professor dieß vortrug und die Studenten sinnend dasaßen, war der Knabe mit einer voll aufgeblühten Rose wieder gekommen.
»Da ist ja schon die Auflösung unseres Räthsels!« nahm Jener das Wort. »Sehen Sie, meine Herren, diese fünf Kelchblätter der Rose. Zwei haben in der That jene eigenthümlichen Franzen oder Einschnitte vom Ansatz bis zur Spitze, welche die botanische Terminologie, obschon uneigentlich, einen Bart nennen könnte; es ist dieß ein artiges Spiel der Natur, das aber sicher einen weisen Zweck hat, jedoch nicht bei allen Rosenarten sich wiederholt, daher zum neuen Räthsel wird, warum die Natur oder der Schöpfer bei einer Rosenart eine Einrichtung nothwendig sand, welche bei einer zweiten und dritten Rosenart nicht nothwendig sein muß, da sie bei ihr nicht gefunden wird.«
Während er sprach, weilte der Blick des Professors öfters mit etwas stechendem Ausdruck länger als gewöhnlich auf einem der jungen Studierenden, der sich durch schlanken Wuchs und ein kluges Gesicht auszeichnete, aber äußerst einfach gekleidet war, als wolle der Lehrer erforschen, ob gerade dieser Zuhörer an dem Vortrage Theilnahme zeige. Dieser begegnete zum Oeftern die Augen nach dem Professor aufschlagend, dem beobachtenden Blick und verstand ihn vollkommen, denn er nahm dabei stets die Miene der größten Aufmerksamkeit an, obschon er sich bewußt war, daß er schon etwas von der Kunst sich angeeignet habe, deren erst zuvor der Professor sich gerühmt, nämlich zweierlei zugleich zu denken, und seine Gedanken auf labyrinthischem Flug durch die Irrgänge des botanischen Gartens betroffen hatte.
Dieß stille Mienen- und Gedankenspiel der Beiden, des Lehrers und des einen Hörers nahm indeß kein Dritter wahr, und jetzte winkte der Professor dem Knaben, und entnahm dem Pflanzenstrauße, den dieser in der Hand hielt, ein blühendes Doldengewächs mit gefiederten Blättern, welche jenen der Petersilie ähnelten, aus der zahlreichen Reihe doldentragender zweiweibiger fünfmänniger Pflanzen, die genau von einander zu unterscheiden, gründliche Kenntniß erfordert.
»Wir wollen einmal diese Pflanze bestimmen, meine Herren!« sprach der Professor. »Wir sehen eine eirund-länglich gestreifte Frucht, fructus ovato-oblongus-striatus, die Blumenblätter einwärts gebogen, die Blätter gefiedert, dreispaltig eingeschnitten, wurzelständig – ja – und die Dolden – die Blätter – nun – nun – es ist doch kein Schierling – kein Bärenfenchel – kein Kerbel – kein Kümmel – hm hm – es schwebt mir auf der Zunge – es ist – Geißfuß.«
Offenbar irrte und verwirrte sich der Professor; eine flüchtige Röthe stieg ihm ins Gesicht; die hellen grauen Augen schossen Blitze; dem scharfen spähenden Blick entging nicht das Lächeln seiner Zuhörerschaft über die unerhörte Blöße, die der gelehrte Mann sich so eben gab, denn noch nie war der Fall vorgekommen, daß er nicht auf der Stelle eine Pflanze völlig richtig zu bestimmen vermocht hätte, und diese, die er jetzt in der Hand hielt, hatte er falsch bestimmt.
Plötzlich nahm sein Gesicht den Ausdruck größter Heiterkeit an, und er sprach lächelnd:
»Nicht wahr, meine Herren, ich irre mich, welches mir doch eigentlich nie geschieht, aber nun will ich Ihnen den Grund sagen, aus dem mein augenblicklicher Irrthum entstanden ist. Schon vorhin erwähnte ich der mir erworbenen Fertigkeit, stets zweierlei zu denken, deren ich auch schon öfter gegen Sie gedachte – auch bin ich erbötig, über diese Kunst ein Privatissimum zu lesen. Als ich nun beim Beginn des heutigen Collegiums in den Garten trat, nahm ich mir vor, einmal ausnahmsweise dreierlei zu denken. Ich habe auch wirklich dreierlei gedacht, allein darüber ist der eine Gedanke auf irrige Bahn gelenkt worden, wie ein junger Mensch manchmal auf Irrwegen geht, wenn er die Wege des Lernens und des Gehorsams wandeln sollte.«
Hier fiel wieder ein scharfer Blick auf den erwähnten jugendlichen schlanken Zuhörer, und auch dieser blieb nicht unverstanden, denn jener erröthete, während der Professor ruhig fortsprach: »Die Pflanze ist eine Bibernelle und zwar nach Linné Pimpinella Anisum, bei uns Kulturpflanze, in Aegypten heimisch, die Blume giebt reichlichen Honig, der Saame ist bekannt, und nicht minder das unangenehm riechende Anisöl, mit welchem man – mit Erlaubniß zu sagen, den Vögeln die Milben und den Menschen die Läuse vertreibt.«
Ohne sich darum zu bekümmern, ob dieser allzunatürliche Nachsatz Beifall finde oder nicht, entnahm der Professor dem Strauße, den der Knabe hielt, mit Bedacht eine Pflanze mit distelähnlichem Blüthenkopf, der gerade im Aufblühen begriffen war, und sprach weiter:
»Da ich eben Aegypten als Heimath des Anises nannte, so will ich Ihnen gleich eine zweite, in diesem Wunderlande heimische Pflanze vorführen, gegen welche ich eine ganz besondere Vorliebe und Verehrung habe, indem ich ihr, neben meinem mir von Gott verliehenen reichen und umfassenden Wissen namhafte Schätze verdanke.«
»Der Kelch dieser Pflanze ist eiförmig, mit an der Spitze fast eiförmig blattartigen Schuppen geschindelt. Die Blätter sind eirund, glattrandig, sägeförmig gestachelt. Die Pflanze gehört in die Klasse der röhrenbeuteligen Phanerogamen mit gleichförmiger Vielehe. Es ist nach Linné Carthamus tinctorius, zu deutsch Saflor; die Blüthe ist höchst nutzbar als Färbekraut, oft zur Verfälschung des Safrans dienend und als solche mindestens von dem Verdienst, unschädlich zu sein, während betrügerische Teufelsbündner jenen mit ungleich schlimmeren Dingen vermengen. Der Farbestoff dieser Pflanze, die mir gewissermaaßen heilig ist, ist mit ein Bestandtheil der von mir erfundenen zur Zeit in Europa noch gar nicht in Gebrauche gebrachten einzig trefflichen und unschädlichen Schminke, die in China jetzt bereits im allgemeinen Gebrauche ist. Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, meine Herren, daß man im Orient auf die verschiedensten Stoffe verfiel, sich die Haut zu malen; schon die Bibel erwähnt der Schminke öfters, die Alten malten ihre Antlitze mit Safran und Krokodilkoth – welches eigentlich nur der Auswurf einer kleinen Eidechsenart ist. Theophrast erwähnt das Rhizion, offenbar die Henna oder Alkannawurzel, Plautus führt das Purpurissimum der Römerinnen an, ohne Zweifel das Roth der Purpurschnecke. Ovid theilt ganz wunderliche Schmink-Recepte mit; Plinius empfielt das Laub der wilden Rebe; Poppea machte einen Semmelteig mit Eselsmilch an, und legte ihn auf, andere Damen versuchten das Kunststück der Hautfärbung mit Essig, noch andere mit dem Absud der Ochsenzungenwurzel. Auf meinen Reisen im Orient habe ich mein Augenmerk vorzüglich auf die Schminkmittel gelegt. Auf Sumatra bereiten die Frauen die Schminke Punguhr aus der Pflanze Dihlum, in Persien und der Türkei wird feinste Schminke aus dem Satzmehl der Iriswurzel, Iris persica, die solches sehr reichlich giebt, gewonnen, das Verfahren ist ganz leicht, ich habe viele solche Schminke selbst bereitet. Das alles ist gar nichts gegen meine Erfindung. Die meisten Schminken, auch die aus dem Iriswurzel-Amylum, haben Bestandtheile, welche die Haut nur röthen, indem sie sie reizen, fortdauernder Reiz aber muß endlich zerstören, oder sie verstopfen die Poren und erzeugen Ausschläge. Als ich nach langen Versuchen meine Schminke erfunden zu haben so glücklich war, habe ich Gott auf den Knieen dafür gedankt; sie ist völlig, aber auch völlig unschädlich, der edelste vegetabilische Purpur, Venus und Juno konnten nicht reizender blühen, als diese Schminke holde Wangen malt, sie verdient den Namen Ichor, welchen ich ihr gegeben. Ich sehe es Ihnen an, meine Herren, Sie sind begierig, diese Schminke kennen zu lernen.« –
Jetzt wurde in der Hand des Professors eine Art Kartenblatt erblickt, wenigstens hatte das hervorgezogene dünne Papptäfelchen nur die Größe des Blattes einer französischen Spielkarte. Dieses Blatt schlug sich auseinander, und zeigte den neugierig Hinzutretenden zwei glatte Flächen, welche in einem metallischen Grün erglänzten, wie die Flügeldecken eines Goldkäfers.
»Grün? Schminken sich denn die Chinesinnen grün?« murmelte mehr als eine Frage der Ueberraschung durch den Studentenkreis.
Wieder lächelte der Professor ganz heiter und nahm das Wort: »Sie vermuthen, meine Herren, weil die Töchter Hiobs sich mit Spießglanz schminkten, und die schönen Britannierinnen zu Cäsars Zeit sich ihre Gesichter himmelblau anmalten, um wahrhaft himmlischschön zu erscheinen, die Grönländerinnen sich gelb schminken, die Araber und Perser aber die schwarzen Schminkpflästerchen aufbrachten, so müßten die Damen des Reiches der Mitte auch etwas voraus haben, und sich grün schminken, dem ist jedoch nicht so. Sehen Sie!«
Jetzt netzte der Professor den zarten reinen Zeigefinger seiner rechten Hand nur wenig mit der Zunge, tippte auf das Blatt, und beschrieb einen feuchten kleinen Kreis. Wie er den Finger davon hob; erschien dessen Spitze, wie in den zartesten Purpur getaucht.
»Sie erstaunen, meine Herren, und mit Recht!« fuhr der Professor fort. »Der Kaiser von China erstaunte auch, als ich ihm diese himmlische Erfindung, meine Erfindung, mein Geheimniß zeigte. Der Kaiser war schlau, wie die meisten Chinesen es sind, dieses Schachervolk Hinter-Asiens mit seinem ewigen Stehenbleiben ohne Fortschritt – er wollte das Geheimniß haben – es sollte ein Monopol der Krone werden. Bedenken Sie, was das sagen will in einem Lande, wo Schminke so unentbehrlich ist, wie bei uns das Salz, wo die ungeschminkten Damen mit ihrer wahrhaft abschreckenden Blässe nicht zum Ansehen sind. Da fragte mich nun der Kaiser, was ich für mein Geheimniß verlange – armer Kaiser – er konnte mich nicht bezahlen – sein Schatz reichte nicht hin. Dennoch bestand er darauf, das Geheimniß zur Bereitung dieser Schminke zu erlangen, und so riß er aus seiner Krone den wundersamen Diamanten, der seines Gleichen nicht hat auf Erden, und gab ihn mir als Pfand für die Summe die ich gefordert, binnen Viertel-Jahresfrist wolle er ihn einlösen – wolle ich aber dieses Pfand nicht annehmen, so sollte ich seinen Palast nicht lebend verlassen. Ich nahm den Stein, der mich anstrahlte wie das Auge eines Zaubergeistes, ich lehrte dem Hofadepten des Kaisers die Bereitung meiner Schminke, die sofort im ganzen Reiche eingeführt wurde, und wohl in der Folge als Handelsartikel bis nach Deutschland dringen wird.«
»Meine Schminke machte den Kaiser von China reich, ich schwöre es.«
»Ein Vierteljahr wartete ich in Madagaskar, wohin ich mich von China aus begab, auf des Kaisers Botschafter, welcher kommen sollte, den Diamanten einzulösen, allein es kam kein Sendbote, und ich kehrte mit diesem Schatze, den kein Fürst Europa's zu bezahlen im Stande ist, und mit einer überaus reichen Ladung von Seltenheiten, Naturprodukten, Idolen, Waffen, Kleinodien und Wunderwerken des Orients nach Deutschland und in diese kleine Stadt zurück, wo ich als der Medicin und Philosophie Doctor, Herzoglich-Braunschweig-Lüneburgischer Hofrath, erster Professor der Arzneiwissenschaft, Chemie, Chirurgie, Pharmazeutik, Physik, Botanik und der übrigen Naturgeschichte an der Universität Helmstädt die Ehre habe, Ihnen meine Herren, ein Collegium botanicum zu lesen und guten Abend zu wünschen.«
Mit dem letzten Worte, das der Professor sprach, schlugen die Thurm-Uhren Sieben, erhob er sich vom Stuhle, empfing aus des Knaben Händen Hut und Stock und entschwand mit freundlichem Neigen des Hauptes gemessenen, doch ganz leichten Trittes dem Studentenkreise.
Wie der Professor so dahin ging auf dem kiesbestreuten Gartenpfade in der Abendsonne freundlichem Scheidestrahl, da sahen die ihm ganz erstaunt und verwundert Nachblickenden, wie die lichtgraugrünliche Farbe seiner Bekleidung jetzt schillerte, wie tyrischer Purpur oder wie vorhin das Roth der chinesischen Schminke, und jene wußten nicht, war das Wirkung des Sonnenstrahles, war es ein Zauber, oder ein Wunder des tief erfahrenen Adepten? –
________________________________________
2. Geheime Liebe.
In einem kühl überschatteten Rund, von blühenden Spiräen und Pfeiffenstrauch umgeben, einem einsamen Plätzchen ganz am Ende des botanischen Gartens, stand ein Arbeittischchen, und an diesem saß mit einer Näherei beschäftigt, ein blühendes Mädchen mit großen blauen Augen, goldblondem Haar und einer lieblichen ebenmäßigen Fülle des Körperbaues. Das erwähnte Haar umwallte aber keineswegs das jugendfrische Antlitz dieses siebenzehnjährigen Naturkindes in Lockenströmen, sondern es war gefesselt von einer ländlichen Haube, zu welcher auch der ganze, sehr reinliche, ja vielleicht reiche Anzug stimmte. Eine Städterin war das nicht, kein Gedanke irgend einer »Frisur« an ihr zu entdecken, weder am Kopf, noch am Kleid, und eine Einheimische war sie ebenfalls nicht, auch nicht vom Lande um Helmstädt, ganz anders, ganz fremdländisch erschien ihre Tracht.
Es war dieselbe Abendstunde von sechs bis sieben Uhr, in welcher im vorderen Theile des botanischen Gartens der gelehrte Professor sein Collegium las, darin seine Zuhörer wenn auch nicht eben viele Botanik, doch gar manches andere Wissenswerthe lernten, denn stets wußte jener Mann Belehrendes, stets Neues und oft Ueberraschendes zu sagen, stets hatte er für das was er sagte, Beweiße vor Augen zu legen, wenn irgend in der Brust eines Hörers sich ein leiser Zweifel an der Wahrheit des Gesagten regen wollte, darunter die kostbarsten Apparate und Instrumente, die merkwürdigsten Naturproducte, und hätte ein Zuhörer der heutigen Vorlesung, wenn ein völlig freier Vortrag ohne Zugrundelegung eines Collegienheftes so genannt werden kann – Wunsch und Verlangen ausgesprochen, die Schlange mit dem Menschenantlitz zu sehen, so würde das den alten Professor nicht im Geringsten in Verlegenheit gesetzt haben.
Je mehr von der bezeichneten Abendstunde dahinfloß, je mehr gab sich im Wesen der einsamen Schönen eine süße Unruhe kund, die liebliche Röthe ihrer blühenden Wangen wuchs wie die Abendröthe wächst, je weiter die Sonne hinabsinkt, fast bis zur Gluth. Sie versuchte, diesen Geist der Unruhe mit dem Zauber des Gesanges zu bannen, und sang die Strophe eines thüringischen Volksliedes mit zärtlicher Melodie und mit vollem frischen Wohlklang ihrer jugendlichen Stimme.
»Du – Du – liegst mir im Herzen –
Du – Du – liegst mir im Sinn;
Du – Du – machst mir viel Schmerzen,
Weißt nicht, wie gut ich Dir bin!«
Die Sängerin stockte – hatte das Lied vielleicht keine zweite Strophe, da die erste so viel, da sie alles sagte, oder ließ die Unruhe der Erwartung sie nicht weiter singen? Die Uhr war Schuld, die Thurmuhr, welche eben zu vierteln begann, und ausschlug – die siebente Stunde. Ein freudiger Schreck, das süße jungfräuliche Bangen, den Geliebten nahen zu wissen.
Und noch hatten nicht alle Uhren der Thürme Helmstädts ihre Schuldigkeit gethan, so schallten Tritte auf einem Seitengange durchs Bosket, so rief, aus dem Spiräengebüsch tretend, ein junger Mann: »Guten Abend, Jungfrau Sophie!« und erbebend, mädchenhaft verlegen, flüsterte die junge Schöne: »Guten Abend, Herr Leonhard.«
»Ach, laß den Herrn hinweg, Liebe!« bat der Jüngling, der nach der Hand des Mädchens faßte, die sie ihm schüchtern ließ. »Ich würde sagen, nenne mich bei meinem Vornamen, wenn mein Vatername nicht schöner klänge als jener.«
»Und wie heißen Sie mit dem Vornamen?« fragte Sophie, indem sie den freundlichen Blick fest auf ihren Verehrer richtete.
»Wie ein alter Studentenrock!« erwiederte Jener: »Gottfried.«
Sophie lächelte.
»Sie lachen! Ja leider ist das ein Name, bei dessen Nennung man in jedem Gesicht ein leises Zucken der Mundwinkel wahrnimmt.«
»Gott ist doch das Höchste, und Friede das Beste,« entgegnete gefühlvoll Sophie.
»Aber Gottfried nicht das Schönste!« gab der schlanke junge Mann zurück, derselbe, der als Zuhörer im Studentenkreise des botanischen Collegiums gesessen, dem des Professors forschende Blicke gegolten, dessen Gedanken zugleich bei jenes Vortrag und in diesem traulichen Winkel des Gartens geweilt hatten.
Es war wundervoll schön und still in dieser heimlichen, grünen Garteneinsamkeit. Nachdem es sieben Uhr geschlagen hatte, und die Studierenden hinweggegangen waren, verließen auch die Gehülfen und die Arbeiter die raumvolle Anlage, der Garten blieb ganz einsam. Die graue Grasmücke ließ wunderschön ihren füllereichen Gesang erklingen und in den Büschen hörte man von Zeit zu Zeit eigenthümliche Vogelstimmen, die halb wie Angstschreie, halb wie Gezänk klangen, und von jungen, im letzten Lenze erst ausgebrüteten Nachtigallen herrührten, die einander durch die Zweige jagten.
»Wer gab Ihnen den Ihnen so unlieben Vornamen?« fragte das junge Mädchen, die das Gespräch nicht stocken lassen zu wollen schien.
»Wer anders, als der alte Herr, mein Pathe, der Professor, aus dessen Collegium ich so eben komme, welchem Collegium ich beiwohnen darf, beiwohnen muß, ohne eigentlich Student zu sein; der Gebieter meines Vaters, der Erhalter unserer ganzen Familie, dem wir Alle Dank, Verehrung und Liebe schuldig sind, und sie ihm auch aufrichtig zollen, der aber doch –«
Hier stockte der junge Mann, und erröthete.
»Nun? Sie schweigen?« fragte Sophie forschend.
»Dieser wunderbare Mann weiß alles, erfährt alles, sein Blick dringt tief in das Innerste!« fuhr der Jüngling fort. »Fast möchte man sich versucht fühlen, zu glauben, die alten Märchen vom Krystallschauen und zauberischen Spiegeln, in denen der Besitzer alles erblicken kann, was er erblicken will, seien keine Märchen – hat er doch der seltsamen Instrumente so viele, deren Gebrauch nur er allein kennt. Ich will darauf wetten, liebe Sophie, er weiß bereits, daß wir uns gut sind, daß ich Dich liebe, Dich, des Gärtners Nichte, Dich, Du liebes Thüringerwaldmädchen, Dich, Du Wunderblume in diesem Garten!«
»Hören Sie auf, Herr Leonhard! Ich bitte!« rief Sophie. »Wohl bin ich ein Mädchen vom Thüringerwalde, aber nur eine einfache Wiesen- durchaus keine Wunderblume; schlicht und einfach in meinem Wesen, ein Kind der Natur, und beim guten Oheim zum Besuch. Sie sahen mich hier im Garten, näherten sich mir freundlich, flößten mir Vertrauen ein. Sie wurden mir lieb, ich Ihnen. Sie haben so schöne Talente, Leonhard, Sie zeichneten und malten mir nette Bilder, schnitten mir hübsche Sachen aus, brachten mir gute, wohlriechende Dinge in Büchschen und Fläschchen mit, die ich nie sah und roch, und wollten mir auch Schminke geben, wenn ich deren bedürfte, aber dem Himmel sei Dank, dieses Bedürfniß überlasse ich den Stadtdamen.«
»Alle diese Dinge, die Odeurs und Parfüms fertigt der alte Herr, und spendet uns gern davon,« erwiederte Leonhard. »Die Schminke, die Sie erwähnen, ist der feinste Carmin, den er erfunden hat, indem er die früher bekannte Fabrikation dieser theuern und beliebten Farbe wesentlich verbesserte. Heute zeigte er uns aber eine von ihm ebenfalls erfundene chinesische Schminke, die uns wie ein Wunder erschien, und deren Feinheit so eigenthümlich zart ist, daß sie gleichsam substanzlos erscheint, wie ein Hauch auf einem Kartenblatt, goldgrün glänzend und mit befeuchtetem Finger berührt, diesen wunderschön röthend.«
»Sie erzählen kaum Glaubliches!« sprach das junge Mädchen staunend. »Aber was Sie vorhin erwähnten, könnte mich beunruhigen – er wird Ihnen zürnen um meinetwillen – und dann auch mir, er wird meinen Oheim bewegen, mich bald wieder nach Hause zu senden – und ich werde gehen müssen und –«
Sophiens Augen wurden feucht, ihre Stimme erbebte. »Und Dein Herz wird hier zurückbleiben!« rief Leonhard ergänzend und freudig aus. »Und mein Herz, meine Liebe, werden Dir folgen über alle Fernen! Ich schwöre es Dir, Sophie, daß ich redlich streben werde, Dich zu erringen, Dich einst die Meine zu nennen. Der alte Mann liebt mich, vielleicht mehr als ich verdiene, er hat mich im Auge, mehr als ich ihm danke. Er beweißt mir das väterlichste Wohlwollen, aber er paart es mit väterlicher Strenge. Gar oft weilt sein Blick auf mir mit eigenthümlichem Ausdruck. Keines von meinen jüngeren Geschwistern darf sein Zimmer betreten, nur der Vater, die Mutter und ich dürfen darin säubern. Vater und Mutter sind treue, schlichte Menschen, sie haben keine Kenntniß von den hohen und kostbaren Dingen, mit denen der alte Herr sich umgeben hat, mit den mannichfaltigen Sammlungen, die so reichen Stoff zur Belehrung bieten. Mir aber lehrt er täglich Neues; es freut ihn, daß mein Sinn sich dem Naturstudium zulenkt. Dennoch scheint er zu mißbilligen, daß ich Jäger, Forstmann werden will. In diesem Fach, meint der alte Herr, sei zwar dereinst noch viel zu leisten, die Forstwissenschaft liege noch in der Wiege, aber es sei kein Fach für mich. Und doch muß ich jeden Sommermorgen hinaus und botanisiren, und von Zeit zu Zeit hinüber auf den Harz, um dessen Pflanzen zu sammeln und kennen zu lernen und für das Herbarium einzulegen, auch Vögel und kleine Thiere muß ich schießen und ausstopfen. Du solltest unser Naturalienkabinet sehen, liebe Sophie! Mehr als zweihundert Stücke habe ich schon mit eigener Hand ausgebalgt und ausgestopft.«
»Da wird Sie der alte Herr nicht sobald von sich lassen, und Sie werden nicht bald selbstständig zu werden vermögen!« warf Sophie offen hin, ein sehr natürliches Bedenken ohne Scheu aussprechend.
»Theures Mädchen!« entgegnete der Jüngling mit liebevollstem Blick und Ausdruck: »Geduld heißt in tausend Fällen der jungen Liebe Losungswort. Geduld und Hoffnung! In Hoffnung liegt ein hohes Glück. Die stillgenährte, geheime Liebe regt zum edelsten Streben an, sie lehrt dem Jüngling Fleiß, Ausdauer, Beständigkeit, ihr verheißungreiches Grün sei unsere Farbe. Laß uns auf einander hoffen, theure Sophie! Gieb mir das Wort der Treue, gieb mir den Kuß der Verlobung, ich schwöre Dir, daß ich alle Kräfte meines Lebens aufbieten werde, Dir nächst dem Herzen, das ich jetzt Dir biete, das Du ganz erfüllst und erfüllen wirst, auch die Hand bieten zu können. An mein treues Herz, Sophie!«
Von dem wonnevollen Zauber reiner Jugendliebe durchglüht und entflammt, sank Sophie in des liebenden Jünglings zärtliche keusche Umarmung und duldete den ersten Kuß und erwiederte ihn.
Die Sommersonne sank und ihre letzten Strahlen übergoldeten die Wipfel. Von den vollblühenden aber im Abblühen begriffenen Viburnumsträuchen fiel reichlicher Blüthenschnee auf den Rasenteppich, und die in nicht minder reicher voller Frische prangenden Blumentraubenbüschel der Akazienbäume erfüllten den Garten mit herrlichem Arom.
Die Liebenden hatten sich neben einander gesetzt, stillselig, wenige Worte auf dem Munde, um so mehr Wonne im Herzen. Sie bauten den Prachtpalast der Hoffnung herrlich auf, reizend und schön, sie lauschten dem Gesang der Grasmücke, der noch immer lieblich und melodisch aus dem Dickicht schallte, bis der Abend tiefer schattete, und sie sich zögernd trennten. – »Ach noch einen Kuß! – Und noch einen! – Und nun den letzten!« – »»Gute Nacht, mein Lieb, mein Leben!«« – »Gute Nacht Du holder Engel! Träume von mir!« –»»Schlummere süß und träume auch Du von mir! – Gute Nacht!«« – »»Gute Nacht! Und wann sehe ich Dich wieder? – Morgen?«« »»Morgen nicht! Uebermorgen!«« – »Ach – wie lange! – Nun gute Nacht!« – »»Süße gute Nacht!«« –
Der liebende Jüngling schlüpfte durch ein Pförtchen, das sich in der Nähe des traulichen Plätzchens gegen das Feld öffnete, und welches Sophiens Hand entriegelte, aus dem Garten, und Sophie ging mit ihrer Arbeit, das Herz voll alle der Seligkeit, mit welcher eine unentweihte Liebe die Menschenseele füllt, nach der Gärtnerwohnung zu.
________________________________________
Die Abenddämmerung war eingebrochen; der Westhimmel sandte noch einen Abglanz von schimmernden Purpurwölkchen nieder auf die Häuser Helmstädts.
Unter diesen Häusern zeichnete sich eines durch besonders alterthümliches Ansehen aus, im Aeußern sowohl, als im Innern. Mächtiger Giebel, graues Gestein, breite Steinsimse vor schmalen Fenstern, von denen die im untern Geschoß durch weit ausgebauchte, mit kunstreichem Laubwerk verzierte Eisengitter zur Abhaltung von Dieben versehen waren. Die große Bogenthüre war ebenfalls mit kunstvoller Schlosserarbeit verziert, und Griff und Klopfer waren von schwerem Bronzeguß, und zeigten einen Löwenkopf mit Ring im Rachen und ein drachenähnliches Monstrum.
War man durch diese Thüre in das Innere getreten, so fand man sich auf einem feuchtkühlen, leeren, hallenden Vorplatz, mit Steinen geplattet, durch einen Pfeiler gestützt, aus dem eine ganz kleine Thüre nach dem Hofe zu führen schien, von dem zwei runde Fenster, die mit Kreuzgitterung verschlossen waren, einiges Licht einfallen ließen. Die grauen, lange nicht geweißten, mit phantastischem grünlichem Gewölk der Schimmelbildung überzogenen Mauern wurden von mehreren Thüren unterbrochen, deren ganze Gestaltung eben auch den Charakter des Alterthümlichen aussprach. Eine dieser Thüren, zur Linken des Eintretenden, öffnete den Eintritt in den Hörsaal des alten Professors, eine gegenüber befindliche zur Rechten ließ in eine Art Empfangzimmer eintreten, welches mit reichem aber höchst altväterischem Hausrath ausgeschmückt war. Eine dritte Thüre führte zur Wohnung des Dienerpaares Leonhard; er ein alter Mann und sie eine bejahrte Frau, beide von schlichtem Aeußeren, einfachem, aber etwas welt- und leutescheuen Wesen, mit ihren Gedanken und Erinnerungen mehr in der Vergangenheit, als in der Gegenwart wurzelnd und lebend. Die Fenster dieser Wohnung, die ziemlich beschränkt war, und nicht ausreichend für den Kindersegen, mit welchem der Himmel dieses alternde Paar bedacht, und der sich in Dachkammern behelfen mußte, gingen nach dem Hofe hinaus, der mit einem kleinen Hausgarten verbunden war – und standen offen, um die letzten Abendstrahlen und den erfrischenden Hauch der Abendkühle einzulassen in die etwas dumpfigen, sonst aber außerordentlich sauber gehaltenen Gemächer.
Auch die nach dem Garten hinausgehenden Fenster der Wohnstube des Professors mußten offen stehen, denn es zogen und zitterten aus ihnen melodische Klänge über den kleinen Hof, die sich mit den letzten Strahlen vermählten, welche ihn verklärten. Es waren Saiten-Klänge, so voll und tief, wie von einer Pedal-Harfe, wunderbar rein, bald stark und machtvoll, bald sanft rauschend, wie das Gemurmel eines Waldbaches, bald ersterbend, wie der Aeolsharfe Tönesäuseln.
Das alte Paar hatte die Abendmahlzeit vollendet, die Kinder zur Ruhe gesandt, und saß im vollen Feierabendfrieden neben einander. Leonhard hatte sein grünes Sammetkäppchen abgezogen und hielt es zwischen den gefaltenen Fingern, wie beim Gebet in der Kirche, den sinnenden Blick nach außen gewendet. Lenore, die Hausfrau, in ehrbarer, steifer, altväterischer Tracht, in ihrem großgeblümten Kattunkleid so ganz in die Umgebung passend, neigte sich lauschend aus dem Fenster und flüsterte: »Horch! Der Herr spielen wieder die Laute – ach wie schön!«
Es war so. In seinem Wohnzimmer, das angefüllt und überfüllt war mit einer unübersehbaren Menge von Büchern, Geräthschaften, Instrumenten, Flaschen, Phiolen, Präparaten, Papieren, alles im buntesten Durcheinander, so daß auch auf Tischen und Stühlen alles voll stand und lag, und das Auge eines Ruhebedürftigen vergebens nach einem Raume zum Sitzen gespäht haben würde – saß auf dem einzigen noch leergebliebenen, an das Fenster gerückten Sessel, im bequemen Hauskleid, der bejahrte Mann mit den grauen Locken – und griff Accorde auf einer Laute oder Theorbe, an welcher alles ausgezeichnet und ungewöhnlich war. Das Instrument war außerordentlich groß, hatte einen zweifachen Wirbelkasten, war mit sechsundzwanzig Saiten bespannt, deren obere Chöre über die unteren frei hinweg liefen; die Wirbelkästen waren künstlich ausgeschnitzt und von Ebenholz, der Hals war mosaikähnlich mit Elfenbein und Mahagoniholz in kleinen schrägen Feldern geschacht, und am Bauche wechselten breite Mahagoni- und Elfenbeinstreifen mit einander ab. Dieses ziemlich alte Instrument besaß eine wunderschöne Resonanz, wie kaum ein ähnliches.
Der alte Herr schien sich Erinnerungen hinzugeben. Er heftete den sichern festen Blick auf die Theorbe, und während er auf ihr fortwährend keineswegs Stückchen oder Melodieen spielte, sondern nur wechselnde Accorde griff, bald volle und starke, bald zarte und schmelzende, sprach er leise vor sich hin, fast rezitirend, fast rythmisch, und der Gegenwart völlig entrückt:
»Bleibe bei mir, liebe Seele! Entfliehe nicht mit den Klängen, süße Seele meiner unsterblichen, ewig lieben Regina!«
»Stimme im Abendroth, elegischer Wiederhall aus seligen Zeiten, als Aurora den Liebenden die Purpurthore holder Lebenshoffnungen, froher Träume klingend aufthat, säusle mir Labung zu!«
»Du geliebte Laute! Du einziges und doch nicht einziges Andenken an sie, an die Unvergeßliche! Ach, sie spielte Dich mit entzückender Meisterschaft – sie sang zu Dir mit himmlischer Stimme. Dich hielt sie im Arme, als ich, ein feuriger Jüngling, zu ihren Füßen lag, und ihr glühende Liebe schwur!«
»Dich legte sie in meine Hände, ehe sie an mein Herz sank. Dich sandte sie mir, daß ich Dich stimme, da nur ich, nächst ihr, dieß konnte, denn alle die Stümper von Musikanten vermochten's nicht – und Du trugst in Deinem verschwiegenen Schoose die schriftlichen Ergüsse unserer Herzen. Die Liebe lehrte mich, Dich zu stimmen, denn in Kirchers Phonurgia und Musurgia war Deine Stimmung nicht zu finden, in unseren Herzen aber war reine Stimmung, vollste Seelenharmonie.«
»In Dich legte sie ihre schöne Seele nieder, in Deine Saiten ihre Klage; Du hast ihre Thränen getrunken! Lange ahnete niemand – niemand unsere geheime, götterselige Liebe – sie war zu hoch, zu göttlich, als daß sie irdische Dauer hätte haben können. Und als Regina mir in tiefer Verborgenheit das theure Pfand gegeben – entschwebte sie, eine Verklärte zu den Verklärten!«
»Du nur, meine Laute, die ich nach ihr Regina nenne, Du kanntest unser Geheimniß in ganzer Fülle, und Du und ich, wir weinen beide ihr nach! Du mit Klängen, ich mit Thränen.«
Tiefer dunkelte der Abend, die Klänge erstarben. Im Gemache des Professors wurde es mondhell – aber von keiner Lampe. Ein zauberhafter Schein und Schimmer durchleuchtete es seltsam und wunderbar. Er ging von einem großen Krystall aus, der ihn verstärkte. Dieser Krystall war ausgehöhlt, und seine Höhlung umschloß hermetisch einen Phosphor von der stärksten, entschiedendsten Leuchtkraft, welche durch eine geheime, keinem Chemiker der Welt bekannte Zubereitung auf das höchste und für lange Dauer gesteigert war.
________________________________________
3. Eine Abendgesellschaft.
Im Hause des Generalsuperintendenten Abt Henke, Vicepräsidenten des Konsistoriums zu Wolfenbüttel und ersten Professor der Theologie zu Helmstädt war Abendzirkel angesagt, und die Frau dieses Hauses überblickte mit dem Auge eines Feldherrn, der den Schlachtplan prüfend überschaut, das Feld ihrer Thätigkeit in Haus und Küche. Im Spiel- und Rauchzimmer der Männer die Kartentische, die bunten Teller mit aufgehäuften feingeschnittenen goldgelben Kanaster, die langen weißen holländischen Pfeifen, die Fidibusse, die silbernen Leuchter mit Kerzen in ausgefranzten Papiermanschetten, alles in zierlicher Ordnung. Große Steinkrüge voll starken Gerstennektars standen in einem mächtig gebauchten Kühlzuber von blankgescheuertem Kupfer, und ein Credenztisch enthielt nicht minder große Deckelhumpen von Glas mit mancher eingeschliffenen Bilder- und Laubwerkzier.
Zwei andere Zimmer waren für Herren und Frauen zur Unterhaltung bestimmt; Tische geordnet, Sessel und Sopha's passend gestellt, nirgend ein Stäubchen, die Vorhänge blüthenfrisch und blendendweiß und kunstvoll aufgesteckt. Die lange Tafel eines Nebenzimmers trug die Theetassen, volle Zuckerschaalen, Zangen, Löffel, die Bretzeln, Kuchen, Konfecte, die Torten, die Weine. Besonders auf einer dieser Torten weilte der Blick der Frau Henke mit einem gewissen schalkhaften Wohlgefallen.
Das häusliche Abendfest war eigentlich zu Ehren eines sehr lieben Besuches veranstaltet. Ein berühmter Freund der Familie, der Professor der Geschichte: August Ludwig Schlözer (damals noch nicht geadelt) war mit seiner talentreichen trefflichen Frau, und mit seiner blühend schönen, zwanzigjährigen Tochter Dorothea nach Helmstädt gekommen, um eine Zeitlang im Hause des jüngern Freundes auszuruhen von seiner unermüdlichen literarischen Thätigkeit und seinen gehaltvollen Vorträgen, in denen er für Auffassung und Behandlung der Geschichte neue Bahn brach.
Da hatten der Profanhistoriker Schlözer und der nicht minder berühmte Kirchenhistoriker Henke gar manche Idee auszutauschen, und mochten wol sich gegenseitig an einander freuen, da auch Henke nicht auf altgewohntem Wege stehen blieb, sondern mit Freiheit und Frische des Geistes vorwärts strebte, die alte Orthodoxie überflügelte, und den Kampf nicht scheute, welcher damals die Geister aus religiösem, wie nicht minder auf politischem Gebiete bewegte.
Zur Frau des Hauses trat bereits im modischsten Putz, die Freundin, der liebe Gast, Frau Schlözer. Sie trug, wie es schien, ein Bild, von einem feinen Battisttuche überhüllt, und sprach: »Hier bringe ich das Bewußte, wo stellen wir es hin? Wie übergebe ich es ihm?« – »Wir hängen es unter diesen Spiegel, lassen es aber verdeckt!« erwiederte die Henke. »Er wird schon fragen; er kann kein Bild ohne das Verlangen, es anzusehen, erblicken, und wie wird er sich freuen, wenn er erfährt, daß es für ihn bestimmt ist!«
»Wer weiß?« warf Frau Schlözer die Frage auf. »Der alte Hagestolz ist kein Frauenfreund.«
»»Und gegen uns Frauen doch viel artiger, als gegen die Männer. Nie hörte ich ihn über eine Frau ein abfälliges Urtheil aussprechen, und noch vielweniger einer von ihnen hinterm Rücken einen seiner unfeinen Ehrentitel geben, wie Hundeschwanz, Kalbsnase, Nashorn, Katzenmaul und dergleichen, mit denen er gegen die Männer, und am meisten gegen seine Collegen, die Professoren, so äußerst freigebig ist, wenn er von ihnen in Gesellschaft spricht, oder ihrer auf dem Catheder erwähnt!««
»»Das ist ja fürchterlich unsittlich! Ich bitte Dich!«« rief auf diese Entgegnung die Schlözer mit edlem Zorne aus. »Ein so geist- und kenntnißreicher Mann! Wie kann er sich so vergessen?«
»O die gelehrten, die geistreichen, die kenntnißreichen Männer können sich sehr, sehr vergessen, und noch viel weiter, wie der alte Hofrath; so weit, daß sie ihre Frauen prügeln und die Frauen Anderer lieben, das thut er wenigstens nicht, denn er hat keine Frau, und in sittlicher Beziehung ist ihm auch nicht das mindeste Ueble nachzusagen!« erwiederte Frau Henke.
»»Ich bin überzeugt,«« gab die Freundin lächelnd zurück: »daß Du im erstern Punkte nur im Allgemeinen, und nicht aus Erfahrung sprichst. Was den zweiten, besondern Punkt betrifft, so freut mich aus Deinem Munde eine Widerlegung dessen zu hören, was die böse Welt dennoch sagt.«
»»Was wäre das?«« fragte die Generalsuperintendentin gespannt, und schon bereit, den Mann, dem sie wirkliche Verehrung zollte, zu vertheidigen.
»Nun!« lachte die Schlözer: »Die böse Welt sagt eben, daß der Alte in jüngeren Jahren – vielleicht durch besondere chemische Mittel seiner Zubereitung – zur Vermehrung des reichlichen Kindersegens seines Dienerpaares nicht ohne thätige Mitwirkung geblieben sei. Er liebt nun einmal Sammlungen in Fülle.«
»»Du bist gottlos!«« strafte Frau Henke, konnte sich aber dennoch nicht enthalten, den im Geist der Zeit liegenden etwas frivolen Scherz verstohlen zu belächeln.
Das verhüllte Bild wurde an seine Stelle gebracht, während in das vordere Zimmer der Hausherr mit seinem gefeierten Gaste eintrat, und diesen nöthigte, einstweilen Platz zu nehmen. Beide wackere Männer hatten große Toilette gemacht, sie erschienen in alle dem deutschpedantischen Putz, der dem akademischen Lehrer jener Zeit an Gallatagen ziemte: die unvermeidliche Perrücke deckte ihr Haupt, die schwarzseidenen Strümpfe waren stramm gezogen, Schuh- und Knieschnallen funkelten, und die Facetten der blankpolirten Stahldegengriffe blitzten wie Diamanten. Auf dem nächsten Tische lagen neben den neuesten Nummern von Nicolai's allgemeiner deutscher Bibliothek auch jene des Moniteur, an diesem Tage mit der Post direkt von Paris angekommen, und diese letztere Zeitung war es, die sofort die ganze Aufmerksamkeit der beiden gelehrten Freunde auf sich zog, und sie zu lebhaftem Wechselgespräch veranlaßte, das nur erst der Eintritt des ersten Gastes und der bald darauf nach einander folgenden zeitweilig unterbrach. Frau Schlözer hatte die Hausfrau nur verlassen, um mit ihrer lieblichen Tochter gleich darauf wieder in die Gesellschaftszimmer zu kommen, in welche nach einander, theils allein, theils in Begleitung von ihren Frauen, erwachsenen Töchtern und Söhnen nun eintraten: der Professor Johann Benedict Carpzov, als Philolog und Kritiker berühmt, Justizrath Professor Karl Friedrich Häberlin, bekannter Publicist, damals Herausgeber des deutschen Staats-Archivs; Christoph August Bode, als Orientalist ausgezeichnet, und als Uebersetzer mehrerer biblischer Schriften genannt; dann ein auch auf einer Ferienreise in dem ihm lieben Helmstädt zum Besuch weilender akademischer Lehrer, Georg Simon Klügel, Professor der Mathematik und Physik zu Halle, Herausgeber eines Lehrbuchs über Optik und eines anderen über sphärische Trigonometrie, der, vor zwei Jahren noch Professor in Helmstädt, einem ehrenvollen Rufe nach Halle Folge geleistet hatte, und jetzt gekommen war, alte werthe Freunde und Collegen wieder zu begrüßen.
Die Ceremonie des Grüßens und Wiederbegrüßens, gegenseitigen Vorstellens, Verneigens und des Wechselns herkömmlicher Höflichkeiten und Redensarten spielte ziemlich lange, während auch noch der tüchtige Chemiker Lorenz Florenz Friedrich von Crell, Enkel des berühmten Chirurgen und Mediciners Heister, ein noch junger geistesreger Professor eintrat, welcher damals ein chemisches Archiv herausgab, das sich allseitiger Anerkennung und Theilnahme erfreute.
Einige durch Kenntniß und Sitte sich auszeichnende Studirende, als Schüler und Zuhörer Henke's künftige Lichter in der protestantischen Kirche, waren ebenfalls eingeladen, und leuchteten an den Wänden mit aller jugendlichen Schüchternheit und aller theologischen Bescheidenheit, die dem künftigen Candidaten rev. Ministerii so äußerst wohl ansteht. Die Frauen und Jungfrauen gaben Anfangs der Steifheit und Förmlichkeit des Männerkreises nicht nur nichts nach, sondern sie übertrafen ihn noch.
Eine Stunde später sah es schon ungleich gemüthlicher aus in diesem erlesenen Kreise. Die Männer saßen, stark rauchend und Bier dazu trinkend, um die Spieltische und karteten mit Eifer. Die Frauen und Jungfrauen waren um die Theetische gruppirt und die jungen Studirenden weilten in deren Nähe, ebenfalls, vielleicht um dieser Nähe Willen, Thee trinkend, und auf das Verzicht leistend, was doch zu den akademischen Lebensfreuden jener Zeit zählte: Bier, Tabak und Karten.
»Wo er nur bleibt?« flüsterte Frau Schlözer ihrer gastlichen Freundin und Wirthin zu, nachdem sich oft genug und immer vergebens bei jedem hörbaren Aufgehen der Hauptthüre ihr Blick nach dieser hingelenkt hatte.
»So pünktlich er ist in seiner ganzen amtlichen Thätigkeit,« erwiederte ebenfalls leise die Henke: »so wenig ist in Gesellschaft auf seine Pünktlichkeit zu rechnen. Er würde aus der Beichte wegbleiben, so fromm er ist, wenn ein armer Kranker gerade zur Zeit derselben seiner Hülfe dringend bedürfte. Er ist als Arzt vielfach beschäftigt – doch horch! Sieh – wenn man vom Wolf spricht, so kommt er.«
Die vordere Thüre, die in das Herrenzimmer zunächst führte, ging auf, und der Professor, von dem die Rede gewesen, trat rasch ein, grüßte gegen die Dasitzenden, die zum Theil Anstandshalber Miene machten, als wollten sie aufstehen, dieß aber auf einen Handwink von ihm unterließen, und nur der Hausherr erhob sich schnell und vertrat mit Begrüßungsformeln dem durch jenes Zimmer schreitenden Gast den Eingang in das zweite, auf welches jener mit einer gewissen Eile zuschritt, und in dessen Thüre auch schon die Frau vom Hause stand, ihn zu empfangen. Alle Damen erhoben sich grazienhaft so gut sie dieß vermochten, und ehrfurchtvoll von ihren Stühlen.
»Guten Abend! Schönen guten Abend, Herr Generalsuperintendent, Abt und College!« redete der Gekommene den Hausherrn an, ohne auf dessen förmliche Anrede zu hören, und fuhr gleich fort: »Um Gottes Willen, halten Sie mich hier nicht auf! So sehr Sie vom Geiste des Göttlichen erfüllt sein mögen, so spielen wir doch bei Ihnen keine göttliche Komödie und ich brenne nicht, im Purgatorium zu verweilen! Ein schönes Fegefeuer das, Ihre Rauchspelunke!«
Mit diesen Worten ließ der, obschon etwas altmodisch, doch höchst vornehm und gewählt gekleidete feingebaute Mann den Hauswirth zur Seite treten und schritt mit der zierlichsten und doch nicht gezierten Verneigung in das Damenzimmer, wo er sogleich zur Frau vom Hause sich wendend, das Wort nahm: »Ihre Güte möge den säumigen Gast entschuldigen! Ein dringender Fall – eine Lebensrettung – Gott sei gepriesen! Wichtig, höchst anziehend, Schade, recht Schade, daß ich ihn den verehrten Frauen nicht mittheilen kann, aber ich bitte, allseits gütigst Platz zu behalten, ich will keine Störung machen; Sie sehen, ich sitze schon selbst, nun – und Wen habe ich denn hier die Freude zu sehen? Ah, ein Gast des Hauses, Frau Professor Schlözer aus Göttingen! Meine liebwerthe Freundin und Gönnerin!« –
Bald ging der beredte Mann von dem Alltäglichen der Reden, welche insgemein Gesellschaftsgespräche einleiten, zu besonderen und anziehenden Gegenständen über. Er saß, eine Tasse Thee nach der anderen mit größtem Wohlbehagen trinkend, und das appetitliche Backwerk, welches ihm dargeboten ward, keinesweges verschmähend, lebhaft sprechend, in etwas vorgebeugter Haltung am Tische, und seine hellen Augen leuchteten und blitzten unter der hohen und breiten Stirne, von starken Brauen überschattet, nach allen Seiten hin, bald prüfend, bald schlau, bald gutmüthig. Er sprach sanft und leise, aber dennoch äußerst vernehmlich, und es herrschte eine tiefe Stille im Zimmer, wenn er sprach. Diesesmal richtete er zunächst an Dorothea Schlözer das Wort, welche von ihm und seiner reichhaltigen Münzsammlung gehört und derselben Erwähnung gethan hatte. »Sie sind also Münzfreundin, werthe Demoiselle? Das freut mich sehr! Ich vermeide gern von meiner Münzsammlung zu reden, sie bedarf nicht des Lobes, aber wenn Sie mich mit Ihren verehrten Aeltern besuchen, so will ich Ihnen die Sammlung zeigen. Sie werden erstaunen. Man findet selten bei Ihrem Geschlechte Vorliebe für die Numismatik, verbunden mit Kenntniß derselben. Die gelehrteste Münzkennerin unserer Zeit ist die alte Reichsgräfin von Bentink, das heißt, so gelehrt, als einer Frau zu werden möglich ist, sie ist eine reiche Dilettantin. Sie hat einen großartigen prunkenden Katalog ihrer Sammlung mit Nachtrag in drei Bänden drucken und sich von ihrem Lieferanten, dem Niederländer Van Damm schauderhaft anführen lassen, was mir freilich nicht begegnen kann. Abbe Eckhel in Wien hat der Dame vorm Jahre in Briefen ein Licht aufgesteckt, die sie schwerlich an den Spiegel stecken wird. Ich kann neben mir nur noch Eckhel als Münzkenner gelten lassen. Heyne, Rasche, Christ, Richter, Lengnich, alle nichts. Gute Philologen, unpraktische Münzkenner! Golz – auch nichts. Golz und Harduin, dieß sagt auch Eckhel, waren große Gelehrte, mißhandelten aber Fräulein Numismatik arg, sehr arg. Van Damm hat einen mirakulosen Folianten drucken lassen, mit dem er die Sammler bethört, Münzen darin abgebildet, die in der Welt nicht vorhanden sind! Doch ich will die verehrten Damen nicht ermüden, ich glaube die neue Münzkunde zieht Sie Alle mehr an, als die alte.«
»Gewiß, Herr Hofrath! Gewiß, Herr Professor!« riefen mehrere Zuhörerinnen – die Einzige, die gern noch mehr gehört hätte, Fräulein Schlözer, trat zurück, und die Hausfrau rief neckend: »Am anziehendsten wird die Münzkunde immer für Solche sein, welche, wie gewisse Leute, Gold machen können!«
»Aha! Gold machen! Meinen Sie mich, Werthgeschätzte? Wer sagt, daß ich Gold machen kann? Wer sagt, daß ich es nicht kann? Der Mensch kann alles, der Mensch kann was er will. Die Meisten denken, wenn sie vom Goldmachen reden, man mache es nur so aus Blei, es komme nicht hoch zu stehen. Weit gefehlt, meine Damen, das Goldmachen ist eine Arbeit, bei welcher man das Leben einsetzt. Pluto blendete den Plutos. Ich habe in Jugendtagen, als ich Chemie lernte, einmal sieben Tage und sieben Nächte vor dem glühenden Schmelzofen zugebracht, da habe ich gelernt, was der Mensch kann, wenn er will, was er kann. Die Operation erforderte, wenn sie gelingen sollte, ein stets waches Auge. Ich durfte nicht schlafen, und ich habe nicht geschlafen. Ich stellte oder setzte mich so, daß wenn ich einschlief, ich in die Gluth fiel, und der Trieb zum Leben überwand die Forderung der Natur. Nachdem jene schreckliche Feuerwache und Feuerwoche vorüber war, glaubte ich, das Augenlicht zu verlieren, so verletzt waren meine Sehnerven, so furchtbar angegriffen von dem steten Blicken in Kohlengluth und schmelzende Metalle. Aber ich erfand einen Augenstein, der die gestörte Sehkraft schnell wieder kräftigte, und der in alle Pharmakopöen aufgenommen werden würde, wenn ich ihn veröffentlichen wollte.«
»Und so wäre wirklich die Möglichkeit, durch Kunst ächtes Gold hervorzubringen, vorhanden, Herr Professor?« fragte Frau Schlözer wißbegierig.
»Sie werfen eine Frage auf, Frau Professorin!« antwortete der alte Herr, indem er seinen durchdringenden klugen Blick auf sie heftete: »welche bereits einige Jahrhunderte lang gescheidte Köpfe angelegentlich beschäftigt. Die Möglichkeit gestehe ich unbedingt zu, der Gewißheit des Gelingens aber dürften wohl nur wenige Sterbliche sich rühmen. Ich kann Ihnen Proben chemischen Goldes zeigen, ich, und Niemand weiter. Daß ich es selbst gemacht, will ich damit keineswegs sagen. Beehren Sie mich mit Ihrer liebenswürdigen Fräulein Tochter, mit dem Herrn Gemahl.«
»»Da kommt so eben mein Mann, mit dem Generalsuperintendenten, der ihn Ihnen vorstellen will!««
Der Professor erhob sich, die Vorstellung erfolgte, Schlözer sprach scherzend: »Sie scheinen ein großer Weiberfreund zu sein, Herr Hofrath, daß Sie an uns vorüber gleich in das Gynäzeum eilten, und doch sind Sie unvermält geblieben!«
»»Letzteres betreffend,«« war die rasch gegebene Antwort: »so halte ich's mit dem Apostel, der da sagte: Wer freit thut wohl, wer nicht freit, thut noch besser. Sie, Herr Professor, haben wohlgethan, Sie haben eine brave Frau, ein liebenswürdiges, ernstes, der Wissenschaft holdes Kind – was aber ersteres betrifft, so war mein schnelles Wandeln in dieses Zimmer nur eine Flucht aus jenem, denn es leidet mich nicht da, wo ich mir sagen muß: Simson, Philister über Dir!«
»»Sie schmeicheln uns aber auch gar nicht, Sie nennen uns Philister!«« rief Henke lachend aus.
»Ja mit Verlaub, Ihr seid es, Ihr Herren. Euer Tabakrauchen, Euer Biertrinken, Euer Kartenspielen ist schauderhaft philiströs. Und wenn Ihr noch so gelehrt seid, und wenn Euer literarischer Ruhm an die Hörner des Mondes anstößt – Ihr seid und bleibt Philister! Kein wahrhaft genialer Mann raucht Tabak – keine geniale Frau kann es aushalten in eines Rauchers Dunstkreis. – Viele arme Frauen freilich halten aus, duldend, leidend – sie sagen, es beeinträchtige sie nicht, sie sind unwahr aus Liebe oder aber, sie rauchen am Ende selbst, nun – dann sind sie roh. Kartenspielen – pfui – wie geistlos! – bei den Karten muß ich jedesmal an die Kartoffeln denken, es ist so eine geistige Alliteration zwischen beiden, gerade wie die Assonanz des Wortlautes – diese eine dumm machende Knolle, jenes ein dumm machendes Spiel – ächt bäurisch; dort sitzen sie tabakdampfend in der Schänke, trinken Bier, speisen Kartoffeln, und die Toffel – karten.«
Diese drastische Grobheit war mit nichts zu erwiedern, die Art und Weise des Gastes war bekannt; Henke wandte sich mit Schlözer wieder in das Männerzimmer zurück, und sagte zu Letzterem: »Lassen wir ihn, er ist nun einmal ein bizarrer Sonderling! Es kommt ihm nicht darauf an, seine besten Freunde mit einer derben Redensart ins Gesicht zu schlagen, aber er meint es nicht böse, ist Allen hülfreich, und nichts weniger als Menschenfeind, oder ein Feind der Gesellschaft. Er will aber immer nur solche Kreise, in denen er Hauptperson ist, die er unterhält, und da er dieß geistreich thut, so lassen wir ihn überall gern gewähren. Bei den Frauen zumal findet er stets ein williges Ohr, und ungleich mehr Glauben an seine Wunderdinge und Thaten, als bei uns Männern.«
Die gelehrten Freunde gesellten sich wieder dem verlassenen Cirkel zu, und es war dieser Kreis keinesweges ein so philisterhafter, als vorhin der Professor ihn bezeichnen zu wollen schien. Waren es doch lauter Männer, bedeutend in der Wissenschaft und ausgezeichnet durch Charakter und sittlichen Ernst, die diesen Kreis bildeten, die Spitzen der berühmten Hochschule und weit mit Ruhm genannte Gäste.
Neben dem nun einmal beliebten Biere, dem angewöhnten Tabakrauchen, dem angenehm zerstreuenden Kartenspiele waren es einerseits das Wöllnersche, nicht lange zuvor erschienene Religionsedikt, und die dasselbe begleitenden, den Flug geistiger und Gewissens-Freiheit hemmenden Regierungsschritte in Preußen, welche lebhaftes Gespräch hervorriefen. Zahlreiche Schriften waren schon über, für und gegen jenes Edikt erschienen, und Henke unterwarf eine nach der andern einer haarscharfen Kritik und sprach sich mit aller Gediegenheit, die ihm eigen war, über diese wichtige Angelegenheit aus.
Andererseits gaben die Ereignisse in Frankreich, die sich drängten und die Blicke von ganz Europa auf dieses Land lenkten, genug zu reden und zu denken. Man sah hell genug, um das Düsterste kommen zu sehen: eine allgemeine Staatsumwälzung mit allen ihren blutigen Gräueln und ihrem Gefolge von Atheismus, Raubsucht, Mordsucht, Communismus und toller Unvernunft. Professor Häberlin sprach, tiefer blickend, manches prophetische Wort, das später seine Erfüllung fand.
Endlich gaben auch neue Erscheinungen in Poesie und Literatur manche Anregung zu gesprächlichem Meinungsaustausch. Nicolai's Bibliothek, Wieland's deutscher Merkur, auch dramatische Zeitschriften lieferten dazu willkommene neueste Beiträge. Carpzov ließ sein kritisches Licht über die Gesellschaft strahlen, und so schwand in mannichfaltig belebter Unterhaltung die Zeit auf raschen Flügeln dahin.
Der wunderliche Professor blieb im Frauenkreise verweilend, und ließ sich's dort gar wohl sein. Sein Ring mit dem eigenthümlichen Onyx hatte die Augen einer jungen Frau auf sich gezogen. In einer gelblichen Pupille zeigte sich an diesem Ringstein eine bläuliche Iris, und in dieser ein dunkler Stern.
»Das ist ja ein wahrhaftiges Auge!« rief jene Frau.
»Es ist ein Weltauge – daheim habe ich ein ungleich Größeres!« erwiederte der Professor, zog den Ring vom Finger und hielt ihn zum Beschauen näher.
Betroffen wandte sich die Frau zurück – und erröthete. »Das ist ja nicht dasselbe!« sagte sie. »Vorhin war es ja ganz anders!«
In der That war der Stein des Ringes, oder schien dieß mindestens, ein Anderer geworden. Ein weißer concentrischer Kreis bildete jetzt die Einfassung um eine gelbliche Pupille, in der, von einem ganz zarten braunen Kreis umschlossen, ein dunkler Kern zu schwimmen schien – und die Bewundrerin des Steines traute kaum ihren eigenen Augen ob der plötzlichen Veränderung des Weltauges.
Der Professor lächelte, gab den Ring in die Hand der Dame, und im Nu war das früher erblickte Auge wieder sichtbar mit seinem schwarzen Sterne.
Der Stein ließ sich innerhalb seiner Einfassung umdrehen, dieß erklärte jetzt das Räthsel der Doppelerscheinung.
Aber er gab sogleich Anlaß zu neuem Bewundern. In dem Augenblicke, wo der Professor ihn darreichte, wurde der dunkle Stern hell, halbdurchsichtig wie edler Opal schimmernd, und die ihn umgebende Pupille wurde dunkel. »Halten Sie das Auge gegen das Licht!« sprach der Professor. »Sehen Sie, der helle Kern, das ist die Sonne, der breite dunkle Kreis ist der Raum, in dem die Planeten kreisen, der äußerste schmale helle Kreis, der diesen Raum umgiebt, das ist der Fixsternhimmel, oder – wenn Sie, lieber wollen, der Feuerhimmel, das Empyreum, und deshalb ist dieser Stein Weltauge genannt, denn wie der Mensch das Ebenbild Gottes ist, so spiegelt sich im Menschenauge das All der Welt.«
Dieses artige Experiment fesselte die ältere, wie die jüngere Frauenwelt, der Ring des Professors ging von einer schönen Hand zur anderen.
»Nein, was Sie nicht alles Schönes und Seltenes haben!« rief die Hausfrau anerkennend aus.
»Ich habe siebenzehn verschiedene Sammlungen, und in jeder Bestes, Seltenstes, Auserlesenstes,« gab der Professor zur Antwort und begann diese Sammlungen einzeln herzuzählen, während mehrere der Herren, angelockt von den Ausrufen der Verwunderung über den Ringstein, in das Zimmer traten, darin diese lebhaft gewordene Gesellschaft sich befand. Aufmerksam hörten Frau Henke, Frau Schlözer und deren Tochter zu, als ein Sammelzweig nach dem andern: Thiere, Münzen, Bilder, Kupferstiche, Bücher, Automaten, physikalische, optische, astronomische Instrumente, Kleidungsstücke und Geräthschaften berühmter Menschen, antike Steine, Ethnographika und so vieles genannt waren, und als der Professor mit seiner Aufzählung zu Ende war, rief Frau Henke triumphirend:
»Und Etwas haben Sie doch nicht, Herr Professor!«
»»Keine Sammlung von Frauen, nicht Eine!«« erwiederte sarkastisch der witzige Mann, und die Männer lachten.
»Wer möchte Ihnen das zumuthen!« versetzte die Henke. »Die meine ich nicht. Sie haben keine Broderien.«
»»Prüderieen habe ich nicht, eben weil ich keine Frauen habe,«« wortspielte der Professor: »aber Broderien kann ich aufzeigen, diese gehören zu den Bildern, und zwar zu meinen liebsten Bildern, von zarten Frauenhänden mit der Nadel gemalt.«
»»Siehst Du, liebe Freundin! Wie fein unser Herr Professor weibliche Kunstfertigkeit schätzt und beurtheilt?«« richtete Frau Henke an Frau Schlözer das fragende Wort »Mit der Nadel gemalt – kann man den Ausdruck sticken geistreicher umschreiben?«
»Schon der römische Dichter Ovid gebrauchte dieselbe Metapher,« lehnte der Professor dieses Schmeichelwort von sich ab.
»Ich besitze drei herrliche Stickereien einer Prinzessin von Braunschweig. Christi Taufe im Jordan, und noch zwei andere Stücke.«
»»Das ist Schade, da komme ich nun zu spät; mit Prinzessinnen kann ich mich nicht in die Schranken wagen.«« warf Frau Schlözer hin.
Der Professor hatte schon einigemale nach dem Spiegel und nach dem unter diesem hängenden verhüllten Bilde geblickt, und da jetzt der Blick der Sprechenden auch dorthin fiel, so nahm er mit sicherer Voraussetzung das Wort und sagte: »Den Ausdruck zu spät liebe ich nicht, erkenne ihn nicht an. Man kann zu allen Zeiten Gutes und Schönes thun und Gutes und Schönes empfangen.«
»»Ja wohl, besonders empfangen!«« unterbrach neckend Frau Henke. »Sammler lassen sich gern Schönes schenken!«