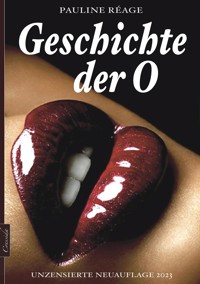14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist keine pikante BoudoirIdylle, sondern eine Geschichte, die mit allen Tabus bricht: O wird von ihrem Geliebten in einem geheimnisvollen Schloss abgeliefert und dort mit Kette und Peitsche gezwungen, sich ganz ihren Gebietern, den Männern, zu unterwerfen. Sie erlebt alle möglichen Formen der Entwürdigung und des Schmerzes, doch je heftiger sie gequält wird, umso offener, gehorsamer und opferbereiter wird sie, bis zur völligen Selbstaufgabe. In ihrer »Geschichte der O« will Pauline Réage den Leser in ihre geheimnisvoll oszillierende Welt hineinziehen. Gibt es also in den Tiefen der Frauenseele etwas, das auf Unterwerfung und Selbstaufgabe besteht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
»Geschichte der O«
Originaltitel: »Histoire d’O«
Übertragen aus dem Französischen von Simon Saint Honoré
»Rückkehr nach Roissy«
Originaltitel: »Retour à Roissy«
Übertragen aus dem Französischen von Margaret Carroux
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12. 05. 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Alle deutschen Rechte bei Langen Müller Verlag GmbH, München
© 2001 Librairie Arthème Fayard
»Geschichte der O«
© 1954 by Jean Jacques Pauvert éditeur, Paris
»Rückkehr nach Roissy«
© 1969 by Jean Jacques Pauvert éditeur, Paris
Schutzumschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: getty-images
ISBN 978-3-7844-8440-2
www.langenmueller.de
Inhalt
Vorwort
Jean Paulhan: Das Glück in der Sklaverei
Geschichte der O
Die Liebenden von Roissy
Sir Stephen
Anne-Marie und die Ringe
Das Käuzchen
Rückkehr nach Roissy
Geschichte der OVorwort
DAS GLÜCK IN DER SKLAVEREI
Ein Aufstand auf Barbados
Ein seltsamer Aufstand forderte im Lauf des Jahres 1838 auf der friedlichen Insel Barbados blutige Opfer. Etwa zweihundert Schwarze, Männer und Frauen, sämtlich durch die März-Erlasse in Freiheit gesetzt, suchten eines Morgens ihren früheren Herrn auf, einen gewissen Glenelg, und baten ihn, sie wieder als Sklaven anzunehmen. Eine Klageschrift, verfaßt von einem Anabaptisten-Pastor, wurde vorgelegt und verlesen. Dann begann die Diskussion. Aber Glenelg wollte sich, aus Zaghaftigkeit, Unsicherheit oder einfach aus Furcht vor dem Gesetz, nicht überzeugen lassen. Worauf die Schwarzen ihm zunächst gütlich zusetzten, ihn dann mit seiner ganzen Familie massakrierten, und noch am gleichen Abend wieder in ihre Hütten zogen, ihre Palaver und gewohnten Arbeiten und Riten wieder aufnahmen. Die ganze Sache konnte durch das Eingreifen des Gouverneurs Mac Gregor schnell unterdrückt werden, und die Befreiung nahm ihren Fortgang. Die Klageschrift übrigens wurde nie aufgefunden.
Ich denke manchmal an diese Schrift. Wahrscheinlich enthielt sie, neben berechtigten Einwänden gegen die Organisation der Arbeitshäuser (workhouses). die Ablösung der Prügelstrafe durch die Gefängnisstrafe, und das Krankheitsverbot für »Lehrlinge« – so nannte man die neuen, freien Arbeiter – zumindest in Umrissen eine Rechtfertigung der Sklaverei. Zum Beispiel die Bemerkung, daß wir nur für die Freiheiten empfänglich sind, die andere Menschen in eine entsprechende Knechtschaft werfen. Es gibt niemanden, der sich nicht freuen würde, frei zu atmen. Doch wenn ich mir zum Beispiel die Freiheit nehme, bis zwei Uhr morgens lustig Banjo zu spielen, so verliert mein Nachbar die Freiheit, mich nicht bis zwei Uhr morgens Banjo spielen zu hören. Wenn ich es fertigbringe, nichts zu tun, so muß mein Nachbar für zwei arbeiten. Zudem ist bekannt, daß totaler Freiheitsdrang unweigerlich schon bald nicht minder totale Konflikte und Kriege nach sich zieht. Dazukommt noch, daß, kraft der Dialektik, der Sklave sowieso einmal zum Herrn wird, es wäre falsch, diese naturgesetzliche Entwicklung forcieren zu wollen. Ferner: sich ganz dem Willen eines anderen ergeben (wie dies Liebende und Mystiker tun), ermangelt nicht der Größe und schafft seine eigenen Freuden, so die Freude, sich-endlich! – befreit zu wissen von den eigenen Neigungen, Interessen und Komplexen. Kurz, diese kleine Schrift würde heute, mehr noch als vor hundert Jahren, als Häresie gelten: als gefährliches Buch.
Hier handelt es sich um eine andere Art von gefährlichem Buch, genau gesagt, um ein Erotikum.
IBündig wie ein Brief
Übrigens, warum nennt man diese Bücher gefährlich? Das ist zumindest unklug. Als hätte man es-wir alle fühlen uns ja gemeinhin recht mutig – geradezu darauf angelegt, daß wir sie lesen und uns so der Gefahr aussetzen. Es hat schon seinen Grund, wenn die Geographischen Gesellschaften ihren Mitgliedern nahelegen, in ihren Reiseberichten den Akzent nicht auf die bestandenen Gefahren zu legen. Nicht aus Bescheidenheit, sondern um niemanden in Versuchung zu führen (man bedenke nur die Leicht-Fertigkeit der Kriege). Doch welche Gefahren?
Eine zumindest besteht, und ich sehe sie von meinem Standpunkt aus sehr deutlich. Eine geringfügige Gefahr. Die Geschichte der O gehört ganz offensichtlich zu den Büchern, die ihren Leser prägen – die ihn nicht ganz so zurücklassen, wie sie ihn vor fanden – oder ihn sogar völlig verändern: die von dem Einfluß, den sie ausüben, auf wunderliche Weise selbst erfaßt werden und sich mit dem Leser wandeln. Nach ein paar Jahren sind sie nicht mehr die gleichen Bücher. So daß die ersten Kritiken bald schon ein bißchen töricht wirken. Aber sei’s drum, ein Kritiker sollte niemals zögern, sich lächerlich zu machen. Am besten gestehe ich sogleich ein, daß ich mich hier auf fremdem Gelände bewege. Ich taste mich durch die Geschichte der O wie durch ein Märchen – die Märchen sind bekanntlich die erotischen Romane der Kinder –, wie durch eines jener Märchenschlösser, die gänzlich verlassen scheinen, in denen jedoch die Sessel unter ihren Hüllen und die Taburetts und die Himmelbetten sorglich abgestaubt und die Peitschen und Reitstöcke ohnehin, sozusagen von Natur aus, blitzblank sind. Nicht die Spur von Rost an den Ketten, kein Schmutzhauch an den buntfarbenen Glasscheiben. So oft ich an O denke, kommt mir spontan ein Wort in den Sinn: das Wort Anstand. Ein Wort, das zu schwierig zu begründen wäre. Lassen wir es also. Und dieser Wind, der unaufhörlich bläst, der durch alle Gemächer streicht. Es weht auch in O ein undefinierbarer Geist, rein und heftig, ohne Pause, ohne Beimischung. Ein entschiedener Geist, der vor nichts scheut, weder vor Seufzer noch Greuel, weder vor Ekstase noch Ekel. Wenn ich ehrlich sein soll, mein Geschmack geht zumeist in eine andere Richtung: ich mag die Werke, deren Autor gezögert hat; bei denen eine gewisse Befangenheit verrät, daß das Sujet ihn zunächst eingeschüchtert hat; daß er bezweifelt hat, ob er jemals damit zurechtkommen würde. Die Geschichte der O dagegen ist von Anfang bis Ende durchgeführt wie ein bravouröses Gefecht. Man denkt eher an eine Rede als an einen gewöhnlichen Herzenserguß; eher an einen Brief, als an ein Tagebuch. Doch an wen ist der Brief gerichtet? Doch wen will die Rede überzeugen? Wen soll ich danach fragen! Ich weiß nicht einmal, wer Sie sind.
Daß Sie eine Frau sind, bezweifle ich kaum. Nicht so sehr wegen der Details, bei denen Sie so gern verweilen, den grünseidenen Kleidern, den Wespentaillen und Röcken, die sich hochrollen lassen (wie Haarsträhnen auf einen Lockenwickler). Vielmehr: weil O, in dem Augenblick, als René sie wieder ihren Peinigern überläßt, noch klar genug denkt, um festzustellen, daß die Pantoffeln ihres Geliebten abgetreten sind, er muß sich neue kaufen. So etwas scheint mir kaum vorstellbar. Darauf wäre ein Mann niemals gekommen, und wenn, so hätte er es nicht zu sagen gewagt.
Und doch stellt O, auf ihre Weise, ein männliches Ideal dar, jedenfalls ein Männerideal. Endlich eine Frau, die es zugibt! Die was zugibt? Das, wogegen die Frauen sich allezeit gewehrt haben (und niemals heftiger als heute). Das, was die Männer aller Zeiten ihnen vorgeworfen haben: daß sie immer nur ihrem Blut gehorchen; daß alles an ihnen Sexus ist, sogar der Verstand. Daß man sie unaufhörlich füttern müßte, unaufhörlich waschen und schminken, unaufhörlich prügeln. Daß sie einfach einen guten Herren brauchen, und zwar einen, der sich hütet vor seiner Güte: denn sobald wir unsere Güte zeigen, beziehen sie daraus allen Elan, alle Freude, alle Leichtigkeit, die sie brauchen, um sich von anderen lieben zu lassen. Kurz, daß man die Peitsche mitnehmen muß, wenn man zu ihnen geht. Es gibt wenige Männer, die nie davon träumten, eine Justine zu besitzen. Doch keine einzige Frau hat bisher, soviel ich weiß, davon geträumt, eine Justine zu sein. Jedenfalls nicht laut davon geträumt, mit soviel Stolz auf Klagen und Tränen, soviel stürmischer Gewalttätigkeit, soviel Leidensgier und soviel Willenskraft, die sich bis zum Bersten spannt. Eine Frau, sicher, aber eine Frau, die etwas von einem Ritter, von einem Kreuzfahrer hat. Als trügen Sie beide Naturen in sich oder als wäre der Adressat des Briefes Ihnen in jedem Augenblick so gegenwärtig, daß Sie seine Neigungen und seine Stimme annehmen. Aber welche Frau, und wer sind Sie?
Wie dem auch sei, die Geschichte der O kommt von weither. Ich spüre darin vor allem diese Ruhe und den Abstand, den eine Erzählung gewinnt, wenn ihr Autor sie lange mit sich herum getragen hat. Wer ist Pauline Réage? Einfach eine Träumerin, wie es viele gibt? (Es genügt, sagt man, auf sein Herz zu hören. Hier ist ein Herz, das vor nichts zurückschreckt.) Eine Dame mit Erfahrung, die das alles selbst erlebt hat? Die es erlebt hat, und sich wundert, daß ein Abenteuer, das so gut begann – oder zumindest so ernsthaft: mit Askese und Züchtigung – schlecht ausgeht und in einer ziemlich zweifelhaften Buße endet, denn schließlich, darüber sind wir uns einig, bleibt O in dieser Art Bordell, wohin die Liebe sie gebracht hat; sie bleibt dort, und hat es dabei gar nicht so schlecht. Dennoch, auch hierbei:
IIEin unerbittlicher Anstand
Auch mich überrascht dieses Ende. Sie werden mir nicht ausreden können, daß es nicht das wirkliche Ende ist. Daß Ihre Heldin in Wirklichkeit (wenn ich so sagen darf) bei Sir Stephen durchsetzt, sterben zu dürfen. Daß er ihre Eisen erst abnimmt, wenn sie tot ist. Aber es wurde noch nicht alles ausgesprochen, und diese Biene – ich meine Pauline Réage – hat einen Teil ihres Honigs für sich behalten. Wer weiß, vielleicht hat sie, dieses eine Mal, einer Autorenüberlegung nachgegeben: eines Tages die Fortsetzung von Os Abenteuern zu schreiben. Auch ist dieses Ende so naheliegend, daß man es nicht zu schreiben brauchte. Wir finden es mühelos selbst. Wir finden es, und es setzt uns ein bißchen zu. Aber Sie, wie haben Sie es gefunden – und wie lautet die Lösung dieses Abenteuers? Ich muß darauf zurückkommen, weil ich überzeugt bin, daß diese Taburetts und Sprossenbetten und sogar die Ketten, sobald man diese Lösung gefunden hätte, sich von selbst erklärten, daß diese große, geheimnisvolle Gestalt, dieses hintergründige Phantom, sich dann zwischen diesen Dingen bewegen könnte.
Ich muß dabei an all das Unerklärliche, Unerträgliche denken, das die männliche Begierde auszeichnet. Es gibt Steine, in denen der Wind singt, die sich plötzlich bewegen oder anfangen, Seufzer auszustoßen oder Musik zu machen wie eine Mandoline. Die Leute kommen von weither, um sie zu sehen. Dennoch möchte man zunächst am liebsten die Flucht ergreifen, auch wenn man die Musik noch so sehr liebt. Sollte die Rolle der erotischen (oder wenn Sie so wollen, der gefährlichen) Bücher darin bestehen, uns aufzuklären? Uns dieserhalb zu beruhigen, wie ein Beichtvater es tut? Ich weiß wohl, daß man sich im allgemeinen daran gewöhnt. Und die Männer machen sich auch nicht sehr lange Gedanken deswegen. Sie werden damit fertig, indem sie sagen, daß sie, die Frauen, selbst damit angefangen haben. Sie lügen, und, wenn man so sagen darf, die Beweise dafür liegen auf der Hand: klar, allzu klar.
Auch die Frauen lügen, wird man mir entgegenhalten. Stimmt, aber bei ihnen fällt es nicht so auf. Sie können immer nein sagen. Welcher Anstand! Daher kommt zweifellos auch die Meinung, daß sie das schönere Geschlecht seien, daß die Schönheit weiblich sei. Schöner, davon bin ich nicht überzeugt. Aber zurückhaltender auf jeden Fall, unauffälliger, und auch das ist eine Form der Schönheit. So denke ich nun schon zum zweiten Mal an den Begriff Anstand im Zusammenhang mit einem Buch, indem davon kaum die Rede ist …
Aber stimmt es, daß davon kaum die Rede ist? Ich denke nicht an den faden und verlogenen Anstand, der sich damit begnügt, sich zu verstellen; der vor dem Stein flieht und leugnet, gesehen zu haben, wie er sich bewegte. Hier haben wir eine andere Art von Anstand, unbeugsam und zu Züchtigungen schnell bereit; der das Fleisch zutiefst demütigt, um ihm seine ursprüngliche Unschuld zurückzugeben, es mit Gewalt zurückzuversetzen in die Tage, als die Begierde noch nicht laut geworden war, der Fels noch nicht gesungen hatte. Ein Anstand, dem man besser nicht ausgeliefert sein sollte. Denn, um ihm Genüge zu tun, müssen Hände auf dem Rücken gefesselt, Knie gespreizt, Leiber ausgespannt, Schweiß und Tränen vergossen werden.
Es sieht aus, als sagte ich grauenvolle Dinge. Mag sein, aber heute ist das Grauen unser tägliches Brot – und vielleicht sind die gefährlichen Bücher nur die Bücher, die uns unserer natürlichen Bedrohung wieder ausliefern. Welcher Liebende wäre nicht entsetzt, wenn er einen Augenblick lang die Tragweite des Schwures ermessen würde, mit dem er sich, keineswegs leichtfertig, für das ganze Leben bindet. Welche Liebende, wenn sie eine Sekunde lang wägte, was die Worte: »ich habe die Liebe nicht gekannt, eh ich dich kennenlernte … mein Herz hat nie gesprochen, eh ich dich traf« besagen, Worte, die sich ihr auf die Lippen drängen. Oder auch das vernünftigere – vernünftig? –: »Ich möchte mich bestrafen für jede Stunde, die ich ohne dich glücklich war. »Jetzt wird sie beim Wort genommen. Jetzt bekommt sie, wenn ich so sagen darf, was sie bestellt hat.
Es fehlt daher nicht an Folterungen in der Geschichte der O. Es fehlt nicht an Peitschenhieben, es fehlt nicht einmal die Brandmarkung mit glühendem Eisen, gar nicht zu reden vom Halsring und der öffentlichen Zurschaustellung. Beinah ebensoviele Foltern, wie es im Leben des Wüstenheiligen Gebete gibt. Nicht weniger sorgfältig abgestuft, und wie numeriert – durch kleine Steinchen voneinander getrennt. Es sind nicht immer vergnügte, will sagen, mit Vergnügen verabreichte Foltern. René weigert sich, sie zuzufügen; und wenn Sir Stephen sie vollzieht, so tut er es, wie man eine Pflicht erfüllt. Ganz offensichtlich finden beide Männer keinen Spaß daran. Sie sind keine Sadisten. Ja, alles geht so vor sich, als hätte O allein von Anfang an verlangt, daß man sie züchtige, ihren letzten Widerstand breche.
An dieser Stelle wird irgendein Dummkopf von Masochismus schwatzen. Von mir aus, aber das hat weiter nichts zu sagen, als daß einem echten Mysterium ein falsches zugesellt wird, ein reines Sprach-Klischee. Was heißt Masochismus? Daß der Schmerz zugleich eine Lust ist; und das Leiden eine Freude! Möglich. Es handelt sich dabei um Behauptungen, wie sie bei den Metaphysikern im Schwange sind – so sagen sie zum Beispiel auch, jede Anwesenheit sei eine Abwesenheit; und jedes Wort ein Schweigen – und ich leugne keineswegs (wenn ich sie auch nicht immer verstehe), daß diese Behauptungen ihren Sinn haben mögen, zumindest ihren Nutzen. Aber einen Nutzen, der sich auf keinen Fall aus der bloßen Beobachtung des Falles ziehen läßt, – der mithin nicht Sache des Arztes oder des einfachen Psychologen und schon gar nicht Sache des Dummkopfs ist. – Nein, sagt man mir, es handelt sich zwar um einen Schmerz, den jedoch der Masochist in Lust verwandeln kann; um Leiden, dem er, mittels eines nur ihm bekannten alchemistischen Verfahrens, reine Freude abgewinnt. Welch frohe Botschaft! Somit hätten die Menschen endlich gefunden, was sie so emsig suchten, in der Medizin, in der Moral, in den Philosophien und Religionen: das Mittel, den Schmerz zu vermeiden oder zumindest ihn zu überwinden: ihn zu begreifen (und sei es nur, indem sie in ihm die Auswirkung unserer Dummheit oder unserer Fehler sehen). Besser noch, sie hätten dieses Mittel immer schon gekannt, denn schließlich gibt es Masochisten nicht erst seit gestern. Und daher wundere ich mich, daß man ihnen nicht die größten Ehren erwiesen hat; daß man nicht versucht hat, hinter ihr Geheimnis zu kommen. Daß man sie nicht in Paläste geholt und dort in Käfige gesperrt hat, um sie besser beobachten zu können.
Vielleicht stellen die Menschen sich niemals Fragen, die nicht schon längst beantwortet sind. Vielleicht genügte es, wenn man sie miteinander in Kontakt bringen, sie ihrer Einsamkeit entreißen würde (als gäbe es ein einziges menschliches Streben, das nicht reine Schimäre wäre). Nun, hier haben wir wenigstens den Käfig, und in dem Käfig haben wir diese junge Frau. Wir brauchen ihr nur zuzuhören.
IIIEin seltsamer Liebesbrief
Sie sagt: »Du bist zu Unrecht erstaunt. Betrachte Deine Liebe genauer. Sie wäre entsetzt, wenn sie begreifen würde, daß ich eine Frau bin und lebe. Du wirst die heißen Quellen Deines Blutes nicht zum V er sie gen bringen, indem Du sie vergißt.«
»Deine Eifersucht täuscht Dich nicht. Sicher, Du gibst mir Glück und Gesundheit und ein tausendfältiges Leben. Aber ich kann nicht verhindern, daß dieses Glück sich sofort gegen Dich kehrt. Auch der Stein singt lauter, wenn das Blut frei strömt und der Körper entspannt ist. Laß mich doch in diesem Käfig und gib mir kaum Nahrung, wenn Du es wagst. Alles, was mich der Krankheit und dem Tod näher bringt, macht mich treu. Und nur dann, wenn Du mir Schmerzen zufügst, bin ich nicht gefährdet. Du hättest Dich nicht bereitfinden dürfen, für mich ein Gott zu sein, wenn die Pflichten der Götter Dir Angst machen, jeder weiß, daß S I E nicht weichherzig sind. Du hast mich schon weinen sehen. Nun mußt Du noch Geschmack an meinen Tränen finden. Ist mein Hals nicht reizend, wenn er sich gegen meinen Willen bäumt und an einem Schrei erstickt, den ich zurückhalte. Es ist nur zu wahr, daß man die Peitsche nicht vergessen darf, wenn man zu uns geht. Und bei manchen bedürfte es sogar der neunschwänzigen Katze.«
Sie fügt sofort hinzu: »Welch dummer Scherz. Aber Du begreifst auch nichts. Wenn ich Dich nicht wirklich lieben würde, glaubst Du, daß ich dann wagte, so zu Dir zu sprechen und meinesgleichen zu verraten?«
Und sagt dann: »Meine Phantasie, meine flüchtigen Träume, werden dauernd zum Verräter an Dir. Nimm mir die Kraft. Befreie mich von diesen Träumen. Liefere mich aus. Sorge dafür, daß ich nicht einmal die Zeit habe, daran zu denken, daß ich Dir untreu bin. Doch laß mich zuerst mit Deiner Nummer zeichnen. Wenn ich die Spur Deiner Peitsche trage oder Deine Kette oder diese Ringe an meinen Lippen, dann muß allen klar sein, daß ich Dir gehöre. Solange man mich in Deinem Namen schlägt und mich schändet, bin ich nur, was Du denkst, was Du wünschst, was Du begehrst. Und genau das wolltest Du, glaube ich. Ich liebe Dich, und deshalb will ich es auch.«
»Wenn ich endgültig aufgehört habe, ich selbst zu sein, wenn mein Mund und mein Leib und meine Brüste nicht mehr mir gehören, dann werde ich zu einem Wesen aus einer anderen Welt, wo alles einen anderen Sinn hat. Eines Tages weiß ich vielleicht nichts mehr von mir. Was ist mir von nun an die Lust, was sind mir die Liebkosungen so vieler Männer, Deiner Abgesandten, die ich nicht unterscheiden – nicht mit Dir vergleichen kann?«
So spricht sie. Ich höre ihr zu und merke sehr wohl, daß sie nicht lügt. Ich versuche ihr zu folgen (die Prostitution hat mir lange zu schaffen gemacht). Es ist schließlich möglich, daß die lodernde Tunika der Mythologien nicht eine simple Allegorie ist; noch die kultische Prostitution eine Kuriosität der Geschichte. Es ist möglich, daß die Refrains der Liebeslieder und die »ich bin sterblich in dich verliebt« keine simplen Metaphern sind. Noch, was die Huren zu ihren Auserwählten sagen: »Ich bin verrückt nach dir, mach mit mir, was du willst.« (Merkwürdig, wenn wir uns von einem Gefühl befreien wollen, das uns verwirrt, dann sprechen wir dieses Gefühl den Ganoven zu, den Prostituierten.) Es ist möglich, daß Héloise, als sie an Abälard schrieb: »Ich werde Dein Freudenmädchen sein«, nicht einfach nur eine hübsche Phrase machen wollte. Sicher ist die Geschichte der O der heftigste Liebesbrief, den ein Mann je erhalten hat.
Ich erinnere mich an jenen Holländer, der so lange auf den Meeren herumirren muß, bis er ein Mädchen findet, das bereit ist, ihr Leben zu verlieren, um seines zu retten; und an den Ritter Guigemar, der, um von seinen Wunden zu genesen, auf eine Frau wartet, die für ihn leidet »wie nie eine Frau gelitten hat«. Natürlich ist die Geschichte der O länger als ein Liebeslied und ausführlicher als ein einfacher Brief. Vielleicht mußte man auch weiter dazu ausholen. Vielleicht war es noch nie so schwierig, auch nur zu begreifen, was die Jungen und Mädchen von der Straße sagen: wahrscheinlich das gleiche, wie die Sklaven von Barbados. Wir leben in einer Zeit, in der die einfachsten Wahrheiten sich uns nur dann nackt (wie O) präsentieren können, wenn sie eine Käuzchenmaske aufhaben.
Denn völlig normale und selbst vemunftbegabte Leute sprechen gern von der Liebe als von einem spielerischen Gefühl, das man nicht ernst nehmen muß. Man sagt, daß es viel Vergnügen verschafft, und daß der Kontakt zweier Epidermen nicht ganz ohne Reiz ist. Man sagt, daß der Reiz oder das Vergnügen sich dem voll erschließen, der es versteht, der Liebe ihren willkürlichen Charme, ihre Kapriziosität, eben ihre natürliche Freiheit zu bewahren. Von mir aus, wenn es Menschen verschiedenen (oder auch gleichen) Geschlechts so leicht fällt, einander Lust zu verschaffen, dann sollen sie sich nur ja nicht genieren. Nur ein oder zwei Wörtchen geben mir dabei zu denken: das Wort Liebe und auch das Wort Freiheit. Natürlich trifft das Gegenteil zu. Liebe bedeutet Abhängigkeit – nicht nur in ihrem Vergnügen, in ihrer Existenz und in dem, was vor der Existenz kommt: in dem Wunsch, zu existieren – von fünfzig wunderlichen Dingen: von zwei Lippen (und von der Grimasse oder dem Lächeln, zu dem sie sich verziehen), von einer Schulter (von der Art, wie sie sich hebt oder senkt), von zwei Augen (von einem Blick, der ein wenig weicher, ein wenig härter ist), schließlich von einem ganzen fremden Körper, mit dem Geist oder der Seele, die in ihm sind – von einem Körper, der in jedem Augenblick strahlender als die Sonne werden kann, eisiger als eine Schneefläche. Es ist keine Freude, das alles an sich zu erfahren, dagegen kommen Ihre Martern mir lächerlich vor. Man zittert, wenn dieser Körper sich bückt, um das Band eines kleinen Schuhs zu knüpfen, und es scheint, daß jeder einem an sieht, wie man zittert. Lieber die Peitsche und die Ringe im Fleisch! Was die Freiheit anlangt … jeder Mann oder jede Frau, die sie an sich erfahren haben, dürften sich dagegen auflehnen, sie mit Schimpf und Greuel bedrohen. Sicher, es fehlt nicht an Greuel in der Geschichte der O. Aber manchmal scheint es mir, daß hier nicht so sehr eine junge Frau als vielmehr eine Idee, eine Meinung gefoltert wird.
Die Wahrheit über den Aufstand
Merkwürdig, die Idee vom Glück in der Sklaverei nimmt sich heutzutage wie neu aus. In der Familie hat das Oberhaupt kaum mehr das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden, in den Schulen und in der Ehe ist die körperliche Züchtigung verpönt, und Männer, die man in früheren Jahrhunderten stolz auf öffentlichen Plätzen enthauptet hat, läßt man heute jämmerlich in Kellern verfaulen. Wir martern nur noch anonym, und Leute, die es nicht verdienen. Deshalb sind diese Martern auch tausendmal grausamer, der Krieg röstet auf einen Schlag die gesamte Bevölkerung einer Stadt. Die exzessive Nachgiebigkeit des Vaters, des Lehrers oder des Liebhabers wird mit Bombenteppichen und Napalm und Atomexplosionen bezahlt. Alles geht vor sich, als existiere in der Welt ein geheimes Gleichgewicht der Gewalttaten, an denen wir den Geschmack verloren haben, ja, deren Sinn wir nicht mehr erkennen können. Und ich bin gar nicht böse, daß eine Frau diesen Geschmack und diesen Sinn wiedergefunden hat. Ich wundere mich nicht einmal darüber.
Ehrlich gesagt, ich habe über die Frauen nicht so viele bestimmte Ansichten, wie dies bei Männern im allgemeinen der Fall ist. Ich bin überrascht, daß es sie gibt (die Frauen). Mehr als überrascht: vage verwundert. Weshalb sie mir vielleicht wunderbarer scheinen, ich beneide sie fast dauernd. Was erregt nun meinen Neid?
Manchmal sehne ich mich nach meiner Kindheit zurück. Dabei gilt aber meine Sehnsucht ganz und gar nicht den Überraschungen und Offenbarungen, von denen die Dichter sprechen. Nein. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich für die ganze Erde verantwortlich war. Abwechselnd Boxweltmeister oder Koch, politischer Redner (jawohl), General, Dieb und sogar Rothaut, Baum oder Fels. Man wird einwenden, daß es sich um ein Spiel handelte. Sicher, für Sie, die Erwachsenen, aber für mich nicht, ganz und gar nicht. Damals war ich Herr des Universums, mit allen Sorgen und Gefahren, die diese Herrschaft mit sich bringt: damals war ich universell. Genau darauf will ich hinaus.
Die Frauen besitzen die Gabe, ihr ganzes Leben lang den Kindern zu gleichen, die wir waren. Eine Frau versteht sich auf tausend Dinge, die uns fremd sind. Fast immer kann sie nähen. Sie kann kochen. Sie weiß, wie man ein Zimmer einrichtet und welche Stile sich untereinander vertragen (ich sage nicht, daß sie alles perfekt macht, aber ich war auch keine perfekte Rothaut). Sie kann noch mehr. Sie kann mit Hunden und Katzen umgehen; sie spricht mit diesen Halbverrückten, den Kindern, die wir unter uns dulden: sie lehrt sie die Kosmologie und gute Manieren, die Hygiene und die Märchen, ja, manchmal sogar das Klavierspielen. Kurz, wir träumen von Jugend an vergeblich von einem Mann, der alle Männer zugleich wäre. Dagegen scheint es, daß es jeder Frau möglich ist, alle Frauen (und alle Männer) zugleich zu sein. Aber es kommt noch merkwürdiger.
Man hört heutzutage oft sagen, daß es genüge, alles zu begreifen, um alles zu verzeihen. Nun, ich war immer der Ansicht, daß bei den Frauen – so universell sie auch sein mögen – das Gegenteil zutrifft. Ich hatte eine Menge Freunde, die mich so nahmen, wie ich bin, und die ich meinerseits so nahm, wie sie waren – ohne den geringsten Wunsch, uns gegenseitig zu verändern. Ich freute mich sogar – und auch sie freuten sich –, daß jeder von uns so sehr er selbst war. Aber es gibt keine Frau, die nicht versuchte, den Mann, den sie liebt, zu ändern, und sich damit. Als löge das Sprichwort, als genüge es, alles zu verstehen, um gar nichts zu verzeihen.
Nein, Pauline Réage verzeiht sich so gut wie nichts. Und ich frage mich sogar, ob sie nicht ein klein wenig übertreibt; ob ihresgleichen, die Frauen, ihr wirklich so gleichen, wie sie annimmt. Aber mehr als ein Mann wird wohl zu gern mit ihr einer Meinung sein.
Muß man bedauern, daß die Klageschrift verlorenging? Ich fürchte, ehrlich gesagt, daß der ehrenwerte Anabaptist, der sie verfaßte, diese Schrift in ihrem apologetischen Teil mit ziemlich abgedroschenen Gemeinplätzen spickte: zum Beispiel, daß es immer Sklaven geben werde (was stimmt); daß es immer die gleichen sein würden (worüber sich streiten läßt); daß man sich mit seinem Stand abfinden und eine Zeit, die man dem Spiel, der Meditation und den üblichen Vergnügungen widmen könnte, nicht mit Klagen vertun solle. Aber ich glaube, er hat nicht die Wahrheit gesagt, nämlich, daß Glenelgs Sklaven in ihren Herrn verliebt waren, daß sie ohne ihn nicht leben konnten. Im Grunde die gleiche Wahrheit, die uns in der Geschichte der O die Bündigkeit und den unfaßbaren Anstand spüren läßt, den fanatischen Sturmwind, der dauernd bläst.
Jean Paulhanvon der Académie Française.
Geschichte der O
IDIE LIEBENDEN VON ROISSY
Ihr Geliebter führt O eines Tages in einem Stadtviertel spazieren, das sie sonst nie betreten, im Parc Monsouris, im Parc Monceau. An der Ecke des Parks, einer Straßenkreuzung, wo niemals Taxis stehen, sehen sie, nachdem sie im Park spazierengegangen und Seite an Seite am Rand einer Rasenfläche gesessen waren, einen Wagen mit Zähluhr, der einem Taxi gleicht. »Steig ein«, sagt er. Sie steigt ein. Der Abend ist nicht mehr fern, und es ist Herbst. Sie ist gekleidet wie immer. Schuhe mit hohen Absätzen, ein Kostüm mit Plisseerock, Seidenbluse, keinen Hut. Aber lange Handschuhe, die über die Ärmel des Kostüms gezogen sind, und sie trägt in ihrer ledernen Handtasche ihre Papiere, Puder und Lippenstift. Das Taxi fährt geräuschlos an, ohne daß der Mann etwas zum Chauffeur gesagt hätte. Er schließt die Schiebevorhänge rechts und links an den Scheiben und hinten am Rückfenster; sie hat ihre Handschuhe ausgezogen, weil sie glaubt, er wolle sie küssen oder sie solle ihn streicheln. Aber er sagt: »Du kannst dich nicht rühren, gib deine Tasche her.« Sie gibt die Tasche, er legt sie außerhalb ihrer Reichweite und fährt fort: »Und du hast zu viel an. Mach die Strumpfhalter auf, rolle deine Strümpfe bis zum Knie: hier hast du Strumpfbänder.« Es geht nicht ganz leicht, das Taxi fährt schneller, und sie fürchtet, der Chauffeur könne sich umdrehen. Schließlich sind die Strümpfe gerollt, und es stört sie, die Beine nackt und frei unter der Seide ihres Hemds zu spüren. Außerdem rutschen die ausgehakten Strumpfhalter hoch. »Nimm den Gürtel ab, sagt er, und zieh den Slip aus.« Das geht einfach, man braucht nur mit den Händen hinter die Hüften fassen und sich ein bißchen hochstemmen. Er nimmt ihr Gürtel und Slip aus der Hand, legt sie in die Tasche und sagt dann: »Du darfst dich nicht auf dein Hemd und auf den Rock setzen, du mußt beides hochziehen und dich direkt auf die Bank setzen.« Die Bank ist mit Kunstleder bezogen, es ist glitschig und kalt, man schaudert, wenn man es an den Schenkeln spürt. Dann befiehlt er ihr: »Zieh jetzt deine Handschuhe wieder an.« Das Taxi fährt noch immer, und sie wagt nicht zu fragen, warum René sich nicht rührt und nichts mehr sagt, noch was es für ihn bedeuten kann, daß sie reglos und stumm, so entblößt und so ausgesetzt, so wohl behandschuht, in einem schwarzen Wagen sitzt und nicht weiß, wohin sie fährt. Er hat ihr nichts befohlen und nichts verboten, doch sie wagt weder die Beine überzuschlagen noch die Knie zu schließen. Sie hat die beiden behandschuhten Hände rechts und links auf den Sitz gestützt.
»Voilà«, sagt er plötzlich. Voilà: das Taxi hält in einer schönen Allee, unter einem Baum – es sind Platanen – vor einem kleinen Palais, ähnlich den kleinen Palais am Faubourg Saint-Germain, das man zwischen Hof und Garten mehr ahnt als sieht. Die Straßenlaternen sind ein Stück entfernt, es ist dunkel im Wagen, und draußen regnet es. »Halt still«, sagt René. »Halt ganz still.« Er streckt die Hand nach dem Kragen ihrer Bluse aus, öffnet die Schleife, dann die Knöpfe. Sie beugt den Oberkörper ein wenig vor, sie glaubt, er wolle ihre Brüste streicheln. Nein. Er tastet nur, faßt und durchschneidet mit einem Taschenmesser die Träger des Büstenhalters und zieht ihn ihr aus. Unter der Bluse, die er wieder geschlossen hat, sind jetzt ihre Brüste frei und nackt, wie ihr Leib nackt und frei ist von Taille bis zu den Knien.
»Hör zu«, sagt er. »Es ist soweit. Ich lasse dich jetzt allein. Du steigst aus und klingelst an der Tür. Du folgst der Person, die dir öffnet, du tust alles, was man von dir verlangt. Wenn du nicht sofort hineingehst, wird man dich holen, wenn du nicht sofort gehorchst, wird man dich zwingen zu gehorchen. Deine Tasche? Nein, du brauchst deine Tasche nicht mehr. Du bist weiter nichts als das Mädchen, das ich anliefere. Doch, doch, ich werde dort sein. Geh!«
Eine andere Version des gleichen Anfangs war brutaler und simpler: die junge Frau war, ebenso gekleidet, von ihrem Geliebten und einem seiner Freunde, den sie nicht kannte, im Wagen mitgenommen worden. Der Unbekannte saß am Steuer, der Geliebte neben der jungen Frau, und diesmal sprach der Freund, der Unbekannte, und erklärte der jungen Frau, daß ihr Geliebter den Auftrag habe, sie vorzubereiten, daß er ihr die Hände auf den Rücken binden werde, oberhalb der Handschuhe, ihre Strümpfe aushaken und herunterrollen, ihr den Strumpfgürtel ausziehen, den Slip und den Büstenhalter, und ihr die Augen verbinden werde. Daß sie dann im Schloß abgeliefert werde. Wo man sie jeweils anweisen werde, was sie zu tun habe. Nachdem sie wie besprochen entkleidet und gefesselt worden war, half man ihr nach einer halbstündigen Fahrt aus dem Wagen, führte sie einige Stufen hinauf, dann mit verbundenen Augen durch ein paar Türen, und als die Binde abgenommen wurde, fand sie sich allein in einem dunklen Zimmer, wo man sie eine halbe Stunde warten ließ oder eine Stunde oder zwei, ich weiß nicht, wie lange, aber es war eine Ewigkeit. Als dann endlich die Tür geöffnet wurde und das Licht anging, sah sie, daß sie in einem ganz gewöhnlichen und behaglichen Raum gewartet hatte, der dennoch eigenartig war: mit einem dicken Teppich auf dem Boden, aber ohne ein Möbelstück, rundum Wandschränke. Zwei Frauen hatten die Tür geöffnet, zwei junge und hübsche Frauen, gekleidet wie hübsche Zofen des achtzehnten Jahrhunderts: mit langen, leichten und gebauschten Röcken, die die Füße bedeckten, mit engen Miedern, die den Busen hochschoben und vorne geschnürt oder gehakt waren, und mit Spitzen am Ausschnitt und an den halblangen Ärmeln. Augen und Mund geschminkt. Jede trug ein enges Halsband und enge Armbänder um die Handgelenke.
Ich weiß nun, daß sie O die Hände losbanden, die noch immer hinter ihrem Rücken gefesselt waren, und ihr sagten, daß sie sich ausziehen müsse und daß man sie baden und schminken werde. Sie wurde also entkleidet und ihre Kleider wurden in einem der Wandschränke verwahrt. Sie durfte sich nicht allein baden, sie wurde frisiert wie beim Friseur, indem man sie in einem dieser großen Sessel Platz nehmen ließ, die beim Kopfwaschen nach hinten gekippt und wieder gerade gestellt werden, wenn man, nach dem Einlegen, unter der Trockenhaube sitzt. Das dauert immer mindestens eine Stunde. Es hat tatsächlich über eine Stunde gedauert, sie war nackt auf diesem Stuhl gesessen, und man verbot ihr, die Beine überzuschlagen oder die Knie zu schließen. Und da sie vor einem großen Spiegel saß, der die Wandfläche von oben bis unten bedeckte und von keiner Konsole unterbrochen wurde, sah sie sich, weit klaffend, so oft ihr Blick den Spiegel traf.
Als sie fertig geschminkt war, die Lider leicht umschattet, den Mund sehr rot, Spitze und Hof der Brüste rosig, den Rand der Schamlippen rötlich, den Flaum der Achselhöhlen und des Schoßes, die Furche zwischen den Schenkeln und die Furche unter den Brüsten und die Handflächen lange mit Parfüm bestäubt, wurde sie in einen Raum geführt, wo ein dreiteiliger Spiegel und ein vierter Spiegel an der Wand dafür sorgten, daß sie sich genau sehen konnte. Sie wurde angewiesen, sich auf den Puff in der Mitte zwischen den Spiegeln zu setzen und zu warten. Der Puff war mit schwarzem Pelz bezogen, der sie ein bißchen stach, und der Teppich war schwarz, die Wände rot. Sie hatte rote Pantöffelchen an den Füßen. An einer Wand des kleinen Boudoirs war ein großes Fenster, das auf einen schönen dunklen Park hinausging. Es hatte zu regnen aufgehört, die Bäume bewegten sich im Wind, der Mond lief hoch oben zwischen den Wolken hin. Ich weiß nicht, wie lange sie in dem roten Boudoir gewartet hat, auch nicht, ob sie wirklich allein war, wie sie annahm, oder ob jemand sie durch eine verborgene Öffnung in der Wand beobachtete. Dagegen weiß ich, daß eine der beiden Frauen, als sie wiederkamen, ein Maßband trug, die andere ein Körbchen. Ein Mann begleitete sie; er trug ein langes violettes Gewand mit Ärmeln, die oben weit und am Handgelenk eng waren, das Gewand öffnete sich beim Gehen von der Taille an. Man sah, daß er darunter eine Art anliegender Strumpfhosen trug, die Beine und Schenkel bedeckten, das Geschlecht jedoch freiließen. Dieses Geschlecht sah O als erstes beim ersten Schritt des Mannes, dann die Peitsche aus Lederschnüren, die im Gürtel steckte, dann, daß der Mann eine schwarze Kapuze übers Gesicht gezogen hatte – ein Netz aus schwarzem Tüll verbarg sogar die Augen –, und schließlich, daß er auch Handschuhe trug, ebenfalls schwarz und aus feinem Ziegenleder. Er sagte ihr, sie solle sitzenbleiben, duzte sie dabei, und befahl den Frauen, sich zu beeilen. Die mit dem Zentimeterband nahm nun von Os Hals und Gelenken die Maße, die zwar klein, aber doch gängig waren. Es war leicht, in dem Korb, den die andere Frau trug, ein passendes Halsband und Armreifen zu finden. Sie waren folgendermaßen gearbeitet: aus mehreren Lederschichten (jede Schicht sehr dünn, das Ganze nicht mehr als einen Finger dick), mit einem Schnappverschluß, der automatisch einklickte wie ein Vorhängeschloß, wenn man ihn zumachte, und nur mit einem kleinen Schlüssel wieder zu öffnen war. An der dem Verschluß genau gegenüberliegenden Stelle, in der Mitte der Lederschichten und beinah ohne Spiel, war ein Metallring angebracht, der es erlaubte, das Armband irgendwo zu befestigen, wenn man das wollte, denn es schloß, wenn es auch gerade so viel Spielraum gab, um keine Verletzung zu bewirken, zu eng am Gelenk an, und das Halsband zu eng um den Hals, als daß man einen noch so dünnen Riemen hätte durchziehen können. Man befestigte nun Halsband und Armreifen an Hals und Gelenken, dann befahl der Mann ihr, aufzustehen. Er setzte sich auf ihren Platz auf den Pelzpuff und zog sie zwischen seine Knie, ließ die behandschuhte Hand zwischen ihre Schenkel und über ihre Brüste gleiten und erklärte ihr, daß sie noch an diesem Abend vorgeführt werden solle, nach dem Essen, das sie allein einnehmen werde. Sie nahm es wirklich allein ein, noch immer nackt, in einer Art Kabine, in die eine unsichtbare Hand ihr die Speisen durch einen Schalter zuschob. Nach dem Essen kamen die beiden Frauen und holten sie ab. Im Boudoir schlossen sie gemeinsam die beiden Ringe ihrer Armreifen hinter ihrem Rücken zusammen, legten ihr einen langen Umhang um die Schultern, der an ihrem Halsband befestigt wurde und der sie ganz bedeckte, sich jedoch beim Gehen öffnete; sie konnte ihn ja nicht zusammenhalten, weil ihre Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Sie durchschritten ein Vorzimmer, zwei Salons, und kamen in die Bibliothek, wo vier Männer beim Kaffee saßen. Sie trugen die gleichen wallenden Gewänder, wie der erste, aber keine Masken. Doch O hatte nicht Zeit, ihre Gesichter zu sehen und festzustellen, ob ihr Geliebter unter ihnen sei (Er war unter ihnen), denn einer der Vier richtete den Strahl einer Lampe auf sie, die sie blendete. Alle Anwesenden verhielten sich regungslos, die beiden Frauen rechts und links von ihr und die Männer vor ihr, die sie musterten. Dann erlosch die Lampe; die Frauen entfernten sich. Man hatte O aufs neue die Augen verbunden. Nun mußte sie näherkommen, sie schwankte ein bißchen und spürte, daß sie vor dem Kaminfeuer stand, an dem die vier Männer saßen: sie fühlte die Hitze, sie hörte die Scheite leise in der Stille knistern. Sie stand mit dem Gesicht zum Feuer. Zwei Hände hoben ihren Umhang hoch, zwei weitere glitten an ihren Hüften entlang, nachdem sie sich überzeugt hatten, daß die Armreifen festgemacht waren: sie trugen keine Handschuhe und eine von ihnen drang von beiden Seiten zugleich in sie ein, so abrupt, daß sie aufschrie. Ein Mann lachte. Ein anderer sagte: »Drehen Sie sich um, damit man die Brüste und den Leib sieht.« Sie mußte sich umdrehen, und die Hitze des Feuers schlug jetzt an ihre Lenden. Eine Hand ergriff eine ihrer Brüste, ein Mund packte die Spitze der anderen. Plötzlich verlor sie das Gleichgewicht und taumelte nach rückwärts; sie wurde aufgefangen, von welchem Arm? während jemand ihre Beine öffnete und sanft die Lippen auseinanderzog; Haare strichen über die Innenseite ihrer Schenkel. Sie hörte jemanden sagen, man müsse sie niederknien lassen. Was auch geschah. Das Knien tat ihr sehr weh, zumal man ihr verbot, die Knie zu schließen und ihre Hände so auf den Rücken gebunden waren, daß sie sich vorbeugen mußte. Nun erlaubte man ihr, sich zurücksinken zu lassen, bis sie fast auf den Fersen saß, wie es die Nonnen tun. »Sie haben sie nie angebunden? – Nein, nie. – Auch nicht gepeitscht? – Auch das nie. Sie wissen ja …« Diese Antworten kamen von ihrem Geliebten. »Ich weiß, sagte die andere Stimme. Wenn man sie nur gelegentlich anbindet, wenn man sie nur ein bißchen peitscht, könnte sie Geschmack daran finden, und das wäre falsch. Man muß über den Punkt hinausgehen, wo es ihr Spaß macht, man muß sie zum Weinen bringen.« Einer der Männer befahl O jetzt, aufzustehen, er wollte gerade ihre Hände losbinden, zweifellos, damit man sie an einen Pfosten oder eine Mauer fesseln könnte, als ein anderer protestierte, er wolle sie zuerst nehmen und zwar sofort – so daß man sie wieder niederknien ließ, aber diesmal mußte sie, noch immer mit den Händen auf dem Rücken, den Oberkörper auf den Puff legen und die Hüften hochrecken. Der Mann packte mit beiden Händen ihre Hüften und drang in ihren Leib ein. Er überließ seinen Platz einem zweiten. Der dritte wollte sich an der engsten Stelle einen Weg bahnen und ging so brutal vor, daß sie aufschrie. Als er von ihr abließ, glitt sie, stöhnend und tränennaß unter ihrer Augenbinde, zu Boden: nur um zu spüren, daß Knie sich gegen ihr Gesicht preßten und auch ihr Mund nicht verschont würde. Schließlich blieb sie, hilflos auf dem Rücken, in ihrem Purpurmantel vor dem Feuer liegen. Sie hörte, wie Gläser gefüllt und ausgetrunken, wie Sessel gerückt wurden. Im Kamin wurde Holz nachgelegt. Plötzlich nahm man ihr die Augenbinde ab. Der große Raum mit den Büchern an den Wänden war schwach erleuchtet durch eine Lampe auf einer Konsole und durch den Schein des Feuers, das wieder aufflammte. Zwei Männer standen und rauchten. Ein dritter saß, eine Peitsche auf den Knien, und der vierte, der sich über sie beugte und ihre Brust streichelte, war ihr Geliebter. Aber alle vier hatten sie genommen, und sie hatte ihn nicht von den anderen unterscheiden können. Man erklärte ihr, daß es immer so sein werde, so lange sie sich im Schloß aufhalte, daß sie die Gesichter der Männer nicht sehen werde, die sie vergewaltigen oder foltern würden, niemals jedoch bei Nacht, und daß sie niemals wissen werde, wer ihr das Schlimmste angetan hatte. Desgleichen wenn sie gepeitscht würde, nur wolle man dann, daß sie sehen könne, wie sie gepeitscht wurde, daß sie also zum ersten Mal keine Augenbinde tragen werde, daß die Männer dagegen ihre Masken anlegen würden und sie sie nicht unterscheiden könne. Ihr Geliebter hatte sie aufgehoben und in ihrem roten Umhang auf die Armlehne eines Sessels an der Kaminecke gesetzt, damit sie hören sollte, was man ihr zu sagen hatte und sehen sollte, was man ihr zeigen wollte. Sie hatte noch immer die Hände auf dem Rücken. Man zeigte ihr den Reitstock, der schwarz war, lang und dünn, aus feinem Bambus, mit Leder bezogen, wie man sie in den Auslagen der großen Ledergeschäfte sieht; die Lederpeitsche, die der erste der Männer, den sie gesehen hatte, im Gürtel trug, sie war lang, bestand aus sechs Riemen mit je einem Knoten am Ende; dann eine dritte Peitsche aus sehr dünnen Schnüren, die an den Enden mehrere Knoten trugen und ganz steif waren, als hätte man sie in Wasser eingeweicht, was auch der Fall war, wie sie feststellen konnte, denn man berührte damit ihren Schoß und spreizte ihre Schenkel, damit sie besser fühlen könne, wie feucht und kalt die Schnüre sich auf der zarten Haut der Innenseite anfühlten. Blieben noch auf der Konsole stählerne Ketten und Schlüssel. An einer Wand der Bibliothek lief in halber Höhe eine Galerie, die von zwei Säulen getragen wurde. In eine Säule war ein Haken eingelassen, in einer Höhe, die ein Mann auf Zehenspitzen mit gestrecktem Arm erreichen konnte. Man sagte O, die ihr Geliebter in die Arme genommen hatte, eine Hand unter ihren Schultern und die andere, die sie verbrannte, zwischen ihren Schenkeln, um sie zum Nachgeben zu zwingen, man sagte ihr, daß man ihre gefesselten Hände nur löse, um sie sogleich, mittels der Armreifen und einer der Stahlketten, an diesen Pfeiler zu binden. Daß aber nur die Hände über ihrem Kopf festgehalten würden, sie sich aber sonst frei bewegen könne und die Schläge kommen sähe. Daß man im allgemeinen nur Hüften und Schenkel peitsche, also von der Taille bis zu den Knien, genauso, wie sie im Wagen, der sie hierher gebracht hatte, vorbereitet worden sei, als sie sich nackt hatte auf die Bank setzen müssen. Daß jedoch einer der vier anwesenden Männer vielleicht Lust haben werde, ihre Schenkel mit dem Reitstock zu zeichnen, was schöne, lange und tiefe Striemen gebe, die man lange sehen werde. Es werde ihr nicht alles zugleich angetan werden, sie werde schreien können, soviel sie wolle, sich winden und weinen. Man werde sie Atem schöpfen lassen, aber weitermachen, sobald sie wieder Kräfte gesammelt habe, wobei die Wirkung nicht nach ihren Schreien oder Tränen beurteilt werde, sondern nach den mehr oder minder lebhaften und anhaltenden Spuren, die die Peitschen auf ihrer Haut zurücklassen würden. Man wies sie daraufhin, daß diese Methode, die Wirkung der Schläge zu beurteilen, nicht nur gerecht sei und alle Versuche der Opfer, durch übertriebenes Stöhnen Mitleid zu wecken, nichtig mache, sondern darüber hinaus auch erlaube, die Peitsche außerhalb des Schlosses anzuwenden, im Park, was häufig geschehe, oder in irgendeiner Wohnung oder einem beliebigen Hotelzimmer, vorausgesetzt natürlich, daß man einen Knebel verwende (den man ihr sogleich zeigte), der nur den Tränen freien Lauf läßt, aber alle Schreie erstickt und kaum ein Stöhnen erlaubt. An diesem Abend jedoch sollte der Knebel nicht verwendet werden, im Gegenteil. Sie wollten O brüllen hören, und so schnell wie möglich. Der Stolz, den sie dareinsetzte, sich zu beherrschen und zu schweigen, hielt nicht lange an: sie hörten sie sogar betteln, man möge sie losbinden, einen Augenblick einhalten, nur einen einzigen. Sie wand sich so konvulsivisch, um dem Biß der Lederriemen zu entgehen, daß sie sich vor dem Pfosten beinah um die eigene Achse drehte, denn die Kette, die sie fesselte, war lang und daher nicht ganz straff. Die Folge war, daß ihr Bauch und die Vorderseite der Schenkel und die Seiten beinah ebenso ihr Teil abbekamen, wie die Lenden. Man entschloß sich nun, einen Augenblick aufzuhören und erst wieder anzufangen, nachdem ein Strick um ihre Taille und zugleich um den Pfosten geschlungen worden war. Da man den Strick fest anzog, damit der Körper in der Mitte gut am Pfosten anlag, war der Oberkörper notwendig ein wenig zur Seite gebeugt, so daß auf der anderen Seite das Hinterteil stärker hervortrat. Von nun an verirrten die Hiebe sich nicht mehr, es sei denn mit Absicht. Nach der Art und Weise zu urteilen, wie ihr Geliebter sie ausgeliefert hatte, hätte O sich denken können, daß ein Appell an sein Mitleid die beste Methode sein würde, seine Grausamkeit zu verdoppeln, daß er größtes Vergnügen daran finden würde, ihr diese unzweifelhaften Beweise seiner Macht zu entreißen oder entreißen zu lassen. Tatsächlich war er derjenige, der als erster bemerkte, daß die Lederpeitsche, unter der sie zuerst gestöhnt hatte, sie weit weniger zeichnete, als die eingeweichte Schnur der neunschwänzigen Katze und der Reitstock, und daher erlaube, die Qual zu verlängern und mehrmals von neuem anzufangen, fast unverzüglich, wenn man Lust dazu hatte. Er bestand darauf, daß man nur noch diese Peitsche verwendete. Verführt von diesem hingereckten Hinterteil, das sich unter den Schlägen wand und sich in dem Bemühen, ihnen auszuweichen, nur um so mehr aussetzte, verlangte nun derjenige der Vier, der an den Frauen nur das liebte, was sie mit den Männern gemeinsam haben, daß man ihm zuliebe eine Pause einlegen solle, und er teilte die beiden Hälften, die unter seinen Händen brannten, und drang nicht ohne Mühe ein, wobei er die Überlegung anstellte, daß man diese Pforte leichter zugänglich machen müsse. Man kam überein, daß das zu machen sei und daß man entsprechende Maßnahmen ergreifen werde.