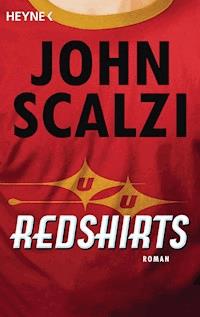Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packendes, temporeiches Abenteuer in einer gefährlichen Parallelwelt – perfekt für Fans von Adrian Tchaikovsky und Michael Crichtons "Jurassic Park"! Sie sind groß, gefährlich und vom Aussterben bedroht … Jamies Traum war es, bei einem Tech Start-up in New York City groß herauszukommen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: auf eine demütigende Entlassung folgt ein schlecht bezahlter Job als Lieferfahrer inmitten einer Pandemie. Es sieht düster für ihn aus, doch schließlich trifft er beim Ausliefern einer Bestellung einen alten Bekannten wieder. Tom hat dringend eine Stelle in seinem Team zu vergeben: Die Bezahlung ist gut, und Jamie hat Schulden – die Entscheidung ist klar. Doch erneut sieht er sich in seinen Erwartungen getäuscht … Und dieses Mal steht sein Leben auf dem Spiel. Toms "Tierschutzorganisation" ist nicht das, was sie zu sein scheint: Die Tiere, die sie retten will, befinden sich nicht einmal auf der Erde! Zumindest nicht auf unserer. In einer anderen Dimension ist sie tropisch warm und nicht von Menschen bevölkert, sondern von riesenhaften dinosaurierähnlichen Bestien. Die Kaijū mögen die größten und gefährlichsten Tiere ihrer Welt sein – doch sie brauchen Hilfe, um zu überleben. Toms "Gesellschaft zur Erhaltung der Kaijū-Monster" wollen ihnen beispringen, andere jedoch wollen Profit aus ihnen schlagen. Wenn sie nicht aufgehalten werden, könnte die Trennung zwischen den Welten fallen – mit verheerenden Folgen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
ANMERKUNGEN DES AUTORS UND DANKSAGUNGEN
»Jamie Gray!« Rob Sanders schob den Kopf aus der Bürotür und winkte mir grinsend zu. »Komm rein. Bringen wir’s hinter uns.«
Ich stand von meinem Arbeitsplatz auf, nahm das Tablet mit meinen Notizen und grinste ebenfalls. Dann sah ich Qanisha Williams an, die mich mit einem Fistbump ermutigte: »Hau ihn von den Socken.«
»Werd ich«, sagte ich und betrat das Büro des CEOs. Mein Mitarbeitergespräch stand an, und in aller Bescheidenheit: Ich würde das Ding rocken.
Rob Sanders bat mich herein und zeigte auf seine »Gesprächshöhle«. So nannte er die vier riesigen, in Primärfarben gehaltenen Sitzsäcke, die rund um einen niedrigen Tisch standen. Der Tisch hatte eine Glasplatte, unter der eine magnetische Perle sich durch den gleißend weißen Sand bewegte, sodass geometrische Muster entstanden. Momentan erschuf die Perle ein Muster aus Wirbeln. Ich entschied mich für den roten Sitzsack und ließ mich nur ein bisschen unelegant hineinfallen. Mein Tablet rutschte mir kurz aus der Hand, doch ich fing es auf, bevor es vom Sitzsack auf den Boden gleiten konnte. Ich sah zu Sanders auf, der sich noch nicht gesetzt hatte, und lächelte. Er erwiderte mein Lächeln, zog einen normalen Bürostuhl heran und setzte sich rittlings darauf. Er verschränkte die Arme auf der Rückenlehne und sah zu mir herunter.
Oh, verstehe. Ein kleines Machtspielchen, dachte ich. Sorgen machte ich mir deswegen nicht. Ich wusste, wie das Ego eines CEOs funktionierte und wie man damit umging. Dies war mein halbjährliches Mitarbeitergespräch, und wie schon gesagt, würde ich ihn von den Socken hauen.
»Sitzt du bequem?«, fragte mich Rob.
»Superbequem«, sagte ich. Dabei verlagerte ich mein Gewicht so diskret wie möglich, um weniger Schlagseite nach Steuerbord zu haben.
»Gut. Wie lange bist du schon hier bei Füdmüd, Jamie?«
»Sechs Monate.«
»Und wie gefällt es dir hier bei uns?«
»Ich bin froh, dass du das fragst, Rob. Ich fühle mich sehr wohl. So wohl, dass ich«, ich hob mein Tablet, »einen Teil dieses Termins damit verbringen möchte, dir Vorschläge zu machen. Nicht nur um die Füdmüd-App zu verbessern, sondern auch unsere Beziehung zu Restaurants, Lieferpersonal und Usern. Wir haben jetzt 2020 und die Lieferdienst-Apps sind ausgereifter. Wir sollten alles daransetzen, uns von anderen abzuheben, damit wir ernsthaft mit Grubhub, Uber Eats und all den anderen Anbietern in New York City und darüber hinaus konkurrieren können.«
»Du glaubst also, wir könnten besser sein?«
»Allerdings.« Ich versuchte, mich im Sitzsack vorzubeugen, was jedoch nur dazu führte, dass mein Hintern noch tiefer einsank. Ich beließ es dabei und zeigte einfach nur auf mein Tablet. »Hast du von dieser COVID-19-Sache gehört?«
»Sicher«, entgegnete Rob.
»Ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, dass wir auf einen Lockdown zusteuern. Hier in der Stadt werden die Leute also noch mehr als sonst auf Lieferdienste zurückgreifen. Restaurants werden jedoch Probleme bekommen, da niemand mehr bei ihnen essen kann. Wenn Füdmüd ihnen eine Gebührensenkung anbieten würde, damit sie ihre Speisen exklusiv über uns vertreiben, würden wir uns nicht nur bei den Restaurantbesitzern beliebt machen, sondern auch an den anderen Apps vorbeiziehen.«
»Du willst, dass wir die Gebühren senken?«
»Ja.«
»Während einer möglichen Pandemie unsere Gewinnmarge schmälern?«
»Nein! Das ist es ja. Wenn wir schnell vorgehen und uns die beliebtesten Restaurants schnappen, werden unsere Einnahmen steigen, weil die Bestellungen zunehmen. Und nicht nur unsere Einnahmen. Unsere Lieferanten …«
»Auslieferatoren.«
Ich rutschte im Sitzsack hin und her. »Was?«
»Auslieferatoren. So nennen wir sie ab jetzt. Clever, oder? Den Begriff hab ich mir ausgedacht.«
»Ich dachte, das wäre Neal Stephenson gewesen.«
»Wer?«
»Ein Schriftsteller. Er hat Snow Crash geschrieben.«
»Was soll das sein? Eine Fortsetzung von Die Eiskönigin?«
»Es ist ein Roman.«
Rob winkte ab. »Wenn er nicht von Disney ist, wird uns niemand deswegen verklagen. Wo waren wir gerade?«
»Unsere, äh, Auslieferatoren könnten auch davon profitieren. Wir könnten ihnen eine höhere Liefergebühr zahlen – natürlich nicht zu viel.« Ich sah, wie Rob an dieser Stelle die Stirn runzelte. »Nur so viel, dass wir uns von den anderen Apps abheben. In so einer Gig-Economy zählt jedes bisschen. Wir könnten dadurch Loyalität aufbauen, was wiederum den Service verbessern würde, womit wir uns weiter von anderen abheben könnten.«
»Du willst also auf Qualität setzen?«
»Ja!« Ich riss bestätigend den Arm hoch, wodurch ich noch tiefer im Sitzsack versank. »Wir sind bereits besser als die anderen Apps. Wir müssen den Vorsprung nur weiter vergrößern.«
»Es wird uns etwas mehr kosten, aber das holen wir wieder rein. Willst du das damit sagen?«
»Ich glaube schon. Irre, ich weiß. Aber darum geht es. Wir werden in völlig neue Sphären im Lieferapp-Geschäft vorstoßen. Und wenn die anderen merken, was wir vorhaben, gehört uns New York City bereits. Und das ist erst die Vorspeise.«
»Du hast mutige Ideen, Jamie«, sagte Rob. »Du scheust nicht vor Risiken und neuen Ansätzen zurück.«
Ich strahlte und legte mein Tablet hin. »Danke, Rob. Ich denke, du hast recht. Ich bin ein Risiko eingegangen, als ich mein Doktorandenprogramm aufgegeben habe, um bei Füdmüd zu arbeiten. Meine Freunde an der Universität von Chicago hielten mich für verrückt, als ich meine Sachen gepackt habe und nach New York gezogen bin, um für ein Start-up zu arbeiten. Aber es fühlte sich richtig an. Ich glaube, dass ich die Art und Weise, wie Menschen Essen bestellen, verändern kann.«
»Ich bin froh, dass du das so siehst. Weil ich mit dir nämlich über deine Zukunft bei Füdmüd sprechen möchte. Wo wir dich einsetzen sollten, damit du diese Leidenschaft optimal einbringen kannst.«
»Ich bin froh, dass du das so siehst, Rob.« Ich versuchte, mich im Sitzsack vorzubeugen, scheiterte und riskierte es, mich hochzustemmen. Dadurch verschob sich der Sitzsack, sodass ich nicht mehr ganz so eingeklemmt dasaß. Dabei rutschte jedoch das Tablet in die Lücke, die mein Körper hinterlassen hatte. Ich saß jetzt auf meinem Tablet. Ich beschloss, das zu ignorieren. »Sag mir, wie ich der Firma am besten dienen kann.«
»Mit Auslieferatur.«
Ich blinzelte. »Was?«
»Auslieferatur«, wiederholte Rob. »Das ist das, was unsere Auslieferatoren machen. Sie auslieferatieren. Also Auslieferatur.«
»Wie unterscheidet sich das von Lieferungen?«
»Lieferungen lässt sich als Begriff nicht schützen.«
Ich wechselte das Thema. »Du siehst mich also als Strategieleiter von Füdmüds Ausliefe…ratur?«
Rob schüttelte den Kopf. »Ich glaube, das würde dich zu sehr einschränken.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, Jamie, dass Füdmüd jemanden wie dich an der Front braucht. Im Schützengraben. Am Puls des Geschehens.« Er zeigte aus dem Fenster. »Du wirst uns die ungeschminkte, nackte Wahrheit lieferatieren. Wie nur du es kannst.«
Ich brauchte einen Moment, um das zu verdauen. »Du willst, dass ich als Füdmüd-Lieferant arbeite?«
»Auslieferator.«
»Aber das ist keine Position innerhalb des Unternehmens.«
»Was nicht bedeutet, dass sie nicht wichtig für das Unternehmen ist, Jamie.«
Ich versuchte noch einmal, mich umzusetzen, und scheiterte erneut. »Was … was ist hier los, Rob?«
»Was meinst du?«
»Ich dachte, dass wäre mein halbjährliches Mitarbeitergespräch.«
Rob nickte. »In gewisser Weise ist es das.«
»Aber du sagst mir, ich soll als Liefer…«
»Auslieferator.«
»Mir ist scheißegal, wie du es nennst, weil es diese Stelle in der Firma nicht gibt. Du schmeißt mich raus.«
»Ich schmeiße dich nicht raus«, versicherte mir Rob.
»Was machst du dann?«
»Ich biete dir eine aufregende Möglichkeit: Du kannst die Füdmüd-Arbeitswelt auf eine ganz neue Weise kennenlernen.«
»Eine, bei der ich weder Urlaub noch eine Krankenversicherung oder ein Gehalt bekomme.«
Rob schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Du weißt, dass das nicht stimmt. Füdmüd hat eine Vereinbarung mit Duane Reade getroffen, damit unsere Auslieferatoren bis zu zehn Prozent Rabatt auf ausgewählte Gesundheitsprodukte bekommen.«
»Schon klar. Ich bin raus«, erklärte ich. Ich hievte mich aus dem Sitzsack, fiel jedoch zurück auf mein Tablet. Das Display knackte. »Na toll.«
»Keine Sorge«, versicherte Rob und zeigte auf das Tablet, als es mir endlich gelang, mich aus dem Sitzsack zu befreien. »Das ist Firmeneigentum. Du kannst es einfach liegen lassen, wenn du gehst.«
Ich warf Rob mein Tablet zu. Er fing es auf. »Du bist ein echtes Arschloch«, sagte ich. »Nur damit du’s weißt.«
»Wir werden dich in unserer Füdmüd-Familie vermissen, Jamie«, sagte Rob. »Aber vergiss nicht, dass du immer gern als Auslieferator zu uns zurückkommen kannst. Versprochen.«
»Nein, danke.«
»Deine Entscheidung.« Er zeigte zur Tür. »Qanisha hat deine Kündigung bereits vorbereitet. Wenn du in fünfzehn Minuten noch hier bist, wird der Sicherheitsdienst dir gern den Weg zur Tür zeigen.« Er stand auf, ging zu seinem Schreibtisch, warf das Tablet in den Papierkorb und nahm sein Telefon, um jemanden anzurufen.
»Du hast es gewusst«, sagte ich anklagend zu Qanisha, als ich auf sie zuging. »Du hast es gewusst und mir trotzdem Glück gewünscht.«
»Tut mir leid«, antwortete sie.
»Heb die Faust.«
Sie war verwirrt, tat es jedoch. Ich schlug leicht dagegen. »So«, sagte ich. »Damit habe ich den vorherigen solidarischen Fistbump zurückgenommen.«
»Verstehe.« Sie reichte mir meine Kündigung. »Ich soll dir auch sagen, dass ein Auslieferator-Konto in deinem Namen eröffnet worden ist.« Sie sprach Auslieferator so aus, als würde es ihr körperliche Schmerzen bereiten. »Du weißt schon, zur Sicherheit.«
»Ich würde eher tot umfallen.«
»Überstürz nichts«, warnte Qanisha. »Der Lockdown wird kommen. Und unser Duane-Reade-Rabatt wurde auf fünfzehn Prozent erhöht.«
»Das war also mein Tag«, sagte ich zu meinem Mitbewohner Brent. Wir saßen in unserer erbärmlich kleinen Wohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl in der Henry Street. Ich teilte sie mit Brent, Brents Freund Laertes und einer praktisch Fremden namens Reba, die wir fast nie sahen. Wenn sie nicht täglich lange Haare an der Duschwand hinterlassen hätte, wäre keiner von uns sicher gewesen, ob sie es sie wirklich gab.
»Das ist bitter«, kommentierte Brent.
»Jag den Laden in die Luft«, schaltete sich Laertes aus dem Zimmer ein, das er sich mit Brent teilte. Er zockte gerade ein Videospiel.
»Niemand jagt irgendwas in die Luft«, rief Brent Laertes zu.
»Noch nicht«, erwiderte Laertes.
»Du kannst nicht jedes Problem mit Sprengstoff lösen«, mahnte Brent.
»Du kannst das nicht«, rief Laertes zurück.
»Jag den Laden nicht in die Luft«, sagte Brent so leise zu mir, dass Laertes es nicht hören konnte.
»Hatte ich nicht vor«, versprach ich. »Obwohl es verlockend ist.«
»Also suchst du jetzt nach was Neuem?«
»Ja, aber es sieht nicht gut aus«, stöhnte ich. »In ganz New York herrscht Notstand. Alle machen zu. Niemand stellt Leute ein und die wenigen Jobs, die’s gibt, werden für das hier zu schlecht bezahlt.« Ich zeigte auf unsere heruntergekommene Wohnung. »Die gute Nachricht – wenn man es so nennen will – ist, dass die Abfindung von Füdmüd meinen Anteil der Miete für ein paar Monate abdeckt. Ich werde vielleicht verhungern, aber wenigstens bis August oder so nicht obdachlos werden.«
Brent blickte unbehaglich drein. »Was ist?«, fragte ich.
Er nahm einen unbeschrifteten Umschlag vom Poststapel in der Mitte des Küchentischs, an dem wir saßen. »Dann hast du das wohl noch nicht gesehen.«
Ich öffnete den Umschlag. Darin befanden sich zehn Hundertdollarscheine und eine Notiz, die nur aus folgenden Worten bestand: Ich hau ab aus diesem Seuchenloch. R.
Ich warf einen Blick auf das Zimmer, das Reba bewohnt hatte. »Sie ist weg?«
»Ja, soweit sie überhaupt je hier war.«
»Sie ist ein Geist mit einer Kreditkarte«, rief Laertes aus dem anderen Zimmer.
»Das ist ja ganz toll«, sagte ich. »Wenigstens hat sie die Miete für den letzten Monat dagelassen.« Ich ließ den Umschlag, das Geld und den Zettel auf den Tisch fallen und vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich hätte euch wohl alle in den Mietvertrag aufnehmen sollen. Ihr beide haut aber nicht ab, okay?«
»Was das angeht …«, sagte Brent.
Ich sah ihn durch meine Finger an. »Nein.«
»Hör zu, Ja…«
»Nein.«
Brent hob die Hände. »Also, es ist so …«
»Nicht das noch«, heulte ich und schlug mit dem Kopf auf den Tisch, was einen schönen lauten Knall verursachte.
»Mach nicht so ein Drama«, sagte Laertes aus dem Schlafzimmer.
»Sagt derjenige, der alles in die Luft sprengen will«, brüllte ich ihn an.
»Das ist nicht dramatisch, sondern revolutionär«, antwortete er.
Ich sah Brent an. »Bitte sag mir, dass ihr mich nicht im Stich lasst«, flehte ich.
»Wir arbeiten im Theater«, erwiderte Brent. »Und wie du schon sagtest, machen alle zu. Ich habe keine Rücklagen und Laertes auch nicht, wie du weißt.«
»Ich bin komplett blank«, bestätigte Laertes.
Brent verzog das Gesicht, als er das hörte, und fuhr fort: »Wenn es schlimmer wird – und es wird schlimmer werden –, können wir’s uns nicht leisten hierzubleiben.«
»Wohin wollt ihr denn?«, fragte ich. Soweit ich wusste, hatte Brent keine Familie.
»Wir können bei Laertes’ Eltern in Boulder bleiben.«
»Mein Kinderzimmer ist noch wie früher«, sagte Laertes. »Bis ich es sprenge.«
»Es wird nichts gesprengt«, warnte Brent, aber er klang nicht überzeugt. Laertes’ Eltern wirkten wie ein sehr nettes, konservatives Ehepaar, sprachen Laertes jedoch ständig mit seinem Geburtsnamen an. Auf Dauer macht einen so etwas fertig.
»Ihr bleibt«, sagte ich.
»Fürs Erste«, stimmte Brent zu. »Aber wenn uns das Geld aus…«
»Ihr bleibt«, sagte ich bestimmter.
»Jamie, ich kann dich nicht um so was bitten«, erwiderte Brent.
»Ich schon«, meldete sich Laertes aus dem Schlafzimmer. »Ich hasse dieses verfickte Boulder.«
»Dann ist es entschieden.« Ich stand auf.
»Jamie …«
»Wir kriegen das hin.« Ich lächelte Brent an und ging in mein Zimmer. Es war so groß wie eine Briefmarke, aber wenigstens zugig und die Dielen knarrten.
Ich setzte mich auf mein klappriges Doppelbett, seufzte, legte mich hin und starrte eine gute Stunde lang die Decke an. Dann seufzte ich erneut, setzte mich auf und zog mein Handy aus der Tasche. Ich schaltete es ein.
Die Füdmüd-App erwartete mich auf dem Display.
Ich seufzte ein drittes Mal und öffnete sie.
Wie versprochen war mein Auslieferator-Konto eingeloggt und aktiviert.
»Hallo und vielen Dank für Ihre Bestellung bei Füdmüd«, sagte ich zu dem Typen, der die Tür der absurd schicken Eigentumswohnung in einem brandneuen Gebäude öffnete, das ich nur hatte betreten dürfen, weil der Portier wusste, dass ein Lieferant erwartet wurde und ich wahrscheinlich kein Räuber war. »Ich bin Jamie, Ihr Auslieferator. Ich brenne dafür, Ihnen Ihr …« Ich warf einen Blick auf mein Handy. »Hühnchen mit sieben Gewürzen und die veganen Frühlingsrollen bringen zu dürfen.« Ich hielt dem Typen die Tüte hin.
»Zwingen sie dich, das zu sagen?«, fragte er, als er die Tüte entgegennahm.
»Tun sie«, bestätigte ich.
»Du brennst nicht wirklich für den Lieferdienst, oder?«
»Kein bisschen.«
»Verstehe. Das bleibt unser Geheimnis.«
»Danke.« Ich wollte mich umdrehen.
»Ich hoffe, du findest deine Samuraischwerter.«
Ich hielt inne. »Was?«
»Entschuldige, Insiderwitz«, sagte der Typ. »Du weißt, dass ›Auslieferator‹ aus Snow Crash ist, richtig? Dem Roman von Neal Stephenson? Der Protagonist ist nämlich ein Lieferant, der Samuraischwerter besitzt. Mir fällt sein Name nicht ein.«
Ich drehte mich ganz zu ihm um. »Danke«, sagte ich. »Ich liefere seit sechs Monaten Essen aus und du bist der Erste, der die Anspielung versteht. Der Erste.«
»Ist schon ziemlich offensichtlich.«
»Sollte man meinen, oder? Ist ja nur ein moderner Klassiker des Genres. Aber niemand kapiert das. Erstens interessiert es keinen«, ich machte eine ausladende Geste, die nicht nur die Kulturwüste der Lower East Side, sondern möglicherweise ganz New York City einschloss, »und zweitens denken diejenigen, die den Begriff kommentieren, dass er eine Anspielung auf Terminator ist.«
»Stimmt ja auch.«
»Ja, schon«, lenkte ich ein. »Aber inzwischen steht er ja wohl für sich.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt weiß, wofür du brennst«, sagte der Typ.
Mir wurde auf einmal meine übertriebene Körpersprache bewusst, die vielleicht daher rührte, dass der Typ und ich Masken trugen, da New York City eine verseuchte Stadt in einem verseuchten Land war, während irgendwo anders immer noch mit einem möglichen Impfstoff experimentiert wurde. »Tut mir leid«, sagte ich. »Eigentlich wollte ich meine Doktorarbeit über utopische und dystopische Literatur schreiben. Wie du dir vorstellen kannst, gehört Snow Crash in die zweite Kategorie.« Ich nickte und drehte mich wieder um.
»Moment«, hielt mich der Typ zurück. »Jamie … Gray?«
Oh mein Gott, brüllte mein Gehirn. Geh einfach. Geh und leugne, dass jemand deine Auslieferator-Schande enthüllt hat. Doch noch während mein Gehirn das brüllte, drehte sich mein Körper um, weil wir wie Welpen darauf konditioniert sind, das zu tun, sobald wir unseren Namen hören. »Der bin ich«, sagte ich. Die Worte entglitten mir und das letzte klang so, als würde meine Zunge verzweifelt versuchen, sich an den ganzen Satz zu erinnern.
Der Typ lächelte, stellte seine Tüte ab, trat aus meinem Atembereich und lüftete kurz seine Maske, damit ich sein Gesicht sehen konnte. »Ich bin Tom Stevens.«
Mein Gehirn wühlte in der primitiven LinkedIn-Version meiner Erinnerung und versuchte herauszufinden, woher ich den Typen kannte. Er half mir nicht. Offenbar hielt er sich für so denkwürdig, dass er sofort in meinem Kopf auftauchen müsste. Das tat er nicht, aber dennoch …
»Tom Stevens, der mit Iris Banks zusammen war, der besten Freundin meines Mitbewohners Diego, als ich noch in dem Apartment auf der South Kimbark, knapp über der 53. Straße gewohnt habe, und der hin und wieder zu unseren Partys kam«, erinnerte ich mich.
»Genau der«, bestätigte Tom.
»Du hast Wirtschaft studiert.«
»Richtig. Stört dich hoffentlich nicht. War nicht sehr akademisch.«
»Aber«, ich wies auf die sehr schicke Eigentumswohnung, »ist doch gut für dich gelaufen.«
Er sah sich in der Wohnung um, als würde er sie erst jetzt bemerken – Arsch. »Irgendwie schon. Ich weiß noch, dass du auf einer dieser Partys über deine Doktorarbeit gesprochen hast.«
»Tut mir leid«, sagte ich. »Das habe ich damals sehr oft auf Partys getan.«
»Schon gut«, versicherte mir Tom. »Du hast mich dazu gebracht, Snow Crash zu lesen. Du hast mein Leben verändert.«
Darüber musste ich lächeln.
»Wieso hast du das Doktorandenprogramm abgebrochen?«, fragte mich Tom, als ich ihm das nächste Mal Essen brachte, ein äthiopisches Fleischgericht mit Injera.
»Ich hatte eine Quarterlife-Crisis«, erklärte ich. »Oder eine Achtundzwanzig-Jahre-Krise, was dasselbe, nur etwas später ist.«
»Verstehe.«
»Ich sah all diese Leute um mich, Leute wie dich – nichts für ungut …«
Tom grinste unter seiner Maske. Ich sah es an den Falten um seine Augen. »Kein Problem.«
»… die ein Leben hatten und eine Karriere, die in den Urlaub fuhren und sexy Leute kennenlernten, und ich saß mit den gleichen sechzehn Leuten im Hyde Park, wohnte in einem beschissenen Apartment und stritt mich mit Studienanfängern darüber, dass sie ihre Hausarbeiten pünktlich einreichen müssen.«
»Ich dachte, du würdest gern Bücher lesen.«
»Das stimmt, aber wenn du Bücher nur liest, weil du musst, hört der Spaß schnell auf.«
»Aber mit einem Doktortitel hättest du Dozent werden können.«
Ich schnaubte. »Du sieht den akademischen Bereich deutlich positiver als ich. Ich starrte in die Mündung einer Hilfsprofessur, und das für den Rest meines Lebens.«
»Ist das was Schlechtes?«
Ich zeigte auf sein Essen. »Ich verdiene mehr, wenn ich dir Injera liefere.«
»Also hast du das sausen lassen, um Auslieferator zu werden?«, fragte Tom, als ich ihm sein koreanisches Hähnchen brachte.
»Nein«, erwiderte ich. »Ich hatte einen richtigen Job bei Füdmüd. Einen mit Aktienoptionen und Sozialversicherung. Dann wurde ich, als die Pandemie gerade losging, vom Arschkrampen-CEO gefeuert.«
»Das ist scheiße.«
»Weißt du, was richtig scheiße ist?«, sagte ich. »Nachdem er mich auf die Straße gesetzt hatte, setzte er meine Ideen mit Exklusivverträgen für Restaurants und einer besseren Bezahlung der Auslieferatoren um. Also, ein paar Auslieferatoren werden besser bezahlt. Dafür brauchst du über vier Sterne. Also gib mir bitte fünf Sterne. Ich bin kurz davor. Jeder Stern zählt, mein lieber Belieferator.«
»Belieferator?«
Ich verdrehte die Augen. »Frag nicht.«
Tom lächelte erneut, wie die Falten um seine Augen verrieten. »Lass mich raten. Der ›Auslieferator‹ stammt nicht von dir.«
»Oh Gott, nein.«
»Also, da du dort gearbeitet hast, kannst du mir vielleicht was erklären«, sagte Tom, als ich ihm seine Chicagoer Pfannenpizza brachte. Ich war überrascht, dass die innerhalb von New York City überhaupt erlaubt war, geschweige denn so nahe an Little Italy. »Was sollen die Umlaute?«
»Du meinst, wieso heißt es Füdmüd und nicht FoodMood, was logischer wäre?«
»Ja, genau.«
»Weil FoodMood schon besetzt war. Eine Lieferapp in Bangladesch heißt so und die wollten den Namen nicht verkaufen«, erklärte ich. »Wenn du also mal in der Nähe von Mymensingh bist, dann benutz die App, deren Name Sinn ergibt.«
»Ich war schon mal in Bangladesch«, sagte Tom. »Gewissermaßen.«
»Gewissermaßen?«
»Im Rahmen meines Jobs. Ist kompliziert.«
»Bist du ein Spion?«
»Nein.«
»Ein Söldner? Das würde die schicke Eigentumswohnung in diesem brandneuen Gebäude erklären.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass Söldner in Schuppen irgendwo in den Wäldern von North Carolina leben.«
»Das würde ich auch behaupten, wenn ich Söldner wäre.«
»Ich arbeite für eine NRO, eine Nichtregierungsorganisation.«
»Definitiv ein Söldner.«
»Ich bin kein Söldner.«
»Ich werde mich an diese Worte erinnern, wenn ich dich während eines Putschs in Bangladesch auf CNN sehe.«
»Leider werde ich mir für eine Weile nichts mehr von dir liefern lassen können«, sagte Tom, als ich ihm seine Shawarma-Platte brachte. »Ich muss wegen meines Jobs weg und werde erst in ein paar Monaten zurückkommen.«
»Du wirst leider nie wieder eine Lieferung von mir bekommen«, entgegnete ich.
»Hast du gekündigt?«
Ich lachte. »Nein, das nicht.«
»Was meinst du dann?«
»Ach, du weißt es noch nicht«, sagte ich. »Füdmüd ist für vier Milliarden Dollar oder so von Uber aufgekauft werden und wird in Uber Eats integriert. Offenbar haben wir so gute Restaurants und Auslieferatoren, dass Uber beschlossen hat, es wäre einfacher, uns mit all diesen Exklusivverträgen aufzukaufen.«
»Also ist der CEO, der deine Ideen gestohlen hat …«
»Rob Affenarsch Sanders.«
»… jetzt Milliardär.«
»Es ist zu achtzig Prozent Bargeld geflossen, also ja, kommt hin.«
»Und du willst nicht für Uber arbeiten?«
»Warte. Jetzt kommt das Beste«, sagte ich. »Uber hat eigene Lieferanten und wollte nicht alle Auslieferatoren übernehmen. Darüber wären ihre Leute ziemlich sauer gewesen. Also nehmen sie nur die mit vier Sternen und mehr.« Ich öffnete meine Füdmüd-App und zeigte ihm meine Bewertungen. »Drei Komma neun sieben fünf Sterne, Baby.«
»Ich hab dir immer fünf Sterne gegeben«, bemerkte Tom.
»Das weiß ich zu schätzen, Tom, auch wenn es mir jetzt nichts mehr bringt.«
»Was wirst du jetzt machen?«
»Auf lange Sicht? Scheiße, keine Ahnung. Ich komme so schon kaum über die Runden. Ich war der Einzige in meiner WG, der einen halbwegs sicheren Job hatte, weshalb ich die Miete, die Rechnungen und die meisten Lebensmittel bezahlt habe. Wir sind mitten in einer Pandemie, also gibt es keine offenen Stellen. Ich habe nichts zurückgelegt und keine anderen Möglichkeiten. Also, ja, keine Ahnung, so auf lange Sicht.« Ich hob einen Finger. »Aber auf kurze? Da werde ich eine Flasche billigen Wodka kaufen und sie in der Dusche austrinken. Dann können meine Mitbewohner die Sauerei, sollte es eine geben, leichter wegmachen.«
»Das tut mir leid, Jamie.«
»Ist nicht deine Schuld«, sagte ich. »Tut mir leid, dass ich dich damit belaste.«
»Schon gut. Wir sind schließlich Freunde.«
Darüber musste ich erneut lachen. »Ich würde es eher als rentables Dienstleistungsverhältnis mit einer dürftigen gemeinsamen Vergangenheit beschreiben. Aber danke, Tom. Ich hab dir gern Essen gebracht. Genieß dein Shawarma.« Ich wollte gehen.
»Warte«, hielt Tom mich zurück. Er stellte sein Shawarma ab und verschwand in den Tiefen seiner sehr schicken Wohnung. Eine Minute später kam er zurück und streckte die Hand aus. »Für dich.«
Ich starrte auf seine Hand. Darin lag eine Visitenkarte. Mein Gesicht zuckte.
Tom bemerkte es trotz der Maske. »Was ist los?«
»Ehrlich?«
»Ja.«
»Ich dachte, du wolltest mir Trinkgeld geben.«
»Das ist besser. Das ist ein Job.«
Ich blinzelte, als ich das hörte. »Was?«
Tom seufzte. »Die NRO, für die ich arbeite. Das ist eine Tierrechtsorganisation. Für große Tiere. Wir verbringen viel Zeit im Außeneinsatz. Ich gehöre zu einem Team. Wir sollen nächste Woche in den Feldeinsatz. Einer meiner Teamkollegen hat COVID und hängt momentan in einem Krankenhaus in Houston am Beatmungsgerät.« Tom sah, dass mein Gesicht erneut zuckte. »Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr und wird wieder gesund, wurde mir gesagt. Aber nicht, bis mein Team vor Ort sein muss. Wir brauchen Ersatz für ihn. Das könntest du sein. Das ist die Karte unserer Rekrutierungsleiterin. Geh zu ihr. Ich sage ihr, dass du kommst.«
Ich starrte die Karte noch etwas länger an.
»Was ist jetzt noch?«, fragte Tom.
»Irgendwie habe ich dich schon für einen Söldner gehalten.«
Darüber musste er lachen. »Ich bin kein Söldner. Was ich mache, ist viel, viel cooler. Und interessanter.«
»Ich, äh … bin nicht dafür ausgebildet. Für was auch immer du da tust. Diese Arbeit mit großen Tieren.«
»Du kriegst das schon hin. Und wenn ich ehrlich sein darf, brauche ich einfach nur jemanden, der Sachen tragen kann.« Er zeigte auf sein Shawarma. »Und ich weiß, dass du das kannst.«
»Und die Bezahlung?«, fragte ich und bereute es sofort, weil es mir vorkam, als würde ich einem geschenkten Gaul ins Maul treten.
Tom zeigte auf die sehr schicke Wohnung, als wollte er sagen: Siehst du das? Dann hielt er mir wieder die Karte hin.
Dieses Mal nahm ich sie. »Ich sage Gracia Bescheid, dass du sie aufsuchen wirst.« Tom sah auf seine Uhr. »Es ist jetzt dreizehn Uhr. Du kannst vielleicht heute noch zu ihr. Oder morgen früh. Aber dann wird es schon etwas eng.«
»Du brauchst so schnell eine Antwort?«
Tom nickte. »Das ist ja das Problem. Wenn Gracia einverstanden ist, gehört der Job dir, aber du musst leider jetzt entscheiden, ob du ihn willst. Ich weiß, dass das nicht cool ist. Aber ich stehe unter Druck und wenn du ihn nicht annimmst, muss ich sehr schnell jemand anders finden.«
»Also, ich habe jetzt frei«, sagte ich. »Du warst mein letzter Belieferator.«
»Okay, gut.«
»Tom …«
»Ja?«
»Warum? Also, danke, und das meine ich wirklich ernst. Vielen Dank. Du rettest mir gerade das Leben. Aber warum?«
»Zum einen, weil du einen Job brauchst und ich einen zu vergeben habe«, erklärte Tom. »Zum anderen, weil du mir gerade den Arsch rettest, denn ich brauche ein vollständiges Team für diesen Einsatz und ich möchte mich nicht auf jemanden verlassen müssen, den ich nicht kenne. Du hast recht, wir sind keine Freunde. Noch nicht. Aber ich kenne dich. Außerdem …« Tom lächelte erneut. »Sagen wir’s so: Dass du mir vor ein paar Jahren Snow Crash empfohlen hast, hat mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin. Also erwidere ich den Gefallen gewissermaßen. Also …« Er zeigte auf die Karte. »Die Adresse ist in Midtown. Ich sage Gracia, dass sie gegen halb drei mit dir rechnen kann. Geh.«
»Fangen wir gleich an«, sagte Gracia Avella zu mir. »Was hat Tom Ihnen über die GEK erzählt?«
Die Büros der GEK – der Name der Organisation, der auf Toms Visitenkarte stand – befanden sich in der 37. Straße, im fünften Stock eines Gebäudes, das auch das Konsulat von Costa Rica beherbergte. Die GEK teilte sich das Wartezimmer mit einer kleinen Arztpraxis. Ich verbrachte dort nicht einmal eine Minute, bevor Avella mich in ihr Büro mitnahm. Sonst waren alle GEK-Büros leer. Ich nahm an, dass die restlichen Mitarbeiter wie alle anderen auch von zu Hause aus arbeiteten.
»Er hat mir erzählt, dass das hier eine Tierrechtsorganisation ist«, sagte ich. »Dass es um einen Feldeinsatz geht und Sie Leute brauchen, die schwere Objekte tragen können.«
»Das sind wir, das tun wir und die brauchen wir«, stimmte Avella zu. »Hat er Ihnen gesagt, um was für Tiere es geht?«
»Äh, große Tiere?«
»Ist das eine Frage?«
»Nein, also, er sagte, große Tiere, ist aber nicht ins Detail gegangen.«
Avella nickte. »Wenn Sie an große Tiere denken, welche fallen Ihnen ein?«
»Ich würde sagen, Elefanten? Flusspferde. Giraffen. Vielleicht Nashörner.«
»Noch andere?«
»Na ja, auch Wale«, sagte ich. »Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Tom die meinte. Er sagte ›Feldeinsatz‹, nicht ›Seeeinsatz‹.«
»›Feldeinsatz‹ kann sich auch darauf beziehen«, erklärte Avella. »Aber ja, ein Großteil unserer Arbeit findet an Land statt.«
»Ich mag Land«, sagte ich. »Da ertrinke ich nicht.«
»Jamie … darf ich Sie beim Vornamen nennen?«
»Bitte.«
»Jamie. Hier sind die guten Nachrichten. Tom hat recht: Wir brauchen jemanden für den nächsten Außeneinsatz, und wir brauchen diese Person sofort. Tom hat Sie empfohlen und ich habe Sie in der Zwischenzeit überprüfen lassen. Keine Verhaftungen, das FBI, die CIA und Interpol suchen Sie nicht, keine problematischen Posts auf Social Media. Sogar Ihre Kreditwürdigkeit ist gut. Zumindest so gut, wie sie bei jemandem mit Studiendarlehen sein kann.«
»Danke. Es geht doch nichts darüber, einen Masterabschluss abbezahlen zu müssen, der mir nie irgendwas nützen wird.«
»Apropos, Ihre Masterarbeit ist ziemlich gut.«
Ich blinzelte. »Sie haben meine Masterarbeit gelesen?«
»Überflogen.«
»Wie haben Sie die bekommen?«
»Durch Freunde in Chicago.«
»Okay, wow.«
»Ich will damit sagen, dass Sie keine offensichtliche Gefahr oder ein Problem für Ihre potenziellen Teamkollegen darstellen. Das reicht uns fürs Erste. Also, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job, wenn Sie ihn wollen.«
»Das ist super«, freute ich mich. »Danke.« Ein ganzer Stressfelsen, den ich nicht mal bemerkt hatte, fiel mir plötzlich von den Schultern. Ich würde inmitten einer Pandemie nicht obdachlos werden und verhungern.
Avella hob den Zeigefinger. »Danken Sie mir noch nicht«, mahnte sie. »Der Job gehört Ihnen – aber ich muss mir sicher sein, dass Sie den Job wirklich verstehen und entscheiden können, ob Sie ihn wollen.«
»Okay.«
»Als Erstes sollten Sie wissen, dass die GEK eine Tierrechtsorganisation ist, die sich aktiv mit diesen Tieren beschäftigt – mit sehr großen, sehr wilden und sehr gefährlichen Tieren. Wir werden Ihnen den Umgang mit ihnen beibringen. Außerdem achten wir strikt darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen stets eingehalten werden. Aber Sie könnten schwer verletzt werden und, wenn Sie nicht vorsichtig sind, sogar sterben. Wenn Sie das zögern lässt oder es Ihnen schwerfällt, Anweisungen präzise zu befolgen, dann ist das kein Job für Sie. Bitte versichern Sie mir verbal, dass Sie das verstehen.«
»Ich verstehe«, sagte ich.
»Gut. Zweitens werden wir Sie draußen in der Natur arbeiten. Also monatelang abgeschnitten von der Zivilisation. Das heißt, kein Internet. Das heißt, wenig Kommunikation mit der Außenwelt. Es kommen kaum Nachrichten rein oder raus. Sie haben nur das, was Sie mitgenommen haben. Sie werden ein einfaches Leben führen, sich auf andere verlassen und es ihnen ermöglichen, sich auf Sie zu verlassen. Wenn Sie ohne Netflix, Spotify und Twitter nicht leben können, ist das kein Job für Sie. Das werden Sie da draußen alles nicht haben. Bitte bestätigen Sie das.«
»Könnten Sie das näher ausführen?«
»Natürlich.«
»Sie sagten ›von der Zivilisation abgeschnitten‹. Wie abgelegen ist das?«, fragte ich. »Heißt es, dass wir vom Rest der Welt abgeschnitten sind, aber feste Unterkünfte haben, oder dass wir in kleinen Zelten leben und in ein Loch kacken, das wir selbst ausgehoben haben?«
»Würde es Ihnen schwerfallen, in ein Loch zu kacken, das Sie selbst ausgehoben haben?«
»Ich habe das noch nie gemacht, aber ich werde es gern lernen.«
Avella lächelte, glaube ich. Hinter der Maske war das schwerer zu erkennen, als mir lieb war. »Es wäre möglich, dass Sie gelegentlich in ein Loch kacken müssen. Allerdings verfügt unsere Einsatzbasis über feste Gebäude. Und Sanitäranlagen.«
»Okay«, sagte ich. »Dann habe ich das verstanden.«
»Drittens: Was wir tun, ist vertraulich. Das bedeutet, dass Sie mit niemandem außerhalb der GEK darüber sprechen dürfen, was Sie tun oder wohin Sie gehen. Ich muss ausdrücklich betonen, dass Sicherheit und Geheimhaltung für unsere Tätigkeit und unsere Vorgehensweise extrem wichtig sind. Sollten wir herausfinden, dass Sie irgendwelche Informationen weitergegeben haben – auch an Familienmitglieder –, können und werden wir Sie im vollen Umfang des Gesetzes anklagen. Das ist keine leere Drohung. Wir haben das schon getan.«
»Heißt das, dass ich eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben muss?«
»Das hier ist Ihre Verschwiegenheitserklärung.«
»Aber ich weiß doch schon, was Sie tun.«
»Sie wissen, dass wir eine Tierrechtsorganisation sind.«
»Richtig.«
»Das ist so, als würde man die CIA als Datensammeldienst bezeichnen.«
»Also sind Sie Spione! Oder Söldner.«
Avella schüttelte den Kopf. »Weder noch. Wir gehen so vor, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten, um die wir uns kümmern. Wenn wir das nicht täten, würden schlimme Dinge passieren.«
Ich dachte an die Geschichten, die ich über Wilderer und Jäger gelesen hatte. Sie benutzten die Geodaten von Touristenfotos, um gefährdete Tiere zu jagen. Ich verstand das Problem.
»Eine Frage«, sagte ich. »Man wird mich nicht bitten, gegen Gesetze zu verstoßen, richtig?«
»Nein«, versicherte Avella. »Das verspreche ich.«
»Okay. Dann verstehe und akzeptiere ich das.«
»Sehr gut.« Avella nahm ein Blatt Papier. »In dem Fall habe ich noch ein paar kurze Fragen an Sie. Erstens, besitzen Sie einen gültigen Reisepass?«
»Ja.« Ich hatte eigentlich vorgehabt, im Sommer nach Island zu reisen, bevor die Pandemie zuschlug und ich meinen Job verlor und den eingesperrten Bewohnern Manhattans ihr Essen bringen musste.
»Irgendwelche schwerwiegenden Körperbehinderungen?« Avella sah auf. »Ich sollte klarstellen, dass Dr. Lee Sie noch umfassend untersuchen wird. Das ist also nur eine grobe Einschätzung.«
»Keine Behinderungen und ich bin gesund.«
»Allergien?«
»Noch keine.«
»Wie kommen Sie mit Hitze und Feuchtigkeit zurecht?«
»Ich habe einen Sommer lang in Washington D. C. als Praktikant gearbeitet und bin nicht gestorben«, sagte ich.
Avella setzte zur nächsten Frage an, hielt aber inne. »Ich sollte Sie jetzt eigentlich fragen, was Sie von Science-Fiction und Fantasy halten, aber da ich Ihre Magisterarbeit gelesen habe, können wir das überspringen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich in diesen Genres wohlfühlen.«
In meiner Magisterarbeit ging es um Biotechnik von Frankenstein bis zu den Murderbot Diaries. »Ja, obwohl das eine ziemlich willkürliche Frage ist.«
»Ist es nicht«, versicherte mir Avella. »Haben Sie ein Testament oder irgendwelche anderen Vorkehrungen für Ihr Ableben getroffen?«
»Äh, nein.«
Sie schnalzte vorwurfsvoll mit der Zunge und machte sich eine Notiz. »Irgendwelche Nahrungseinschränkungen?«
»Ich habe mich mal als Veganer versucht, aber ich konnte ohne Käse nicht leben.«
»Es gibt veganen Käse.«
»Nein, gibt es nicht. Es gibt geriebene orange-weiße Traurigkeit, die Käse und alles, wofür er steht, verhöhnt.«
»Da ist was dran«, räumte Avella ein. »Es würde Ihnen dort, wo Sie hingehen werden, ohnehin schwerfallen, vegan zu leben. Letzte Frage: Haben Sie ein Problem mit Nadeln?«
»Ich finde sie nicht toll, habe aber keine Phobie«, antwortete ich. »Warum?«
»Weil Sie gleich jede Menge davon sehen werden.«
»Bringen wir das hinter uns«, sagte Dr. Lee, bevor sie mir ein Wattestäbchen durchs Nasenloch bis ins Gehirn rammte. Das war der letzte Teil meiner Untersuchung, die ich, wie man mir sagte, bestanden hatte. Die Impfungen gingen jedoch erst los.
»Geiles Gefühl«, höhnte ich, als Dr. Lee fertig war.
»Wenn Sie auf so was stehen, möchte ich Ihnen nie privat begegnen«, kommentierte sie. Dann bereitete sie das Wattestäbchen für den Test vor. »Sie sehen nicht so aus, als wären Sie infiziert, aber anfangs sieht niemand so aus. Also gehen wir lieber auf Nummer sicher. In der Zwischenzeit können wir uns um die Impfungen kümmern.« Sie griff in einen Glasschrank und nahm ein Tablett voller Spritzen heraus.
»Was ist das alles?«
»Ihre Grundimmunisierung«, erklärte sie. »Nur das Übliche, neue Impfungen und Auffrischungen. Masern, Mumps, Röteln, Grippe, Windpocken, Pocken.«
»Pocken?«
»Ja, warum?«
»Die sind ausgestorben.«
»Sollte man meinen, oder?« Sie hielt eine der Spritzen hoch. »Die ist neu. COVID-Impfung.«
»Gibt’s die schon?«
»Theoretisch ist sie noch im Experimentierstadium. Verraten Sie das Ihren Freunden nicht. Sonst werden sie neidisch. Also. Wie oft sind Sie international verreist?«
»Nicht oft. Ich war letztes Jahr bei einer Konferenz in Kanada. Und als Student in Mexiko.«
»Asien? Afrika?«
Ich schüttelte den Kopf. Dr. Lee schnaubte und griff nach einem weiteren Spritzentablett. Ich fing an zu zählen und wurde nervös.
Dr. Lee bemerkte es. »Ich verspreche Ihnen, dass die Impfungen besser sind als alles, wovor sie Sie schützen«, sagte sie.
»Das glaube ich gern«, erwiderte ich. »Das sind nur sehr viele.«
Sie tätschelte mir die Schulter. »Das sind nicht viele.« Sie streckte den Arm aus und nahm das letzte Tablett, auf dem mindestens zehn Spritzen lagen. »Jetzt sind es viele.«
»Heilige Scheiße.« Ich wich tatsächlich vor dem Tisch mit den Tabletts zurück. »Was zum Teufel ist das alles?«
»Man hat Ihnen doch gesagt, dass Sie mit großen Tieren arbeiten werden, richtig?«
»Ja, und?«
»Okay, die …« Dr. Lee zeigte auf die vordersten Spritzen auf dem neuen Tablett. »Die sind gegen die Krankheiten, die diese Tiere übertragen können.« Sie deutete auf die nächsten. »Die sind gegen Krankheiten, die deren Parasiten übertragen können.« Sie zeigte auf die letzte. »Und die ist gegen Krankheiten, die Sie einfach nur aus der Luft aufschnappen können.«
»Ach du Scheiße.«
»Sehen Sie es so«, meinte sie. »Wir schützen nicht nur Sie vor den Tieren. Wir schützen auch die Tiere vor Ihnen.«
»Können Sie mir nicht alle auf einmal in einem Tropf oder so geben?«
»Oh nein, das wäre nicht gut. Einige dieser Impfstoffe vertragen sich nicht gut miteinander.«
»Aber sie landen trotzdem alle in meinem Körper.«
»Ja, aber in einer sehr spezifischen Reihenfolge«, erklärte sie. »Damit Ihr Körper die ersten schon verdünnt hat, bevor die nächsten hinzukommen.«
»Sie verarschen mich, oder?«
»Aber sicher … Also fangen wir an«, sagte Dr. Lee. »Kurz noch zu den Nebenwirkungen. Sie werden ein paar Tage lang Gliederschmerzen haben und vielleicht erhöhte Temperatur. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern völlig normal. Das zeigt uns, dass Ihr Körper die Krankheiten kennenlernt, die er bekämpfen soll.«
»Verstehe.«
»Ein paar dieser Impfungen werden starken Hunger auslösen. Essen Sie ruhig, so viel Sie wollen, aber vermeiden Sie übermäßig fette Speisen. Einer dieser Impfstoffe wird Ihrem Körper nämlich befehlen, Fett auf eine Weise loszuwerden, die Ihren Schließmuskel vor eine große Herausforderung stellen wird.«
»Das … ist weniger gut.«
»Ziemlich unangenehm. Im Ernst, denken Sie in den nächsten achtzehn Stunden nicht mal daran zu furzen. Das ist kein Furz. Und Sie werden es bereuen.«
»Ich mag Sie nicht.«
»Höre ich oft. Ach so, die Farbe Blau könnte in den nächsten Tagen einen Migräneanfall auslösen.«
»Blau?«
»Ja. Wir wissen nicht, warum das passiert, nur, dass es passiert. Wenn es dazu kommt, sehen Sie eine Weile einfach etwas an, das nicht blau ist.«
»Sie wissen schon, dass der Himmel blau ist, oder?«
»Ja. Bleiben Sie drinnen. Sehen nicht hoch.«
»Unglaublich.«
»Hören Sie, ich kann nichts dafür. Ich gebe Ihnen nur für die Injektionen, durch die Sie diese Nebenwirkungen bekommen. Bei der hier«, Dr. Lee zeigte auf eine der hintersten Spritzen auf dem längsten Tablett, »besteht eine Chance von eins zu zweihundertfünfzig, dass der Empfänger den Drang verspürt – wie sage ich das? –, extreme Gewalttaten zu begehen. So was wie: ›Ich bringe alle im Gebäude um und baue einen Scheiterhaufen aus ihren Schädeln.‹«
»Das kann ich nachempfinden«, beteuerte ich.
»Nein, das können Sie nicht«, versicherte sie mir. »Zum Glück gibt es die begleitende Nebenwirkung extremer Trägheit, die die meisten Leute davon abhält, diesem Drang nachzugeben.«
»Also so was wie: ›Ich möchte Sie töten, aber dafür müsste ich vom Sofa aufstehen‹?«
»Genau«, sagte Dr. Lee. »Wir nennen das Kiffermordsyndrom.«
»Das ist ein Witz.«
»Das ist kein Witz, mein Freund. Wir haben herausgefunden, dass bestimmte Nahrungsmittel den Drang zur Gewalt hemmen. Wenn Ihnen das passiert und Sie genug Energie zum Aufstehen und Herumlaufen haben, sollten Sie sich Speck braten oder eine Packung Eis oder ein paar Butterbrote essen.«
»Also fettige Nahrung?«
»Im Grunde ja.«
»Sie wissen noch, dass Sie mir eben geraten haben, fettige Nahrungsmittel zu vermeiden?«
»Ja.«
»Also habe ich die Wahl zwischen ›mörderischem Wahnsinnigen‹ und ›Kacktornado‹?«
»Ich würde es nicht ganz so ausdrücken, aber ja. Allerdings stehen die Chancen ziemlich gut, dass Sie von beiden Nebenwirkungen verschont bleiben und sie erst recht nicht gleichzeitig bekommen werden.«
»Und wenn doch?«
»Würde ich Ihnen raten, Ihren Speck wutschnaubend auf der Toilette essen.« Dr. Lee nahm die erste Spritze. »Bereit?«
»Sind die Impfungen gut verlaufen?«, fragte Avella, als ich in ihr Büro zurückkehrte.
»Ich habe Dr. Lee nicht ermordet«, antwortete ich. »Aber das könnte daran liegen, dass ich meinen Arm kaum bewegen kann.«
»Danke, dass Sie unsere Ärztin verschont haben«, sagte sie und nahm ihre Maske ab. »Ich bin schon vor Wochen geimpft worden«, erklärte sie, als sie meinen Blick bemerkte. »Und da Sie jetzt auch geimpft sind, muss ich nicht mehr so tun, als wäre es nicht so. Aber ich kann sie wieder aufsetzen, wenn Ihnen das unangenehm ist.«
»Nein, das ist in Ordnung.« Ich dachte darüber nach, meine Maske abzusetzen, tat es aber nicht.
Avella legte die Hand auf eine Mappe auf ihrem Schreibtisch. »Sie müssen noch ein wenig Papierkram ausfüllen. Wir brauchen Informationen, damit wir Ihnen Ihr Gehalt überweisen und Ihnen Ihre Krankenversicherung und Zusatzleistungen zukommen lassen können. Wenn Sie möchten, können Sie uns auch eine eingeschränkte Vollmacht geben, damit wir uns um Dinge wie Ihre Miete und das Unidarlehen kümmern können.«
»Was?«
Avella lächelte. »Tom hat Ihnen das also nicht erzählt. Zusätzlich zu Ihrem Gehalt übernimmt GEK Ihre monatliche Miete und alle Studiendarlehen, die Sie abzubezahlen haben. Sollten Sie Kreditkartenschulden oder Ähnliches haben, müssen Sie selbst dafür aufkommen, aber wir können sie entweder für Sie überweisen und von Ihrem Gehalt abziehen oder Ihnen bei der Erstellung eines Dauerauftrags behilflich sein, sollten Sie noch keinen haben.«
»Das ist fantastisch«, staunte ich.
»Wir werden sehr viel von Ihnen verlangen, Jamie. Und wir werden Sie von der Außenwelt abschneiden, wenn wir das tun. Wir sollten also wenigstens dafür sorgen, dass Sie einen Ort haben, an den Sie zurückkehren können. Apropos Gehalt, wir haben noch nicht über Zahlen gesprochen. Wenn Sie einverstanden sind, schlage ich ein vorläufiges Jahresgehalt von hundertfünfundzwanzigtausend Dollar vor.«
»Ja, äh, ist in Ordnung«, sagte ich benommen.
»Das schließt den Bonus von zehntausend Dollar, der die Zeit bis zur ersten Lohnzahlung überbrücken soll, nicht ein.«
»Natürlich nicht«, sagte ich wie ein Blödmann.
Avella zog einen gefütterten Umschlag aus ihrer Schreibtischschublade und reichte ihn mir.
Ich starrte ihn an. »Ist das …?«, setzte ich an.
»Zweitausend in bar und ein Bankscheck über den Rest«, erklärte sie. »Wir können Ihnen die achttausend aber auch per Venmo schicken, wenn Ihnen das lieber ist.«
»Kann ich …?« Ich hielt inne.
»Ja?«, hakte Avella nach.
»Ich wollte nur fragen, ob ich das an meine Mitbewohner weiterleiten kann, damit sie während meiner Abwesenheit die Ausgaben bezahlen können.«
»Das ist ein Geldbonus, Jamie. Sie können damit machen, was Sie wollen. Und wenn Sie sich Sorgen um Ihre Mitbewohner machen, können wir ihnen während Ihrer Abwesenheit einen Teil Ihres Gehalts überweisen. Das machen wir oft. Wir sind eine internationale Organisation und viele unserer Mitarbeiter schicken Geld nach Hause. Das ist im Grunde nichts anderes.«
»Das ist großartig!«, stieß ich hervor. Unglaublich, wie schnell sich meine Probleme mit einer strategischen Anwendung von Geld lösen ließen.
»Es freut uns, dass Sie das so sehen«, sagte Avella und legte erneut die Hand auf die Mappe. »Hier drin ist ein Zugticket. Abreise ist in zwei Tagen. Das sollte reichen, um alles hier in New York City zu regeln. Die restlichen Formulare können Sie mir einfach per Kurier schicken und dann alles für eine lange Reise zusammenpacken. Machen Sie sich keine Gedanken über Kleidung. Sie brauchen nur die, in der Sie unterwegs sein werden. Ansonsten sollten Sie jedoch auf einen Aufenthalt von mehreren Monaten vorbereitet sein. Und vergessen Sie Ihren Pass nicht.«
Ich nahm die Mappe. »Wo geht es denn hin?«, fragte ich.
»Zuerst zum Flughafen Baltimore-Washington«, sagte Avella. »Alles andere … werden Sie dann schon sehen.«
Tom Stevens holte mich am Flughafenbahnhof ab, als ich aus dem Zug stieg, und warf einen Blick auf meinen kleinen Koffer und den Rucksack. »Mehr hast du nicht dabei?«
»Mir wurde gesagt, ich sollte nur Reiseklamotten mitbringen«, antwortete ich. »Abgesehen davon habe ich eine Menge eingepackt.« Ich zeigte auf den Koffer. »Hygieneartikel und Snacks.« Ich lenkte seine Aufmerksamkeit auf den Rucksack. »Meine ganze Elektronik und einige Terabytes Filme, Musik und Bücher. Sonnenbrille und Basecap. Ich dachte, die würde wahrscheinlich brauchen. War das falsch?«
»Nein, das ist völlig in Ordnung so«, sagte Tom. »Wir kümmern uns um den Rest. Schön, dich zu sehen, Jamie. Danke, dass du den Job angenommen hast. Du rettest uns echt den Arsch.«
»Na ja, du hast mir echt den Arsch gerettet, also sind wir quitt.«
»Wenn du meinst.« Er reichte mir ein Ticket. »Deine Reisedokumente.«
Ich warf einen Blick auf das Ticket. »Wo zum Teufel ist die Thule-Flugbasis?«, stutzte ich.
»In Grönland.«
»Wir fliegen nach Grönland?«, stieß ich hervor. »Werden wir mit Eisbären abhängen?«
Tom grinste hinter seiner Maske, die er wie ich nur zur Tarnung trug, wie ich jetzt wusste. »Komm, wir müssen ein Shuttle zum Flughafen nehmen. Dann checken wir dich ein. Wir fliegen erst um zwei Uhr morgens. Wir haben eine Lounge gemietet.«
»Grönland?«, sagte Brent im Video auf meinem Handy.
»Hammer, oder?« Ich saß in der Chesapeake-Club-Lounge, die wohl normalerweise von British-Airways-Passagieren vor ihrem Flug nach London genutzt wurde. Heute saßen jedoch einige Dutzend GEK-Mitarbeiter dort. Die meisten hingen wie ich am Handy und sprachen vermutlich mit Freunden und Verwandten, solange das noch ging.
»Da gibt’s bestimmt Eisbären«, sagte Brent.