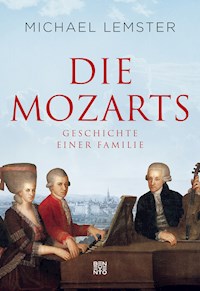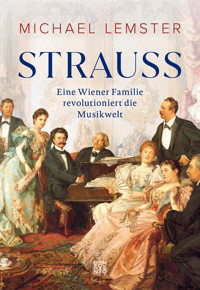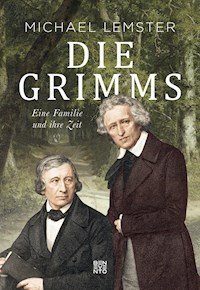
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Sprache: Deutsch
Mehr als märchenhaft: Wer war die Familie Grimm? Ihre Sammlung der »Kinder- und Hausmärchen« wird bis heute gelesen, mit dem Grimmschen Wörterbuch leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte. Jacob und Wilhelm Grimm sind jedoch bei weitem nicht die einzigen Familienmitglieder, die die deutsche Geschichte beeinflusst haben. Von der Mitte des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gestaltete die bürgerliche Familie Grimm die Gesellschaft aktiv mit und war bestrebt, ihr ihren Stempel aufzudrücken. Dabei war die Familie nicht immer das, was sie zu sein vorgab. Michael Lemster beleuchtet in dieser Familienbiografie die Geschichte der Grimms. Kenntnisreich analysiert der Kulturwissenschaftler das epochale Wirken der Grimms vor dem Hintergrund ihrer tiefen existenziellen Angst vor der Moderne. - Der Stammbaum der Familie Grimm: Welche berühmten Persönlichkeiten gerieten in Vergessenheit? - Die erste Familienbiografie der Grimms: Einblicke in ein Stück deutscher Kulturgeschichte - Eine lebensprall erzählte Familiengeschichte, eingebunden in die Geschichte Deutschlands - Mit Zeittafeln, Personen- und Ortsregistern sowie weiterführender Literatur Unterhaltsam und erhellend: Eine Zeitreise von der Frühen Neuzeit bis in die Moderne Nicht nur Jacob und Wilhelm waren Meister ihres Fachs. Die Grimms waren eine Familie großer Persönlichkeiten und Künstler. Doch Michael Lemster richtet den Fokus auch auf jene Familienmitglieder, die stets im Schatten ihrer berühmten Verwandten standen: Ferdinand Grimm, der bis zu seinem frühen Tod die Rolle des »Idioten der Familie« zu spielen hatte, Lui, der romantischste Grimm, oder der »trostlose« Carl, der ein suchender Sonderling blieb. So fächert der Autor die facettenreiche Historie einer Künstlerfamilie auf, die von Gewalt und Angst, aber auch von Freundschaft und Güte geprägt war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MICHAEL LEMSTER
DIEGRIMMS
Eine Familie und ihre Zeit
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitungohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlagesist ausgeschlossen.
Wir haben versucht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Sie dennochUnstimmigkeiten im Bildnachweis feststellen, so bitten wir Sie, uns dies nachzusehenund sich an den Verlag zu wenden.
1. Auflage
© 2021 Benevento Verlag bei Benevento Publishing München - Salzburg,
eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags,
der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung,
auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche
Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Jonas Wegerer, Freiburg
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Cambria
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotive: akg-images
ISBN 978-3-7109-0115-7
eISBN 978-3-7109-5119-0
INHALT
Vorwort
Eine Impression
Kapitel 1: Familienahnen (1485–1785)
Hanau zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg
Im Vertrauen auf Gott und die Obrigkeit
Kapitel 2: Welt und Umwelt der Grimms
Neue Wege und alte Mächte
Die Stadt
Der Brunnen
Die Spindel
Die Mühle
Der Esel
Das Schloss
Die Prinzessin
Die Straße
Der Bettler
Das Feld
Der Wald
Der Wolf
Die Räuber
Die Handwerksburschen
Die Zwerge
Kapitel 3: Fünf Hanauer Buben und ihre Steinauer Schwester (1785–1798)
Der Wille zum Idyll
Tod eines Amtsmanns
Kapitel 4: Frühe Nöte und Chancen (1798–1812)
Eine intellektuelle Welt
Hohe Ambitionen und stockende Karrieren
Kapitel 5: Wie Figuren eines Schachspiels (1803–1822)
Der widerborstige Ferdinand
Der »trostlose« Carl
Der schneidige Lui
Die »liebe Lotte«
Kapitel 6: Zwei Brüder, Rechts- und Sprachgelehrte (1807–1821)
Ein Leben zwischen Büchern und Papier
Was macht die Deutschen aus?
Kapitel 7: Märchen über Märchen (1806–1825)
»Aus der Volksseele« – Märchen als Modetrend
Dornröschen – Biografie eines Märchens
Die »Märchenlieferanten«
Kapitel 8: Mehr als die kleinen Geschwister (1809–1836)
Reisen und Liebeleien: Lui, der romantischste Grimm
Carl, ein suchender Sonderling
Ferdinand: Corrector und »Verräter«
Oberappellationsgerichtsassessorengattin Lotte Hassenpflug
Kapitel 9: Familiengründungen (1822–1832)
Das Haus Hessen: adelige Ehehöllen
Kasseler Romanzen, Wilhelms Ehe
Lottes früher Tod und Luis späte Ehen
Kapitel 10: Die Göttinger Sieben (1829–1840)
Der Vormärz in Göttingen
Exil in der Heimat und das »Deutsche Wörterbuch«
Judenfeindschaft bei den Grimms
Kapitel 11: Dem Verdienste seine Kronen (1840–1849)
Der Ruf des Königs nach Berlin
Parlamentarier und Revoluzzer
Kapitel 12: Herman Grimm und seine Familie (1828–1901)
Herman und seine Geschwister
Berliner Laufbahn
Erbe und Verwalter einer reichen Tradition
Kapitel 13: Eine Generation tritt ab (1833–1863)
Lebensleistungen
Todesumstände
Nachwort: 200 Jahre Märchen
Dank
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Zeittafel
Personen- und Werkregister
Bildnachweis
»Das deutsche Volk ist ein Volk von Freien,und deutscher Boden duldet keine Knechtschaft.Fremde Unfreie, die auf ihm verweilen, macht er frei.«Jacob Grimms Antrag zum Artikel 1 der Grundrechte in der deutschenVerfassung von 1849. Der Antrag wurde nicht angenommen.Verteidigen wir diese Freiheit!
Meiner Familie; dem »Jacob« in meinem Lebenund meiner Schwester –wie gut, dass wir einander haben!
VORWORT
Dieses Buch führt uns in eine Welt, um deren sichtbare Überreste die Menschheit uns Deutsche beneidet. Staunenswerte Überreste, zu denen gebildete, neugierige Menschen aller Nationen pilgern wie zu Wallfahrtsstätten, um sich der Verführungskraft sanfter bewaldeter Hügel, verträumter Wiesengründe, mäandernder Bäche, majestätischer, von Burgen überragter Ströme, bergender Fachwerkstädte und ragender gotischer Kirchen hinzugeben.
In eine Welt, die so idyllisch nicht war, wie die Butzenscheiben uns glauben machen könnten. In der nicht so sehr dasjenige in Ruinen fiel, was man nicht mehr brauchte, sondern das, was mächtigen Feinden im Wege stand. In der die Selbstbehauptung es erforderte, mit schweren Waffen zu kämpfen und grobe Keile auf grobe Klötze zu hauen. In der die Freiheit des Denkens und des Wortes unerhört im wahrsten Sinne war und erst erkämpft und behauptet werden musste. In der physische Sicherheit und das Lebensnotwendigste für die Allermeisten keine einklagbaren Rechte waren und in jeder Krise weithin fehlten. Keine Generation blieb von schweren Krisen verschont.
In eine Welt andererseits, die vielen im tiefsten Sinne Heimat war. Heimat mit all ihren Begrenzungen – materiellen, räumlichen, ständischen, religiösen, seelischen. Aber auch mit all dem Festigenden, das die Beschränkung den Menschen gibt. Menschen verhedderten sich nicht so oft im Netzgeflecht möglicher Entscheidungen, da so vieles festgelegt war. Die Menschen blieben meist lebenslang Nachbarn, da ihr Stand oder ihre Mittel es ihnen verboten zu reisen oder da sie nur dann reisten oder auswanderten, wenn es unbedingt erforderlich war.
In eine Welt, in der es von allem, was Menschen wichtig ist, weniger gab – von Wohlstand, von Wissen, von Nachrichten, sogar von Mitmenschen. Die Weite, in der sich heute so manche verlieren, gab es nur für wenige privilegierte, gebildete oder aber randständige Menschen: einerseits für den Adel, für die Geistlichkeit, für die Gelehrten, für die bürgerlichen Kauf- und Fuhrleute; andererseits und unter steter Bedrohung für das unter meist prekären materiellen Bedingungen überlebende fahrende oder gesetzlose Volk: die Wandergesellen und Soldaten, die Schausteller und Musikanten, die Glücksritter und Goldmacher, die Diebe und Räuber.
Halt finden, äußeren und inneren, und ihre Position verbessern, wenn nicht in dieser, so dann doch in einer der kommenden Generationen: Das war die einzige große weltliche Aufgabe, die sich viele Menschen damals stellten. Mit Geschick, Ruchlosigkeit, Charisma und Glück bewältigten sie die einen, andere wieder scheiterten. Den erfolgreichen unter ihnen wuchsen unterwegs erstaunliche Kräfte zu und wurden manchmal erstaunliche Schicksale zuteil.
Diejenige Klasse, die zwischen Früher Neuzeit und Moderne – also in der Zeit zwischen der Mitte des 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – für Aufstieg schlechthin stand, war das Bürgertum. Es erfand sich selbst in einem jahrhundertelangen Prozess als Stand von Kaufleuten, Geldverleihern, Handwerkern, Industriellen, Forschern, Gelehrten, Beamten und Pfarrern. Es lernte gegen alle Widerstände seinen Raum neben den Ständen des Adels, der Bauern und der Kirche zu behaupten, sich zur Führung der Gesellschaft aufzuschwingen und diese Führung gegen die Ansprüche nachdrängender Schichten zu behaupten.
Im vorliegenden Buch ist eine dieser bürgerlichen Familien kennenzulernen: die Familie Grimm. Ihre frühesten erhaltenen Lebensspuren reichen zurück bis ins 15. Jahrhundert. Eine Familie von Bauern und Handwerkern, die ihre Chancen nutzten und zunächst kleine Verwaltungsposten ergriffen, bis sie als Juristen, als Pfarrer und schließlich als Wissenschaftler öffentlich zu wirken begannen.
In der Barockzeit begegnen wir erstmals ausgeprägten Persönlichkeiten unter den Grimms mit einem beachtenswerten schriftlichen Nachlass. Ihre Reihe beginnt mit dem in Hanau geborenen und verstorbenen Friedrich Grimm dem Älteren, einem Pfarrer und Kirchenpolitiker, den das Leben mitten in die Konfessionskämpfe jener Zeit stellte. Über Philipp Wilhelm Grimm, den früh verstorbenen landgräflich-hessischen Amtmann in Steinau und Schlüchtern, führt der Weg zu den prominentesten Grimms, den Märchensammlern und -erzählern Jacob und Wilhelm Grimm.
Diese werden so oft zusammen dargestellt, dass sie fast zu einer Person verschmelzen. Der unrichtige Glaube, sie seien Zwillinge, ist weit verbreitet. Das brüderliche Bündel von Persönlichkeitsmerkmalen zu entwirren und jeden der beiden als deutlich umrissenen Menschen zu zeigen, ist ein Hauptanliegen dieses Buches. Ebenso wie der Versuch, die Lebenslinien der übrigen vier Geschwister nachzuziehen, von denen einige Bedeutsames geleistet haben – weil ihnen ihr Schicksal Talent, Tatkraft und das privilegierte, das männliche Geschlecht zugeteilt hat. Doch die unterschiedlichen Talente und Temperamente stellten die geschwisterlichen Beziehungen dauernd unter Hochspannung bis zur katastrophalen Krise…
Wir begegnen auch den Frauen der Grimms, wie sie mit unermüdlichem Kampfgeist ihre, mag sein, nicht so glanzvollen, aber genauso wichtigen täglichen Aufgaben meistern – immer wieder entkräftet durch Schwangerschaft und Kindbett, zurückgeworfen durch die Krankheiten, die früher unzertrennliche Begleiter des Mutterwerdens und Mutterseins waren.
Schließlich lernen wir die Nachkommen kennen, allen voran Wilhelms Sohn Herman, der nicht nur aus der Kunstgeschichte eine spannende Disziplin machte, sondern auch den Goethe-Kult mitbegründet hat – und den Grimm-Kult. Hermans Bruder Rudolf endlich sorgte dafür, dass die Familie Grimm bis ins 21. Jahrhundert weiterlebt.
Die Grimms dachten in den Kategorien von menschlichen Beziehungen, Rechten und Verpflichtungen: gegenüber der Familie, den Nachbarn, der Obrigkeit, dem Land, der Nation und Gott. Sie waren religiös gebunden, in der reformierten Konfession, einer spirituell und intellektuell radikalen Auslegung der christlichen Lehre. Und sie waren weltlich nicht minder gebunden – als Diener der Gemeinschaft, die die verschiedenen Generationen der Grimms unterschiedlich umschrieben hätten: Kirche, Fürstentum, Gelehrtenrepublik, Volk.
»Volk« oder »Nation« ist ein mehrdeutiger Begriff. Dies gilt gerade für die Deutschen, die am Drehkreuz eines Kontinents sitzen. Einige der Grimms haben sich wie viele andere Vertreter ihrer Generation an dieser schillernden Kategorie abgearbeitet und – wie wir zur Genüge sehen werden – zu intellektuell zweideutigen Mitteln gegriffen, um sie zu vereindeutigen.
Die Grimms waren keine besonders mutigen Menschen. Im Gegenteil fügten sie sich vorsichtig ein in das gesellschaftliche Gefüge ihrer jeweiligen Zeiten. Passten sich an, wo die Notwendigkeit zu überleben dies erforderte – oft selbst dort, wo sie sich verbiegen mussten. Und als mit Macht die Moderne hereinbrach in Gestalt französischer Truppen, drängten früh eingeprägte Ängste in ihnen an die Oberfläche und diktierten ihnen in die Feder. Vieles von dem epochalen Wirken der Grimms lässt sich nicht erklären, ohne diese tiefe existenzielle Angst vor der Moderne und ihrer Unsicherheit zu verstehen.
Einmal schließlich wuchsen Grimms über sich hinaus: als es galt, gegen Fürstenwillkür aufzustehen. Die Brüder Jacob und Wilhelm, schon zu ihren Lebzeiten weltberühmte Märchensammler und Philologen, die nicht anstanden, sich als Monarchisten zu bezeichnen, forderten ihren Monarchen heraus. Nicht als Volkstribune auf den Schultern ihrer Anhänger sitzend, sondern als stille Gelehrte, die ihren König sachlich und klar an seine Verpflichtungen erinnerten. Dafür nahmen sie Vertreibung und Verarmung in Kauf – und ein Wiedererleben der Traumata ihrer Kindheit.
Auch wir stehen heute an der Schwelle einer Moderne, die Kräfte entfesselt hat, die die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengen. Vielleicht ist daher gerade heute so wichtig, uns auf Zeitreise zu begeben in vergangene Epochen, die aus damaliger Perspektive so unübersichtlich und bedrohlich waren wie unsere heutige für viele von uns. Um zu staunen darüber, wie die Menschen ihre Schwierigkeiten meisterten. Aber auch, um zu erkennen, dass es ohne Zuversicht und Tatkraft nicht weiterging und nicht weitergehen wird.
Einige vorgreifende, aber das Verständnis dieser Familiengeschichte sicherlich erleichternde Begriffsklärungen sind an diesem Ende des Beginns wohl angebracht. Mit »den Grimms« ist die komplette Familie gemeint oder enger gefasst die jeweils lebenden Generationen. Mit »den Geschwistern Grimm« die sechs Kinder des 1796 früh verstorbenen Amtmanns Philipp Wilhelm Grimm, unter ihnen die Märchen- und Sprachforscher Jacob und Wilhelm sowie der jüngste Bruder Ludwig Emil, dem seine visuelle und handwerkliche Begabung eine Künstlerkarriere ermöglichte. Ist dagegen die Rede von »den Brüdern Grimm«, so sind ausschließlich Jacob und Wilhelm gemeint unter Ausschluss des Künstlerbruders und der beiden nach glanzlosen Leben verstorbenen Brüder.
EINE IMPRESSION
Der Tag dämmert über einem Interieur unter hoher stuckierter Zimmerdecke. Eines der Fenster steht offen und lässt durch einen geblähten Blumenvorhang lindenduftende Morgenluft in schwachen Stößen und träges Vogelzwitschern herein. Undeutlich heben sich Möbelstücke voneinander ab: Tische und niedrige Stellagen mit Stapeln von Büchern darauf, ein Schreibtisch, eine weiße Frauenfigur, offene Bücherregale rundum an den Wänden rechts und links der zweiflügeligen Türen, sogar den Raum zwischen den Fenstern bedecken sie. Obenauf große gerahmte Bildnisse in Öl, an die Mauern gelehnt und akkurat ausgerichtet. Ein Sofa mit groß gemustertem Bezug, von dem ein alter Mann sich eben erhebt. Hat er die Nacht hier verbracht oder ist er nur in momentaner Erschöpfung eingeschlummert, auf der Suche nach irgendetwas, die ihn aus seinem Bett getrieben hat? Etwas mühsam kommt er auf die Beine, eines seiner Gelenke knackt, dann steht er leicht gebeugt, aber voll Spannung, ein drahtiger Herr, dessen schlohweiße volle Locken sich im Zwielicht gegen den Kragen seines dunklen langen Rocks deutlich abheben. Er schiebt sich etwas unbeholfen zum Fenster, schwankt, sein Fuß stößt an ein Stuhlbein, das Schurren zerbricht einen Moment lang die Stille. Mithilfe der Stuhllehne findet der Weißhaarige sein Gleichgewicht und zieht den Vorhang auf, schaut auf die Straße, über der das Gaslicht schon ausgegangen ist. Eine Mondsichel steht niedrig am Himmel. Eine Katze überquert in langen Sätzen den Fahrdamm, zwei, drei menschliche Schatten hasten auf dem Trottoir stumm vorbei. Der Alte wendet sich einem der Bücherregale zu, lässt seine Hand gleiten über die ledernen brüchigen Rücken, auf denen schwach und unlesbar goldgeprägte Aufschriften schimmern. Dennoch findet er rasch den Band, den er sucht. Kippt ihn am Kopfbund vom Regalboden, er leistet Widerstand, denn er steht dicht an dicht mit seinen Nachbarn. Dann hält er ihn in der Hand, und die entstandene Lücke schließt sich halb. Routiniert bläst er unsichtbaren Staub vom Kopfschnitt, seine freie Hand streicht über die wulstig hervortretenden Bünde des Rückens, die trennenden goldenen Schmuckleisten, das seidene Kapitalband, dessen Buntheit im schwachen Licht noch ein Grau ist. Er schlägt den Band halb auf, das Knistern, das hörbar wird, deutet an, dass dieser noch nicht durchgelesen ist. Der Herr hebt das Buch zum Gesicht, klappt es ganz auf, taucht die Nase zwischen die jungfräulichen Seiten, saugt in langen ruhigen Zügen die Aromen von Druckerschwärze, Buchbinderleim, Papier und Leder in sich, während der Blick seiner hellen Augen ins Leere fällt. Er schlägt es zu, ein kurzes trockenes Geräusch antwortet ihm. Dann legt er sein Fundstück am Schreibtisch ab; ein kleines, aber akkurates Rechteck ist von Büchern und Schreibutensilien frei, dort landet der Band mit einem neuen dumpfen Laut. Leicht gebeugt verharrt die Gestalt, auf die Tischplatte gestützt, und lauscht den spärlichen Lauten, die von außen hereindringen; etwas amüsiert ihn, die Mundwinkel zucken nach oben. Seine freie Hand streicht über die Oberfläche des benachbarten Bücherstapels, die Fingerkuppen genießen die samtige Glätte des Leders, fahren den Vertiefungen einer golden eingeprägten Verzierung nach, richten den Band an den Kanten des darunterliegenden aus. Dann richtet der Alte sich mit leisem Seufzen auf, geht zur angelehnten Tür, die er lautlos öffnet, bevor er sich durch die Öffnung schiebt. Ein stärkerer Windstoß hilft ihm unerwartet beim Schließen, das deutlich hörbare Krachen hallt wider im Haus, dann ist das Zimmer menschenleer und still wie zuvor und wartet auf den Tag und auf seinen arbeitsamen Bewohner – auf Jacob, den ältesten und letzten der sechs Geschwister Grimm.
Ein »Biber in seiner viereckigen Bücherwohnung«: So beschreibt ein Besucher Jacob Grimm. Zeichnung von Ludwig Emil Grimm, 1817.
KAPITEL 1FAMILIENAHNEN(1485–1785)
Hanau zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg
Die Welt der ersten Grimms war eine Welt voller Schrecken, in der Spiritualität und Überlebenskampf, Erbarmen und Erbarmungslosigkeit grell miteinander kontrastierten. Verkörpert war dieser Kontrast besonders in der Kirche, die in den mehr als tausend Jahren ihres Bestehens so manche Reform gesehen, abgewehrt, verkraftet oder integriert hatte und an ihnen gewachsen war. Besonders drückend empfand das Volk den Machtmissbrauch des Klerus, weil seine Lebensbedingungen sich aufgrund schlechter Ernten, billigen Geldes – die Edelmetalle, die die Konquistadoren in erstaunlichen Mengen aus Amerika brachten, überschwemmten die europäischen Märkte – und raschen Bevölkerungswachstums verschlechterten. Die Unzufriedenheit erreichte mancherorts bedrohliche Ausmaße. Sie äußerte sich nicht nur als politischer Protest, sondern – scheinbar harmloser – auch als religiöse Verinnerlichung und Suche nach direkter Begegnung mit Gott. Die Zeit schrie nach Reformen, nicht nur der weltlichen, sondern auch der geistlichen Dinge. Die Mittlerschaft der Kirche zwischen Gott und Gotteskind aber stand dem mystischen Ziel einer unmittelbaren Vereinigung mit Gott oder dem einer direkten »Nachfolge Christi«1 im Wege. Fragen dieser Art waren für die Menschen keineswegs rein erbaulicher Natur, sondern existenziell. Der Tod stand mitten in jedem Menschenleben – Seuchen, Infektionskrankheiten, das Kindbettfieber –, Unfälle forderten täglich Tribut, und es galt so zu leben, dass man vorbereitet war für das Heil, um nicht ewiger Höllenqual anheimzufallen. Die Gläubigen konnten sich diese sehr konkret vorstellen: Die Bilder in den Kirchen und die Predigten der Geistlichen halfen in dieser Hinsicht ihrer Fantasie auf die Sprünge.
Ein Weg zur unmittelbaren Gottesbeziehung könnte ja über die innerliche Aneignung der Heiligen Schrift führen, die als geoffenbartes Wort Gottes galt, als Seine umfassende Predigt an jeden Menschen. Warum diese Predigt nicht aus Seinem Mund hören? Warum nicht persönlich um ihr Verständnis und um ihre Lehren für ein richtiges Leben ringen?
Eines der wichtigsten Ziele der kritischen Theologen war es daher, die Schrift jedem Gläubigen in seiner Sprache zugänglich zu machen. So warf sich der wirksamste deutsche Reformator Martin Luther während seines Exils auf der Wartburg auf die Übersetzung der Evangelien und später auf die der »Gantzen Heiligen Schrifft« ins Deutsche. Neben einem Werk zur Stärkung des Glaubens schuf er damit ein folgenreiches Sprachwerk und Sprachkunstwerk. Denn mit ihm begann die neuhochdeutsche Volkssprache als Schriftsprache. Jahrhundertelang sollten später mehrere Generationen der Grimms sich an diesem Werk und der deutschen Sprache abarbeiten: als Theologen, als Juristen, als Gelehrte, als Universitätslehrer, als Erzähler.
Allerdings brachte die Übersetzung allein die Schrift nicht zu den Menschen. Dazu war ihre Vervielfältigung notwendig. Die Voraussetzung dafür schuf erst der Buchdruck, der, erfunden im 15. Jahrhundert ausgerechnet im Land des führenden katholischen Kardinals, des Erzbischofs von Mainz, sich im 16. Jahrhundert in Europa durchsetzte. Er entzog die Verbreitung des Wissens den klösterlichen Skriptorien und legte sie in die Hände des bürgerlichen Handwerks. Nun entschied nicht mehr die Geistlichkeit, was der Vervielfältigung würdig war, sondern der Wunsch der Leser, zu denen sich nach und nach auch Leserinnen gesellten. Um die drängendsten geistlichen und weltlichen Probleme der Menschen entstanden Debatten im Dialog aufeinander antwortender Druckwerke in stetig wachsender Taktung, Buch antwortete auf Buch. Damit wurde neben dem, was geschrieben stand, auch wichtig, wer es geschrieben hatte: der Autor als geistige Persönlichkeit. Dasselbe galt für grafische Werke. Der Druck erlaubte es zusätzlich, Bilder zu vervielfältigen und aus der Unzugänglichkeit der Klöster und Schlösser oder der Entrücktheit der Kirchen in die Häuser der Menschen zu bringen – als Andachtsbilder, als erbaulichen Raumschmuck, als unterrichtende Schaubilder oder als moralische oder politische Satiren. Meister wie Dürer, Cranach und Holbein ließen ihre Werke in Kupfer stechen oder in Holz schneiden und verkauften Tausende von Blättern, womit sie den Grundstein zu ihrem Nachruhm legten. Wir werden noch einem Grimm begegnen, der diese Meister zu seinem Vorbild nimmt.
Gelehrtheit, Religiosität und Publizität wirkten also eng zusammen, um in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einer beispiellosen Ermächtigungsbewegung auf den Weg zu verhelfen: dem Protestantismus. Der Lehrstand sollte fallen.2 Gott mit seiner geoffenbarten Heiligen Schrift sollte der einzige verbindliche Lehrer sein. Die Sakramente, die nur Priester spenden durften, sollten ihre Macht als zwingende Heilsvoraussetzungen verlieren. Jeder Mensch sollte verstehen können, was Gott ihm sagte, und unmittelbar mit ihm sprechen können. Die Fürsprache der Heiligen war überflüssig, und der lukrative Kult um die Reliquien, ihre sterblichen Überreste, sollte als Aberglaube verdammt werden. Vertrauen in Gott und in seine Gnade sollte den Menschen vor der Höllenqual erretten – nicht die Entrichtung des Peterspfennigs oder der Kauf eines Ablasspapiers beim Pfaffen, der das Geld anschließend öffentlich verhurte.
Nicht nur im Heiligen Römischen Reich, sondern im gesamten katholischen Europa erhoben Protestanten diese Forderungen. In Italien, Spanien und Frankreich gelang es, sie abzuwehren und einzudämmen. In England, Skandinavien und den Niederlanden fegten sie den alten Glauben hinweg. Im Reich allerdings schuf die Reformation eine besondere Lage: Sie schied die Bevölkerung und die Reichsstände in zwei etwa gleich starke Lager. Auch dadurch verfiel der Riese in der Mitte Europas, dessen Bevölkerungsstärke von zwölf Millionen Menschen nur von der Frankreichs übertroffen wurde, machtpolitisch in einen Starrezustand, der dreihundert Jahre später – und da wären wir bereits mitten in unserer Erzählung – in der Niederlage gegen französische Armeen endete. Statt mit Europa beschäftigte Deutschland sich mit sich selbst und mit dem, was die Reformation ausgelöst hatte: mit Volksaufständen, Bauern- und Bürgerkriegen, mit der Schaffung einer neuen Machtbalance zwischen dem katholischen Kaiser3 und den protestantischen und katholischen Reichsständen und nicht zuletzt mit der Eindämmung der Extreme einer reformatorischen Bewegung, die sich immer weiter auffächerte. Einunddreißig Jahre nach Luthers Exkommunikation durch den Papst, nach dem Schmalkaldischen Krieg 1546/47, in dem einer der Landgrafen von Hessen, Vorgesetzte von mehreren Generationen der Grimms, eine tragende Rolle spielte, und mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 war das Machtgleichgewicht wiederhergestellt. Der Herbst des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation hatte begonnen.
Zwar schien die Sonne deutscher Macht und Herrlichkeit nur noch gedämpft über Europa – das Reich hatte seine politische und militärische Offensivkraft weitgehend eingebüßt, obwohl in ihm »die Sonne nicht unterging«, wie Kaiser Karl V. selbstbewusst gesagt haben soll. Spätere Generationen, denen wir im Verlauf dieser Erzählung noch begegnen werden, trauerten solcher Herrlichkeit nach. Aber in dieser milden Herbstsonne reiften reiche Früchte des Geistes, von denen sich nicht nur die Deutschen jahrhundertelang nährten: Musik, Philosophie, Dichtung, Kunst und Wissenschaft. Die Schöpferkraft der Deutschen war beileibe nicht einzigartig. Einzigartig war aber, dass keine überragende Metropole, kein Paris, Rom, Neapel, Madrid oder London ihr Gravitationszentrum war, sondern dass ihre Früchte auch in kleinen Städten und Dörfern von den Bäumen fielen: in Heidelberg oder Jena, in Göttingen oder Weimar, in Bayreuth oder im hessischen Marburg oder Kassel. Dutzende von Landesfürsten waren bereit, in ihren Städten Universitäten zu gründen oder an ihren Höfen große Geister an sich zu binden, wenn ihre Ambitionen es ihnen geboten.
Das Wort der Fürsten galt auch in Fragen der Konfession. »Cuius regio, eius religio«, wes Land, des Glaube sollte gelten. Dies hatten Kaiser und Fürsten 1555 auf dem Augsburger Reichstag vereinbart. Mit diesem Frieden war der schwächende Hader der Konfessionen einstweilen beigelegt. Was an diesem Prinzip gut war für die Stände und für Deutschland, war oft schlecht für ihre Untertanen und schuf eine mögliche Quelle der Unsicherheit für sie. Denn nicht mehr die Kirche oder das eigene Gewissen diktierte nun, was man zu glauben und wie man zu beten hatte, sondern der Landesherr. Wer nicht zu dessen Glauben übertreten wollte, dem drohten die Ausweisung und schlimmstenfalls der Verlust des Vermögens. Über Jahrhunderte prägte nun ein barbarisches Phänomen das Schicksal vieler Christen: die systematische Vertreibung Andersgläubiger, der bis dato nur jüdische Gemeinschaften anheimgefallen waren. Solche »religiösen Säuberungen« konnten massive Schäden in den Ländern anrichten, die sie auslösten, wenn sie wirtschaftlich erfolgreiche und dynamische Teile der Bevölkerung betrafen – so etwa die Vertreibung der letzten Protestanten im Zuge der erzbischöflich-salzburgischen Gegenreformation im mittleren 18. Jahrhundert. Länder, die solche »Exulanten« willkommen hießen, ansiedelten und integrierten, konnten dagegen erheblich profitieren – so Hessen-Kassel und dort besonders Hanau, die Heimatstadt der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Hanaus spätere Bedeutung nicht nur für deren Familiengeschichte wäre undenkbar ohne die Glaubensflüchtlinge, die die Stadt seit dem späten 16. Jahrhundert in verschiedenen Wellen aufnahm – Menschen, die auf ihr Gewissen mehr hörten als auf alle anderen Stimmen. Philipp Ludwig II. erlaubte Hunderten calvinistischen Flüchtlingen aus Frankreich und den Spanischen Niederlanden, sich auf Hanauer Gebiet niederzulassen und auf den Feldern zwischen der Stadt im Kinzig-Knie und dem Main eine großzügige Neustadt zu bauen – dreimal so groß wie die Altstadt, zeigen die Pläne, und politisch unabhängig für mehr als zweihundert Jahre. Mit den Neuansiedlern kamen Kapital und handwerkliches Fachwissen. Sie brachten einen eigenen Baustil nach Hanau: An der Straße standen die Wohnhäuser, hinten im Garten die Werkstätten und Manufakturen. Neben Goldschmieden eröffneten Tuchmacher, Weber, Seidenweber sowie Hutmacher ihre Gewerbe. Mit diesem Zuzug begann der Aufstieg Hanaus zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort.
Und dort finden wir den ersten Stamm- und Namensvater der Grimms, von dem wir mehr wissen als das, was uns ein paar Einträge im Kirchenbuch erzählen: Thomas Grimm, um 1580 geboren in Bergen, einem stattlichen, befestigten hanauischen Dorf und Gerichtssitz an der Grenze der Freien Reichsstadt Frankfurt gelegen, zwei Meilen von Hanau entfernt. Bäcker ist er zunächst in Bergen, erwirbt und veräußert Grundbesitz, nämlich eine Hofreite (eine komplette Hofstelle), »neben ihm selbst und Bast Trapps Witwe« gelegen, weiß ein Chronist. Er wird Müller in Bad Vilbel, einem hanauisch-kurmainzischen Kondominium, das also Steuern an den Grafen und an den Kardinal abführt – ein Beleg dafür, dass damals selbst einfache Leute mobil waren und durchaus nicht »an der Scholle klebten«, wie manchmal vermutet wird. Amtiert zwischendurch als Bürgermeister, Gerichtsschöffe und bis zu seinem Tode 1650 als Zentgraf4, also als Vertreter der Gemeinde beim Landgericht, und als Vorsitzender des Ortsgerichts.
Schloss, Alt- und Neustadt von Hanau in der Barockzeit. Norden ist in dieser Ansicht links.
Es gab Grimms, die vor Thomas kamen, natürlich, und im Stammbaum in diesem Buch können auch sie bequem nachgeschlagen werden – ganz zu Anfang der vermutlich um 1485 in der Freien Reichsstadt Friedberg geborene und 1508 in Frankfurt eingebürgerte Peter Grym. Diese frühen, »vorgeschichtlichen« Grimms bestellten den Boden – eigenen oder fremden –, betrieben ein schlichtes Handwerk oder eine Gastwirtschaft, hatten, wenn es hochkam, ein kleines Amt oder gingen sogar nur einem »unehrlichen«, nicht zunftfähigen Beruf nach wie der Frankfurter Türmer Lotz Grimm. Nicht einmal ihre Lebensdaten oder ihre Ehepartner sind lückenlos bekannt. Es gab keinen Grund, jemals über sie zu schreiben – es sei denn in den Kirchenbüchern oder in den Verzeichnissen des Magistrats, die Taufen, Ehen und Leichenbegängnisse verzeichneten.
Eine angesehene Person ist jedenfalls Thomas Grimm. Nicht mit göttlichem Gesetz befasst er sich, sondern mit menschlichem, und begründet damit ersichtlich eine grimmsche Familientradition: die juristische. Noch sechs Generationen später wird diese Tradition einen tüchtigen Diplomaten und erfolglosen Politiker hervorbringen: Jacob Grimm, den älteren der beiden »Märchenbrüder«. Thomas Grimms Sohn aus erster Ehe, Johann, begründet den Hanauer Zweig der Grimms, indem er 1639 in die Stadt mit dem Schwanenwappen übersiedelt und die dortigen Bürgerrechte erhält. Damit schuf er die Voraussetzungen für diese Geschichte.
Auch Johann war ein tatkräftiger, mobiler und offensichtlich geselliger Mensch. In Bergen führte er ein Wirtshaus. In Hanau behielt er sein Metier bei, indem er das »Fass« in der Hanauer Altstadt übernahm. Die Altstadt war damals noch eine selbstständige Gemeinde und blieb dies bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, obwohl ein gemeinsamer moderner Befestigungsring sie zusammen mit der südlich angrenzenden Neustadt umschloss.
Warum zog es ihn ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt nach Hanau? Wir können darüber nur mutmaßen. Tatsache ist allerdings, dass Orte wie Bergen entlang der Hohen Straße, die als Teil der mittelalterlichen Via Regia West- und Osteuropa verband, unter den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges am schwersten litten. Tatsache ist auch, dass die Berger Synagoge während des Krieges in Asche fiel. Vielleicht also hatte auch Johann sein Wirtshaus verloren und suchte eine Zukunft in Hanau, das trotz Besatzung und Belagerung dank seiner Befestigungen glimpflich davongekommen und im Vorjahr den Schweden endgültig entrissen worden war. Auch stiegen nach und nach die Höhenstraßen in die einst versumpften Flusstäler hinab, weil es gelang, immer stabilere Straßen und Brücken zu bauen, und längst war Hanau Station und Knotenpunkt mehrerer Fernstraßen geworden.
Dass Johann begütert war und seine Güter geschickt mehrte, beweist ein Eintrag im Ratsprotokoll drei Jahre später: Gegen das »Fass« ertauscht er das in der Vorstadt direkt neben der Kinzigbrücke gelegene »Weiße Ross« – eine Gastwirtschaft an bevorzugter Stelle. Wer nämlich nicht beizeiten vor Dunkelwerden das Kinzigtor passieren konnte, musste – sofern er die Mittel dazu hatte – hier absteigen. Denn es war nicht ratsam, nachts auf den Schutz fester Häuser zu verzichten. Dies galt in Friedenszeiten, und es galt noch mehr in Zeiten kriegerischer Wirrnisse wie der des Dreißigjährigen Krieges.
In diese Wirrnisse wurde Henrich Grimm hineingeboren, Johanns vierter Sohn. Henrich war ein Mensch, dem bei Weitem nicht alles glückte im Leben. Warum dies so war, darüber schweigen die Quellen. Sie betrieben damals keine psychologische Zergliederung der Menschen, und das Unglück galt es hinzunehmen wie das Glück. Aber die furchtbaren Ereignisse des Krieges konnten schon damals Geister zerrütten und Seelen nicht weniger entstellen, als sie Gesichter und Körper zerstörten.
Der »Bürger und Handelsmann« Henrich Grimm jedenfalls kam mit seinen Geschäften auf keinen grünen Zweig. Dies lassen die Steuerbücher des Magistrats in den siebziger Jahren des 17. Jahrhunderts überdeutlich erkennen: Gerade einmal zwei Gulden jährlich hat er zu entrichten. Da ist er bereits gestandener Familienvater. Später hat er – so lautet ein Beschluss des Stadtrates, der damals noch über die Belastbarkeit eines jeden Bürgers befand – nur noch zwölf Albus oder Weißpfennige im Jahr zu zahlen5, »weilen er ganz und gar von Mitteln kommen«. Wieder sieben Jahre später halbiert man sogar diese geringe Summe noch. Denn er hat sich – »ohne Abschied«, also ohne offizielle Zustimmung, wird eigens protokolliert – in die Vorstadt begeben, also seinen Wohnsitz außerhalb der Stadtmauer genommen. Und kein Bürger tat dies ohne zwingende Gründe. Denn mit diesem Schritt setzte er die Sicherheit seiner Habe, vielleicht sogar die seines Lebens aufs Spiel. Niemandem dürfte dies bewusster gewesen sein als Henrich Grimm und seiner im Krieg aufgewachsenen Generation.
Aber er schlug sich durch. Es scheint ihm ein bedingter Wiederaufstieg geglückt zu sein, und zu völliger Ehrlosigkeit sank er nie herab. So viel geht jedenfalls aus einem Eintrag für Henrichs Frau Juliana Maria im Totenregister des Jahres 1692 von der Hand des Küsters und Glöckners Johannes Mann hervor, der festhielt, dass aus Anlass von Julianas Heimgang das volle Geläut der reformierten Marienkirche ertönte. »Privilegien« dieser Art mögen heute sonderbar erscheinen, aber für die Gesellschaft der Frühen Neuzeit waren sie hochbedeutende Signale, denn Ehre brachte soziale und materielle Kreditwürdigkeit.
Vielleicht waren es die Beziehungen seiner Frau Juliana, die das Schlimmste vom glücklosen, aber braven Henrich abgewendet haben. Fünfzehn Jahre jünger als ihr Mann, stammte sie aus dem nassauischen Dillenburg und war eine geborene Pezenius oder Petzenius. Die Schreibungen des Namens gehen auseinander, so wichtig nahm man es nicht mit der Orthografie in dieser Zeit. Julianas Vater Peter war der erste Pezenius, der der Enge des Westerwälder Dorfpfarrhauses in die Stadt entkam und Karriere machte: Zum ersten, also obersten Stadtpfarrer in Hanau war er bestellt, seit 1653 neben seinem seelsorgerischen Amt sogar Inspektor, beaufsichtigte mithin die calvinistisch-reformierten Gemeinden in der Residenzstadt und in der umgebenden Grafschaft.
Das winzige Hanau – nicht größer als heute ein großes Dorf – war mehrheitlich calvinistisch. Denn 1595 machte Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg von seinem »Jus reformandi« Gebrauch. Dieses Recht, seinen lutherisch reformierten Untertanen seine calvinistische Konfession zu oktroyieren oder sie aus seinem Gebiet zu vertreiben, hatte der Augsburger Religionsfriede ihm und allen anderen »Ständen« (Fürsten) des Reiches verliehen. Mit dem Untergang der Münzenberger zwei Generationen später stand Hanau im Mittelpunkt eines konfessionellen Wettstreits: Während die Grafen von Hanau-Münzenberg reformiert waren, hingen die Hanau-Lichtenberger dem Luthertum an. Peter Pezenius musste also in einer Zeit, in der der lutherische Lichtenberger Graf Friedrich Casimir herrschte, die Interessen der calvinistischen Mehrheit verteidigen. Katholiken kannten die Hanauer nur als Durchreisende.
Inwieweit Peter Pezenius seiner Aufgabe gerecht wurde, ist nicht überliefert. Aber unstreitig ist, dass seine Tochter Juliana eine gute Partie war für Henrich Grimm, den Glücklosen, Rechtschaffenen. Mag sein, dass Juliana etwas Vermögen mit hineinbrachte in die Familie. Auch in spiritueller Hinsicht schlug Peter Pezenius’ Vorbild Wurzeln in der Familie Grimm. Denn Henrichs erster Sohn Friedrich folgte seinem mütterlichen Großvater im Dienst an calvinistischer Gemeinde und Kirche. Friedrich begründete damit, neben der juristischen, eine zweite Tradition der Grimms: die geistliche.
Im Vertrauen auf Gott und die Obrigkeit
Der Dreißigjährige Krieg hatte einige Throne umgestürzt, nicht aber die alte feudale Ordnung. Es brauchte noch mehr als zweihundert Jahre, bis deren Autoritäten überwunden waren: die der Kirchenoberen und vor allem die der weltlichen Fürsten. Bürgerliche Familien wie die Grimms waren es, die einen neuen, nicht auf Geburt oder sakramentaler Macht, sondern auf Talent, Verdienst und Bildung beruhenden »Adel« begründeten.
Den Grundstein dafür legten ironischerweise christliche Fürsten aller Konfessionen, die ihre Würde auch als Bürde und ihr Amt auch als Verpflichtung verstanden. So Graf Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg, indem er in Hanau bereits 1607 die Hohe Landesschule gründete – heute »Hola« gerufen. Zunächst sollte sie als »Paedagogium« oder »Gymnasium inferius« den Knaben diejenigen Fähigkeiten vermitteln, die sie für weiterführende Studien brauchen würden. Den Knaben, denn die damals vorgesehene allenfalls rudimentäre Mädchenbildung fand zu Hause oder an vereinzelt vorhandenen Mädchenschulen statt.
Die Ansprüche an die Kinder waren hoch, und es ist leicht vorstellbar, dass manch einer der kleinen Kerle, die vielleicht schon mit fünf Jahren in eine der Bänke hineingeklemmt wurden, die Angst als täglichen Begleiter kennenlernte – die Angst, geschlagen zu werden oder als Versager gemaßregelt von den Lehrern, von den Eltern oder von hochmögenden Wohltätern, die für ihren Unterhalt sorgten. Wir werden am Beispiel der Grimms noch sehen, wie wirkmächtig Sorgen dieser Art werden konnten.
Als »Gymnasium illustre«, als »Academie« bereitete die Hohe Landesschule fortgeschrittene Schüler später auf die Universität vor. Aber nicht nur das: Sie deckte bereits Fächer ab, die hauptsächlich den Universitäten vorbehalten waren: neben Medizin und Philosophie namentlich Jurisprudenz und Theologie. Im Alltag des 17. Jahrhunderts waren dies die bedeutendsten wissenschaftlichen Disziplinen. Denn die Paragrafen des weltlichen und des kirchlichen Rechts regelten das Leben der Menschen bis ins Detail. Sie galten für alle, ob edel geboren oder gemein – zumindest theoretisch. Am Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis entzündete sich der gerechte Zorn der Benachteiligten. Dieser machte später den Weg frei zu einer gerechteren und offeneren Gesellschaft.
»Holaner« wurde auch Friedrich Grimm, Enkel Peter Pezenius’ und Sohn Julianas und Henrichs. Als geistige Leitfigur zieht er eine leuchtende Spur durch die Familiengeschichte der Grimms, denn er ist die erste öffentliche Person dieses Namens. Geboren ist er 1672 in der Hanauer Neustadt. Friedrich ist noch nicht sechs, als man ihn einschult. Aber schon als Vierjähriger scheint Friedrich eine Vorklasse durchlaufen zu haben, in der er Lesen und vielleicht etwas Schreiben gelernt hatte. Zu diesem Zweck gab es die »kleine Schule« oder Hauslehrer. Auch seine Mutter konnte ihn sicherlich unterrichten, denn Pfarrer legten in der Regel Wert darauf, dass auch ihre Töchter lesen und schreiben konnten. Diese Fähigkeiten zahlten sich nicht zuletzt im Arbeitsalltag der Pfarrhäuser aus.
Bis Friedrich fünfzehn ist, ist das Paedagogium der Ort seiner Pflichterfüllung. Was er dort lernt? Der Elementarunterricht stellte im 17. Jahrhundert ganz andere Fächer in den Mittelpunkt als der heutige: nicht Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern Religionslehre und gesprochenes und geschriebenes Latein. Dazu kam Französisch, zumal dieses nach wie vor die Umgangssprache der hugenottischen Minderheit in Hanau war. Und wer waren seine Mitschüler? Sein Bruder Henrich zunächst einmal; andere Grimms sollten sich später zu irgendeinem Zeitpunkt in den Schulmatrikeln finden – zeitweise waren sechs von ihnen gleichzeitig am Paedagogium. Zeitweise wurde fast ein Drittel der Professorenschaft von grimmschen Verwandten gestellt – ohne diese weitverzweigte und hochproduktive Familie ging es eben nicht in Hanaus geistigem Leben.
Friedrich Grimm gehörte sichtlich zu den Schülern, deren besonders hohe Begabung es rechtfertigte, wenigstens am Gymnasium illustre weiterzustudieren, das sich nur darin von einer echten Universität unterschied, dass man hier nicht promovieren konnte. Tatsächlich findet er sich 1688 in der Schulmatrikel wieder – und nicht nur das: Sein Bildungsweg führt ihn 1691 für volle sechs Jahre zum Theologiestudium nach Bremen an das dortige Gymnasium illustre. Es stand zu dieser Zeit in voller Blüte und zog den reformierten Nachwuchs aus ganz Mitteleuropa und sogar aus Nordamerika und dem holländisch kolonisierten Ostindien an. Die Hessen waren neben den bremischen Landeskindern die kopfstärkste Gruppe. Hier konnte also Friedrich nicht nur weltläufig werden, sondern auch Beziehungen knüpfen, die ihm in seiner künftigen Tätigkeit vielleicht noch nützlich werden konnten. Nebenher nötigte die absolute Wahlfreiheit, was die besuchten Vorlesungen oder Disputationen betraf, ihn dazu, selbstständig zu planen und seinen eigenen Bildungsweg zu finden. Nicht einmal eine Abschlussprüfung hatten die Studenten zu absolvieren. Allein die individuellen Zeugnisse der Professoren entschieden über die Karrierechancen ihrer Schüler.
Geradezu paradiesische Aussichten vielleicht aus der Sicht heutiger Studenten – aber rigorose Disziplinarregeln sorgten dafür, dass es den jungen Herren nicht zu wohl wurde: An jedem zweiten Tag hatte der Gottesdienst besucht und das Abendmahl eingenommen zu werden – und kein Einlass galt ohne Bibel und Psalter. Waffentragen und Duelle – »das verfluchte Balgen, Ausfordern, Sekundieren, das wilde wüste Wesen Abends auf den dunklen Straßen«, wie ein Dekret des Gymnasialrats geradezu poetisch lautet – waren ihnen untersagt ebenso wie private Trinkgelage, der Besuch von Bier- und Weinschenken oder gar der Verkehr mit »leichtfertigen Personen«, vulgo Prostituierten. Für derlei Entbehrungen durften sie sich – so die Empfehlung des Rates – bei körperlichen Übungen und beim Botanisieren in der freien Natur vor der Stadt schadlos halten.
Friedrich Grimm lernte offenbar gut – aber nicht alles, was er lernte, konnte seinen orthodoxen Mentoren gefallen. Denn im Kollegium des Bremer Gymnasiums tummelten sich verdächtige Neuerer: der Pietist Theodor Undereyck und sein Kreis, dem auch der Dozent Cornelius de Hase – mit dem Friedrich sich anfreundete – und vermutlich am Ende Friedrich Grimm selbst angehörte. Dennoch wird er 1698 zum dritten Pfarrer der reformierten Hanauer Marienkirche berufen, 1699 zum Hofprediger im zweieinhalb Meilen entfernten Marienborn– drei Wegstunden zu Fuß von Hanau entfernt. Hier regieren außergewöhnlich tolerant und pietistisch-gottesfürchtig die feudalen Nachbarn der Hanauer Grafen, die Grafen von Ysenburg.
Hocherfreut sicherte Friedrich Grimm dem Grafen und seiner Frau brieflich seine Loyalität zu und trat sein Amt an. Die Strecke zwischen Hanau und Marienborn war selbst zu Fuß leicht in einem halben Tag zu bewältigen. So ist es wahrscheinlich, dass der junge Hofgeistliche in regem persönlichem Kontakt mit seiner Familie und Vaterstadt verblieb, zumal er verlobt war und sich mit allerhöchster »Concession« wenige Tage nach Antritt seiner Marienborner Pfarrstelle im Juli 1699 verheiratet hatte – mit der Hanauerin Maria Magdalena Stahl, einer geborenen Jean-Jean, hugenottischer Herkunft ausweislich ihres französischen Mädchennamens, sechs Jahre älter als er und Ehe-erfahren. Ein »Anticipando«, ein Vorschuss aus der gräflichen Hofkasse, ist nötig, damit das private »freuden u: liebesmahl«, also die Hochzeitsfeier, zu der der Graf persönlich und sein Sohn eingeladen sind, standesgemäß ausfallen kann. Es geht also familiär zu in den kleinen Fürstentümern. Und ohne derart freundliche Fürsten – und Fürstinnen – in der Familiengeschichte wäre die generationenlange Treue der Grimms zu ihren feudalen Dienstherren kaum erklärbar.
Die Bitte um Vorschuss zeigt: Die Grimms waren klamm; aber sie hatten gelernt, mit dem Mangel kreativ umzugehen und zu improvisieren. Die Braut kommt – einmal mehr – aus einem Wirtshaus und dürfte einen entsprechend praktischen Sinn gehabt haben. Daneben preist Friedrich sie in einem Brief an den Grafen als »tüchtig, mit einem unsträflichen Wandel einer Gemeine auch vor zu leuchten«. Ihr Licht erlischt rasch, schon nach einem knappen Jahr stirbt Maria Magdalena im Kindbett mit dem ersten Sohn Johannes, der überlebt. Eine alltägliche Tragödie, wie die meisten Menschen sie wiederholt abzuwettern hatten. Verschärft wurde sie dadurch, dass Friedrich schon wieder auf dem Sprung war.
Denn er kehrte in seine Heimatstadt zurück, um dort ein Amt als zweiter Prediger der reformierten Marienkirche anzutreten – wo offenbar bereits eine neue Braut auf ihn wartete: Juliane, Tochter des kurz zuvor verstorbenen hanauischen reformierten Inspectors Johannes Hake oder modisch-gelehrt Hackenius. Der erneut knappe Zeitabstand zwischen dem Antritt seiner Stelle und dieser Hochzeit deutet darauf hin, dass er vorausschauend den Hanauer »Heiratsmarkt« nach Jungfrauen von passendem Stand sondiert hatte. Mit der neuen Ehe, die ein Vierteljahrhundert hielt, bis Julianes Tod sie schied, war Friedrich Grimms Laufbahn vorgezeichnet. Juliane passte zu seinen Karriereambitionen. Sie passte aber offensichtlich auch in anderen Angelegenheiten, die nur Eheleute etwas angehen, denn sie gebar mindestens sieben Kinder, unter ihnen 1703 Christina Margarete, ihre Älteste, und 1707 den Stammhalter Friedrich.
Und fünf Jahre später erreichte Friedrich der Ältere als erster Pfarrer, Konsistorialrat und Inspector den Gipfel seiner Laufbahn. Vierunddreißig Jahre war er da alt. Aus dem Seelsorger war ein Kirchenpolitiker und politischer Mensch geworden, der das Amt des Kircheninspectors der Grafschaft Hanau versah, mit ihren 50 000 Bewohnern und vierzehn Ämtern von Bockenheim nördlich Frankfurt bis nach Schlüchtern auf zwei Dritteln des Weges nach Fulda. Als Inspector beerbte er praktischerweise seinen kürzlich verstorbenen Schwiegervater. In sehr weitreichendem Sinn hatte er die Aufsicht und Verantwortung für einen der weltlichen Obrigkeit genügenden und gottgefälligen Zustand von Gemeinden, Amtsträgern und Gemeindegliedern. Auch die Schulen gehörten zu diesen Institutionen. Um dieser Aufsicht in den Landgemeinden nachzukommen, musste ein Inspector beschwerliche Wege auf sich nehmen, was körperliche Tüchtigkeit und Zeit voraussetzte. Friedrich Grimm hatte diese in seiner Marienborner Zeit bereits unter Beweis gestellt.
Friedrich Grimm hatte erkannt, dass es galt, Verwahrlosung durch Ordnung zu ersetzen, und er war der richtige Mann dafür. Er musste konkret dafür sorgen, dass die einzelnen Pfarreien das Kirchenrecht einhielten und so ausgestattet waren, dass sie ihre Aufgaben verrichten konnten. Diese Stellung brachte regelmäßige Reisen mit sich – die von lässigen Dorfgeistlichen sicherlich gefürchteten »Visitationen«.
Reisen zum Beispiel in das Amt Steinau, »das kleinste unter den Hanauer Ämtern«, wie das aufklärerische »Hanauische Magazin« 1781 bemerkt, »indem solches nur aus einer Stadt, einem Dorfe und Hofe besteht«. Sechs Meilen und also eine halbe Tagesreise nordöstlich der Residenzstadt Hanau gelegen »an der Straße«, der schnellsten Verbindung der verschwisterten Grafschaften Hanau und Kassel. Via Regia hieß sie auch und war eine Teilstrecke der mittelalterlichen Handels- und Heerstraße zwischen der Kaiser- und Messestadt Frankfurt und dem für Kaufleute nicht minder wichtigen mitteldeutschen Leipzig. Die Leipziger Frühjahrsmesse und die Frankfurter Herbstmesse gaben den Pulsschlag vor, mit dem Güter und Geld durchs deutsche Land flossen. Einzig im Buchgewerbe hat sich dieses Brauchtum bis heute erhalten. Ein Rinnsal war dieser Fluss von Geld und Gut, wenn wir ihn mit den heutigen alles verschlingenden Warenströmen vergleichen. Es gab Tage, da war man froh, wenn ein einziger Kaufmannswagen zwischen den Schlagbäumen der Zollstation am Burgmannenhaus von Steinau passierte. Oder eben Friedrich Grimm, wenn er zu einer seiner Visitationen unterwegs war – allein oder, wie es damals nicht unüblich war, begleitet von einem seiner älteren Kinder, namentlich seinem Ältesten Friedrich, den wir in der Folge als »den Jüngeren« kennenlernen werden.
»Steinau an der Straße«, so der offizielle Name bis heute, wird für die grimmsche Familiengeschichte hochbedeutend werden. Eine weitsichtige Politik hat in Steinau dazu geführt, dass eine zerstörerische Modernisierung die historische Atmosphäre der Stadt bis heute kaum berührt hat. Hier steht das einzige äußerlich unverändert erhaltene Wohnhaus der »Märchenbrüder« Grimm und ihrer Geschwister und Eltern. Hier empfingen einige der Hauptfiguren der Grimms tiefe Prägungen. Hier vollzieht sich ihr weiterer Aufstieg dank vorsichtig-gewissenhafter Pflichttreue, Verdienst und Loyalität – Tugenden, die Friedrich Grimm seiner Gesellschaft und seiner Familie weithin sichtbar vorlebte. Verdienst und Treue – aus diesen beiden Zutaten bestand die »Rezeptur«, die die Grimms nun in jeder folgenden Generation aufs Neue ansetzten. Das Vertrauen in die Gottgefälligkeit und weltliche Wirksamkeit dieser Rezeptur formte nicht allein diese Familie, sondern Generation um Generation des deutschen Bürgertums. Es sorgte für seinen Aufstieg und für den Stempel, den diese Klasse der modernen Gesellschaft aufdrückte – und es war maßgeblich mitverantwortlich für die fürchterlichen zivilisatorischen Abstürze Deutschlands im 20. Jahrhundert.
Dem Inspector war nicht nur der beklagenswerte Zustand von Kirchen und Schulgebäuden ein Dorn im Auge, sondern mehr noch die gleichgültige Einstellung vieler Eltern zum Unterricht. Ohnehin schon waren die älteren Bauernkinder zwischen Pfingsten (das zwischen Mitte Mai und Mitte Juni zu liegen kommt) und Michaelis (am 29. September) bis auf eine einzige tägliche Unterrichtsstunde freigestellt, um ihren Eltern in deren Landwirtschaft zu helfen. An dieser einen Stunde hielt die Schulordnung eisern fest, denn die Gefahr war zu groß, dass die Kinder bis zum Herbst alles vergaßen, was sie bis zum späten Frühjahr gelernt hatten. Dem Inspector missfiel weiter, »daß es im unterricht meistentheils bey dem bloßen außwendiglernen und recitiren verbleibet, und der verstand dessen denen kindern nicht zugleich beygebracht, noch diese zum nachsinnen auff daß was sie gelernet haben, angeführet werden«. Sätze wie diesen hätte später sein Urenkel Jacob Grimm sicherlich unterschrieben – er verweist schon auf einen Begriff von Bildung, der erst im 19. und 20. Jahrhundert Gemeingut wurde. Sein Sohn Friedrich der Jüngere, mittlerweile Pfarrer in Steinau, meldete sich einige Male mit der Bitte um Unterstützung der Armen mit »Bibeln, Testamenten, Gesangbüchern, Lobwasser’schen Psaltern6, Kinderlehren und ABC-Büchern«. Er erhielt sie; namens des Konsistoriums – der obersten Kirchenbehörde – kümmerte sich sein Vater um alle Details.
Die Liebe zum Detail – bemüht mal lustvoll um Ordnung des Ungeordneten, mal sorgsam um Vermeidung von Fehlern – scheint den Grimms eigen zu sein; das belegt bereits die Vielzahl an Denkschriften, Verordnungen und Anweisungen, die Friedrichs Unterschrift tragen und ihn nicht primär als inbrünstigen Mystiker, tiefgründigen Theologen oder in seine Gemeinde eingewurzelten Seelsorger erweisen, sondern eher als sorgfältigen und politisch geschickten Verwalter in der Tradition seiner Voreltern wie Henrich Grimm. Etwa seine »Hypotyposis oder kurze Darstellung von den Dingen, die im Amt der Kirche verlangt werden durch die Autorität und auf Geheiß des höchst angesehenen und verehrungswürdigen Reformierten Konsistoriums«, seine frühe »Schulordnung auff dem land« oder sein »Sendschreiben an die unter seiner Aufsicht stehenden Prediger vom erbaulichen Predigtamt«.
Wofür tat er all dies? Sicher für den Glauben; aber er hatte auch eine wachsende Familie zu unterhalten. 190 Gulden in Silber erhielt er jährlich dafür, dazu freie Wohnung und »Emolumente und Accidenzien« (Naturalien) im Wert von etwa 200 Gulden – nämlich Dienstwein, verschiedene Getreide, Holz, Stroh sowie drei Gärten und zwei Wiesen zur eigenen Bewirtschaftung, was voraussetzt, dass er Personal oder Tagelöhner beschäftigte. Der Herr Pfarrer als Landwirt – kein Wunder also, sollte es im Konsistorium manchmal umstandslos und etwas hemdsärmelig zugegangen sein.
Ob Friedrich Grimm nicht nur ein guter Vater seiner Gläubigen, sondern auch ein guter Vater seiner Kinder war, darüber lässt sich nur spekulieren. Seine Werke und die Kirchenbücher geben darüber nur spärliche Auskunft, und an privaten Briefen mangelt es. Auf einem Porträt von 1741 tritt uns der Urgroßvater der Brüder Grimm fast siebzigjährig leibhaft entgegen: im schwarzen Samttalar mit akkurat gestärktem weißen Beffchen zwischen den Enden der weiß gepuderten Allongeperücke, zu dem der strenge Blick und der lehrhaft erhobene rechte Zeigefinger passen. Seine Linke dagegen, die Herzhand, ruht auf einer Seite der geöffneten Heiligen Schrift mit dem Christusversprechen: »Ego sum vitis vera et vos palmites, qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum« – Ich bin der wahre Weinstock und ihr die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Dieses Porträt begegnet uns wieder als bildlicher Appell zur aufopfernden Pflichterfüllung in Jacob Grimms von Büchern verstopftem Berliner Arbeitszimmer.
Furchtbar-tatkräftige Vaterfigur der Grimms: Friedrich Grimm der Ältere. Der Maler des Porträts ist unbekannt.
Es ist leicht vorstellbar, dass Friedrichs drastische Bußpredigten, für die er berüchtigt war, gläubige Menschen erschütterten. Sein Rezept für seine Gläubigen: Gottesfurcht als Heilmittel der Furcht vor der Unbeständigkeit und Unsicherheit der menschlichen Verhältnisse und Pläne. »Vor allem die Furcht Gottes« sollten die Kinder in seinen Schulen erlernen …
Lassen wir uns einmal in Jacob und Wilhelm Grimms »Deutschem Wörterbuch« über »Furcht« belehren. Einer der längeren Artikel in dem gigantischen Werk; über fünf Seiten häuft Jacob Grimm fast obsessiv Beispiel auf Beispiel und definiert Furcht als »eine unangenehme, veranlaszt durch eine wirkliche oder mögliche, auch blosz eingebildete gefahr, durch ein übel das zukommt oder zukommen kann, eben so wol eine unangenehme seelenregung in beziehung auf ein wesen das diese gefahr oder dieses übel zukommen läszt oder doch zukommen lassen kann«. Eine Bedingung des Menschseins; in der christlichen Theologie hat sie einen Ehrenplatz als der wirkmächtige Widerpart des »Trostes«. »Ich weysz wol, wo mein trost und trotz stehet, der mir wol sicher stehet für menschen und teuffeln«, wird Luther im Wörterbuch zitiert. Dieser Satz könnte als Motto über dem Leben der Grimms stehen. Trost und Trutz, Heilmittel der heillosen Furcht sind Gehorsam, Loyalität und disziplinierte Arbeit. Nach calvinistischer Lehre, der die Grimms seit jeher anhingen, beweist der irdische Lohn der Arbeit die Zugehörigkeit zu den wenigen, die Gott bereits vor allem Anfang zur Erlösung begnadet und nicht zur Verdammnis ausersehen hat. Bei Jacob schlägt, wie wir später sehen werden, diese Haltung aus bitterer Lebenserfahrung um ins fast Manische, mit dem er seine Familie treiben – und auseinandertreiben – wird.
Auch von Friedrich Grimm dem Jüngeren gibt es ein gemaltes Porträt. Anders als das seines Vaters findet es sich allerdings nicht in den detailreichen Interieurs der grimmschen Berliner Wohnungen wieder. Der unbekannte Künstler hat Züge von schalkhafter Güte in das Gesicht seines Modells eingetragen – der Betrachter ist geneigt, dem Sohn des energisch-bärbeißig wirkenden Inspektors tiefe seelsorgerische Neigungen, aber auch eine gewisse Schlitzohrigkeit abzunehmen.
Ein Karrieremacher war Friedrich der Jüngere nicht. Der Vater versucht den Zwanzigjährigen an der Hola, die er selbst durchlaufen hatte, als Professor für Philologie und Kirchengeschichte zu installieren – der Landgraf lässt dankend ablehnen. Nun zog es ihn, erneut durch den Vater vermittelt, aus der Residenzstadt hinaus wie einst den Vater, der in Marienborn seine Chance gesucht hatte – nur dass dieser bei guter Gelegenheit aus ysenburgischen Diensten nach Hanau zurückgekehrt und dort aufgestiegen war. Anders der Sohn: Das Städtchen Steinau, das er aus seiner Kindheit kannte, wurde seine Heimat auf Lebenszeit und prägte die grimmsche Familiengeschichte so tief, wie Friedrich seinerseits als Pfarrer die Stadt prägte.
Seelsorger, kein Karrieremann: Friedrich Grimm der Jüngere.
In dieser steinauischen »Grimmheimat« können wir den ersten auch heute noch aus damaliger Zeit erhaltenen Lebensspuren der Brüder Grimm begegnen und sie mit dem Anblick vergleichen, der sich vor zwei Jahrhunderten den Grimms bot. Wir dürfen Steinau sogar das spirituelle Zentrum der Grimms nennen – auch wenn diese zunächst rein physisch dort geboren wurden, aufwuchsen, lebten und starben. Wir wissen von zehn Kindern, die Friedrich der Jüngere in zwanzigjähriger Ehe zeugte, als Siebenundzwanzigjähriger verheiratet mit Christine Elisabeth Heilmann, Tochter eines Amtmanns aus dem Vogelsberger Städtchen Birstein. Zwar wirkten am Ort zwei examinierte Hebammen, aber die elfte Geburt überlebten weder Mutter noch Sohn. Und nicht nur die Kinder des Paars belebten das Pfarrhaus direkt neben dem gotischen Rathaus – fast jederzeit beherbergte es dieses oder jenes Geschwister oder andere Verwandte, wenn diese etwa in Bedrängnis waren. Aus der langen Geschwisterreihe sind die Älteste, Juliane Charlotte Friederike, 1735 geboren, und der 1751 geborene Jüngste, Philipp Wilhelm, besonders bedeutsam. Juliane wurde wie ihr kleiner Bruder in Steinau geboren und starb auch dort, und wie dieser zog sie als Erwachsene nach Hanau: als Frau des in Hersfeld gebürtigen Klosterrentmeisters – also Finanzverwalters – und Kammerschreibers Jacob Ludwig Schlemmer. Julianes Ehe blieb ohne Kinder, bis der Rentmeister früh starb. Juliane wäre wohl allein geblieben, wenn ihr Bruder Philipp sie nicht später dringend gebraucht hätte.
Lebenslanger Sehnsuchtsort der Grimms: das Steinauer Amtshaus, die einzige noch unverändert erhaltene Lebensstätte. Von Ludwig Emil Grimm.
Um die Kirche drehte sich das ganze Leben des Großvaters der Brüder Grimm. Er war Seelsorger mit Leib und Seele. Kirche war, wo er war. Sein Amtsort war die Katharinenkirche, das älteste Steinauer Gotteshaus. Es stammte »noch aus dem Papsttumb«, also aus dem Mittelalter, und war seitdem mehrfach erweitert worden. Die Steinauer waren stolz auf das Geläut, in deren Zentrum die mächtige Katharinenglocke stand. Sie war in die Jahre gekommen, so wie das Joch, an dem sie hing, und Pfarrer Grimm musste mehrfach mahnen, sie zu schonen und nicht allzu heftig zu läuten, woran eine kleinere Glocke bereits zuschanden gegangen war.
Einigkeit mit den Presbytern, den Gemeindeältesten, dürfte in der Sache des Glaubens bestanden haben, in der der »gehorsame Sohn Fr. Grimm« kompromisslos agierte. Unterstützt vom Presbyterium und notfalls vom Hanauer Inspectorat, ging er gerade in seinen jungen Jahren unerbittlich vor gegen das nächtliche Viehaustreiben zum Pfingstborn und andere abergläubische Bräuche der Bauern – von denen viele kurzzeitige Ausbrüche aus freudloser Alltagsroutine bedeuteten –, schlechte Kindererziehung und Unmoral im Familien- und Sexualleben und verbreitete damit Unbehagen und manchmal Angst und Schrecken. Wenn Tanzereien an Tauftagen nicht aufhörten, würde er keine Kinder mehr taufen. Einer Frau, die ihren Mann verlassen hatte, verweigerte er vier Jahre lang das Abendmahl, und beugte sich erst einer entsprechenden Anordnung des Hanauer Konsistoriums, letztlich also seines Vaters. Ebenso streng war sein Verdikt über einen Steinauer »brandewein sauffer, flucher, Bürger und Schuhmacher«, der sich bei Schnee und Frost am Ohlberg verirrt hatte und erfroren war. Ohne Glockenschlag und Leichpredigt ließ er ihn begraben »zur warnung und spiegell Vor mehrere sauffer und Verwegene leuthe hieselbsten«. Später lehrte ihn das Leben, milder zu verfahren, etwa, als er sich für die »Schanddirne vulgo Lumpenluisa« starkmachte, die der Rat der Stadt und ihr eigener Vater aus der Grafschaft jagen wollten, da sie unehelich schwanger war.
Auch die Missionierung für die reformierte Kirche betrieb Friedrich der Jüngere leidenschaftlich, wenn auch nicht immer fair, sandte etwa den Schulmeister aus, um lutherische Mütter so lange zu drangsalieren, bis sie ihre Kinder in die reformierte Schule schickten, oder versprach Konvertiten wirtschaftliche Unterstützung – zum großen Verdruss der Lutherischen. Überhaupt begleiten Kämpfe um seine Autorität Friedrichs Leben in Stadt und Gemeinde Steinau. Die Presbyter und sein Vater halten ihm die Stange – auch gegen wiederholte Vorwürfe, er vernachlässige seine Amtspflichten oder bereichere sich unzulässig. Es ging zuweilen rabiat und sogar ruchlos zu in der Stadt.
Während Pfarrer Grimm also den Mangel bestmöglich verwaltete und fehlende Mittel durch persönlichen Eifer zu kompensieren suchte, ging es ihm nicht schlecht im barocken Pfarrhaus. Zwar klingen seine jährlichen Bezüge nicht eindrucksvoll: 50 Gulden von der Herrschaft, 15 von der Kirchenbaukasse und weitere 25 von verschiedenen anderen Gebern. Aber jede Trauung schlug mit anderthalb Gulden zu Buche, auch die Taufen und Leichpredigten warfen einen kleinen Betrag ab, und wenn ein »gefallenes Mädchen« vorsprach, um sich seelsorgerlich abmahnen zu lassen, musste es anderthalb Gulden Bußgeld im Pfarrhaus lassen. Und das, was in Silber und Kupfer hereinkam, war nur das Sahnehäubchen. Denn die ihm zustehenden Naturalien sorgten für den täglichen Bedarf der Familie: Roggen, Gerste und Hafer von der Herrschaft, Weizen, Roggen, Gerste und Hafer vom Kloster Schlüchtern, Brennholz von der Herrschaft ebenso wie Lämmer zum Schlachten und Wein für den Tisch, Kraut und Rüben, acht Wagen Heu fürs Vieh, Roggenstroh vom Viehhof und vom Klosterhof Lindenberg. Zusätzlich durfte er auf eigene Rechnung einige Gärten, Wiesen und Äcker bestellen und seine Rinder und Schweine »Hirtenlohn- und mast frey« halten, musste also den Gemeindehirten keine Gebühr für die obligate Weide zahlen. Auch die Brauabgabe für sein selbst gemachtes »Hausbier« war ihm erlassen. Es war dem Herrn Pfarrer sogar gestattet, von seinem Weindeputat gegen Bezahlung an die Steinauer auszuschenken und die örtlichen Schankwirte zu unterbieten, wie ein Streit zeigt, den die Kontrahenten bis vor den Amtmann trugen. Dieses Gemisch von Einkünften musste neben allen anderen Angelegenheiten verwaltet werden; aber es sicherte gleichzeitig den bescheidenen Wohlstand im Pfarrhaus gegen Krisen ab.
Not brachte später der Siebenjährige Krieg über die Stadt und die umliegenden Dörfer – und über die Grimms. Französische Truppen besetzten von 1756 bis 1762 die Grafschaft Hanau. Die Via Regia war für die Aufmärsche der Franzosen und ihrer süddeutschen Verbündeten äußerst wichtig. Steinau musste all diese Jahre Durchmärsche, Einquartierungen, Brandschatzungen, Kriegsfron und Subsidien erdulden. So hießen erzwungene Lieferungen von Proviant und anderem Truppenbedarf. Sogar ein Lazarett richteten die Franzosen in Steinau ein. Die Truppen raubten die Magazinscheuer mit den Vorräten aus, zertrümmerten die Waage im Rathauskeller, demolierten die Wachthäuser und richteten mancherlei Zerstörungen in den Bürgerquartieren an. Betrunkene Soldaten schlugen Fensterscheiben ein – auch im reformierten Pfarrhaus. Durchziehende bewaffnete Marodeure und Deserteure, die angeblich ihre Regimenter suchten, bedienten sich an der Habe der Steinauer. Eine Missernte verschärfte den Übelstand zusätzlich. Der Schulunterricht kam zum Erliegen. Als das Kriegsglück sich zuungunsten der Franzosen wendete, erging es den Steinauern nicht besser. Nun waren es die Preußen und ihre Verbündeten, die ihnen das Leben schwer machten, indem sie zum Beispiel die Bauern- und Handwerkersöhne zwangsrekrutierten.
Der Siebenjährige Krieg gab also den Menschen genügend Gelegenheit, ihre Erinnerung an die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges und besonders an die der Franzosen aufzufrischen. Und auch in Friedenszeiten ist das Land nicht sicher. Die Gefahr durch das herumschwirrende Diebsgesindel und Bettelvolk sei so groß, dass er nachts einen Bediensteten bei Licht wachen lassen müsse, sagt Friedrich. Denn nur der Kirchhof trennt den Hof des Pfarrhauses von der Außenwelt. Und wo die Toten der Auferstehung entgegenruhen sollen, lärmt nachts das lose Gesindel. Wirft Steine an die Fenster des Pfarrhauses, um auszuprobieren, ob jemand wach sei. Dringt in den Keller der Kirche ein, um den Abendmahlswein wegzuzechen.
Der Tod trifft Friedrich Grimm fünfzehn Jahre nach dieser Bedrängnis, kurz nach seinem siebzigsten Geburtstag. Wenige Wochen zuvor hat er infolge seiner zerrütteten Gesundheit seinen Abschied aus dem Amt genommen. In den fast fünfzig Jahren seines Steinauer Wirkens hat er der Stadt seinen Stempel aufgedrückt – sogar ihrer Architektur. Denn er setzte es durch, dass ein kleines Tor in die Kirchenmauer gebrochen wurde, damit er schneller vom Pfarrhaus ins Gotteshaus gelangen konnte und nicht ums Rathaus herumgehen musste. Kann man sich eine klarere Unabhängigkeitserklärung der geistlichen Obrigkeit von der weltlichen vorstellen?
Aber auch seine Familie prägte Friedrich Grimm tief. Zwar zeigte sich rasch, dass an seinem 1751 geborenen Jüngsten Philipp Wilhelm kein Kanzelmann verloren ging. Aus Langeweile beschnitzte dieser während der Predigt lieber die Kirchenbank. Aber die Ehrfurcht vor den Vätern – dem himmlischen und dem irdischen – hatte Friedrich auch Philipp eingepflanzt. Dieser gab sie weiter an die neue Generation. Sein Ältester, Jacob Grimm, der im Gedenken an Großvater Friedrich ursprünglich Pfarrer werden sollte, verlieh dieser Bestimmung einmal im kindlichen Spiel Ausdruck, indem er auf einem Stuhl stehend seinen Geschwistern eine Predigt hielt. Immerhin wurde er später zum öffentlichen Redner, wenn auch in der weltlichen Gemeinde der Wissenschaft und in der des Parlaments. Und die Bilder der verstorbenen Familienoberhäupter begleiteten die Brüder Grimm auf ihren Lebenswegen. Um 1860 – sie waren längst alte Männer – aquarellierte der Thüringer Maler Moritz Hoffmann die Arbeitszimmer der beiden in ihrer letzten Berliner Wohnung in der Linkstraße 7. Während Jacob arbeitete – immer noch in rasender Geschwindigkeit, als wäre jemand hinter ihm her –, fixierten ihn von hoch oben auf einem der vielen Bücherregale, mit denen der große Raum vollgestellt war, die Ahninnen und Ahnen. Ganz so, als wachten sie schützend und kontrollierend über dem jetzigen Familienoberhaupt, ob es seinen drückenden Verpflichtungen tatsächlich gerecht werde.
Philipp Wilhelm schloss sich trotz seiner Alltagsfrömmigkeit nicht an die theologische, sondern an die ältere, staatsdienende Familientradition der Grimms an. Über die Umstände seiner Kindheit und Jugend im Pfarrhaus von Sankt Katharinen wüssten wir gern mehr. Die Tragödie seines kurzen Lebens ließ es allerdings nicht zu, dass er sich schriftlich Rechenschaft darüber gab. Was er seinen Kindern darüber erzählte, fand nur zum allergeringsten Teil seinen Weg in deren Erinnerungsschatz. Seine Frau wusste sicherlich mehr, aber sie behielt es, der damaligen Frauenrolle entsprechend, für sich.
Philipp durfte, nachdem er die harte Steinauer Schule des Dorflehrers Präzeptor Zinckhan durchlaufen hatte, mehrere Jahre wohl zu Fuß ans Schlüchterner Gymnasium pilgern, täglich eine gute Stunde hin, eine Stunde zurück, und anschließend mit neunzehn Jahren in Marburg Rechtswissenschaften studieren. Nach zwei Generationen von reformierten Pfarrern ist er der erste Grimm, der sich auf höchstem Niveau dem Dienst an der zweiten großen Autorität neben der Kirche widmete.
Der frühe Tod des Vaters Philipp Wilhelm überschattete die Kindheit der Grimms. Gemälde von Georg Carl Urlaub.
Er mag seinen Söhnen einiges von seinen Studentenjahren erzählt haben, die auch damals jeden Menschen für das Leben prägten – Jahren der Freiheit und Ungebundenheit. Student zu sein war auch in der Frühen Neuzeit ein Schwebezustand zwischen beschützter Knabenheit und männlicher Verantwortung und Disziplin. In Vorwegnahme künftiger Einschränkungen erlegten sich vor allem die gut betuchten Kreisen entstammenden Studiosi möglichst wenige Zwänge auf. Da sie, soweit sie dem Adel angehörten, berechtigt waren, scharfe Waffen zu tragen, waren sie der Schrecken der von ihnen verachteten »Spießbürger«. Sie stellten ihren Mädchen nach, gingen keiner Rauferei aus dem Weg und hinterließen auf ihren kleinen »Schlachtfeldern« nicht selten blutende Opfer. Daran konnte auch die drakonische Disziplin nicht viel ändern, deren schärfstes Mittel vor der Relegation – dem endgültigen Verweis von der Universität – der Freiheitsentzug im Karzer war.
Anders bürgerliche Studenten: Ihnen ebnete nicht ihr Stand allein frag- und risikolos den Weg an die Universität, wie es später Jacob Grimm bei seinem adeligen Mitschüler und Freund Otto von der Malsburg mitansehen musste. Oft waren sie für die teuren Hörgebühren und ihren Unterhalt auf Stipendien angewiesen. Dazu mussten sie sich anfangs durch gute Zeugnisse ihrer bisherigen Lehrer beglaubigen und nachfolgend permanent durch Leistung bewähren. Kein Wunder also, dass sie lernten zu arbeiten und wirtschaftlich zu denken – anders als so mancher adelige Jüngling. Diese Selbstwirksamkeit und das daraus resultierende Selbstvertrauen werden wir später bei Jacob wiederentdecken – aber auch deren Kehrseite, die Getriebenheit.