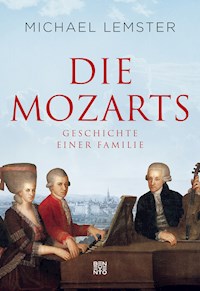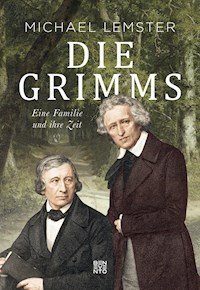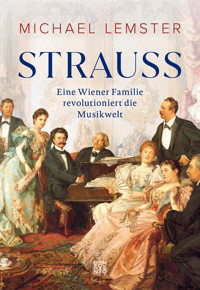
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Aufstieg einer Künstler-Dynastie, die Musikgeschichte schrieb Das 19. Jahrhundert in Wien war eine Zeit großer Veränderungen: Nach Krieg und Einschränkungen sehnte sich das Volk nach Zerstreuung – ungeachtet der staatlichen Repressionen durch das System Metternich. Eine Wiener Familie wusste das für sich zu nutzen: Was Johann Strauss Vater, Komponist des Radetzky-Marschs, begann, führte sein Sohn, der "Walzerkönig", erfolgreich fort. Michael Lemster zeichnet die Geschichte dieser Familie nach, die sich aus ärmlichen Verhältnissen zu absoluten Stars der Musikwelt hocharbeitete. Ein spannender Einblick in die Entstehung des internationalen Unterhaltungsbusiness! - Berühmte Musiker: Die Geschichte der Familie Strauss zwischen Fakten und Legenden - Zeit für ein Tänzchen: Warum der Walzer ein fulminanter Erfolg wurde - An der schönen blauen Donau: Musik und Geselligkeit gegen politische Unterdrückung - Johann Strauss Sohn, Vater und die Frauen der Familie: Ein Künstlerimperium - Aus der Armut zum Erfolg zwischen Biedermeierzeit und Belle Époque Wie das Kulturerbe Walzer einer Familie zu Wohlstand verhalf Johann Strauss Vater und seine Geschwister hatten als Kinder eines Wiener Wirts keinen einfachen Start ins Leben. Umso größer war der Drang, es zu etwas zu bringen. Von der Gastronomie führte der Lebensweg die Familie zur Kunst – und von dort zu unglaublichen internationalen Erfolgen. In der Nacherzählung vieler kleiner Begebenheiten rund um die "Sträusse" und dem Aufdecken so mancher Irrtümer macht Michael Lemster ein Stück Musikgeschichte greifbar. Ein spannendes Buch über eine faszinierende Familie und eine Tanzmusik, die sie unsterblich machte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Canaletto-Blick«: Blick vom Oberen Belvedere auf die Innere Stadt um 1760. Gemälde von Bernardo Bellotto, gen. »Canaletto«
MICHAEL LEMSTER
STRAUSS
Eine Wiener Familierevolutioniert die Musikwelt
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Wir haben versucht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Sie dennoch Unstimmigkeiten im Bildnachweis feststellen, so bitten wir Sie, uns diese nachzusehen und sich an den Verlag zu wenden.
Der besseren Lesbarkeit wegen verwendet der Autor im nachfolgenden Text die Sprachform des generischen Maskulinums. Personenbezogene Aussagen beziehen sich auf alle Geschlechter.
1. Auflage
Copyright © 2024 by Michael Lemster
Copyright deutsche Erstausgabe © 2024 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Dieses Werk wurde vermittelt durch Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Oliver Domzalski, Hamburg
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Proxima Nova, Juana, Novel Pro
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © akg-images / De Agostini Picture Lib. / A. Dagli Orti,
© Austrian Archives (AA) / brandstaetter images / picturedesk.com
Karte und Stammtafel im Vor- und Nachsatz: © Peter Palm, Berlin
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN: 978-3-7109-0165-2
eISBN: 978-3-7109-5153-4
Inhalt
Vorwort
Totenklage
Teil I VOR-GESCHICHTEN
Kapitel 1: Keine Erinnerungen an Pesth: »Bürgerlicher Bürwirth« in der Leopoldstadt
Kapitel 2: Wiener Launen-Walzer: Ein Reich setzt sich neu zusammen
Kapitel 3: Es gibt nur ein Wien! Die Stadt, die Wiener, der Wein, die Wirte
Teil II WALZERKÖNIG: DER GRIFF NACH DER KRONE
Kapitel 4: Heimath-Klänge: Frühe Jahre eines »Kaschemmenkönigs«
Kapitel 5: Wein, Weib und Gesang: Als Wien tanzte und Berlin turnte
Kapitel 6: Wiener Kreuzer-Polka: Vom »Bratlgeiger« zum »Musik-Director«
Kaptitel 7: Eisenbahn-Lust-Walzer: Zusammenwachsen zu Land, auf Wasser und Schiene
Kapitel 8: Sperls Fest-Walzer: Die Walzerfabrik
Kapitel 9: Morgenblätter: Presse, Werbung, Öffentlichkeit zur Strauss-Zeit
Teil III KINDHEIT EINER DYNASTIE
Kapitel 10: Kusswalzer: Galante Nöte und Familienfreuden
Kapitel 11: Controversen: Der Kampf der Tigermutter
Kapitel 12: Concurrenzen: Sohn und Rivale
Kapitel 13: Freiheits-Lieder: Die Musik der Barrikaden
Kapitel 14: Radetzky-Marsch: Ein Imperium macht sich fein zum Sterben
Teil IV DIE HERRSCHAFT DER STRÄUSSE
Kapitel 15: Orpheus-Quadrille: Strauss, Strauss, Strauss & Strauss
Kapitel 16: Reiseabenteuer: Interkontinentale Karrieren
Kapitel 17: Die Fledermaus: Operettenriese und Opernzwerg
Kapitel 18: Abschiedsrufe: Ein Strauss wird Deutscher
Kapitel 19: Schatzwalzer: Eine Welt voller Strauss-Konserven
Epilog
Dank
Weiterführende Literatur
Personenregister
Bildnachweis
Anmerkungen
Das Geld und die Streckenangaben in diesem Buch: Die Wiener und die Deutschen maßen bis ins 19. Jahrhundert Entfernungen in Meilen, Klaftern und Ellen und grenzten sich damit – wie bis heute die Menschen der anglofonen Welt – vom metrischen Dezimalsystem der französischen Revolutionäre ab. Die Deutsche Meile maß etwa 7,5 Kilometer. Da der Begriff der »Meile« jedoch schillernd ist und alles zwischen 1,5 und 11 Kilometern meinen kann, wurden Strecken zur besseren Orientierung in »anachronistische« Kilometer umgerechnet.
Die im Wien des 19. Jahrhunderts gängige Währung war der Gulden, der in 60 Kreuzer geschieden war (ab 1857: 100 Kreuzer). Ein Kreuzer waren vier Heller. Ein Gulden war im Jahr 1800 der Lohn für drei Tage Arbeit.
Für geografische Angaben wie Städtenamen habe ich in diesem Buch die historischen deutschen Bezeichnungen (Pressburg für Bratislava etc.) ausschließlich deshalb gewählt, weil die handelnden Hauptpersonen selbst deutsch sprachen und daher diese gebraucht haben dürften.
Die kursiv gesetzten Bestandteile der Kapitelüberschriften habe ich den Werken der Sträusse entnommen.
»Der Adel hat eine Familiengeschichte, der jüdische Bourgeois eine Neurosengeschichte.«
Hermann Broch an seinen Sohn Hermann Broch de Rothermann
Vorwort
Eine Revolution von welthistorischer Bedeutung begann vor etwa 200 Jahren in Wien. Keine, in der Blut floss. Blut hatten die Wiener mehr als genug gesehen in dem fast 30-jährigen Krieg um die Vorherrschaft in Europa und damit der gesamten Welt, der 1789 mit der Französischen Revolution und den Koalitionskriegen begonnen hatte. Nun war Friede, nun war Ruhe eingekehrt. Grabesruhe zwar in politischer Hinsicht – Kanzler Metternich höchstselbst hatte die Wiener eingesegnet, und seine Spitzel und Schergen standen Wacht an den Gräbern politischer und ziviler Freiheit.
Aber den meisten Wienern dürfte dies egal gewesen sein. Sie hatten überlebt: Durchzüge und Plünderungen von Armeen, Teuerung, Mangel und Seuchen, die der Krieg wie immer mit sich brachte. War das kein Grund zur Ausgelassenheit? Kein Grund, das Alte, Bedrückende hinter sich zu lassen? Es nach Möglichkeit aus dem Gedächtnis zu tilgen – zu vergessen, jetzt, wo der Winter der Krisen einem neuen Frühling gewichen war? Und was schenkt Vergessen besser, als es Musik, Tanz und Flirt täten?
Revolution also. Alte Hemmungen und Verklemmungen flogen über Bord. Das junge Wien schlug die empörten Ordnungsrufe der Alten in den Wind und warf sich in die Arme eines frischen, vitalen Lebensgefühls. Was sollte da noch die nüchterne Vernunft der Aufklärung, wenn es galt, das eigene Herz zu spüren und romantisch seinem Zusammenklingen mit anderen Herzen nachzulauschen?
Die Heldengestalten dieser Revolution waren folgerichtig Musiker. In der 300 000-Einwohner-Stadt Wien lebten Tausende vom Musizieren, gastierten hier zeitweise oder spielten aus privater Passion. Seit Jahrzehnten bereits zog das Repräsentationsbedürfnis von Adel, Kirche und Bürgertum sie aus allen Reichsteilen an: Joseph Haydn aus Niederösterreich, Mozart aus Salzburg, Beethoven aus dem Rheinland, Bruckner aus Oberösterreich, Brahms aus Hamburg, aber auch Salieri, Rossini, Paganini und viele, viele andere aus Italien. Tatsächlich gab es vor Franz Schubert und Johann Strauss (Vater) keinen in Wien geborenen Komponisten, der hier zu Ruhm gelangte.
Was sie schufen, war reine Leichtigkeit. Und in diesem luftigen Universum konnte jeder zum Gestirn werden – als Kapellmeister oder Komponist, als Instrumentalist oder Sänger, als Meister oder Dilettant, als Tänzer oder Zuhörer. Instrumentenbauer und Notenstecher, Drucker und Verleger und nicht zuletzt die Musikunternehmer, die den Wienern die Tempel der Unterhaltung bauten: Ganze Industrien gaben den Wienern und den Wienerinnen die Möglichkeit, das neue Leben zu feiern und ihre Sorgen wenigstens zeitweise auf Abstand zu halten.
Wem fiele da nicht das »swingende« London der 50er- und 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts ein? Die strahlende Metropole eines Weltreichs im Schwundzustand, dessen Jugend sich aktiv oder zuhörend neuer Klanglichkeit und Rhythmik öffnete und einen Musiker-Olymp hervorbrachte, dessen Götter bis heute den Soundtrack des globalen Alltags prägen.
Und ganz so, wie etwa die Beatles oder die Rolling Stones sich in die Menschheitsgeschichte eingeschrieben haben, taten es auch die Komponisten, Kapellmeister und Instrumentalisten aus der Familie des Johann Strauss (Vater). Johann definierte die weltweiten Maßstäbe des Showgeschäfts, die bis heute gelten. Und die Seinen taten es ihm nach, übertrafen ihn darin sogar. Um diese Strauss-Dynastie geht es in diesem Buch. (Die Schreibung des Namens mit Doppel-s am Ende war in der Familie seit jeher die übliche. Die bis heute anzutreffende Schreibung mit »ß« missinterpretiert das Lautverdopplungszeichen der im 19. Jahrhundert in Deutschland üblichen Kurrentschrift.)
Johann Strauss (Vater) gelang in einer nahezu hermetisch nach Ständen gegliederten Gesellschaft binnen drei Jahrzehnten mit nichts als seinen Talenten ein beispielloser Aufstieg in die höchsten sozialen Sphären. Zwar blieb er immer ein Angehöriger der »Parallelgesellschaft« der Musik- und Bühnenkünstler – aber als deren populärster Exponent, als der erste »Walzerkönig« agierte er irgendwann auf Augenhöhe mit der ersten Gesellschaft des Adels und des reichen Bürgertums. Umso bemerkenswerter, als er von ganz weit unten kam. Aber es gelang ihm nie, dieses »Unten« ganz abzuschütteln. Seine Schatten verfolgten ihn zeit seines Lebens. Das »Unten« sollte seine Familie prägen, im Guten wie im Schlimmen.
Um die Biografie markanter Persönlichkeiten wie Johann Strauss (Vater) legt sich häufig eine Schicht von Legenden – nicht zuletzt durch eigenes Zutun.
»Die tradierte Überlieferung hält, soweit die Quellenlage dies überhaupt zulässt, einer kritischen Prüfung nicht stand. Die nur geringe Anzahl von Primärquellen begünstigt(e) die Verbreitung zahlreicher Klischees, Anekdoten und Halbwahrheiten.«1
So beschreibt die Musikwissenschaftlerin Isabella Sommer vom Wiener Institut für Strauss-Forschung das Problem.
Wie ist es im Fall der Sträusse? Doch halt – diese etwas »zoologisch« anmutende Beugung des Familiennamens will erklärt sein. Sie hat sich eingebürgert, weil sie anschaulich ist und den Fluss der Sprache nicht hemmt. Daher wird sie auch in diesem Buch verwendet.
Die Sträusse also waren bereits zu Lebzeiten ungeheuer populär – und deshalb ist diese Legendenschicht bei ihnen besonders zäh und dicht. Dies beginnt bereits beim Elementaren wie bei den Datierungen – etwa wenn ein Konskriptionsverzeichnis der Militärverwaltung Johann Strauss (Vater) ein Jahr älter macht, als er tatsächlich war, oder wenn eine andere Quelle behauptet, dieser habe 1832 »ab 11. Juni wiederholt an Donnerstagen und Sonntagen Feste im Tivoli« begleitet – obwohl der 11. Juni 1832 ein Montag war.
Zu den Tatsachen hinter den Legenden durchzudringen, ist trotz der Fülle an Dokumenten schwierig. Denn von den drei bewahrenden Instanzen – den Behörden von Zivil, Militär und Kirche, dem berichtenden und kommentierenden Medienbetrieb und den handelnden Personen selbst – ist nur auf die erste einigermaßen Verlass. Und auch dort sind krasse Fehler nicht ausgeschlossen.
Außerdem bewegt sich jeder Biograf in demselben Spannungsfeld. Die offiziellen Quellen nennen Fakten, dringen aber niemals zum Wesentlichen vor, nämlich zu dem, was die Menschen zu ihrem Tun und Lassen motivierte. Lob- und Schmähartikel sowie Briefe und private Erinnerungen hingegen transportieren meist eine persönliche Agenda der Schreibenden mit, die die Tatsachen vernebelt. Gleichzeitig verraten sie manchmal ungewollt Details, die – richtig interpretiert – die Geschichte und die handelnden Personen deutlicher hervortreten lassen.
Was uns leider komplett fehlt, ist eine Innensicht der familiären Verhältnisse und Beziehungen. Dies gilt zumindest für die Frühzeit des Johann Strauss (Vater) und seiner Vorfahren. Der Ahnherr der Sträusse war kein leidenschaftlicher Schreiber von privaten Briefen und Memoiren. Haben sie sich als Familie gefühlt und dies einander und nach außen hin auch gezeigt? Oder hat ihr unablässiger Existenzkampf die Emotionen verflachen lassen und die Beziehungen funktionalisiert? Gab es Dokumente, die untergingen oder gar gezielt vernichtet wurden? Das darf bezweifelt werden. Denn Johann war so populär, dass jeder Adressat Originalbriefe des Walzerkönigs zu seinen kostbarsten Schätzen gezählt hätte. Und selbst wenn Hinterbliebene Briefe in größerer Menge ausgetilgt hätten, um den Ruf der Familie zu schonen – der Zugriff auf Korrespondenz, die außerhalb der Familie zirkulierte, hätte weitgehend gefehlt.
Vermutlich sind so wenige strausssche Privatbriefe aus der frühen Zeit erhalten, weil die Sträusse keinen Grund hatten, groß zu korrespondieren. Ihre Familie und ihr Freundeskreis waren vollzählig in Wien versammelt, und ihre Briefe nach außen waren in erster Linie Geschäftsbriefe, die sich um Auftrittsmöglichkeiten und Gagen, Reisen und Unterkünfte drehten.
Bleibt das, was Zeitgenossen über sie aufschrieben, die sie aus eigenem Erleben oder vom Hörensagen kannten. Angesichts der Popularität ihres Gegenstandes waren sie nicht unbedingt wählerisch, wenn es Ausgedachtes von den Tatsachen zu unterscheiden galt – zumal der allgegenwärtige romantische Geniekult der Zeit vielfach die Feder führte. Ein Übriges tat der allgemein laxe Umgang mit Fakten in den damaligen Medien. Und so woben zeitgenössische Verehrer, Neider und Hasser sowie nicht zuletzt Mitglieder der eigenen Familie ein dichtes Netz von Mythen über den Sträussen, durch das Tatsachen kaum eindeutig festzustellen sind.
Diese Quellenlage macht es zur besonderen Herausforderung, die Persönlichkeiten und ihre Beziehungen und Schicksale sozusagen zu häuten – besonders dann, wenn die Legendenbildung so früh einsetzt wie bei Johann Strauss (Vater), der ja bereits zu Lebzeiten ein Star war. (Obwohl anachronistisch, passt der Begriff »Star«. Er ist treffender als jedes zeitgenössische Wort und stellt Strauss ganz bewusst an den Beginn einer Entwicklung, die direkt zur Popmusik des 20. Jahrhunderts und zu ihrem Starkult führt.) Als Autor ist man oft gezwungen, sich unter mehreren einander widersprechenden Daten, Orten oder Vermutungen für eine zu entscheiden. Wo dies geschieht, wird es angegeben. Insgesamt allerdings sollten solche Vermutungen der an Dramen reichen und an Linien klaren straussschen Familiengeschichte keinen bedeutenden Eintrag tun – selbst wenn spätere Erkenntnisse sie überholen sollten.
»Prinz, die Kunst geht nach Brot«, sagt der Maler Conti seinem Fürsten in Lessings Emilia Galotti. Der weitere Dialog lässt es erahnen: Der Fürst versteht nicht recht. Und so wie dem Fürsten wird es vielleicht auch manchem Leser gehen, wenn in diesem Buch viel von Geld die Rede ist. Die Sträusse redeten, zumindest brieflich, fast pausenlos von Geld. Geld lieferte ihren großrahmigen Leben die Energie, und da sie in diese Leben mit leerem Beutel starten mussten, bestimmten die Suche nach der nächsten Futterkrippe und die Auseinandersetzung um die gerechte Verteilung der knappen Körner ihre Existenz. Ihre Musik war die einzige Währung, mit der sie an der Futterstelle bezahlen konnten. An dieser arbeiteten sie pausenlos, schrieben sie auf Notenpapier, arrangierten sie, unterhielten sich über sie; in der Musik verstanden sie sich auch ohne Worte. Sie gingen rau um miteinander, so rau, wie das harte Wiener Leben hinter den glänzenden, heiteren Fassaden der Stadt sie gemacht hatte. Diese Härte und Rauheit zur Kenntnis nehmen zu müssen, schmerzt oft. Man wünscht sich, sie wären weicher gewesen, konzilianter. Hätten sie dann nicht gemeinsam mehr herausgeholt für die Familie, für sich selbst?
Gleichzeitig gilt es zur Kenntnis zu nehmen, dass die Familie aus dem harten Geschäft der Gastronomie kam und in das noch härtere der Kunst wechselte. Die Sträusse sahen unzweifelhaft Hunderte von Musikern materiell zugrunde gehen nach dem Muster von Grillparzers Novelle Der arme Spielmann, und wenn Existenzangst nicht ohnehin eines ihrer Erbteile gewesen wäre, so hätte das Leben sie diese Angst gelehrt. Und wie alle Menschen, die in dieses brutale »Goldene Zeitalter« Wiens hineingeworfen wurden, dürfen wir auch die Sträusse ein wenig bedauern.
Totenklage
Wien, am ersten Freitag im April 1816; der 5.4., so zeigen ihn die Kalender an in den Tausenden Kanzleien, Kasernen, Kontoren und Kirchenämtern der k. k. Haupt- und Residenzstadt.
Ein dunkler, klammer Tag, windgepeitscht, Regen, der mit Graupel abwechselt, so dürfen wir ihn uns wohl vorstellen. Denn vor genau einem Jahr ist in einem weit entfernten Winkel der Welt, auf der holländisch beherrschten Sunda-Insel Sumatra, ein Vulkan buchstäblich in die Luft geflogen. Die Winde haben seitdem seinen Auswurf um die ganze Erde verteilt. Die Staub- und Gasschwaden selbst sind zwar kaum sichtbar, hindern aber das Sonnenlicht daran, den Winter wie üblich aus dem Erdboden zu treiben. Das Wetter ist mit dem Frühjahr in Unordnung geraten: Ein ganzes Jahr lang wird es kalt und nass bleiben. Deprimierend für die Wiener, die in früheren Jahren um diese Zeit schon längst zwischen den Krokussen und ersten Maßliebchen im Prater spazieren gingen. Desaströs für die Ernte, wie sich Wochen später herausstellen wird. Aber ergiebig für die romantischen Maler, die sich an farbenprächtigen Sonnenuntergängen ergötzen können – auch für diese sorgte die ferne Naturkatastrophe.
An diesem Tag stehen die Müßiggänger zuhauf am Ufer des Donaukanals, dort, wo die flachen, kiellosen Boote, die »Zillen« der Fischer, Marktleute und Kleinhändler festzumachen pflegen. Der Donaukanal, der eigentlich ein Donauarm ist und knapp 20 Kilometer lang parallel zur Donau selbst verläuft, ermöglicht Lieferungen auf dem Wasserweg bis direkt an die ummauerte »Innere Stadt«, den heutigen I. Bezirk. Flöße schaffen aus Bayern, Salzburg und Oberösterreich – »Österreich ob der Enns« hieß es damals – Holz, Mauer- und Pflastersteine und viele Dinge des täglichen Bedarfs für die 300 000 Bewohner der größten Stadt im Reich heran – wobei vier von fünf in den rapide wachsenden Vorstädten leben.
Es sind aber nicht die Flöße und deren exotisch aussehende Mannschaften, die die Blicke der Neugierigen auf die opake, unratstarrende Wasseroberfläche lenken. Es ist ein Anblick, der Gott sei Dank selten geworden ist, seit sieben Jahre zuvor die Donauübergänge Schauplätze blutiger Kämpfe zwischen Franzosen und Österreichern gewesen waren: Im Wasser treibt ein aufgeschwemmter männlicher Leichnam in einst grüner, vom Wasser weitgehend geschwärzter Weste.
Als die Männer, die ihn mit langen Stangen von den Flößen und vom Ufer aus zu bergen versuchen, den Körper auf den Rücken wenden, geht ein erkennendes, bedauerndes Raunen durch die Menge: Einige erkennen ihren Nachbarn und Schankwirt. Es ist Franz Borgias Strauss, der ziemlich verkrachte Wirt der Bierschenke Zum Heiligen Florian in der Florianigasse (heute heißt sie Floßgasse), nur einen Steinwurf weit vom Wasser auf der nördlichen, der Leopoldstädter Kanalseite gelegen. Die Wiener sprechen auch vom »Fausthaus«, denn der sagenumwobene Alchemist und Magier Dr. Faust soll im 16. Jahrhundert hier gelebt haben.
Nicht ohne Mühe gelingt es den Männern, den massigen Leichnam aus der eiskalten Brühe ans Ufer zu bugsieren. Ein Gassenkommissär von der Civil-, Polizei- und Bezirkswache ordnet an, dass der Tote mit einem Karren ins Allgemeine Krankenhaus geschafft wird. Gleichzeitig eilt eine barmherzige Seele in die Florianigasse, um Katharina Straussin die Nachricht zu hinterbringen. Denn im Heiligen Florian wird Franz schon vermisst von seiner Frau und seinem ärmlichen, buntscheckigen Publikum. Kleine Handwerker sind unter ihnen, Tagwerker, die am Kanal Schlamm schaufeln oder auf einer der zahlreichen öffentlichen Baustellen schuften. Fuhrknechte, Fischer, Dienstleute, Soldaten auf Freigang. Flößer aus aller Herren Länder von Baden bis Bulgarien in ihren abgerissenen Gewändern. Einige böhmische Musiker oder die »Linzer Geiger«, die mit den Flößen zu kommen pflegen, um sich in den Kneipen der Stadt ein paar Kreuzer zu verdienen. Bauern, Gärtner und Kleinhändler, die in ihren Zillen Gemüse, Fisch oder Federvieh auf den Markt gebracht haben von den Inselchen im amphibischen Gewirr der Donaugerinne oder vom Marchfeld auf der linken Donauseite, aus Floridsdorf, Enzersdorf oder Aspern.
Aus dem glorreichen Aspern, auf dessen Fluren vor sieben Jahren Erzherzog Karl mit seinem Heer erstmals überhaupt einem napoleonischen Korps eine Niederlage beigebracht hatte. Es mit seiner Übermacht in Morast und Wasser gedrückt hat, wie Wölfe eine Schafherde reißen. Die meisten Franzosen konnten genauso wenig schwimmen wie die österreichischen Soldaten, und der Strom stand noch hoch vom eisigen Schmelzwasser der Alpentäler, in dem ihre Körper nun dem Schwarzen Meer entgegentrieben, den Welsen zum Fraß. Viele Leopoldstädter erinnern sich noch heute mit Grausen dieses Anblicks.
Eine Elendszeit hatte unter Napoleon begonnen, die trotz der Befreiung nicht nachgelassen hat in ihrem Würgegriff – besonders für die ärmeren Wiener. Für unbedeutende Leute wie Franz Borgias Strauss und die Seinen – eine kleine Familie nur, und auch diese nur lose wieder zusammengefügt nach einer ersten Katastrophe: dem Tod von Franz’ erster Frau Barbara, der Mutter seiner Kinder Ernestine und Johann, am Schleichfieber fünf Jahre zuvor. (»Schleichfieber« – das wurde damals häufig in die Totenscheine eingetragen und konnte alles und nichts bedeuten. Deshalb verschwand der Begriff später aus der Medizinsprache.) Gerade 14 Jahre hatte diese Ehe gedauert. 40 Jahre alt war die Mutter, als sie starb, 12 das Mädchen und 7 der Junge.
Mit dem Tod des Vaters, der neu geheiratet hatte, sollte sich das Drama unter umgekehrten Vorzeichen wiederholen. Die Stiefmutter Katharina, die Tochter eines Linzer Messerschmieds, würde sich sicherlich wieder verehelichen – wie sollten sie, die Kinder und das Gasthaus sonst überleben? Das Bett, das sie mit Franz teilte, war ohnehin nicht besonders heiß gewesen, bestenfalls lauwarm, und Kinder hatten sie nicht gezeugt. Ernestine und Johann würden sich daran gewöhnen müssen, ohne leibliche Eltern und mit einem fremden Vormund unter einem Dach zu leben. Ihre ohnehin schon trostlose Jugend würde noch trostloser werden.
Ob die Geschwister dies bereits ahnten, als sie Katharina die Hände vor dem Mund zusammenschlagen sahen, während ein Fremder eindringlich auf sie einredete? Sie lehnte am Schanktisch mit dem Bierfass darauf, der schon umlagert war von Gästen, die lautstark nach einem Trunk lechzten, während das Sirren zweier Geigen, die die Musikanten in der Saalecke zum Aufspielen bereit machten, das Stimmengewirr übertönte. Ob sie schon verstanden, dass die Bissen, die sie zum Essen bekamen, nun noch dürftiger ausfallen würden, und die Kittel, die sie morgens überstreiften, noch fadenscheiniger? Die Strohsäcke, auf die sie sich nachts betteten, noch muffiger, und der Platz, den sie sich mit Knechten, Mägden und zahlenden Bettgehern teilen mussten, noch enger?
Nein, dass über Johann Strauss und seiner großen Schwester Ernestine kein gütiger Stern waltete, das fand jeder, der überhaupt über sie nachdachte. Und das taten bei Gott nicht viele.
Teil I
VOR-GESCHICHTEN
»Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.«Friedrich Nietzsche
Kapitel 1
Keine Erinnerungen an Pesth: »Bürgerlicher Bürwirth« in der Leopoldstadt
Wir wissen nicht, ob die oben beschriebene traumatische Urszene im Leben des kleinen Johann sich so oder ähnlich abgespielt hat. Vielfach sind wir auf Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten angewiesen.
Bereits am ersten auffindbaren Familiendatum hängen Fragezeichen: Wurde Wolf oder – latinisiert nach barocker Mode – Wolfgangus Strauss tatsächlich 1699 geboren? Und ist er tatsächlich aus Ofen gebürtig? So verdeutschten die Wiener den Namen der gut 200 Kilometer donauabwärts gelegenen Stadt Buda, bevor diese mit ihrer Nachbargemeinde Pest zu Wiens Schwesterstadt Budapest verschmolzen wurde. Zu Wolfs angeblich ungarischer Herkunft passt nämlich nicht, dass Wolfgang, wie er da und dort auch heißt, in keinem Register dieser Zeit als Ofener Bürger verzeichnet ist. Denkbar ist, dass er als Agent eines Heereslieferanten arbeitete und als Angehöriger dieser hochmobilen Profession viel herumkam. Wie im gesamten Handelsstand waren auch hier Juden überproportional vertreten.
Wolfgangs Frau war eine Theresa Prielinger. Diese für uns leider völlig ungreifbare Frau dürfen wir als die Stammmutter der Sträusse ansehen. Möglicherweise war ihre Familie im Traunviertel »ob der Enns« zu Hause, während einige Spuren der straussschen Ahnenschaft nach Frankfurt am Main zeigen.
Aus Ofen oder Buda jedenfalls stammte Wolfs Sohn Johann, der älteste von vielen Trägern dieses Vornamens unter den Sträussen. Dieser Johann Michael Strauss war der Vater Franz Borgias’ – des Toten vom Donaukanal – und damit der Großvater des ersten Walzerkönigs Johann Strauss (Vater). (Orientierung bietet bei Bedarf der Familienstammbaum auf dem hinteren Vorsatz dieses Bandes.)
Das Trauungsbuch der Dompfarre St. Stephan in Wien hat 1762 Johann Michaels Geburtsort festgehalten: Buda 1714 geboren. Um 1750 muss er mit seinem Brotherrn, dem Feldmarschall-Leutnant Franz Anton Graf von Rogendorf, nach Wien gekommen sein. Er diente diesem als Bursche – eine vergleichsweise respektable Position, zu deren Zustandekommen, so wird vermutet, Vater Wolfs Stellung im Umfeld des Offizierskorps beigetragen haben könnte.
Johanns Frau Rosalia Buschin, Buschini oder Buschinin, also die Großmutter des Walzerkönigs, stammte aus dem Waldviertel, aus Gföhl in der Gegend von Krems. Ihr Vater Johann Georg war dort Revierjäger. Die Tatsache, dass Rosalia Strauss zwischen 1763 und 1769 wenigstens vier Kinder geboren hat, lässt nicht gerade auf eine reine Konvenienzehe schließen, wie sie zu dieser Zeit auch einfachere Menschen häufig schlossen – zum Beispiel, um ererbte Handwerksgerechtigkeiten, also Berufszulassungen, nicht zu verlieren oder schlicht um »d’ Sach’«, also das Familienvermögen, zu mehren.
Über Johann Michael Strauss und seine Familie, vor allem aber über seine Vorfahren wissen wir trotz intensiver Forschung2 wenig.
Eine familiengeschichtliche Tatsache ist allerdings so markant, dass sie nationalsozialistische Bürokraten auf allerhöchste Anordnung zu einer aufwendigen Fälschung veranlasste. Diese betraf Johann Michael Strauss.
Zwar hatte der Heilige Florian, Franz Borgias Strauss’ Bierschenke, im Leopoldstädter Jargon des beginnenden 19. Jahrhunderts das »Judenwirtshaus« geheißen. Und die Neue Freie Presse hatte es noch 1905 als in Wien allgemein bekannt vorausgesetzt,
»… daß in den Adern eines der Schöpfer der Wiener Walzer reines, unverfälschtes, orientalisches Blut fließt, daß der Radetzky-Marsch, der noch heute der echt österreichische Siegeshymnus ist, von einem Judenstämmling komponiert worden ist, wie die schöne Bezeichnung lautet«3.
Dem »orientalischen Blut« Johanns sei auch dessen exotisches, oft als afrikanisch beschriebenes Äußeres zuzuschreiben, mutmaßte damals das Blatt weiter. Doch im aufkeimenden Antisemitismus dieser Epoche verdrängte man wohl diesen Hinweis. Er geriet in Vergessenheit. Und so jubelte anlässlich der deutschen Annexion Österreichs 1938 durch Hitlers Truppen das weitverbreitete Hassblatt Der Stürmer: »Es gibt wohl kaum noch eine andere Musik, die so deutsch und so volksnah ist, als [sic!] die des großen Walzerkönigs.«
Kurz darauf allerdings fanden Hanns Jäger-Sunstenau und Hans Bourcy den unumstößlichen Beweis für die jüdische Abstammung der Walzerkönige. Im 60. Band des Trauungsbuches der Pfarre bei St. Stephan heißt es auf Seite 211 unter dem Jahr 1762 über Johann Michael und seine Frau (lateinisch »uxor«) Rosalia klipp und klar:
»Cop[ulati] sunt [Getraut wurden] 11. Febr.: Der ehrbare Johann Michael Strauß, Bedienter bey titl. Excell. H. Feldmarschall Grafen von Roggendorff [korrekt: Rogendorf], ein getauffter Jud, ledig, zu Ofen gebürtig, des Wolf Strauß und Theresa ux[oris], beyden jüdisch abgelebten, ehelicher Sohn; mit der ehr- und tugendsamen Rosalia Buschinin, zu Gföll in Unterösterreich gebürtig, des Johann Georg Buschini, eines gewesten Jägers, und Evae Rosinae ux[oris] ehelichen Tochter.«4
Wolf und Theresa Strauss, die Urgroßeltern von Johann Strauss (Vater), praktizierten also bis zu ihrem Tod ihren jüdischen Glauben. Erst ihr Sohn Johann Michael muss irgendwann zum römisch-katholischen Glauben konvertiert sein. Ob es ein inneres Bedürfnis war? Ob Rosalias Familie oder sein militärischer Brotherr darauf bestanden? Wir wissen es nicht. Ein solcher Akt der Assimilation war in der frühen Neuzeit jedenfalls nicht ungewöhnlich. Gleichzeitig hatten sich die Wiener mit ihrer jüdischen Bevölkerung weitgehend arrangiert.
Dass Wolfgang, Theresa und ihre Nachkommen jüdischer Abstammung waren, bescherte den Nationalsozialisten, die alle Menschen jüdischer Herkunft aus dem öffentlichen Gedächtnis zu tilgen versuchten, ein erstrangiges kulturpolitisches Problem. Infolge der Nazi-Rassengesetze war nämlich in Wien die Aufführung fast aller musikalischen Vorzeigestücke bereits verboten, weil Menschen, denen das Etikett »Jude« anhaftete, entweder die Musik oder den Text geschrieben hatten: Mahlers Sinfonien, die Musik von Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach und Korngold, die Csárdásfürstin, die Gräfin Mariza und andere Operetten von Emmerich Kálmán, Oscar Straus, Leo Fall, Paul Abraham und Edmund Eysler, Tausende Wienerlieder und Schlager vom Fiakerlied bis zu Im Prater blüh’n wieder die Bäume und vieles andere. Robert Stolz, Richard Tauber, Joseph Schmidt und viele andere Künstler waren auf einmal Unpersonen, und ihre Schallplatten durften nicht mehr verkauft werden. Da waren der Radetzky-Marsch des »Vierteljuden« Johann Strauss (Vater) und die populären Tänze und Operetten der Strauss-Dynastie absolut nicht wegzudenken aus dem mutwillig verarmten deutsch-österreichischen Musikleben, das ohnehin unter der Emigration vieler talentierter Musiker litt. Aber wie sollte ein linientreuer »Volksgenosse« noch unbefangen der Fledermaus lauschen oder zur Schönen, blauen Donau walzen, wenn er einmal wusste, dass diese keinem rein arischen Geist entsprungen waren? Dem Abhandenkommen weiterer Genies galt es entgegenzutreten.
»Ein Oberschlauberger hat herausgefunden, daß Joh. Strauß [Sohn] ein Achteljude ist. Ich verbiete, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn … ich habe keine Lust, den ganzen deutschen Kulturbesitz so nach und nach unterbuttern zu lassen.«
Dies notierte Propagandaminister Goebbels unter dem 5. Juni 1938 in sein Tagebuch – und weiter in seltener Einsicht:
»Am Ende bleiben aus unserer Geschichte nur noch Widukind, Heinrich der Löwe und Rosenberg übrig. Das ist ein bißchen wenig. Da geht Mussolini viel klüger vor. Er okkupiert die ganze Geschichte Roms, von der frühesten Antike angefangen, für sich. Wir sind demgegenüber nur Parvenüs. Ich tue dagegen, was ich kann. Das ist auch der Wille des Führers.«5
Goebbels erklärte nun den Strauss-Stammbaum zur »Geheimen Reichssache«:
»Zunächst wurden jene Forscher […] zum Leiter des damals groß aufgezogenen Sippenamtes der Gauleitung Wien der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei im Gebäude am Hof Nummer 4 zitiert und von ihnen unter verklausulierter Androhung unangenehmer Folgen striktes Stillschweigen gegenüber Dritten gefordert. Mit der Zeit sickerten aber doch, und zwar ausgerechnet aus Kreisen von Parteigenossen der NSDAP, verschiedene Andeutungen durch, weswegen man sich zu einer radikalen Lösung entschloss.«6
Goebbels ließ 1941 das historische Trauungsbuch durch einen Wiener Gestapo-Beamten beschlagnahmen, nach Berlin schaffen und durch eine mit dem Dienstsiegel des Reichssippenamtes beglaubigte fotografische Kopie ersetzen – aus der freilich der verräterische Eintrag auf Seite 211 gelöscht war. So wurden die Sträusse kurzerhand zu »Ariern« gemacht – ein Vorfall, so bizarr, dass er seinerseits einer Strauss-Operette hätte entstammen können.
Und tatsächlich ließen sich die »Geheime Reichssache« und die dreiste Fälschung jahrelang unter der Decke halten. Selbst einige Wiener Bürger, die von den Machenschaften des Sippenamtes Wind bekamen, schöpften keinen Verdacht – oder wollten keinen schöpfen. Einige, die von einer Urkundenmanipulation munkeln hörten, vermuteten sogar, diese habe einem angeblich jüdischen Ahnherrn des Wiener Gauleiters Baldur von Schirach gegolten, der zu dieser Zeit in der Hofburg residierte. Und erst das Ende der Naziherrschaft brachte das Ende dieser »arischen« Lüge. Kurze Zeit nach der Befreiung holte das Dompfarramt den Originalband aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv zurück und bewahrte daneben die Kopie auf – als Zeugnis behördlicher Skrupellosigkeit im Nationalsozialismus.
Ob unter Druck judenfeindlicher Strömungen oder freiwillig: Johann Michael Strauss jedenfalls, der Ahnherr der Walzerkönige, hatte sich wie viele Juden damals für eine Konversion zum Katholizismus entschieden. Während aber seinen Dienstherrn Rogendorf nach einigen Jahren seine Karriereaussichten weiter nach Böhmen führten, blieb sein Diener an der Donau. Er sattelte um und wurde Tapezierer – ein zwar nicht zunftgebundenes, aber vermutlich ertragreiches Handwerk, denn der Bedarf des Adels und des reichen Bürgertums an exklusiven Wandverkleidungen in ihren neuen Stadtpalais dürfte kaum zu decken gewesen sein. Und zusätzlich brachte die Tätigkeit ihn in Kontakt mit hochgestellten oder wohlhabenden Persönlichkeiten. Unter den Taufpaten von Johanns Kindern, so belehrt uns das Taufbuch der Pfarre, figurierten ein Orgelbauer und sogar ein »Hof-Musicus« namens Philippus Louis.
Dies sind allerdings die einzigen schwachen Hinweise auf musikalische Interessen und Beziehungen unter den strauss’schen Ahnen. Ob Johann Michael selbst musizierte, gar eine musikalische Familientradition begründete, ist weder durch Dokumente noch durch Erzählungen belegt. Auszuschließen ist es aber absolut nicht, denn Adlige wie der Graf von Rogendorf stellten gern musikalisch geschultes Personal ein. Wenn sie sich nämlich keine bezahlten Musiker leisten wollten oder konnten, rekrutieren sie gern aus ihrer Dienerschaft kleine Kammerorchester, um ihren Bedarf an Repräsentation und Unterhaltung zu decken. Eine derartige Stellung stand zum Beispiel am Beginn von Leopold Mozarts erfolgreicher Musikerlaufbahn.
Noch einmal zurück zur Taufe: Wer in der strikten Hierarchie der Ständegesellschaft nach oben wollte, wählte die Taufpaten seiner Kinder mit Bedacht. Denn die Paten konnten – vorausgesetzt, man ehrte sie angemessen und pflegte die entstandenen Beziehungen – Wege ebnen, die anderenfalls zu steinig gewesen wären. Und nicht zuletzt war es Brauch, dass sie den Patenkindern zu den großen Kirchenfesten – je nach Kassenlage – kleine oder größere Geschenke machten. Idealerweise wuchsen sich solche Beziehungen aus zu festen Klientelverhältnissen, in denen der Pate die Verfügbarkeit des Patenkindes, um persönliche Angelegenheiten zu erledigen, und seine Loyalität mit seiner Protektion belohnte, wenn es um eine lukrative Stellung oder Ehe ging. Daher ist es möglicherweise nicht ohne Belang für die Familiengeschichte und die Ambitionen der Sträusse, dass unter den frühen Taufpaten musikalische Menschen waren.
Vor jeder Taufe stand in »honetten«, ehrbaren Familien natürlich eine Eheschließung. Dass Johann Michael Strauss und seine Rosalia 1762 heirateten, wissen wir aus dem oben zitierten kirchlichen Trauungsbuch. Und auf Kinder musste das Paar nicht lange warten. Der spätere Bierwirt und Musikervater Franz Borgias Strauss war, 1764 geboren, der erste Knabe und der Zweite in der Geschwisterreihe. Weiß der Himmel, wo Johann Michael den ungewöhnlichen und nach gesellschaftlicher Ambition klingenden zweiten Vornamen »Borgias« für seinen Stammhalter nahm. Später sollten die Sträusse sich als zwar sehr kreativ in musikalischen und kommunikativen Dingen erweisen. Wenn es allerdings um die Namensgebung für ihre Kinder ging, setzte sich die christliche Konvention durch.
Wir werden also einigen Johanns, Josefs, Eduards und Annas begegnen, die es auseinanderzuhalten gilt. Zur Vereinfachung heißt im weiteren Verlauf dieses Textes Johann Strauss (Vater) – der erste Walzerkönig – »Johann«, während wir seinen Sohn Johann Strauss, den Jüngeren, »Jean« nennen, wie es auch seine Freunde und seine Familie taten. (Er selbst schrieb sich in seiner Korrespondenz mit Vertrauten gern in französischer Manier »Jeany« oder ließ sich so schreiben.) Jeans Brüder Josef und Eduard erhalten ihre familiären Namen Pepi und Edi, und auch die Frauen der Familie werden bei ihren vertraulichen Namen genannt. Wo es solche Kosenamen nicht gibt, können zumindest bei den Berufsmusikern die dynastischen Nummerierungen herhalten wie bei Johann Strauss III.
Franz Borgias’ elterliche Familie wohnte zeitweise in der Fuhrmannsgasse in der Josefstadt, westlich der Inneren Stadt gelegen. Vom Burgtor aus war diese Vorstadt über das Glacis in einer guten Viertelstunde zu Fuß erreichbar. (Das Glacis war eine mehrere Hundert Schritt breite unbebaute, weitgehend baumlose Zone – etwaige Angreifer sollten keine Deckung finden, wenn sie sich der Befestigungsmauer annäherten. Mit dem Blick eines überfliegenden Vogels gesehen muss Wien damals wie ein Auge gewirkt haben, in dem das Glacis das Weiße und die Innere Stadt die Pupille war. Jenseits des Glacis lagen die Vorstädte.) Die Familie wurde aber zumindest zeitweise weiter zum Pfarrsprengel St. Leopold in der Leopoldstadt gezählt. Katharina, die 1763 geborene Älteste, versinkt bereits als junge Frau in der Anonymität der niedersten Klassen. Der jüngere Bruder Johann Adam wurde Friseur und scheint Wien irgendwann verlassen zu haben, möglicherweise in Richtung Ungarn. Die Jüngste, Maria Anna, ist als ledige Dienstmagd in der Leopoldstadt belegt und stirbt 1802 mit 33 an der »Abzehr«. Unter dieser Diagnose fassten die Ärzte dieser Zeit Krankheitsbilder mit Kräfteverfall und starkem Gewichtsverlust wie Krebs oder Tuberkulose zusammen. Da sie die Ursachen der Krankheiten mehr ahnten als durchschauten, standen sie den Symptomen meist hilflos gegenüber und »dokterten« herum, bis der Patient entweder genas oder starb – je nachdem, wie gut seine Abwehrkräfte waren. Die brauchte er nicht nur gegen die Krankheit, sondern auch gegen manche Therapien wie den berüchtigten Aderlass und die verbreiteten Brech- und Abführkuren. Wer sich solche Ärzte leisten konnte, verlängerte so oft nur sein Leiden.
Auf Johann Michael Strauss traf dies zweifellos nicht zu: Er war ein armer Teufel und starb als armer Teufel. Denn er und seine Familie sind offensichtlich gescheitert beim Aufstieg in höhere gesellschaftliche Sphären. 1785 lebten sie in absoluter Armut im Haus Zum Schwarzen Bären in der Rossau, einer Vorstadt direkt am Donaukanal. Denn hier starb Johann Michaels Frau und Franz Borgias’ Mutter Rosalia 56-jährig »nachts um 12 Uhr«, so das Totenschauprotokoll, an der »Lungensucht«, vermutlich also an Tuberkulose.7 Ein typisches Armeleuteschicksal, dem damals jeder fünfte Wiener erlag. Aber auch Menschen aus besseren Kreisen verschonte diese damals praktisch unheilbare Schreckenskrankheit nicht völlig.
Vater Johann Michael hielt durch bis 1800, fristete seine letzten Jahre mittellos im Greisenasyl und fiel dort seinerseits der »Abzehr« zum Opfer. Laut dem knappen Protokoll der Leichenbeschau wurde er 86 Jahre alt – eine Langlebigkeit, die nicht typisch für die Sträusse war. Den Kontakt zu seinen Kindern hatte er offenbar seit Langem komplett verloren, weshalb die Erinnerung der Familie an den Ahnen und dessen eventuelle musikalische Talente schnell verblasst sein muss. Zu ernst und vielfältig waren zu dieser Zeit die täglichen Sorgen, und zu entschlossen versuchten wohl die Sträusse, deren Ursachen auszuräumen und ihr Leben besser zu machen. Dieses schwere Leben galt es nicht durch den Rückspiegel zu betrachten, sondern mit dem Blick nach vorn anzugreifen. Kein Wunder, dass auch spätere Generationen echte Kämpfernaturen hervorbrachten. Wir werden diese noch kennenlernen.
Johann Michaels Tochter Maria Anna war nicht besser dran als ihr Vater, als sie 1802 starb:
»An Vermögen hätte die Verlebte angegebenermaßen außer der wenigen in das allgemeine Krankenhaus überbrachten Leibskleidung nichts hinterlassen, und wäre dieselbe gratis verpflegt und begraben worden. Es konnte daher keine Sperr angeleget werden.«8
Dies resümiert nüchtern die »Verlassenschaftsabhandlung« unter Sperrskommissar Ludwig Rauch, der sich von Amts wegen mit Erbangelegenheiten zu befassen hatte. Es bedeutete, dass die bis zu einer Nachlassregelung vorgeschriebene Sperre über die Hinterlassenschaft sich mangels Masse erübrigte. Der Hauswirt Mathias Springer »als erbedener Zeuch« (hinzugebetener Zeuge) unterschrieb mit. Es gab nichts zu erben für den einzigen Hinterbliebenen Franz Borgias Strauss, Maria Annas älteren Bruder, der in diesem Dokument bereits »Wirth in der Brigittenau« heißt, im nördlich an die Leopoldstadt angrenzenden Viertel auf dem Oberen Werd.
Franz hielt es nicht mit dem Handwerk und der im Takt von Arbeitstag und Feierabend pendelnden Lebensweise seines Vaters. Offensichtlich zog es ihn nicht in die Respekt einflößenden Paläste der Reichen, sondern zu den einfachen Menschen: Als junger Mann verdingte er sich als Kellner in den Beiseln, in denen die Männer abends beisammensaßen, um je nach Temperament und Bildung die Tagesereignisse zu kommentieren, ihre kleinen Siege zu feiern, ihre Misserfolge und Schicksale zu beklagen, ihren Kummer darüber in Bier zu ertränken, ihr Mütchen in Provokationen oder Handgreiflichkeiten zu kühlen oder dem Spiel der »Linzer Geiger« zu lauschen.
Wir sehen den Wirt bei seinen Gästen sitzen, lachen, schwadronieren, singen, vielleicht sogar selbst ein Musikinstrument im Arm – »eine etwas groteske Erscheinung mit einem auf einem überaus dicken Hals sitzenden kahlen Kopf, dicken Ohrmuscheln, umfangreichem Bauch und breiten einwärts gebogenen Füßen«, wie die wenig schmeichelhaft klingende, aber genaue Beschreibung durch den »Kleidermacher«, also den Schneidermeister Anton Müller lautet. »Er trug immer eine grüne Weste, ein schwarzes Lederkappel, doch niemals eine Krawatte und seine büffelledernen Stiefel waren nie gewichst.«9 Mangels gemalter oder gezeichneter Porträts des Strauss-Vaters muss dieses erinnerte Bild, obwohl vielleicht durch Ressentiment oder Geringschätzung gefärbt, als Realitätsersatz herhalten. Zumindest dürfen wir unterstellen, dass Müller den scharfen Blick eines Fachmanns für Äußerlichkeiten hatte. Und wieso er Grund hatte, genauer hinzusehen, werden wir bald erfahren.
Bis auf einen Abstecher nach Pest im Sommer und Herbst 1792 (von dem wir wissen, weil ihm dafür eigens ein Reisepass ausgestellt wurde) blieb Franz seiner Stadt treu. Ebenso seinem bodenständigen Gewerbe als Kellner und Wirt in der Leopoldstadt – zumal ihm dieses erlaubte, seinem unbestreitbaren Hang zu übermäßiger geistiger »Erfrischung« vergleichsweise unauffällig und kostengünstig nachzugeben. Dank seiner beruflichen Erfahrung gelang es ihm 1803, 39-jährig den Heiligen Florian zu pachten, die erwähnte Leopoldstädter Bierschenke. Um diese Zeit auch legte der »Bürwirt« den Leopoldstädter Bürgereid ab und zahlte die fällige Gebühr von zwei Gulden à 60 Kreuzer. Der »Ungar« war angekommen in Wien.
Ein Bürger zu sein, war damals nicht selbstverständlich – es war ein Privileg, für das man nicht zu knapp bezahlen musste (die zwei Gulden entsprachen etwa sechs Tageslöhnen) und das nur Menschen in Anspruch nehmen durften, die in einer Stadt geboren oder dort schon lange wohnhaft waren, die von anerkanntem gesellschaftlichem Stand, Beruf, Vermögen oder Titel waren und der »richtigen« Konfession angehörten, in Wien also der römisch-katholischen. Ehefrauen und leibliche Kinder hatten automatisch teil am Bürgerrecht. Wer es nicht genoss, war »Bewohner« oder »Tagwerker« und hatte zum Beispiel bei schuldloser Verarmung keinen Anspruch auf die rudimentäre Versorgung aus der Bürgerspitalsstiftung. Ähnliche Bedingungen galten nicht nur in Wien, sondern an vielen Orten in Deutschland. Wer die Mildtätigkeit der Gemeinschaft genießen durfte und wer nicht, war also schon damals ein Thema.
Kein Wunder, dass Franz Borgias Strauss nun den Titel »bürgerlicher Bierwirt« wie einen Orden trug, denn er bewies, dass er es zu etwas gebracht hatte. Weiter als fast jeder Strauss bisher: Von den Urgroßeltern der späteren Walzerbrüder genossen nur zwei jemals an irgendeinem Ort der Erde das Bürgerrecht. Kaum einer besaß mehr als das Allernotwendigste. Keiner ging je einem geregelten Zunftberuf nach, für den er eine Lehre und Gesellenjahre hätte absolvieren müssen, der ihn aber gleichzeitig in ein festes soziales Gefüge mit Rechten und Pflichten, Geselligkeit und Sicherheit eingebunden hätte. Bauern waren die Familienahnen, Gärtner, Jäger, Kutscher, Tapezierer, Schuster, Zuckerbäcker, Händler für Militärbedarf oder Früchte, ein »Artillerie-Tischler« war unter ihnen und Wirte, Wirte, Wirte. Aus akuter Not geborene Wechsel der Beschäftigung waren an der Tagesordnung. Alle Sträusse waren also kleine Leute, deren Leben mit heute unvorstellbaren Risiken »gewürzt« war. Möglichst herauszukommen aus solchen Milieus, das war ein Gebot des Selbsterhaltungs- und Überlebenstriebs.
Der »bürgerliche Bierwirt« immerhin scheint seinen Heiligen Florian erfolgreich geführt zu haben – wenigstens zu Beginn. Die schmale Florianigasse dürfte durch die Flussschiffer und Dienstleute, die die Güter vom Fluss zu den Magazinen zu schaffen hatten, gut frequentiert gewesen sein. Tatsächlich belegen die städtischen Steuerbücher ziemlich regelmäßige jährliche Gewerbesteuerzahlungen von fünf Gulden aus dem Florian. Keine gewaltige Summe; bei der Brauerei konnte man gerade einmal zwei Fässer Bier dafür erhalten. Aber die Steuerlast war allgemein geringer als heute. Und was konnte umgekehrt einer wie Franz Borgias Strauss schon als Gegenleistung erwarten von Staat und Stadt?
Der nächste folgerichtige Schritt war es, sich um eine Familie zu kümmern. Die Frau hierfür hatte Franz bereits gefunden und im Oktober 1797 mit der für die niederen Stände erforderlichen behördlichen Genehmigung geehelicht: Barbara, die 1770 geborene Tochter des früh verstorbenen selbstständigen kaiserlichen Kutschers und Reitknechts (also Pferdepflegers) Josef Dollmann und der Gärtnerstochter Katharina Niessig. Mutter Katharina dürfte erleichtert gewesen sein, dass ihr Mädchen mit 27 doch noch versorgt war – und das durch einen Leopoldstädter Bürger. Trauzeuge war Johann Rath, ein anderer Bierwirt und vermutlich ehemaliger Dienstgeber des Bräutigams.
Die Bierschänke Zum Hl. Florian, das Geburtshaus von Johann Strauss (Vater).
Barbara gebar 1798 und 1802 zunächst zwei Mädchen. Das erste trug den Namen ihrer Taufpatin, der Bierwirtsgattin Ernestine Post – vielleicht ebenfalls einer früheren Dienstgeberin von Franz. Das zweite war vermutlich benannt nach der schon erwähnten, im selben Jahr verstorbenen Tante Maria Anna, dem einzigen Vatergeschwister, das die Jahrhundertwende noch erleben durfte. Während Ernestine robust war, musste die kleine Anna bereits als Kleinkind sterben, ebenso wie später ihre Geschwister Franz (mit sechs Monaten »am Wasserkopf«, vielleicht als Folge einer Hirnhautentzündung) und Josefa (zehn Monate alt und ebenfalls »am Wasserkopf beschaut«).
Durch diese äußerst lapidaren Standardphrasen der Leichenschau scheint bereits die Beiläufigkeit und Eile hindurch, mit der solche Diagnosen gestellt wurden. Wenn man sie vergleicht mit der heuchlerisch gefühligen Weitschweifigkeit, mit der die Wechsel- und Todesfälle gekrönter Häupter kommentiert wurden, so erkennt man: Die Sträusse zählten nichts im offiziellen Wien, so wenig wie Hunderttausende anderer kleiner Habenichtse.
1804 brachte Barbara den ersten Knaben Johann Baptist zur Welt – der später als Johann Strauss (Vater) in die Musikgeschichte eingehen sollte. Als Taufpate ist Johann Bauer festgehalten, ein Windenmachermeister, also eine Art Wagenschlosser, der Hebevorrichtungen einbaute.
Von insgesamt sechs Babys – der elende Tod der Jüngsten Josefa ist später noch zu erwähnen – überlebten nur zwei das Kleinkindalter. Zwei sah der kleine Johann sterben. Trotz Barbaras Fruchtbarkeit blieben die Sträusse also eine kleine Familie. Die später romantisch verklärte Groß- und Mehrgenerationenidylle mit »Urahne, Großmutter, Mutter und Kind«, wie sie der romantische Dichter Ludwig Uhland in einer seiner Balladen besingt, war ein absoluter Ausnahmefall.
Auch eine Familienidylle war der Heilige Florian nicht, wie wir noch sehen werden. Kleinkinder aus den niederen Bevölkerungsschichten galten so gut wie nichts. Sobald sie halbwegs sauber waren, blieben sie weitestgehend sich selbst und der Obhut älterer Kinder überlassen. Außer diesen wandte niemand etwas ein, wenn sie den ganzen Tag über in der Nachbarschaft herumstromerten, selbst wenn sie sich und andere in Gefahr brachten – es sei denn, ein Gendarm schaute zufällig zu und griff brachial ein. Oft schlossen die Kinder sich kleinen Banden an, die bestimmte Bezirke als ihre Reviere empfanden und mit Fäusten, Füßen, Zähnen und Krallen gegen andere Banden verteidigten. Spielzeug gab es keines außer dem, das sie selbst bastelten oder irgendwo fanden. Statt eines Balles musste ein »Fetzenlaberl« herhalten, ein annähernd kugelförmiger Ballen aus gepressten Lumpen. Trinkwasser fanden sie am Brunnen oder am Bach. Um etwas zu essen zu erhalten, mussten sie nach Hause, wo sie verzehren durften, was der Vater übrig ließ. »Jo Kinder, wanns amol vadients, kennts a a Fleisch hobm«10, bekamen sie vielleicht zu hören, wenn sie auf den vollen Teller ihres Erzeugers starrten. Wenn die Notdurft sie überkam, hoben auch die kleinen Buben ihre Kinderhemden und erleichterten sich überm Rinnstein oder in einem Winkel. Kam der Vater nach Hause, hatten sie wie auch seine Ehefrau zur Stelle zu sein und seine Befehle abzuwarten, ihm Pantoffeln und Tabakspfeife zu bringen oder sich still in die Ecke zu setzen und seine Erholung von den Strapazen des Tages nicht mit ihrem Geplapper zu stören. Sobald sie verständig und kräftig genug waren, mussten sie für Eltern, Verwandte oder Nachbarn kleine Botengänge erledigen oder sich an der Arbeit beteiligen. So rutschten sie – falls sie nicht in der Schule ihren Lehrern oder Priestern positiv auffielen – schrittweise in die Erwerbstätigkeit und die Mädchen oft genug in die Prostitution. Mindestens 8000 minderjährige Prostituierte soll es gegen Ende des Biedermeier in Wien gegeben haben.
Vermutlich mussten die Strauss-Kinder nicht das Allerschlimmste erleben, selbst wenn manche Bürgerkinder scheu oder verächtlich die Straßenseite wechselten, sobald sie Kinder des niederen Standes sahen. Da seit 1774 allgemeine Unterrichtspflicht herrschte, dürften beide eine elementare Schulbildung »genossen« haben. Denn trotz der drakonischen Disziplin und der Eintönigkeit des Unterrichts bewahrte die Schule sie erst einmal vor einer monotonen, schmutzigen, vielleicht gefährlichen und sicher anstrengenden Erwerbsarbeit als einziger Alternative. Es ist anzunehmen, dass die immerhin fünf Jahre ältere Ernestine Johanns wichtigste Aufsichtsperson und Erzieherin wurde – noch vor den ständig mit ihren Gästen beschäftigten und daher vermutlich selten verfügbaren Eltern mit ihren aus Kindersicht ungewöhnlichen Arbeitsund Schlafenszeiten.
1806, als Johann zwei Jahre alt war, musste der Vater den Heiligen Florian aufgeben. Die Zeiten waren unsicher und schlecht. Napoleons Grande Armée war im Vorjahr über Österreich hergefallen. Sie hatte am 13. November die stark verteidigte Taborbrücke genommen, die einzige feste Möglichkeit zur Überquerung der Donau, und Wien kampflos besetzt: Drei französische Marschälle kamen mit weißer Fahne über die Taborbrücke und überzeugten den österreichischen Befehlshaber, dass der Krieg eigentlich schon vorbei sei. Der Franzosenkaiser residierte eine Zeit lang in Schloss Schönbrunn, und die Stadt hatte Zehntausende von Soldaten mitsamt deren Tross unterzubringen und zu verköstigen.
Dass Soldaten selten zimperlich in der Wahl ihrer Mittel waren, wenn es galt, sich mit Speis’ und Trank den Bauch zu füllen, wissen wir aus zahllosen Erzählungen. Es liegt nahe, dass sie sich nach ihren Dienstgängen und -ritten über die Taborbrücke häufig des nur einige Hundert Schritte seitwärts gelegenen straussschen Beisels erinnerten und hier zum Feiern zusammenkamen – wenn der Sold bereits verpulvert war, eben auf Kosten der Wirtsleute. Und wie in vielen anderen ärmeren Wiener Familien dürfte die Verzweiflung auch bei Franz mit am Tisch gesessen haben als Gast, dem es mit Bier und Schnaps aufzuwarten galt, um ihn auf Distanz zu halten.
Dass das Schwesterchen Josefa bei einer Pflegefrau starb – der Kirchendienerswitwe Magdalena Fritz »Bey Der Unmöglichkeit No. 22« –, deutet auf akute Geldnot bei den Sträussen hin. »Ein Kind kann leichter eine ganze Familie versalzen als versüßen«, beobachtete etwa zur selben Zeit der Schriftsteller Jean Paul. Und wer sein Kind einer solchen Pflegerin überantwortete, hatte bereits reichlich von diesem Salz geschmeckt und schon abgeschlossen mit dem Kleinen, denn diese »Engerlmacherinnen«, ihrerseits oft bitterarm, hungerten nicht selten die armen Würmer nach und nach zu Tode.
Wie auch immer Franz nun seine Familie durchgebracht haben mag: Zwei Jahre später gelang es ihm, die Gaststätte Zum Guten Hirten in der Leopoldstädter Weintraubengasse zu pachten. Allerdings hatte Franz erneut seine Rechnung ohne die Franzosen gemacht, die im Folgejahr Wien nochmals besetzten – diesmal nach schwerem Beschuss. Napoleon war ausgebildeter Artillerist und hatte diese Waffengattung zu furchtbarer Wirksamkeit gesteigert. Gnadenlos hatte er sie bereits gegen den inneren Gegner eingesetzt, um sich bei den Revolutionsführern beliebt zu machen. Umso rücksichtsloser setzte er sie nun auch gegen die Wiener ein:
»Ziegel und Steine fielen von den Häusern, Feuer brach aus, Geschrei auf den Gassen, niemand wagte die Brände zu löschen, aus Angst vor den Granaten und dem Bombardement. Die Leute flüchteten in die Gewölbe der Kaufhäuser und nächtigten auf den Verkaufstischen, sie flohen in Kirchen, aber auch zu Nachbarn mit sicheren Kellern. In den Häusern verbaute man die Fenster mit Federbetten gegen Granatsplitter.«
So der beklemmende Bericht eines Augenzeugen.11 Auch Beethoven, Wiens prominentester Musiker dieser Zeit, überstand diese Kanonade im Keller. Wir dürfen vermuten, dass auch die Sträusse die dicken kühlen Mauern ihres Bierkellers schätzen lernten, dass aber besonders die Kinder – der fünfjährige Johann unter ihnen – bei jedem nahen Einschlag die Augen panisch nach oben kehrten.
Die Schlachten im nahen Aspern (wo die Österreicher überraschend siegten) und in Wagram (wo die Franzosen Revanche nahmen) überschwemmten die Stadt mit Zehntausenden Verwundeten – Österreicher und Franzosen. Diese galt es notdürftigst zu versorgen. Die Schlachten jener Zeit wurden ohne Rücksicht auf die körperliche Unversehrtheit der Truppen geführt, und diese mussten ohne jede Deckung im Gleichschritt in den gegnerischen Kugelhagel hineinmarschieren. Die Verwundeten – ob Feind, ob Freund – schleppte man zur Versorgung in die Stadt. Der Anblick stöhnender und röchelnder, verstümmelter, sterbender oder toter Soldaten gehört zweifellos zu Johanns frühesten und traumatischsten Kindheitseindrücken. Wir stellen ihn uns vor, wie er, seine kleine Hand in Ernestines gekrallt, mit Faszination und Grauen auf das Schauspiel gestarrt haben mag.
Die Franzosen blieben diesmal länger als 1805. Eine unerträglich hohe Kriegsentschädigung von 40 Millionen Gulden ruinierte Österreichs Finanzen. Der Fiskus versuchte, durch Münzverschlechterung gegenzusteuern, und setzte damit den Teufelskreis der Teuerung in Gang, die Zehntausende von Existenzen zerstörte. Im Februar 1811 erklärte die Regierung formell den Staatsbankrott. Auf einen Schlag verlor das Geld vier Fünftel seines Wertes. Aus harten Zeiten wurden härtere – auch für Franz Borgias Strauss und sein Wirtshaus, wie seine Steuerunterlagen beweisen.
Und dann erlag seine Frau Barbara 1811 mit gerade einmal 41 Jahren dem bereits erwähnten »schleichenden Fieber«. Hat ihre Mutter Katharina, die ihre Tochter um zwei Jahre überlebte, der Familie ihres Schwiegersohns beigestanden? Wir wissen es nicht. Zwar hat Eduard Strauss, Franz’ jüngster Enkel, es 1906 auf sich genommen, ein Erinnerungsbuch zu veröffentlichen, aber da waren die Sträusse eine hochberühmte Familie, auf die kein Schatten fallen sollte. Erinnerungen an überstandenes Elend suchen wir folglich in dieser Quelle vergebens.
Unter welchen Bedingungen die Strauss-Geschwister aufwuchsen, wissen wir also nicht genau und können es allenfalls erschließen aus den äußeren Umständen und aus dem Vergleich mit ähnlich situierten Wiener Familien. Die Tatsache, dass Franz und Barbara fünf ihrer sechs Kinder bei sich behielten und nur Josefa weggaben, ist ein Anhaltspunkt dafür, dass sie nicht zu den Ärmsten der Armen gehörten. Arbeiter, Tagelöhner und Gesinde hatten oft nicht einmal eine eigene Unterkunft, sondern hausten bei ihren Dienstherren in einem Untermietzimmer oder gar als Bettgeher bei Fremden, wo sie stundenweise und ohne jede Privatsphäre eine Schlafstatt nutzten. An die Aufzucht von Kindern war unter solchen Umständen nicht zu denken. Daher gaben sie ihre Neugeborenen oft gleich im Gebärhaus weg oder anschließend zu notdürftiger Versorgung in die Findelanstalt, was deren nahezu sicheren Tod bedeutete, wenn sie nicht an Zieheltern weitergereicht wurden. Findelmütter, also ledige Mütter, die im Findelhaus Zuflucht suchen mussten, hatten sich von Gesetzes wegen als Ammen herzugeben.
Schon ein eigener Haushalt war also ein Merkmal sozialer Distinktion. Dasselbe galt bereits für den bloßen Status als Familie – in einer Zeit, in der gerade einmal ein Drittel der Wiener überhaupt verheiratet war und drei von zehn Kindern unehelich zur Welt kamen.
Wir können davon ausgehen, dass armselig bezahlte Dienstboten und Bettgeher zum Einkommen der kleinen Familie beitrugen und vielleicht am Esstisch ihre einfachen Mahlzeiten teilten. Wie es um Hausrat und Vermögen der Sträusse bestellt war, erfahren wir aus der behördlichen Verlassenschaftsabhandlung nach dem frühen Tod der »Ehewirthin« Barbara Strauss. Ihr gesamter persönlicher Besitz erschöpfte sich in zwei »pikeenen Röcken«, zwei »Schmissen« (lange dünne Hemden), drei »Leibeln« (Mieder), drei »ordinairen Hauben«, einem Paar Schuhe und ein wenig Wäsche. Sie hatte nichts in die Ehe eingebracht, wie Franz versicherte, und die 125 Gulden, die sie irgendwie erspart hatte, gingen ebenso drauf für »die Krankheits- und Leichkösten« wie 887 Gulden aus dem Vermögen des Ehemannes und jetzigen Witwers.
Barbaras Tod könnte dessen Schicksal besiegelt haben. Zwar vertauschte er 1812 den Guten Hirten wieder mit dem Heiligen Florian, vermutlich weil Carl Friedrich Hensler, der Pächter des Leopoldstädter Theaters, auf dem Grund des Guten Hirten bauen wollte. Aber sei es, dass an ihm doch kein großer Geschäftsmann verloren gegangen war, dass die wirtschaftlichen und familiären Schicksalsschläge ihn zermürbt und der Trunksucht ausgeliefert hatten – die Familie rutschte immer weiter ab. Hohe Schulden bei den Brauereien wurden zum Dauerzustand. Dazu kam eine erneute Finanzkrise, in deren Folge sich seine Steuerlast beinahe vervierfachte.
Den Leopoldstädter Bierwirt Franz Borgias Strauss fischte man am 5. April 1816 – »alt 50 Jahr«, wie der Beschauer denkbar knapp und falsch notiert – tot aus dem schönen blauen Donaukanal. Fast genau am selben Tag feierte ein Komponist namens Michael Pamer mit seiner Tanzkapelle nur wenige Schritte entfernt im Sperlwirt seinen ersten triumphalen Erfolg. Wir werden noch von ihm hören.
Ernestine war 17, Johann 12 Jahre alt. Sie waren nun mehr denn je aufeinander angewiesen. Die Verlassenschaftsabhandlung über das Vermögen des Verstorbenen resümierte, dass »der Fall zu Eröffnung eines Konkurses vorhanden wäre«. Allerdings verzichteten die Gläubiger »wegen Geringfügigkeit des Aktivstands und zu Vermeidung der Weitwendig- und Kostspieligkeit eines Konkurses«12 – soweit sie sich überhaupt die Mühe gemacht hatten, Ansprüche zu stellen.
Spekulationen aller Art ranken sich um Franz’ rätselhaftes Ende: War es ein Unfall? Gar ein alkoholbedingter? War es Selbstmord? Und wenn ja: Ist an dem Gerücht etwas, dass Franz sich »durch einen Sprung in die Donau der irdischen Gerechtigkeit« entzog, wie der Komponist Philipp Fahrbach senior zitiert wird?13 Entsprang die Tat materiellen Nöten? Oder ging sie auf »unbefriedigende Familienzustände« zurück, wie der Musikwissenschaftler und Strauss-Biograf Kurt Pahlen eine zerrüttete Ehe diskret umschreibt? War er gar Ausdruck einer seelischen Grundbefindlichkeit? Nochmals Pahlen, der sich festlegte:
»Ob dieser mutmaßliche Freitod letzten Endes ›nur‹ die Folge jener seltsamen Unrast und einer tiefsitzenden, nie erklärbaren Melancholie gewesen ist, die so manches Mitglied der Strauss-Familie, am meisten wohl unseren Johann Strauss Vater, quälte und so verunsicherte, dass sie eigentlich selten in den Genuss sonniger Augenblicke oder ihrer Erfolge gekommen sind?«14
Allein die fortdauernd und in jeder Hinsicht »unbefriedigenden Familienzustände«, in denen Johann aufwachsen musste, könnten auch seelisch widerstandsfähigere Menschen lebenslang mit Melancholie belastet haben – heute würde man vermutlich »Depression« schreiben.
Schwere Seelennot ist eben keine Erscheinung der Moderne.
Kapitel 2
Wiener Launen-Walzer: Ein Reich setzt sich neu zusammen
Dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, repräsentiert durch den Habsburgerkaiser Franz II. in Wien, schlug im August 1806 seine letzte Stunde. Und die Ahnung dessen mag in der Luft gelegen haben, als Franz am 14. Juli 1792 im Frankfurter Dom gekrönt wurde.
Da war es nämlich auf den Tag genau drei Jahre her, dass Pariser Bürger die Bastille, das alte Staatsgefängnis, gestürmt und ein paar unbedeutende, verwitterte Häftlinge aus ihr befreit hatten. An einem Symbol des Staatsterrors also hatten die Bürger einen Akt der Selbstermächtigung exerziert.
Die Schockwelle, die sie damit durch Europa gesandt hatten, sollte sich erst im Oktober 1815 brechen, als Napoleon als Kriegsgefangener Seiner Majestät König George III. auf die britische Atlantikinsel St. Helena deportiert wurde. Auf ihrem zerstörerisch-schöpferischen Zug hatte sie ein altes Deutschland hinweggefegt, dessen politische Instanzen sich weder hinreichend reformieren noch hinreichend verteidigen konnten. Und ein deutsches Reich hatte keinen Platz in Napoleons Vorstellungen von der Neuordnung Mitteleuropas.
Als er sein politisches Werk 1806 mit der Gründung des Rheinbundes krönte – einem Bündnis seiner deutschen Vasallenstaaten –, wurde offensichtlich, dass Österreich auch in Deutschland nichts mehr zu gewinnen hatte – nachdem Frankreich dem Reich bereits die jahrhundertelang behauptete Herrschaft über Norditalien entwunden hatte. Franz, Erzherzog von Österreich und gewählter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und damit Träger eines Heiligtums, entschloss sich, eine Epoche von fast 1000 Jahren zu beenden: Er liquidierte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und legte dessen Krone nieder. Die österreichische Krone dagegen konnte ihm so schnell niemand nehmen. Denn für sich selbst und seine Hausmacht hatte Franz schon 1804 mit einem Staatsstreich von oben vorgesorgt: Keine drei Monate, nachdem der französische Parvenü Napoleon sich selbst die Kaiserkrone angemaßt und aufgesetzt hatte, zog Franz nach. So konnte er auch nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs seine Ranggleichheit mit dem Franzosen behaupten. In Österreich hatte er bis dahin nur den Titel eines Erzherzogs getragen, wie alle seine Vorfahren auf dem Reichsthron. Nun war er Franz I., Erbkaiser von Österreich.
Kaiser Franz II. von Österreich (1768–1835), der letzte deutsche und erste österreichische Kaiser. Gemälde von Friedrich Amerling, 1832.
Mit dieser Proklamation griff er zwar in die Souveränitätsrechte der Fürsten in den politisch abhängigen Teilen seines Herrschaftsgebietes ein, allerdings trug er ohnehin bereits die Königskronen der wichtigsten dieser Territorien: Ungarns und Böhmens.
Mit Ausnahme von Russland verfügte nun der österreichische Kaiser über das größte Territorium in Europa – vom lombardischen Mailand bis zur Bukowina und von der böhmischen Oberelbe bis zum montenegrinischen Kotor. (Das Gebiet war etwa achtmal so groß wie die heutige Republik Österreich.) In diesem Reich lebten mehr als 21 Millionen Menschen mit an die 20 verschiedenen Muttersprachen. Diese Größe ermöglichte es Österreich einerseits, aus seinen Waffengängen mit Napoleon gestärkt hervorzugehen, auch wenn diese nicht nur über seine Hauptstadt Wien Elend brachten. Andererseits überforderten die Nationalismen im 19. und 20. Jahrhundert seine Integrationskraft, und das »kakanische Jahrhundert«, das auch das Jahrhundert der Sträusse ist, wurde zu einer Abfolge von ethnischen Revolten und militärischen Niederlagen, bis das Kaisertum im Ersten Weltkrieg in den selbst verursachten Zerfall ging.
Napoléon Bonaparte (1769–1821), Kaiser der Franzosen und Gegenspieler Franz’ und Metternichs.
Doch zurück zur napoleonischen Zeit: Österreichs Niederlage im Fünften Koalitionskrieg 1809 bereitete die Bühne für den Aufstieg des Staatskanzlers Klemens Fürst von Metternich, der dem Land seinen Stempel aufdrücken konnte wie sonst kein Politiker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Österreich der Sträusse, wie wir es in Kapitel 5 näher kennenlernen werden und das er 40 Jahre lang regierte, trägt bis in die Details hinein seine persönliche Handschrift. Als erster Untertan seines Regenten machte er sich daran, das Kaisertum in die Moderne zu führen – eine Moderne, die nicht allen gefiel.
Er regierte Österreich und Deutschland fast 40 Jahre, bis die Revolution ihn wegfegte: der Rheinländer Klemens Wenzel Fürst von Metternich (1773–1859). Gemälde von Thomas Lawrence, um 1820–1825.
Überzeugt davon, dass die Fliehkräfte im Reich zu groß waren, als dass es sich auf die Dauer zusammenhalten lassen würde, setzte er auf ein Gleichgewicht der europäischen Mächte als Stabilitätsfaktor – eine politische Maxime, die galt, bis im Ersten Weltkrieg Ozeane von Blut und Knochen Europa überfluteten. Als Österreichs Botschafter in Berlin hatte Metternich mit führenden Köpfen der Romantik Bekanntschaft geschlossen, besonders mit Fichte und August Wilhelm Schlegel, bei denen er Vorlesungen hörte. Schlegels Bruder Friedrich ließ er später als Propagandisten seiner Weltanschauung nach Wien holen.
Auch Frankreich hatte er aus erster Hand kennengelernt, 1806 als Botschafter in Paris, wo er so elegant auftrat, dass er den Beinamen »le beau Clement« erhielt. Mit den Mächtigen dort stand er auf bestem Fuß und unterhielt ein jahrelanges Liebesverhältnis mit Caroline Bonaparte, der verheirateten jüngsten Schwester des Kaisers – toleriert von deren Ehemann, dem Feldmarschall Murat. Es ging ungeniert zu in der Hauptstadt des Empire, und der Erzkatholik Metternich erwarb sich durch seine Affären den Ruf eines zügellosen Lebemannes. Ungeniert, aber nicht freundschaftlich: Stets war der Diplomat wach in ihm, und seine Matratzenplaudereien mit hochgestellten Frauen pflegte er nach Wien durchzustechen, sobald sie politisch oder militärisch bedeutsam wurden. Vom Polizei- und Sicherheitsminister Fouché war zu lernen, wie man Heere von Spitzeln einsetzte, um »Ruhe im Lande« durchzusetzen. Auch den Nutzen der Propaganda und den Wert der Zustimmung des Volkes erkannte Metternich in Paris: »Die öffentliche Meinung ist, wie die Religion, das stärkste Machtmittel, das selbst in den verborgensten Winkel dringt, wo Regierungsanweisungen jeden Einfluss verlieren.«15
Am Ende des napoleonischen Sturms, der das alte Europa 20 Jahre lang erschüttert hatte, bestätigte sich Metternichs Strategie, die er 1809 nach dem Frieden von Schönbrunn mit Frankreich formuliert hatte: »Unsere Sicherheit«, schrieb er, könne Österreich »nur in unserer Anschmiegung an das triumphierende französische System suchen«. Es müsse also »vom Tage des Friedens an unser System auf ausschließliches Lavieren, auf Ausweichen, auf Schmeicheln beschränken«, um auf diese Weise »unsere Kraft auf bessere Zeiten aufzuheben«16. Auch dank seiner schier unerschöpflichen Ressourcen ging Österreich als stärkste mitteleuropäische Macht aus dem gesamten Konflikt hervor, und Metternich hatte sich als der bestvernetzte und gerissenste Diplomat bewiesen. So war es die Anerkennung der realen politischen Machtverhältnisse, als sich nach der Restauration der französischen Monarchie die europäischen Stände 1814 in Wien und unter Leitung des kaiserlich-österreichischen Ministers trafen, um über Europas künftige Ordnung zu verhandeln.
Der Wiener Kongress 1814/15. Sitzung mit (u. a.): Kaiser Franz I. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland, König Friedrich Wilhelm III. von Preussen, Lord Castlereagh für England und Talleyrand für Frankreich.
In Frankreich regierte mittlerweile als konstitutionell gebundener Monarch Napoleons Nachfolger, der aus dem Exil reaktivierte Bourbone Ludwig XVIII., Bruder des gewaltsam ums Leben gekommenen Ludwig XVI., ein fast 60 Jahre alter König von Metternichs Gnaden. Alle Kriegsparteien entsandten ihre Delegationen, natürlich auch Frankreich, dessen Deputation unter der Leitung von Metternichs altem »Freund« Talleyrand stand. Gastgeber war offiziell Kaiser Franz I., aber es war Metternichs Amtssitz am Ballhausplatz, wo sich das Schicksal der europäischen Fürsten entschied, von denen viele persönlich erschienen waren und sich mehr oder weniger geschickt in die Verhandlungen ihrer Berufsdiplomaten einschalteten: »Alles was Europa an erlauchten Persönlichkeiten umfasst, ist hier in hervorragender Weise vertreten«, resümiert zufrieden der österreichische Generalsekretär Friedrich von Gentz eine Woche nach Beginn der Versammlung: