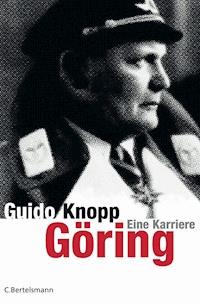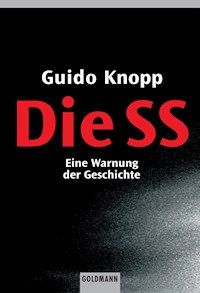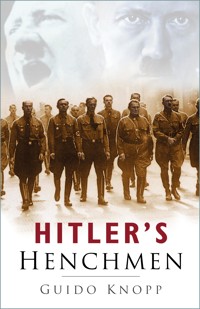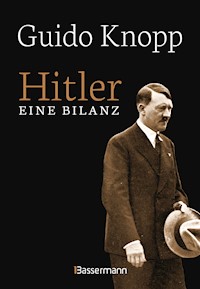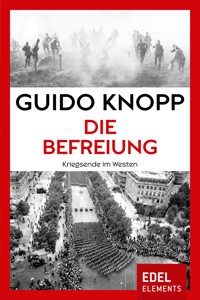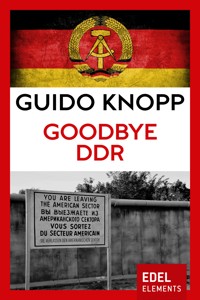4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Ende des 2. Weltkrieges werden durch den Einmarsch der Roten Armee Millionen Zivilisten aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben. Von ihrem Überlebenskampf, ihrem Leid, erzählt dieses Buch zur großen Serie des ZDF. Sie hatten ausgehalten bis zur letzten Minute im Zeichen von Hitlers Durchhaltewahn. Dann war es für eine sichere Rettung zu spät. Im Januar 1945 rückte die Rote Armee unaufhaltsam vor. Auf Unrecht folgte Unrecht. Hunderttausende begaben sich überstürzt auf die Flucht, die über zwei Millionen von ihnen nicht überleben sollten. Guido Knopp und sein Team erhielten für diese Dokumentation Einblick in russische Archive: Bislang unbekanntes Material ermöglichte es, Hintergründe und Zusammenhänge zu den damaligen Geschehnissen so eindringlich wie nie zuvor darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Guido Knopp
Die große Flucht
Das Schicksal der Vertriebenen
Edel:eBooks
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Autor
Vorwort
Der große Treck
Der Untergang der »Gustloff«
Die Festung Breslau
Die verlorenen Kinder
Die Stunde der Frauen
Die verlorene Heimat
Ortsregister
Autor
Prof. Dr. Guido Knopp, Jahrgang 1948, arbeitete nach dem Studium als Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und als Auslandschef der „Welt am Sonntag“. Von 1984 bis 2013 war er Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte. Seitdem moderiert er die Sendung History Live auf Phoenix. Als Autor publizierte er zahlreiche Sachbuch-Bestseller. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Jakob-Kaiser-Preis, der Europäische Fernsehpreis, der Telestar, der Goldene Löwe, der Bayerische und der Deutsche Fernsehpreis, das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und der Internationale Emmy.
Vorwort
Solange noch Zeit ist
Die Familie meines Vaters stammt aus Oberschlesien. Meine Großeltern und beide Tanten, damals junge Frauen, sind zunächst geflüchtet, dann für ein paar wirre Wochen nach dem Krieg zurückgekehrt, sodann nach schrecklichen Erlebnissen im Sommer 1945 enteignet und vertrieben worden. Wir lebten in Aschaffenburg, weil meine Tante nach der Flucht dort eine Anstellung als Lehrerin gefunden hatte. Mein Vater war noch in Gefangenschaft. Die Familie fand sich, wie in hunderttausenden von anderen Fällen, dort zusammen, wo der Erste einen Job erhielt.
Ich bin ein Nachkriegskind. Freitagabends bin ich mit den Eltern immer zu den Großeltern gegangen, zwei Jahrzehnte lang: Schlesienabend. Es gab schlesische Gerichte mit viel Mohn und Thymian und Erinnerungen an die alte Heimat, die ich nie gesehen hatte. Ich erinnere mich vor allem an die Wehmut dieser Abende. Als Kind hat mich das manchmal irritiert. Erst später habe ich verstanden, was die Großeltern bewegte. Der Verlust der Heimat ist gerade für die Älteren ein Schmerz, der bleibt. Die Wunden der Erinnerung können heilen, doch die Narben tun immer noch weh. Aus der Heimat zu flüchten, aus dem angestammten Lebensumfeld vertrieben zu werden – für fünfzehn Millionen Deutsche war dies das traumatische Ereignis ihres Lebens. Am Ende eines Krieges, der gezeigt hat, wozu Menschen fähig sind; eines Krieges, der von deutschem Boden ausgegangen ist, den Deutsche aggressiv geführt haben – am Ende dieses Krieges sind deutsche Frauen, Kinder, alte Menschen selbst millionenfach zu Opfern geworden.
Wenn wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Opfer des 20. Jahrhunderts gedenken, dann sollten wir uns aller Opfer erinnern – der von Krieg und Holocaust, aber auch von Flucht und Vertreibung. Und gewiss nicht nur der deutschen Opfer. Denn Vertreibung war im 20. Jahrhundert ein Verbrechen, das viele traf: Allein in Europa haben zwischen 1939 und 1948 fast fünfzig Millionen Menschen ihre Heimat unter Zwang verlassen müssen. Zwar gibt es da und dort noch Stimmen, die uns die Trauer um die eigenen Opfer untersagen wollen: weil Hitler den Krieg begonnen hat, weil Deutsche zu Tätern im Holocaust geworden sind. Doch ich halte eine solche Einstellung für anmaßend. Es hat nichts mit Relativierung oder gar Aufrechnung zu tun, wenn wir der Toten gedenken, die auf den eisigen Straßen Ostpreußens im Winter 1945 sterben mussten; wenn wir der Toten gedenken, die auf der Flucht über die Ostsee mit ihren Schiffen untergegangen sind; wenn wir der Menschen gedenken, die als Zwangsarbeiter nach Sibirien verschleppt worden sind; wenn wir der Toten gedenken, die während der Vertreibung umgekommen sind. Die Fähigkeit zu trauern geht Hand in Hand mit dem Mut, uns zu erinnern.
Es ist ein wunderbares Zeichen für ein neues Miteinander in Europa, dass es nach Jahrzehnten eifriger Polemik diesen Mut inzwischen auch in jenen Ländern gibt, die damals Schauplätze der schrecklichen Geschehnisse gewesen sind. In Polen wird der Kommandant des Flüchtlingslagers Lamsdorf vor Gericht gestellt. In Tschechien wird das Unrecht der Vertreibung von Millionen Menschen offen diskutiert; in Kroatien wird der Donauschwaben, Mitbürger von einst, gedacht. Ein Europa, das zusammenwächst, kann und darf es sich nicht leisten, die dunklen Schatten der Vergangenheit ohne Aufarbeitung zu verdrängen und zu vergessen. Schuld darf nicht aufgerechnet, aber sehr wohl ausgesprochen werden. Denn Versöhnung braucht vor allem Offenheit.
Wir schulden diese Offenheit nicht nur den nachfolgenden Generationen, nicht nur den Toten, derer wir gedenken, sondern auch den Überlebenden. Es muss den Augenzeugen von damals heute möglich sein, offen über ihr Erleben zu reden. In ein paar Jahren werden diese authentischen Stimmen verstummt sein. So gilt es jetzt, sie umfassend zu sichern. Es ist höchste Zeit.
Über tausend Interviews sind mit Zeitzeugen von Flucht, Vertreibung und Verschleppung für dieses Buch geführt worden. Die Erinnerungen sind oft schmerzlich. Schmerzlich für die Überlebenden – und schmerzlich auch für jene, die diese Geschichten zum ersten Mal lesen und hören. Ich bin dankbar, dass es nicht nur Interviews mit Deutschen waren, sondern ebenso auch Interviews mit Russen, Polen, Tschechen und Ukrainern. Wenn es heute möglich ist, zu den blutigen traumatischen Kapiteln unserer Geschichte eine gemeinsame Sprache zu finden, lassen sich die letzten Gräben überwinden – für die Zukunft aller in Europa. Wir haben erst seit ein paar Jahren die Möglichkeit, östlich von Oder und Neiße in bislang unveröffentlichte Akten einzusehen und bislang unbekanntes Filmmaterial auszuwerten. Zwar fanden wir kaum Bilder von dem Leid der Menschen, die gequält, gepeinigt und getötet wurden. Es gibt keine Filme über jene Deutschen, die ins Innere der Sowjetunion verschleppt wurden. Keine Filme von den Todeszügen, in denen Leichen waggonweise gestapelt wurden. Keine Bilder, die sich in das kollektive Bewusstsein eingebrannt haben. Doch was es gibt, ist die Erinnerung der Menschen, die all das erlebt haben.
Flucht und Vertreibung hatten nicht erst begonnen, als am 20. August 1944 ein Spähtrupp der Roten Armee östlich von Schillfelde über den Grenzfluss Scheschuppe setzte und der Zweite Weltkrieg Ostpreußen erreichte. Fünf Jahre vorher waren bereits die ersten Polen aus Posen und Westpreußen von Hitlers Helfern vertrieben worden. Drei Jahre vorher hatten bereits Himmlers Schergen von Finnland bis zum Schwarzen Meer eine Blutspur von millionenfachem Mord gezogen, um den Wahn vom Lebensraum im Osten zu verwirklichen. All das schlug nun zurück auf Schlesier und Sudetendeutsche, Ostpreußen und Pommern – kostete dreizehn Millionen Menschen die Heimat und darüber hinaus wohl bis zu zwei Millionen Menschen das Leben.
Es war die »Stunde der Vergeltung für die Qualen und Leiden, für die verbrannten Dörfer und zerstörten Städte, die Kirchen und Schulen, für die Verhaftungen, Lager und Erschießungen, für Auschwitz, Majdanek, Treblinka, für die Ausrottung des Ghettos« – so das Manifest des »Nationalen Polnischen Befreiungskomitees« vom Juli 1944. In jenem Juli 1944 hätte das Geschehen wohl zum letzten Mal noch abgewendet werden können. Wenn im Rastenburger Stadtwald das Attentat auf Hitler gelungen wäre – alles hätte anders kommen können. Dann wäre, ob durch eine provisorische Regierung Goerdeler oder durch ein Militärregime, der Krieg beendet worden – so oder so. Die Abtrennung Ostdeutschlands und die Vertreibung seiner Menschen hätten nicht verhindert werden können. Beides stand als alliiertes Kriegsziel ja längst fest. Doch dann wäre es vielleicht doch eine »Umsiedlung« geworden, halbwegs geordnet, eher im Sommer, nicht im Winter und nicht in überstürzter Flucht vor der Rache der Roten Armee. Die Rache war furchtbar. Angestachelt von den mörderischen Parolen eines Ilja Ehrenburg übten die Sowjets nun blutige Vergeltung an der deutschen Zivilbevölkerung. Von Stalingrad bis an die deutschen Grenzen waren sie den grausamen Spuren von Hitlers Vernichtungsfeldzug gefolgt. Nun zogen sie plündernd und mordend durch die deutschen Städte und Dörfer. Die Bilder jener Tage waren unbeschreiblich. Von Panzern überrollte Trecks auf vielen Straßen, ermordete Männer, vergewaltigte Frauen, getötete Kinder, erfrorene Babys – Augenzeugen, die das Grauen überlebten, werden diese Bilder nie vergessen können. Es waren keine Täter, an denen sich die Wut der Sieger austobte – es waren Wehrlose. Vor allem Frauen, Kinder, alte Menschen.
Vieles wäre der Zivilbevölkerung erspart geblieben, hätte man sie rechtzeitig evakuiert. Doch die Menschen durften ihre Dörfer und Städte nicht verlassen. Schließlich war es zu spät für eine sichere Rettung. Als die Rote Armee binnen weniger Tage die dünnen deutschen Verteidigungslinien an der Grenze zu Ostpreußen durchbrach und bei Elbing an die Ostseeküste vorstieß, saßen zweieinhalb Millionen Menschen in der Falle. So sammelten sich überall in aller Eile Trecks, die zu den Häfen strebten. Zu Fuß, mit Schlitten oder Pferdewagen versuchten die angstvollen Menschen, ein rettendes Schiff zu erreichen. Doch vor den scheinbar sicheren Häfen lag das Haff, eine bis zu zwanzig Kilometer breite, siebzig Kilometer lange Ostseebucht, die durch eine fünfzig Kilometer lange Landzunge, die Nehrung, von der offenen See getrennt ist. Schon die Überquerung des zugefrorenen Haffs war für viele ein Wettlauf mit dem Tod. In der dunklen Eiswüste kamen sie vom festen Weg ab, verirrten sich und brachen ein.
Durch den ganzen deutschen Osten zog sich eine Spur des Grauens: Kinderwagen mit erfrorenen Säuglingen standen am Straßenrand. Kadaver verhungerten Viehs säumten die Alleen – und immer wieder wurden Trecks von Tieffliegern zerschossen, von Panzern überrollt. Der britische Premier Winston Churchill schrieb am 1. Februar 1945 an seine Ehefrau: »Dir darf ich bekennen, dass die Berichte über die Massen deutscher Frauen und Kinder, die auf den Straßen in vierzig Meilen langen Kolonnen vor den vordringenden Armeen nach Westen fliehen, mein Herz mit Trauer erfüllen.«
Was die Menschen dennoch antrieb, war die pure Angst. Viele wussten nicht einmal genau, wohin. Sie wussten nur: Sie mussten fort. Denn im Rücken der Trecks brannte die Heimat.
Wer in seinem Dorf noch ausgeharrt oder sich zu spät zur Flucht entschlossen hatte, erlebte das Grauen oft in noch schlimmerer Form: Vergewaltigungen, Morde, hunderttausendfach. Ein sowjetischer Offizier schrieb in sein Tagebuch: »Vor unseren Panzern hat ein Soldat eine deutsche Frau und ihren Säugling erschossen, weil sie sich weigerte, ihm zu Willen zu sein. Es ist fürchterlich. Aber die Deutschen haben bei uns massenhaft noch viel Schlimmeres verbrochen.«
Doch inmitten der schlimmsten Exzesse unmenschlicher Brutalität finden sich auch Belege von Humanität. Lew Kopelew, der spätere Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, landete für viele Jahre in Stalins Straflagern, weil er versucht hatte, deutsche Zivilisten vor der Mordgier seiner Kameraden zu retten. Ebenso erging es Alexander Solschenizyn.
Im Gedächtnis haften bleiben den Überlebenden nicht nur die Gräuel der Eroberer, sondern auch die Perversion der NS-Amtswalter: ein Erich Koch in Ostpreußen, der die Bevölkerung zum Ausharren zwang, während für ihn selbst zwei Schiffe zur Flucht über die Ostsee bereit lagen; oder ein anonymer Polizist in Pommern, der einer jungen Frau befahl, ihren Schuhladen bei Todesstrafe offen zu halten. Eine Stunde später rollten die Sowjetpanzer vor. Die Pommerin Libussa Fritz-Osler erinnert sich, dass Flüchtlinge, die ohne schriftliche »Erlaubnis« unterwegs waren, umgehend erschossen wurden.
Wer in Ostpreußen und Pommern die brennende Heimat hinter sich ließ, wer die Hafenstädte Swinemünde, Danzig oder Pillau lebend erreichte und das Glück besaß, auf eines der übervollen Schiffe zu gelangen, die nun täglich Richtung Westen ablegten, glaubte sich gerettet. Doch der Leidensweg der Menschen war noch nicht zu Ende. Unter den vielen traurigen Geschichten jener Tage ragt eine besonders hervor – der Untergang der »Wilhelm Gustloff«. Für dieses Buch ist es gelungen, nicht nur Dutzende von Überlebenden zu befragen, sondern auch zwei Männer der Besatzung jenes U-Boots, das die »Gustloff« damals torpedierte. 9000 Menschen kamen um. Über die Hälfte von ihnen waren Kinder. Es war, bedingt allein durch die Zahl der Opfer, wohl die größte Katastrophe in der Geschichte der Seefahrt.
Während in Ostpreußen und auf der Ostsee die Menschen um ihr Überleben kämpften, vollzog sich in Schlesien eine Tragödie anderer Art. Hier hatte sich Gauleiter Hanke – wie viele seiner Amtskollegen – allen Forderungen widersetzt, die Bevölkerung rechtzeitig zu evakuieren. Stattdessen wurde die schlesische Hauptstadt Breslau zur »Festung« erklärt. Starke russische Kräfte sollten gebunden werden, um den Vormarsch der Roten Armee auf Berlin zu verzögern. Es war das Todesurteil für die Stadt.
Und wieder traf die überstürzte Flucht vor allem Frauen und Kinder. Sprichwörtlich wurde der »Todesmarsch der Breslauer Mütter«, die mit ihren Kindern im eisigen Schneesturm bei minus zwanzig Grad zu Fuß nach Westen zogen. 18 000 Menschen starben dabei – vor allem Kinder. In den kommenden zehn Wochen wurden in Breslau zehntausende von Menschen in den Tod getrieben – nicht nur durch Feindbeschuss, sondern auch durch eigenen Fanatismus. Auch hier waren es vor allem Einheiten der Hitlerjugend, die am längsten und heftigsten Widerstand leisteten. Als eine der schönsten deutschen Städte in einem Meer von Blut und Tränen unterging, verschwand ihr Gauleiter Hanke mit einem »Fieseler Storch«.
Während sich die »Festung« Breslau in einem sinnlosen Kampf aufrieb, wurden in den schon eroberten Gebieten seit dem März 1945 vollendete Tatsachen geschaffen: Im Vorgriff auf die Westverschiebung Polens, die auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 beschlossen werden sollte, kamen Pommern, Schlesien und Masuren unter polnische Verwaltung. Danzig folgte wenig später. Die Deutschen, die noch in diesen Gebieten lebten, mussten ab Ende Juni ihre Heimat verlassen. Zum Teil wurden sie vor ihrer Vertreibung in Lagern zusammengepfercht. Oft waren die Internierten dort wehrlos der Willkür der Wachen ausgesetzt.
Andere Deutsche schickte man ohne Vorwarnung auf den Weg. Innerhalb von zehn Minuten hatten sie ihre Sachen zu packen. Danach waren sie wochenlang auf der Landstraße. »Es war ein Elendszug. Wir zogen Kinderwagen, Leiterwagen, Schiebkarren, Sportwagen, man sah die unmöglichsten Gefährte. Von morgens bis abends um sieben durfte man auf der Landstraße bleiben, dann schlief man entweder im Wald, in schmutzigen Scheunen und leeren Wohnungen«, schildert eine Frau aus Sorau die Strapazen. Für sie endete der Weg in Cottbus, in der sowjetisch-besetzten Zone.
Cottbus war wie die anderen »Grenzstädte« Stettin, Frankfurt an der Oder und Görlitz im Sommer 1945 bis zum Bersten überfüllt. Neben den Einheimischen kämpften auch diejenigen ums Überleben, die hofften, in den nächsten Wochen und Monaten in ihre Heimat im Osten zurückkehren zu können. Viele Wohnungen waren zerstört, Lebensmittel kaum aufzutreiben. Typhus und andere Krankheiten grassierten.
In der Tschechoslowakei erging es den Deutschen nicht besser: Als sich die Tschechen am 5. Mai 1945 in Prag gegen die deutsche Besatzung erhoben, unterschieden sie nicht zwischen Militär, Beamten und friedlichen Bürgern. Wen die Aufständischen als Deutschen erkannten, der wurde mitgenommen, unter Stockhieben auf Lastwagen getrieben und in Schulen, Kinos oder Kasernen interniert. Dann brachte man die Deutschen als Zwangsarbeiter aufs Land oder in eines der Lager. Dort hatten sie auf ihre Ausweisung zu warten. Ob es sich bei den Aufgegriffenen um NS-Funktionäre handelte, um Flüchtlinge aus Schlesien oder um Menschen, die schon seit Generationen in Prag lebten, war einerlei.
Die Wut auf die Deutschen mündete in gezielte Diskriminierung: Eine weiße oder gelbe Armbinde mit dem Buchstaben »N« für »Němec«, Deutscher, wurde Pflicht. Die Binde kennzeichnete, wer öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen durfte oder die Sperrstunde einzuhalten hatte. Die Ausgrenzung, die wenige Jahre zuvor den Juden widerfahren war, fiel auf die Deutschen zurück. Welchen Hass die ehemaligen Besatzer auf sich zogen, zeigte sich in Aussig. Als dort am 31. Juli 1945 ein Munitionslager explodierte, vermutete man einen deutschen Sabotageakt. Eine halbe Stunde später griff eine aufgebrachte Menge Deutsche an, die über eine Brücke von der Arbeit heimkehren wollten. Über 200 Menschen verloren ihr Leben.
In Brünn, wie auch an anderen Orten, ließ man den Deutschen Ende Mai nur wenig Zeit, zusammenzupacken, bevor sie nach Westen getrieben wurden. »Wir durften uns nicht setzen, durften uns nicht ausruhen, keinen Schluck Wasser trinken, obwohl es fürchterlich heiß war. Hier hat eine Mutter nach ihrem Kind geschrien, dort haben Kinder nach der Mutter geschrien. Es war furchtbar.« Zu den Strapazen des tagelangen Fußmarschs gesellten sich der allgegenwärtige Nahrungsmangel und die wüsten Beschimpfungen und Schläge durch aufgebrachte Tschechen am Wegrand. Wer nicht mehr weiterkonnte, wurde liegen gelassen oder erschossen. Unterwegs wurden die Flüchtlinge wiederholt überfallen, die Frauen mehrfach vergewaltigt. Bei ihrer Ankunft im Westen besaßen die Vertriebenen oft nur mehr das, was sie am Leib trugen.
Besonders ergreifend ist das Schicksal all der Menschen, die in jenen Tagen zur Zwangsarbeit in das Innere der Sowjetunion verschleppt wurden. Mindestens 530 000 Deutsche wurden in den letzten Kriegs- und ersten Friedenswochen von Sonderkommandos des sowjetischen Geheimdiensts gefangen genommen und deportiert. Andere Quellen sprechen von mehr als einer Million zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion verschleppten deutschen Zivilisten. Ohne Erklärung, oft völlig willkürlich wurden sie abtransportiert. Mitunter wurden alle verfügbaren Deutschen zwischen dreizehn und 65 Jahren, in Einzelfällen sogar kleine Kinder, deportiert.
Für sie war eine eigene Organisation geschaffen worden, die GUPVI. Diese »Hauptverwaltung für Angelegenheiten der Kriegsgefangenen und Internierten« funktionierte nach demselben Schema wie der Archipel GULAG, das System der Straflager für die inneren »Feinde« der Sowjetunion.
Jahrelang fehlte jedes Lebenszeichen von den Verschleppten, die im Archipel GUPVI verschwunden waren. Während Kriegsgefangene schon in den ersten Jahren Karten an ihre Angehörigen schreiben durften, war dies den Zivilinternierten lange verboten. Von besonderer Tragik war das Schicksal jener Kinder, deren Mütter verschleppt wurden, verhungerten oder als Folge von Vergewaltigungen starben. So schlugen sich tausende ostpreußische Kinder nach Litauen durch, um dort als kleine Landstreicher ums Überleben zu kämpfen. Sie wurden »Wolfskinder« genannt – wohl, weil sie wie die Wölfe in den Wäldern lebten, allmählich ihre deutsche Sprache verlernten und sich auf Litauisch oder gar Russisch oft auch nicht recht verständlich machen konnten. Viele von ihnen suchen bis heute nach ihren Verwandten, um endlich eine Antwort auf die bohrende Frage zu bekommen: »Wo komme ich her, wer bin ich?« Sie sind die verlorenen Kinder des 20. Jahrhunderts.
Wenn wir von Hoffnung, Mut und Zuversicht in diesen dunklen Wochen hören, sind es oft Geschichten von und über Frauen. Die das grausige Geschehen überlebten, trugen die Hauptlast von Flucht und Vertreibung. Ihre Männer, Brüder, Väter, Söhne waren oft nicht da – vermisst, gefangen oder gefallen. Sie sahen sich zum Handeln gezwungen. Mochte Hitlers Reich zugrunde gehen, Hitlers Volk ging nicht zusammen mit ihm unter – auch wenn Hitler selbst dies gern gesehen hätte. Das Leben ging weiter, Kinder kamen auf die Welt. Der Kampf der Männer war vorbei, der Kampf der Frauen begann erst. Sie waren es vor allem, die für das Überleben der Familien sorgten. Es war die Stunde der Frauen.
Was allen, die Flucht und Vertreibung überlebt hatten, bevorstand, war die Aufnahme im Westen. Kaum einer empfing sie mit wirklich offenen Armen. Viele Geschichten zeugen von Missgunst, Ablehnung, ja offenem Hass, der den Vertriebenen und Flüchtlingen entgegenschlug.
Die Verdichtung der Bevölkerung führte angesichts von Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftselend anfangs zu enormen Spannungen. So kam es, dass die Neubürger oft als »Fremde« beargwöhnt und je nach Herkunft als »Polacken«, als »Sudetengauner« oder »Flüchtlingspack« beschimpft wurden.
Aber ohne diese Menschen wäre das viel zitierte nachkriegsdeutsche Wirtschaftswunder nicht möglich gewesen. Diese Menschen mochten kein Vermögen haben – doch sie hatten Kenntnisse, sie hatten Ehrgeiz, wollten es zu etwas bringen, wieder in Würde leben. Und sie gingen dorthin, wo die Arbeit war. Das »Wirtschaftswunder« war für sie kein Wunder, sondern harte Arbeit und Verzicht auf Zeit. Ohne die Vertriebenen und Flüchtlinge von einst wäre es wohl kaum so glanzvoll ausgefallen.
Dass es nach dem Krieg gelungen ist, Millionen hungernden und heimatlosen Menschen wieder ein Dach über den Kopf zu geben, sie in Wirtschaft und Gesellschaft einzugliedern, ohne Streiks und Bürgerkrieg – das ist das eigentliche deutsche Nachkriegswunder.
Mit dem Verlust der Heimat haben sich die meisten Überlebenden inzwischen abgefunden. Viele haben sich den Traum, die alte Heimat wiederzusehen, längst erfüllt – Heimkehr auf Zeit, ohne Zorn. Die meisten wollen die Verständigung, eine Versöhnung mit den Menschen, die heute an den Stätten ihrer Jugend leben. Und viele wünschen sich vor allem eines: dass man ihnen zuhört, wenn sie sich erinnern. Sie wollen sagen können, dass auch sie sich als Opfer jenes mörderischen Krieges fühlen. Einfach darüber reden, solange noch Zeit ist.
Dem dient dieses Buch.
Ostpreußen, Januar 1945. Sowjetische Panzer durchbrechen innerhalb weniger Tage die Ostfront. Hunderttausende deutsche Zivilisten fliehen überstürzt aus der Heimat. Sie reihen sich ein in den immer länger werdenden Treck nach Westen.
Der große Treck
Die Fläche schien endlos: Siebzig Kilometer lang und zwanzig Kilometer breit glitzerte das Eis des Frischen Haffs. Am Horizont, nur schemenhaft zu erkennen, lag die schmale Landzunge, die die Bucht vom offenen Meer, der Ostsee, trennte. Die Frische Nehrung war für viele Flüchtlinge im Januar 1945 zur letzten Hoffnung geworden. Oft waren sie wochenlang mit ihren Pferdewagen, ihren Handkarren und Schlitten umhergezogen: bei schneidender Kälte, ohne Ordnung, ohne Ziel, im Rücken die immer näher kommende Front. Am 12. Januar hatte der Sturm der Roten Armee auf Ostpreußen begonnen. Schon nach wenigen Tagen, am 23. Januar 1945, stießen sowjetische Panzer bei Elbing zur Ostseeküste vor. Damit war die Landverbindung zwischen Ostpreußen und dem Reichsgebiet im Westen abgeschnitten – über zweieinhalb Millionen Menschen saßen in der Falle. Flucht war nur noch mit dem Schiff über die Ostsee möglich. Der einzige Weg in die Hafenstädte Danzig oder Pillau führte nun über die Frische Nehrung. Doch um zur rettenden Landzunge zu gelangen, mussten die Flüchtlinge mit ihren Planwagen und Karren das Eis des Haffs überwinden. Es war für viele ein Wettlauf mit dem Tod. An manchen Stellen war die Eisfläche nur wenige Zentimeter dick, gefährliche Spalten hatten sich aufgetan. Holzpfähle oder kleine Tannenbäume, die ins Eis gesteckt worden waren, sollten den Weg für die Flüchtlinge markieren.
Es wusste keiner, ob er lebend über das zugefrorene Haff kommen würde. Hanns-Joachim Paris, Kriegsberichterstatter
Eine gefährliche Überfahrt: Die gleißend weiße Fläche bot keinerlei Schutz vor sowjetischen Tieffliegerangriffen. Dort, wo Sprengbomben Löcher in das Eis gerissen hatten, bildete sich bei Temperaturen von bis zu minus zwanzig Grad Kälte schnell eine tückisch dünne Eisschicht, die aber kein Gewicht tragen konnte. Immer wieder brachen Wagen ein und zogen Mensch und Tier mit in die Tiefe.
Für viele Ostpreußen zählt die Haffüberquerung zu den traumatischsten Erlebnissen der Flucht. Hildegard Rauschenbach aus dem Kreis Pillkallen war damals 19 Jahre alt. Ende Januar 1945 erreichte sie mit ihren Eltern die Küste bei Heiligenbeil. Vor dem Haff wurde die Familie auf einen großen Platz geführt, auf dem bereits Hunderte von Schicksalsgenossen warteten. Den Flüchtlingen wurde nur gestattet, ihr Handgepäck mitzunehmen. Alles andere mussten sie zurücklassen, denn die Wagen durften bei der Flucht über das brüchige Eis nicht zu schwer beladen sein. Binnen weniger Stunden türmte sich das Flüchtlingsgut am Straßenrand: Nähmaschinen, Fässer mit gepökeltem Fleisch, Radios, Federbetten, Kisten mit wertvollem Porzellan und Familiensilber. Überall wimmelte es von Menschen, Kinder weinten vor Kälte und Angst, Schreie durchschnitten die eisige Luft – inmitten des ganzen Chaos wurden Familienmitglieder voneinander getrennt, gingen Kinder ihren Müttern für immer verloren.
Damit das Eis die schwere Last tragen konnte, wurden die Wagen im Abstand von mehreren Metern nacheinander auf die vorgesehene Strecke eingewiesen. Es kam zu langen Stauzeiten. Viele versuchten das Eis im Schutz der Dunkelheit zu überqueren. Nur nachts konnten sich die Flüchtlinge vor sowjetischen Jagdbombern sicher fühlen. In der dunklen Eiswüste aber kamen viele vom Weg ab und stürzten in die Bombenkrater. Wer stehen blieb, lief Gefahr zu sinken. Schnell bildeten sich Wasserlachen um die Räder der Wagen, sackten riesige Eisschollen in die Tiefe. »Wir sind die ganze Nacht gefahren und gefahren«, erinnert sich Hildegard Rauschenbach, »mein Vater sagte: ›Wir müssten doch schon längst auf der Nehrung sein!‹ Als dann der Morgen graute – dieses Bild werde ich nie in meinem Leben vergessen -, sah ich diese endlos lange Schlange von Wagen. Ich hörte dieses leise Knirschen der Räder im Schnee. Die Pferde schnaubten mit den Nüstern und ihr Atem vermischte sich mit der eisigen Winterluft. Dann ging die Sonne auf. Es war gespenstisch still. Nur das Schnauben der Pferde und die knirschenden Räder waren zu hören.« Hildegard Rauschenbach und ihre Eltern gelangten unbeschadet über das Eis des Frischen Haffs.
Für die Ostpreußin Irmela Ziegler aus Warschfelde im Kreis Elchniederung endete die nächtliche Flucht über das Eis mit einem Unglück. Sie lief neben dem Wagen ihrer Familie her, als ein jähes Krachen die 18-Jährige aufschreckte: Unmittelbar vor ihr sank der Wagen in Sekundenschnelle. Mutter, Vater und die sechs Geschwister schienen verloren. Doch ihrem Vater gelang es, vom Kutschbock abzuspringen und die Pferde am Zügel zu greifen. Mit letzter Kraft stemmten sich die Tiere mit den Vorderhufen auf die Kante des Eises und rissen den Wagen hoch. Irmela Ziegler sah ihre Mutter starr vor Schreck im Wagen sitzen – von ihr war keine Hilfe zu erwarten. Die junge Frau stellte sich auf die Eiskante, hielt sich mit einer Hand an den Pferden fest und griff mit der anderen Hand hinüber: Drei ihrer Geschwister krabbelten an der Mutter vorbei aus dem Wagen. Irmela riss sie, ohne zu zögern, zu sich. Dann aber rutschten die Pferde ab und der Wagen ging unter. Verzweifelt klammerten sich die vier Geschwister aneinander. Die Mutter und zwei weitere Geschwister hatte der Vater gerade noch aus dem sinkenden Wagen retten können. Doch für die jüngste Schwester, ein wenige Monate altes Baby, kam jede Hilfe zu spät. Die Kleine ertrank vor den Augen ihrer hilflosen Eltern.
Tag für Tag, von Januar bis März 1945, spielten sich auf dem Eis dramatische Szenen ab. Hitlerjugend- und Volkssturmeinheiten wurden abgestellt, um die Trecks auf dem Eis vor Angriffen der Sowjets zu beschützen. Ein aussichtsloser Auftrag: Auf der weiten Fläche bot der Flüchtlingsstrom den russischen Tieffliegern bei gutem Wetter ein unübersehbares Angriffsziel. Wahllos schössen die Bord-MGs der Flieger auf die Menschen, die mit ihren letzten Habseligkeiten das Haff überquerten. Fontänen spritzten hoch, wenn Bomben in das Eis einschlugen. Eis- und Granatsplitter prasselten auf die Flüchtlinge herab, die verzweifelt hinter ihren Fuhrwerken Deckung suchten. »Man hatte das Gefühl, man würde bei Gewitter fahren, so grollte und blitzte es um uns herum, Tag und Nacht«, erinnert sich Hannelore Thiele. Den Weg zur Nehrung säumten bald zerfetzte Körper und Pferdekadaver, deren Blut das Eis rot färbte. »Wir haben nichts weiter tun können, als am nächsten Morgen die Toten zu bergen«, erinnert sich Karl-Heinz Schuhmacher an seinen »Volkssturmeinsatz« auf dem Haff. »Das war wirklich ganz grausam. Alle hatten nur einen Wunsch: ›Raus, raus, raus!‹«
Wie ein dichter Waldstreifen am Horizont wirkte der kilometerlange Strom der Flüchtlingstrecks – Wagen an Wagen reihte sich auf dem Eis des Haffs. Wer die schmale Landzunge lebend erreichte, glaubte sich zunächst in Sicherheit und schöpfte wieder Hoffnung. Doch auch hier nahm das Elend kein Ende. Auf den engen Sandwegen drängten Wagen einander die Böschung hinab. Verletzt, von Kugeln getroffen, erschöpft und völlig unterkühlt blieben zahllose Flüchtlinge am Straßenrand liegen, vor allem Alte und Kinder – die Schwächsten der Schwachen. Wie Lemminge schoben sich die Menschen die Nehrungsstraße entlang, vorbei an Leichen, zerschmetterten Wagen und Bergen von Gepäck. Einige scherten aus dem Strom aus und unterbrachen die qualvolle Reise, um sich von den Strapazen der Haffüberquerung zu erholen.
Die Trecks sind meistens nachts übers Haff gefahren, weil sie am Tag beschossen wurden. Da, wo Bomben Löcher ins Eis geschlagen hatten, stand immer jemand und leitete die Wagen um das Loch herum. Tote Pferde, Hausrat und auch tote Menschen schwammen in den Löchern. Heinz Grönling, damals vierzehn Jahre alt
Auch die Familie von Irmela Ziegler machte auf der Nehrung Halt. Trotz drohender Tieffliegerangriffe trieb es den Vater an diesem Morgen nach der Tragödie noch einmal auf das Haff hinaus, um sein totes Kind aus dem Wasser zu bergen. Als er wieder unversehrt zurückkehrte, schaufelte die Familie schweigend ein kleines Grab im Sand, rollte den Säugling in einen Teppich und bestattete ihn. »Ich heulte wie ein Schlosshund«, schildert Irmela Ziegler die traurige Szene, »aber meine Mutter war völlig erstarrt. Sie hat das lange, lange nicht verarbeiten können.«
Nur wenige Monate zuvor schien der Krieg noch weit entfernt. Über den wogenden Kornfeldern lag die drückende Hitze des Hochsommers, auf den weiten Feldern und Wiesen standen Pferde und Rinder, die Bauern bereiteten die Ernte vor: Ostpreußen, die »Kornkammer Deutschlands«, wirkte weitab von allen Fronten wie eine Insel des Friedens. »Wir hatten eine sehr beschauliche Zeit im Krieg«, erinnert sich der Schriftsteller Arno Surminski, der in Jäglack im Kreis Rastenburg aufwuchs. »Jahrelang herrschte relativer Frieden. Man hörte vom Krieg nur durch die Urlauber von der Front oder durch Gefallenenmeldungen.« Während im »Reich« schon Hunderttausende von Bombenopfern zu beklagen waren und Städte wie Lübeck, Köln und Hamburg bereits in Schutt und Asche lagen, fühlten sich die Menschen in Ostpreußen vor alliierten Luftangriffen weitgehend sicher. Die Propaganda des Hitlerregimes hatte ihnen weisgemacht, keinem britischen Bomber würde es je gelingen, die weite Strecke bis Ostpreußen zurückzulegen. So trafen aus dem Westen immer öfter voll besetzte Züge ein: Mit der »Kinderlandverschickung« wurden seit 1941 Kinder aus gefährdeten Ballungsgebieten, vor allem aus Berlin, evakuiert. Das Land des Bernsteins, der dunklen Wälder und kristallenen Seen, des hohen Himmels und der vielen Störche schien wie geschaffen als Zufluchtsort für ausgebombte Reichsbewohner. Die ständig zurückweichende Ostfront beeinträchtigte das Sicherheitsgefühl der Zivilbevölkerung wenig, spielten sich die Kampfhandlungen doch noch immer nicht auf deutschem Boden ab.
Es war eine grauenvolle Fahrt: Ich hatte meine beiden kleinen Kinder fest im Arm, weil ich mir sagte, wenn wir getroffen werden würden, dann hoffentlich alle. Stephanie Lingk, flüchtete über das Haff
Dass sich jenseits von Memel und Weichsel eine Katastrophe anbahnte, ahnte im Spätsommer 1944 kaum jemand.
Dabei hatte der Untergang Ostpreußens bereits am 22. Juni 1944 begonnen. Am dritten Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion eröffnete die Rote Armee nach stundenlangem Trommelfeuer ihre Sommeroffensive. Die deutsche Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall Ernst Busch setzte sich zu diesem Zeitpunkt nur noch aus rund 500 000 Mann zusammen. Vergeblich hatten die Oberbefehlshaber Hitler darum gebeten, den fast eintausend Kilometer langen Balkon, den die Front weit nach Osten formte, aus strategischen Gründen zurückzunehmen. In blinder Verbissenheit klammerte sich der Kriegsherr an die fixe Idee, jedes einmal eroberte Fleckchen Boden »bis zum letzten Mann verteidigen zu müssen«. Den Bau von Befestigungslinien hinter der Front lehnte er ab. Stattdessen erklärte er Städte, die im Frontbereich lagen, zu »festen Plätzen« und befahl deren Verteidigung »bis zur letzten Patrone«. Es war ein Kriegsgebaren, dem inzwischen jeder Sinn für die Wirklichkeit fehlte. Schon lange verfügte die deutsche Wehrmacht nicht mehr über die Kräfte, die nötig gewesen wären, solche »Festungen« zu halten. Hitler hatte sämtliche Reserveeinheiten an die Invasionsfront im Westen abberufen. Als gut zwei Wochen nach der alliierten Landung in der Normandie 160 Divisionen der Roten Armee mit 2,2 Millionen Soldaten und über 6000 Schlachtfliegern im Osten losschlugen, vermochte die Heeresgruppe Mitte der russischen Übermacht nur wenig entgegenzusetzen. Der Angriff der Sowjets entwickelte sich für die deutschen Truppenverbände zu einer der verlustreichsten Schlachten des Krieges im Osten: Von 38 eingesetzten Divisionen wurden 25 vollständig vernichtet, rund 350 000 deutsche Soldaten verwundet oder getötet. Der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte übertraf in seinen Auswirkungen sogar die Katastrophe von Stalingrad. Die Front war auf etwa 350 Kilometer aufgebrochen – der Weg zu Deutschlands Reichsgrenzen lag nun für die Rote Armee offen. In nur sechs Wochen stießen die Sowjets rund eintausend Kilometer weit nach Westen vor, durchmaßen den weiten Raum zwischen Dnjepr und Weichsel. Erst kurz vor der ostpreußischen Grenze kamen sie schließlich zum Stehen. Wer in grenznahen Gebieten wohnte, hörte in der Ferne schon das unheilvolle Grollen des Kanonendonners.
Es war immer gesagt worden: »Ihr braucht euch um nichts zu kümmern, keine Beunruhigung. Keinen Zentimeter ostpreußischen Bodens werden wir den Russen überlassen!« Marion Gräfin Dönhoff
Ende Juli zogen die ersten Flüchtlingstrecks durch Ostpreußen. Die Menschen stammten überwiegend aus dem Baltikum und dem angrenzenden Memelland, an das sich ein sowjetischer Panzerkeil bedrohlich nah herangeschoben hatte. Hitler genehmigte die Evakuierung der Memelländer, bevor die Rote Armee vorstoßen konnte. Auf einen solchen Befehl wartete die ostpreußische Bevölkerung im Januar 1945 vergeblich. Ströme von Menschen, mit hoch beladenen Kastenwagen, Pferden und Vieh, suchten nun Aufnahme bei den ostpreußischen Bauern. Ihr Anblick verursachte nur bei den wenigsten böse Vorahnungen. Viele, vor allem die Flüchtlinge selbst, waren davon überzeugt, dass die deutsche Wehrmacht die Sowjets bald zurückschlagen würde und sie wieder nach Hause zurückkehren konnten. Die deutsche Propaganda hatte die meisten Menschen so indoktriniert, dass sie sich in trügerischer Sicherheit wiegten. Als es tatsächlich gelang, den russischen Einbruch in die deutschen Linien abzuriegeln und die Front vorübergehend zu stabilisieren, atmete das Land erleichtert auf. Die Memelländer beeilten sich, auf ihre Höfe zurückzukehren und die Ernte einzubringen. Und obwohl allerorts Stimmen laut wurden, dass ein weiterer Vorstoß der Russen zu befürchten sei, säten auch in Ostpreußen die Bauern Korn für das nächste Jahr aus. Die Menschen hielten an ihrem gewohnten Lebensrhythmus fest – und an der Hoffnung, dass der Spuk bald vorüber sei. Dass der Krieg gegen die Sowjetunion einmal zu seinem Ausgangspunkt zurückkehren könnte, schien für die meisten unvorstellbar.
Dabei war die Zeit, als Ostpreußen zum Aufmarschgebiet für den Feldzug im Osten geworden war, noch vielen im Gedächtnis. Tagelang waren im Juni 1941 auf den Chausseen Kolonnen der Wehrmacht vorbeigezogen. Die Kinder am Straßenrand hatten den Soldaten zugewunken, die fröhlich singend in Richtung Osten fuhren oder marschierten. In Scheunen, Turnhallen und Spritzenhäusern waren Soldaten einquartiert worden und hatten ausgelassen den bevorstehenden Vormarsch gefeiert. Im August 1944 wurde die Illusion von der friedlichen Idylle jäh zerstört. Zweihundert britische Bomber erreichten in der Nacht vom 26. auf den 27. August den Luftraum über Königsberg.
Es war eine unerhört fröhliche Situation damals. Ich wundere mich im Nachhinein, dass diese Soldaten so ganz arglos ihren Weg machten. Dass sie nicht geahnt haben, dass da irgendetwas Schlimmes passieren würde. Es gibt keinen größeren Kontrast als den zwischen dieser Fröhlichkeit im Juni ‘41 und dem bitteren Ende im Januar ‘45, als die Front zurückkehrte. Da sind Welten dazwischen. Arno Surminski, Schriftsteller, Jahrgang 1934
Rund fünfhundert Tonnen Bomben gingen auf die Hauptstadt Ostpreußens nieder, 10 000 Menschen wurden über Nacht obdachlos, mehr als tausend fanden den Tod. Der zweite Angriff folgte nur wenige Tage später: Sechshundert Bomber der Royal Air Force warfen am 29. und 30. August vor allem über der Innenstadt ihre tödliche Fracht ab. Neue Brandstrahlbomben lösten verheerende Feuerstürme aus. Über 5000 Menschen starben in den Flammen, 150 000 Menschen verloren ihr Zuhause, die Zahl der Verletzten wurde nie ermittelt. Bei dem Angriff wurden über 50 Prozent der historischen Gebäude zerstört: die Fachwerkspeicher am Hafen, das Stadtschloss, die Universität, die Schlosskirche.
Auch für die Landbevölkerung Ostpreußens war der Luftangriff auf Königsberg ein einschneidendes Erlebnis. Der Feuerschein am Horizont erhellte nahe gelegene Dörfer und Gehöfte, feine Asche, Stanniolstreifen und Papierfetzen wurden durch die Luft geweht und gingen auf den Dächern und Straßen nieder. Auf den Feldern fanden die Bauern ausgebrannte Flugzeugwracks und Trümmer, die vom unerbittlichen Luftkampf über Königsberg zeugten. Die Menschen reagierten bestürzt und betroffen – es war die erste große Welle der Zerstörung in einer vom Krieg bis dahin kaum berührten Welt.
Nach dem Luftangriff auf Königsberg und dem raschen Vormarsch der Roten Armee schlug Wehrmachtsgeneral Friedrich Hoßbach, Oberbefehlshaber der 4. Armee, die »vorbeugende Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den östlichen Gebieten Ostpreußens« vor. Doch seine Rufe verhallten ungehört. Vor allem Erich Koch, Gauleiter Ostpreußens und intimer Freund von Hitlers Sekretär Martin Bormann, lehnte den Vorschlag strikt ab und verkündete stattdessen, kein Russe werde jemals ostpreußischen Boden betreten. Als »Reichsverteidigungskommissar« brüstete sich Koch mit einer Schimäre, die Ostpreußen vor dem bevorstehenden Angriff der Sowjets schützen sollte: dem Bau des »Ostwalls«. Mit Schützen- und Panzergräben meinte er den Vormarsch der Roten Armee aufhalten zu können: »Ein Aufruf an die Parteigenossen, ein leidenschaftlicher Appell des Führers an den Idealismus und die Vaterlandsliebe des gesamten Volkes würde genügen, um in wenigen Tagen hunderttausende von Freiwilligen zu den Fahnen zu rufen und einen Damm im Osten aufzurichten.« Doch weniger freiwillig als unter Androhung drakonischer Strafmaßnahmen wurden Zehntausende von ihren Arbeitsplätzen abgezogen, Männer und Frauen zum Schanzdienst verpflichtet. Mit einem wahren Massenaufgebot von Menschen, Pferden und Wagen trieb Koch den Stellungsbau voran. Theo Nicolai nahm als 16-Jähriger an der Schanzaktion teil: »Wir haben geschuftet und malocht von früh bis spät. Das war richtige Sklavenarbeit. Jeden Abend musste ein Abschnitt fertig sein, sonst konnte man nicht in sein Quartier zurück.«
Ich kann mich erinnern, dass eine Frau sagte: »Aber unser Führer wird doch nicht die Russen in unser schönes Ostpreußen hineinlassen!«, obwohl es sich schon abzeichnete. Aber wir haben bis zum Schluss noch gehofft. Es war unvorstellbar, einfach wegzugehen. Hildegard Rauschenbach, damals 18 Jahre alt
Dass der Bau des »Erich-Koch-Walls«, wie er im Volksmund bald genannt wurde, in die Erntezeit fiel und die deutsche Wehrmacht nun Kommandos stellen musste, um das Korn einzubringen, störte den Gauleiter wenig. »Ohne Partei gibt es den Frontgau Ostpreußen nicht. Nur die Partei kann sich herausnehmen, Menschenmassen zu fuhren. Innerhalb von drei Stunden nach Erhalt des Befehls standen die ersten Kolonnen abmarschbereit«, erklärte Koch triumphierend. Damit bezog er klar Stellung gegen die militärische Führung.
Zwar wurde der Verlauf der »Ostpreußenschutzstellung« von den Festungsstäben des Heeres festgelegt, doch die Einzelausführung lag in den Händen der Partei – und somit in den Händen Kochs. Als Generaloberst Georg-Hans Reinhardt Verteidigungslinien im Landesinneren statt in grenznahen Gebieten forderte, bot ihm der Gauleiter die Stirn und schmetterte sein Ansinnen als Defätismus ab. Koch nahm sich überdies heraus, in die Rüstungsproduktion des Landes einzugreifen, um sich ein eigenes Waffenlager anzulegen. Und Hitler ließ ihn gewähren. Mit der Errichtung des »Ostwalls« war es dem Gauleiter endgültig gelungen, sich zum Herrscher über Ostpreußen zu erheben. Damit stand ein Mann an der Führungsspitze der Provinz, der für seine Kälte und Unmenschlichkeit bekannt war. Als Koch 1943 als Reichskommissar der von deutschen Truppen eroberten Ukraine eingesetzt wurde, ließ er an den Mitteln seiner Politik nicht den allergeringsten Zweifel aufkommen: »Wir sind die Herrenrasse, und wir müssen hart, aber gerecht regieren. Ich werde das Letzte aus diesem Land herauspressen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Freude zu bringen. Die Bevölkerung muss arbeiten, arbeiten und wieder arbeiten. Wir sind bestimmt nicht hierher gekommen, um Manna zu verteilen. Wir sind hierhergekommen, um die Basis für den Sieg zu schaffen. Wir sind eine Herrenrasse. Wir müssen immer wieder daran denken, dass der niedrigste deutsche Arbeiter rassisch und biologisch tausendmal wertvoller ist als die Bevölkerung hier.« Zwangsarbeit, Hunger und Erschießungen kennzeichneten Kochs Regierungszeit. Der Gauleiter wusste nur zu gut, was geschehen würde, sollte die Rote Armee die Grenzen Deutschlands überschreiten. Drei Jahre lang hatten die Menschen in der Sowjetunion unter deutscher Gewaltherrschaft gelitten. Unzählige russische Soldaten waren gefallen oder in Gefangenschaft geraten, Zivilisten getötet, Städte und Dörfer zerstört worden. Immer wieder hatte die deutsche Propaganda die »jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung« angeprangert, immer wieder hatte sie das Zerrbild vom russischen »Untermenschen« gezeichnet. Hass hatte Hass erzeugt.
Jetzt, im Spätsommer 1944, stand die Rote Armee vor den Grenzen Ostpreußens. Die Soldaten waren auf ihrem Weg durch das von Deutschen verwüstete Russland gezogen, hatten Orte gesehen, die Görings und Himmlers Befehlen von der »verbrannten Erde« zum Opfer gefallen waren. Der Vormarsch ihrer Truppen hatte die unmenschlichsten Verbrechen ans Licht gebracht. Schon waren Meldungen von Vernichtungslagern, in denen das NS-Regime einen perfekt organisierten Massenmord betrieb, an die Weltöffentlichkeit gelangt. Die Hetzparolen der russischen Propaganda fielen nun auf fruchtbaren Boden.
Ilja Ehrenburg, Schriftsteller und Journalist, zählte zu den populärsten Figuren der sowjetischen Kriegspresse. Mitte der dreißiger Jahre war er durch seine Reportagen über den spanischen Bürgerkrieg bekannt geworden. Seit Beginn des »Unternehmens Barbarossa« war er zur Berühmtheit avanciert. Seine Artikel wurden in hunderten von Frontzeitungen abgedruckt und von unzähligen Soldaten der Roten Armee verschlungen. »Katjuschas« – »Stalinorgeln« nannte man seine Aufsätze, mit denen er in der Prawda und dem RotenStern gegen die Deutschen, die »Fritzen«, hetzte. In seinen zu Beginn der sechziger Jahre verfassten Memoiren bekannte Ehrenburg: »Ich erkannte es als meine Pflicht, das wahre Gesicht des faschistischen Soldaten zu zeigen, der mit einem erstklassigen Füllfederhalter in ein Tagebuchheft blutrünstigen, abergläubischen Unsinn über seine rassische Überlegenheit eintrug; Dinge, die so schamlos und barbarisch sind, dass sie selbst einen Kannibalen in Verlegenheit gebracht hätten. Ich musste unsere Krieger daran erinnern, dass es sinnlos war, auf die Klassensolidarität der deutschen Arbeiter, auf eventuelle Gewissensregungen bei Hitlers Soldaten zu rechnen, dass jetzt nicht die Zeit sei, in der attackierenden feindlichen Armee ›die guten Deutschem herauszufinden und dabei unsere Städte und Dörfer der Vernichtung preiszugeben. Ich schrieb: ›Töte den Deutschen!«
Gauleiter Koch verbot jede Flucht und wollte damit das sichere Gefühl vermitteln, dass die Russen nicht weiterkommen würden. Die Parole lautete: »Jeder Quadratmeter Heimatboden wird verteidigt.« Dass er den »Ostwall« hat bauen lassen, war – militärisch gesehen – völliger Unsinn. Hunderte von Frauen und Jugendlichen und alten Männern mussten im Herbst 1944 Panzergräben durch ganz Ostpreußen ziehen. Die haben hinterher gar nichts genützt. Winfried Hinz, Jahrgang 1927
Wie sehr dieser von fanatischem Hass geprägte Journalist die russischen Frontsoldaten beeinflusste, bezeugt Wladimir Korobuschin, der 1944 mit seiner Einheit vor den Grenzen Ostpreußens stand: »Der Krieg war grausam und Patriotismus bei unseren Soldaten weit verbreitet. Ehrenburg hatte großen Einfluss auf uns. Seine patriotischen Artikel riefen wöchentlich zum Hass und zum Töten auf. Aber auch ich hatte zerstörte Städte gesehen, ausgebrannte Dörfer, getötete Zivilisten. Und ich hatte viel über die nach Deutschland in Arbeitslager verschleppten Russen gehört.« Während die parteiamtliche Propaganda anfänglich noch zwischen der Naziführung und der deutschen Bevölkerung unterschied, reduzierte Ehrenburg in seinen Artikeln die Deutschen auf ein Volk von Barbaren und Verbrechern. Moskau ließ Ehrenburg gewähren. Schnell hatte die Partei erkannt, dass seine Artikel für die tägliche Stimmungsmache an der Front nur von Vorteil waren. Ehrenburgs Stil wurde schließlich vom Kriegsrat der Front in einem Aufruf an die Soldaten der Roten Armee übernommen: »Merke dir, Soldat! Dort in Deutschland versteckt sich der Deutsche, der dein Kind gemordet, deine Frau, Braut und Schwester vergewaltigt, deine Mutter, deinen Vater erschossen, deinen Herd niedergebrannt hat. Geh mit unauslöschlichem Hass gegen den Feind vor! Deine heilige Pflicht ist es, um der Gerechtigkeit willen und im Namen des Andenkens an die von den faschistischen Henkern Hingemordeten, in die Höhle der Bestie zu gehen und die faschistischen Verbrecher zu bestrafen. Das Blut unserer im Kampf gefallenen Kameraden, die Qualen der Gemordeten, das Stöhnen der lebendig Begrabenen, die unstillbaren Tränen der Mütter rufen euch zu schonungsloser Rache auf.« Einen Tag nach dem Erscheinen dieses Aufrufs, am 16. Oktober 1944, begann der russische Vorstoß nach Ostpreußen.
Es genügt nicht, die Deutschen nach Westen zu treiben. Die Deutschen müssen ins Grab gejagt werden. Gewiss ist ein geschlagener Fritz besser als ein unverschämter. Von allen Fritzen aber sind die toten am besten. Krasnaja Swesda, sowjetische Soldatenzeitung, 24. Oktober 1944
Von Mitte August bis in den Oktober hinein war es an der Front ruhig geworden. Die Heeresdivisionen hatten die Gefechtspause genutzt, ihre Stellungen zu verstärken und auszubauen, um für den erwarteten Angriff der Sowjets gerüstet zu sein. In dieser Zeit hätte man auch die Bewohner der bedrohten Gebiete in Sicherheit bringen können. Doch war es in diesem Punkt zwischen der Gauleitung und der Heeresgruppe zu äußerst heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Hitler hatte sich strikt geweigert, Ostpreußen zum Operationsgebiet zu erklären. Damit war der Heeresgruppe die Befehlsbefugnis auch über den zivilen Bereich entzogen. Erich Koch verfügte als Gauleiter und »Reichsverteidigungskommissar« bis zur Front über die vollziehende Gewalt und bestimmte damit über Leben und Tod der ostpreußischen Bevölkerung. Obwohl der Gauleiter die bevorstehende Gefahr kannte, veranlasste er keinerlei Maßnahmen zur Räumung der frontnahen Gebiete. Stattdessen verkündete er Parolen vom »Endsieg« und verfolgte mit drastischen Mitteln jene, die daran Zweifel erkennen ließen. Landräte, Kreisbauernleiter und Bürgermeister erhielten die strikte Anweisung, jede Fluchtvorbereitung sofort zu melden. Als Mitte Oktober 1944 die Rote Armee ihre Herbstoffensive begann, war in Ostpreußen so gut wie niemand darauf vorbereitet.
Wir haben in den Zeitungen gelesen, was die Deutschen auf sowjetischem Boden angerichtet hatten. Sie hatten das Volk misshandelt, unschuldige Menschen vernichtet, massenweise. Meine Mutter, eine alte, kranke Frau, wurde direkt ins Ghetto umgesiedelt, wo sie auch starb. Moissej E. Barwinskij, damals Soldat der Roten Armee
Der Angriff erfolgte frontal von Osten in Richtung Königsberg – für die deutsche Heeresgruppe völlig unerwartet. Da die Front der 4. Armee in einem weiten Bogen nach Osten vorsprang, hatte man damit gerechnet, dass die Sowjets einen Zangenangriff versuchen würden. Nun stürmten sie mit vielfacher Übermacht gegen die deutschen Stellungen. Artilleriefeuer bislang unbekannter Stärke verwandelten das ostpreußische Grenzgebiet in eine Feuerhölle. Das dumpfe Grollen der Front erschütterte die ganze Provinz und versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Zum ersten Mal in der Geschichte jenes Krieges, den Hitler im Namen des deutschen Volkes entfesselt hatte, rollten russische Panzer auf deutschem Boden. Obwohl die sowjetischen Befehlshaber wegen des Schutzwalls zunächst Zweifel am Erfolg der Operation angemeldet hatten, war es ihnen nach wenigen Tagen gelungen, fünf Kilometer tief in ostpreußisches Gebiet vorzudringen.
Der sowjetische Stoßkeil teilte sich in drei Richtungen auf. Der mittlere, auf den Ort Nemmersdorf zielende Vorstoß war der erfolgreichste. Für die Dorfbewohner der kleinen Gemeinde brachte er Schrecken, Leid und Tod. Am 21. Oktober drangen russische Soldaten in ihre Häuser und Höfe ein. Als deutsche Einheiten das Dorf zwei Tage später zurückeroberten, bot sich ihnen ein grausames Bild: Alle, die Nemmersdorf nicht rechtzeitig verlassen hatten, waren brutal ermordet worden. Die grausame Bilanz der ersten Konfrontation russischer Kampfverbände mit deutscher Zivilbevölkerung lautete: 26 Tote, unter ihnen Frauen, Kinder und Alte.
Gnade gibt es nicht – für niemanden, wie es auch keine Gnade für uns gegeben hat. Es ist unnötig, von den Soldaten der Roten Armee zu fordern, dass Gnade geübt wird. Sie lodern vor Hass und Rachsucht. Das Land der Faschisten muss zur Wüste werden, wie auch unser Land, das sie verwüstet haben. Appell von General Iwan D. Tschernjachowskij am Vorabend des Angriffs auf Ostpreußen
Sofort lief Goebbels’ Propagandamaschinerie auf Hochtouren. Deutsche wie ausländische Zeitungen berichteten wenig später vom »Massaker in Nemmersdorf« und sparten dabei nicht an Details: »vergewaltigte Frauen und Kinder«, »brutal hingerichtete Greise«. Die deutsche Wochenschau brachte Bilder, die sich für immer in das kollektive Gedächtnis der entsetzten Kinobesucher schreiben sollten. Der Name des kleinen, einst friedlichen Dorfes am Flüsschen Angerapp ging als Fanal des Schreckens in die Geschichte ein. Auch heute noch verbinden sich mit ihm für viele Ostpreußen psychische und physische Traumata. »Über Nemmersdorf kann man nicht sprechen«, lautet die Reaktion vieler Zeitgenossen. Heute wie damals ist Nemmersdorf ein Fixpunkt der historischen Diskussion. Die 1951 vom Bundesministerium für Vertriebene in Auftrag gegebene »Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa« spricht im Zusammenhang mit Nemmersdorf von »grausamen Exzessen«, während Die Zeit 1992 fast kühl bilanziert: »Im Verhältnis zur Katastrophe des Sowjetreichs, zu den Dutzenden von Millionen Toten, ist ›Nemmersdorf‹ 1944 ein winziger Punkt im All.« Was also macht Nemmersdorf bis heute zum Gegenstand zahlreicher, meist emotionsgeladener Debatten? Was lässt auch heute noch, fast sechzig Jahre nach dem Überfall, Menschen »Rache für Nemmersdorf« fordern, wie es jüngst an einer Häuserwand in der früheren ostpreußischen Grenzstadt Tilsit zu lesen war? Hartnäckig und allzu oft ungeprüft halten sich im Zusammenhang mit Nemmersdorf Berichte über beispiellose Verbrechen – Vergewaltigungen, Mord und Kreuzigungen. Der grausame Tod von 26 wehrlosen Zivilisten ist unbestritten, doch zeichnen bislang unveröffentlichte Dokumente der Geheimen Feldpolizei, Aussagen von Goebbels’ engsten Mitarbeitern und der einzigen Überlebenden von Nemmersdorf heute ein differenzierteres Bild. Was geschah wirklich in jenen Tagen im Oktober 1944 in Nemmersdorf, dem heutigen Majakowskoje?
Es war damals noch alles auf den »Endsieg« programmiert. Jedenfalls lauteten so die offiziellen Parolen der Partei. Hätte man die Zivilbevölkerung evakuiert, wäre dies ein Beweis dafür gewesen, dass man an den »Endsieg« nicht mehr geglaubt hätte. Und das wollte man auf alle Fälle verhindern. Hanns-Joachim Paris, Kriegsberichterstatter
Ein Rekonstruktionsversuch: Nemmersdorf gehörte als eines von sechs Kirchdörfern zum Landkreis Gumbinnen und bildete eine Art Zentrum im Südwesten. Das Dorf zählte rund 650 Einwohner, besaß einige Handwerksbetriebe und Gutshöfe, die die wirtschaftliche Existenz der kleinen Gemeinde bestimmten. Ein ruhiges und beschauliches Leben, an das sich Gerda Meczulat, die einzige heute noch lebende Augenzeugin, nicht ohne Wehmut erinnert: »Unser Ort war wunderschön gelegen. Das Flüsschen Angerapp schlängelte sich hindurch und es gab einen kleinen Birkenwald, in dem wir als Kinder immer spielten.«
Gerda Meczulat, zum Zeitpunkt des Überfalls zwanzig Jahre alt, kümmerte sich damals um ihren Vater, nachdem die Mutter früh gestorben war, und führte den gemeinsamen Haushalt. In ihre bis dahin friedliche Welt drang Mitte Oktober 1944 der schwere Geschützdonner der herannahenden Front. Die Post stellte den Dienst ein, immer häufiger wurde Nemmersdorf von russischen Tieffliegern angegriffen. Etliche Dorfbewohner trafen heimlich Vorkehrungen zur Flucht. Einige hatten bereits Familienmitglieder unauffällig zu Verwandten »ins Reich« geschickt und so in vermeintliche Sicherheit gebracht. Am Freitag, dem 20. Oktober, rumpelten Flüchtlingstrecks, die aus den weiter östlich liegenden Nachbardörfern aufgebrochen waren, über das Kopfsteinpflaster der Dorfstraße. Obwohl der russische Sturm nur noch neun Kilometer von Nemmersdorf entfernt war, gab es noch immer keinen Räumungsbefehl für die Gemeinde. Besorgt suchten die Dorfbewohner bei ihrem Bürgermeister Rat, der schließlich ein salomonisches Urteil fällte: Sollte die Rote Armee nicht bis zum nächsten Morgen das Dorf überrannt haben, würde er eine Flucht auch ohne offiziellen Evakuierungsbefehl genehmigen.
Die Dorfbewohner beeilten sich, ihre Habe zusammenzupacken und sich mit Proviant zu versorgen. Im nun herrschenden Durcheinander fielen jene kaum auf, die sich dem allgemeinen Aufbruch nicht anschlossen – darunter Gerda Meczulat und ihr Vater. »Mein Vater sagte: ›Die Russen sind doch auch nur Menschen.‹ Und wo sollten wir denn auch hin?« So blieben vor allem ältere Menschen und jene, denen es nicht gelungen war, ein geeignetes Transportmittel zu organisieren, in Nemmersdorf zurück. Die ganze Nacht über verstopfte der endlose Flüchtlingsstrom mit Fuhrwerken und Handkarren die Dorfstraße in Richtung Westen. Als der Geschützdonner gegen Morgen immer lauter wurde und überdies Maschinengewehrfeuer zu hören war, entschlossen sich auch die letzten Zögerer zur Flucht. Gerda Meczulat und ihr Vater, der an diesem Tag 71 Jahre alt wurde, suchten hingegen in einem für die Dorfbewohner am Kanal eingerichteten Unterstand Schutz: in einer großen Tunnelröhre, die mit Stroh ausgelegt und an den Seiten mit Bänken versehen worden war. Zwölf weitere Menschen flüchteten sich wie sie dorthin, darunter auch vier Kinder.
Danzig meldet, dass die in jämmerlichem Zustand eintreffenden Flüchtlinge aus Ostpreußen Gauleiter Koch die schwersten Vorwürfe machen. Zum Teil seien die ostpreußischen Flüchtlinge erst von den zurückgehenden Soldaten darauf aufmerksam gemacht worden, dass ihnen die Bolschewisten auf dem Fuße folgten. Aus dem Tätigkeitsbericht der Abteilung II des Propagandaministeriums vom 25. Oktober 1944
Während die Dorfbewohner im Bunker um ihr Leben bangten, entbrannte über ihnen ein unnachgiebiger und verlustreicher Stellungskampf. Gustav Kretschmer, Soldat des 2. Fallschirmjägerregiments, das zur Verstärkung herbeigerufen worden war, erinnert sich an seinen Einsatz: »Am 21. Oktober ging der Angriff los. Im dicksten Nebel, im Morgengrauen, unter Bedingungen also, unter denen normalerweise niemand angreift. Wegen des Nebels konnten auch wir nicht sehen, wo die Russen ihre Stellungen hatten. Dies hatte zur Folge, dass von den 170 Mann, mit denen wir angetreten waren, innerhalb einer halben Stunde nur noch 22 Mann übrig waren.«
Während einer der Gefechtspausen wagte es Vater Meczulat, den Unterstand noch einmal zu verlassen, um in sein Haus zurückzukehren: »Es war unheimlich still draußen, kein Schusswechsel war mehr zu hören«, erzählt Gerda Meczulat. »Mein Vater sagte: ›Ich gehe jetzt und koche uns Kaffee.‹ Wir hatten noch nicht einmal gefrühstückt und er brauchte ja nur die Straße zu überqueren. Nach einer ganzen Weile kam er tatsächlich mit frischem Kaffee und Schnitten wieder und sagte: ›Das Dorf ist voller Russen.‹« Die Sowjets hatten den alten Mann nach Waffen durchsucht und wieder laufen lassen. Immer noch hofften die Menschen in der Tunnelröhre, mit heiler Haut davonzukommen.
Als am späten Nachmittag die deutsche Luftwaffe einen schweren Angriff flog, waren die Rotarmisten selbst gezwungen, Schutz zu suchen – und drangen schließlich in den Bunker ein. Die Sowjets ließen die überraschten Dorfbewohner zunächst unbehelligt. Einige spielten sogar mit den anwesenden Kindern.
In der bereits genannten Ortschaft Nemmersdorf, die zwölf Kilometer westlich Gumbinnen liegt, wurden insgesamt 26 Leichen aufgefunden, darunter zwölf Frauen, neun Männer und fünf Kinder. Aus dem Bericht des Völkischen Beobachters am 28. Oktober 1944
Erst gegen Abend kam es zu einem verhängnisvollen Zwischenfall: Im Bunker erschien ein höherer Offizier und begann mit den Soldaten eine heftige Auseinandersetzung. Schließlich befahl er den Zivilisten, den Unterstand zu verlassen. Gerda Meczulat erinnert sich an die schrecklichsten Minuten ihres Lebens: »Der Offizier blieb vorne am Eingang stehen. Und dann hieß es immer: ›Paschol, paschol!‹ Als wir heraustraten, stand der ganze Abhang zu beiden Seiten des Ausgangs voller Russen – mit Maschinenpistolen. Ich hörte Schüsse und dann nur noch das Röcheln der Erschossenen.« Gerda Meczulat, die seit ihrem siebten Lebensjahr an Kinderlähmung leidet, verließ den Unterstand als Letzte. Dabei stolperte sie und fiel. Nun trat der russische Offizier von hinten an sie heran, legte die Pistole an ihren Kopf und schoss. Die Kugel zerfetzte ihren Kiefer und trat über dem Jochbein wieder aus. Wie durch ein Wunder überlebte die junge Frau – als Einzige.
Als die Deutschen am nächsten Morgen Nemmersdorf zurückeroberten, fanden sie überall in den Häusern Tote vor. In einem Haus entdeckten sie eine alte Frau auf ihrem Sofa, eine Decke über den Knien. Die Rotarmisten hatten sie mit einem Kopfschuss getötet. Ein älteres Ehepaar hatte versucht, sich hinter einer Tür zu verstecken – vergeblich. Auch sie waren von den eindringenden Rotarmisten erschossen worden. Ein junges Mädchen fanden die Soldaten aufrecht sitzend, gegen eine Wand gelehnt, ihr Kopf war gespalten. An der Brücke über die Angerapp lagen drei weitere Leichen: eine ältere Frau neben einer Mutter mit Kleinkind. Der Schnuller des Kindes lag im Staub der Straße. Die deutschen Soldaten reagierten entsetzt auf die Brutalität, mit der die Rote Armee gewütet hatte. Viele schworen Rache für die Toten von Nemmersdorf und beklagten die sinnlosen Morde an der wehrlosen Zivilbevölkerung. Trotz aller Empörung kam bei einigen der deutschen Soldaten jedoch auch das Gefühl von Schuld auf: »Wir sind erst zweitausend Kilometer weit nach Russland vormarschiert und dann zweitausend Kilometer wieder zurück. Da ist nichts ganz geblieben«, bekennt der Soldat Helmut Hoffmann heute im Rückblick und resümiert leise: »Wer Wind sät, wird Sturm ernten.«
Zu unserem Entsetzen tauchten an den Hängen der Angerapp an diesem nebligen Oktobermorgen die ersten Russen auf. Sie machten zunächst einen abwartenden Eindruck, pirschten sich dann aber näher, und ehe wir’s uns versahen, standen sie vor uns. Sie nahmen den Flüchtlingen im Vorbeigehen die Uhren und den Schmuck ab. Marianne Stumpenhorst, als Flüchtling bei Nemmersdorf von den Sowjets eingeholt