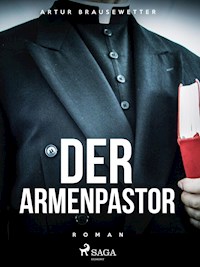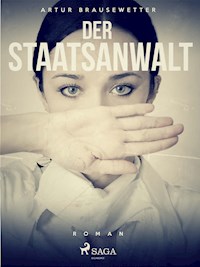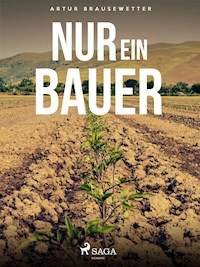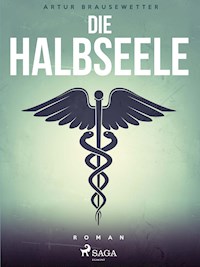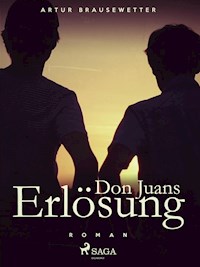Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Hochzeit der jungen Hildegard von Ravenstein steht unter keinem guten Stern. Ihr Gatte muss bereits eine Woche später "hinausgehen an die scharfumstrittene Front" des Ersten Weltkrieges und zugleich ist ihre Mutter schwer erkrankt. Die einzige Hoffnung auf Heilung bietet die Behandlung durch Doktor Eckart, den "Mann der Heilungen und Wunder", der schon viele Verlorengeglaubte zurück ins Leben geholt hat. Während ihm nun in der Tat die Heilung gelingt, entbrennt Hildegards Schwester Mechthild in sehnsüchtiger Liebe zu dem geheimnisvollen Mann, über den man, von seinen ärztlichen Erfolgen abgesehen, nur wenig weiß. Und sicherlich weiß Hildegard nichts von der schweren Schuld, die er auf sich geladen hat, von dem dunklen Geheimnis, das über Doktor Eckart lastet. Als er schließlich verhaftet wird, scheint alles bereits zu spät ... Der zuerst 1918 erschienene Roman war eines der meistgelesenen Bücher Brausewetters und erlebte Dutzende von Auflagen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Die große Liebe
Zwanzigste Auflage
Saga
Die große LiebeCopyright © 1935, 2019 Artur Brausewetter und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711487716
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Eine Kriegstrauung, mein liebes junges Paar, liegt hinter Ihnen. Für üppige Gelage und Feste haben wir weder Zeit noch Sinn. Darum ist auch der Kreis, der Sie an dieser Hochzeitstafel begrüsst, nur klein. Aber um so fester und treuer umschliesst er Sie. Freilich, das Beste fehlt in ihm: die Mutter. Kurz, aber reich an Inhalt sei, liebe Frau Hildegard — zum letztenmal nenne ich Sie heute bei dem Namen, der mir seit dem Jahre, da Sie in meiner stillen Konfirmandenstube sassen, vertraut geworden ist —‚ der Wunsch, den ich Ihnen bringe: Gott lasse Ihre verehrte Mutter zu Ihres Vaters Freude und Ihrer Schwestern Segen bald genesen. Er behüte Ihren tapferen jungen Gatten, wenn er nach seiner schweren Verwundung nun zum zweitenmal, geborgen im Besitze des Liebsten, das er sich hier errungen, in den Krieg zieht. Bis er, mithelfend zu dem Siege unseres Vaterlandes, des wohlverdienten Glückes an der Seite seiner liebreizenden Gattin in ungetrübtem Frieden sich erfreuen kann. Darauf, meine verehrten Damen und Herren, erheben wir, in allem Schweren frohgemut, die Gläser. Unser junges Kriegspaar, Herr und Frau Hauptmann Fliessbach, hurra, hurra, hurra!“
Gedämpft nur klingt es von der kleinen Tafelrunde im Marinesaal des Kronburger Hofs zurück. Lothar Heckebarth zwar, der, in seinem bürgerlichen Beruf Regierungsrat, jetzt als Husarenrittmeister neben Mechthild v. Ravenstein, der älteren Schwester der Braut, sitzt, ruft sein Hurra, laut und scharf die beiden rr ineinanderwirbelnd wie auf der Parade. Aber er ist der einzige, und seine schmetternde Stimme klingt den einen komisch, den anderen störend.
Mechthild wenigstens kneift die Lider zusammen, so dass ihre Augen nur wie zwei blanke Striche zwischen den schwarzschattenden Wimpern hervorschimmern. Sie ist sonst wenig nervös. Aber heute — eine Schwester verheiraten, alle Obliegenheiten der Mutter übernehmen, diese schwer krank zu Hause wissen, und hier im festlichen Gewand an der hochzeitlichen Tafel sitzen, mit der Todesangst im Herzen — es ist keine leichte Aufgabe, die sie übernommen.
Ihr Nachbar, der eine sichtbar aufgezäumte Heiterkeit an den Tag legt, tut, als merke er auch davon nichts. Als man sich nach dem Trinkspruch des beliebten Geistlichen von St. Salvator wieder gesetzt und die Diener den wundervollen Rheinlachs mit dem alten Deidesheimer Herrgottsacker reichen, nimmt er das unterbrochene Gespräch, auf, redet lebhaft und in einem Zuge von dem Pfarrer, der ihn heute so gepackt, als wäre er selber der beneidenswerte Bräutigam gewesen, von einer entzückenden Sängerin, die er gestern im „Barbier von Sevilla“ gehört, von einem blutjungen, eben der Schule entlaufenen Vetter, der nach einem erfolgreichen und gefährlichen Sturm an der Spitze seiner Kompagnie den Orden Pour le mérite erhalten, von dem Weine, den sie in gleicher Güte weder am Rhein noch in Frankreich trinken könnten, und von tausend anderen Dingen, die wie leerer Schall an Mechthilds Ohr vorüberrauschten.
Dabei ist sie ihm nicht gram. Er ist ein kluger und guter Mensch von weitschauendem Gesichtskreise und vielseitigem geistigen Interesse, dazu ein vorzüglicher Tänzer, mit dem sie in vergangenen besseren Zeiten auf so manchen Bällen getanzt.
Er aber lässt seinen Blick voller Wohlgefallen über ihre schöngewachsene Gestalt gleiten, in der bei aller Anmut etwas herb Verschlossenes ist, über ihr feingeschnittenes Antlitz mit der matten blassen Farbe und der kühlen weissen Haut, dem vollen Haar von leise rötlicher Farbe und metallenem Glanz, das, über der klaren Stirn geteilt, glatt und schlicht an den Schläfen bis hinter das Ohr zurückgestrichen ist. Und er muss daran denken, wie er dies Antlitz geliebt hat von der ersten unvergesslichen Stunde an, da es ihm, damals noch in mädchenhaftem Frohsinn, entgegenblühte. Wie er es lieben würde, fest und unverbrüchlich bis in den Tod.
Man reicht die einzelnen Gänge in sehr schneller Folge. Das junge Paar will noch mit dem Abendzuge bis Berlin, und die Angehörigen unterhalten sich an der blumenduftenden Tafel mit einem Zwang, der sich, insbesondere bei Mechthild, bis zur Qual steigert. Immer hat sie den Blick auf ihren Vater gerichtet. Der sitzt so ruhig auf seinem Platze, unterhält die lebhafte Mutter seines Schwiegersohnes, die trotz ihrer sechzig Jahre noch gern Eindruck auf die Männer macht und kein unschuldiges Mittel dazu unversucht lässt, tadellos und geht auf ihre kleinen koketten Scherze mit so gütigem Entgegenkommen ein, dass ihm niemand auch nur die leiseste Sorge anmerkt.
Sie aber weiss es besser, weiss, wie er mit jeder Faser seines Herzens an seiner Frau hängt, wie ein unglücklicher Ausgang ihres Leidens ihn treffen würde — aber er hat sich stets in straffer Zucht gehalten, von ihm hat sie beides, das reiche Gemüt und die herbe Abgeschlossenheit, die ihr Empsinden nur selten und da nur, wo sie sich innerlich berührt fühlt, zum Ausdruck kommen lässt. Er hat es sie gelehrt, das Beste in sich zu verbergen wie ein Kleinod, das an Wert verliert, wenn man es den Augen anderer preisgibt. Bei aller Selbständigkeit ist sie ihre ganze Jugend hindurch unbewusst bei ihm in die Schule gegangen. Kein anderer hat sie beeinflusst, nicht einmal die sanfte, im Leiden starke Mutter.
„Vielleicht geht es zu Hause besser, als Sie fürchten,“ wendet sich Pfarrer Wendlandt, der ihr gegenüber sitzt und sie bis dahin ungestört gelassen, jetzt zu ihr, als wüsste er, dass jeder ihrer Gedanken nur daheim ist. Natürliche Anlagen und ein grosses Amt haben ihm einen Einblick in die Herzen der Menschen gegeben, den er mit feinem Taktgefühl verbindet. „Man muss in dieser Welt zwei Gesichter haben,“ fährt er in seiner ruhigen Art fort, „eins, das nach aussen blickt und über das man Herr ist, eins, das nach innen schaut und über das man wohl weniger Gewalt hat.“
Sie lächelt ihm in jener stillen Dankbarkeit zu, die wir empfinden, wenn wir unter Fremden einem Menschen begegnen, der mit uns fühlt und uns das ohne Aufdringlichkeit zu verstehen gibt.
„Gerade als wir zur Kirche fuhren, stand es schlecht, die Unruhe des Tages und die seelische Aufregung —“
„Aber Fräulein Sophie ist bei ihr —“
„Eine von uns dreien musste natürlich zu Hause bleiben. Ich hätte es am liebsten getan, aber mein leisester Versuch schon steigerte Mutters Erregung; ich hätte es ja wohl auch Hilde schwer antun können, sie entbehrt die Mutter heute genug. Schon dass Sophie nicht mitfuhr, kostete einen heftigen Kampf.“
Der Sekt wird gereicht, man trinkt dem Hochzeitspaare zu. Dieses dankt nach allen Seiten hin; auch über die beiden schattet stiller Ernst. Der junge Gatte weiss, dass er noch acht kurze, schöne Tage an der Seite der Geliebten verbringen wird, und dass es dann hinausgehen heisst an die scharfumstrittene Front. Und Hilde, die ihn geliebt von dem ersten Augenblicke an, da sie ihn im Hause einer Freundin kennengelernt, zählt in schmerzlich-seligem Glück jede Sekunde, die er ihr noch gehört.
Lothar Heckebarth wendet sich zu Mechthild und liest ihr den neuesten Heeresbericht vor, den ihm eben der Kellner gebracht. Sie überfliegt mit schnellen Augen den fettgedruckten Satz auf dem kleinen gelben Papier, das sich in seiner Hand knisternd bewegt, und hört nun nicht weiter zu. Als er aufgehört, vernimmt sie wieder Pfarrer Wendlandts wohltuende Stimme.
„Wer behandelt Ihre Frau Mutter?“
„Geheimrat Mollenhauer.“
„Er ist ein tüchtiger Arzt, ohne Frage. Aber ich höre jetzt in meiner Gemeinde einen Doktor Eckart rühmen . . . überall.“
„Doktor Eckart, wer ist das? Ich habe seinen Namen bisher nie gehört.“
„Persönlich habe ich ihn auch noch nicht kennengelernt. Aber man erzählt mir oft von ihm. Er kam aus dem Kriege, in dem er, es war wohl bereits im Anfang, wegen hervorragender Tapferkeit das Eiserne Kreuz erster Klasse erhielt und später verwundet wurde. Dann lag er eine Zeitlang im Lazarett, nahm seine bürgerliche Praxis wieder auf und liess sich hier bei uns nieder, wohl gerade zur richtigen Zeit, denn wir hatten einen fühlbaren Ärztemangel.“
„Auch heute noch. Es hält oft sehr schwer, Geheimrat Mollenhauer zu bekommen, und der Jüngste ist er auch nicht mehr.“
Pfarrer Wendlandt schiebt das Glas, aus dem man eben Pfirsich nach Melba gegessen, beiseite und sagt nach kurzem Nachdenken: „Sie sollten es doch einmal mit Doktor Eckart versuchen. Eine alte Dame, die ich seit langer Zeit kenne und die an gichtischer Lähmung daniederlag, ist durch ihn gesund geworden. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ein junges Mädchen, das von drei Ärzten aufgegeben war, geht bereits wieder in ihr Geschäft. Auch sie gehört zu meiner Gemeinde. Die Eltern hängen abgöttisch an ihm und meinen, er wirke Wunder.“
Mechthild schürzt die roten Lippen. „Glauben Sie wirklich an Wunder, Herr Pfarrer? Glauben Sie, dass sie heute noch geschehen können?“
Der Geistliche verharrt in seinem ruhigen Ernst.
„Ehe ich Ihnen die Frage beantworten kann, müssten Sie mir erst einmal sagen, wo die Grenze zwischen dem Natürlichen und dem Wunderbaren ist. Warum sollte es nicht auch heute noch Persönlichkeiten geben, von denen eine Wirkung auf die Menschen, besonders auf Kranke, ausgeht, die wir uns nicht erklären können? Gerade bei Ärzten kann ich mir vorstellen, dass sie durch ihre Persönlichkeit mehr erreichen als durch alle Arzneien, die sie verschreiben.“
„Aber doch immer nur in ganz bestimmten Fällen, bei denen Nerven, Stimmung oder gar Einbildung eine Rolle spielen. Bei meiner Mutter handelt es sich um ein ausgesprochen körperliches Leiden, das von mehreren Ärzten einwandfrei festgestellt ist. Sie kann sich seit drei Monaten überhaupt nicht mehr bewegen — denken Sie — gar nicht mehr bewegen, ist das nicht entsetzlich?“
Und nun, als will sie sich ihren schmerzlichen Gedanken entreissen: „Zudem könnte ich schon mit Rücksicht auf unseren alten Geheimrat, der Vaters volles Vertrauen hat, keinen anderen Arzt hinzuziehen.“
Das Brautpaar erhebt sich. Stühle werden gerückt, die Tafel ist aufgehoben. Man begibt sich in die behaglichen Nebenräume des vornehmen Gasthauses, in denen der Kaffee gereicht wird.
Das Hochzeitspaar steht in der Mitte des kleinen, mit weissgedeckten Tischen und einladenden Sesseln besetzten Saales. Jetzt erst sieht man, eine wie schneidige Figur der junge Ehegatte, eine wie entzückende Frau Hildegard v. Ravenstein ist. In ihren blühenden Augen, die die Farbe von Vergissmeinnicht haben, wohnt bei allem Ernst das leuchtende Glück.
Die anderen haben sich um die beiden herum gruppiert, Hildegard zur Seite steht ihr Vater, eine hohe, edelmännische Erscheinung; um die Oberlippe, die ein weisser, kurzgeschorener Schnurrbart deckt, ein unverkennbar strenger, beinahe amtlicher Zug, aber um die hohe Stirn und in den grauen klugen Augen milde, versöhnende Güte.
Das Glück seiner Tochter und das Wohlgefallen, das er vom ersten Augenblick an seinem Schwiegersohn gefunden hat, lässt die Sorge dieses Tages in den Hintergrund treten. Er spricht einige scherzende Worte zu der jungen Frau, als möchte er ihr über den bevorstehenden, durch die Umstände doppelt schweren Abschied hinweghelfen.
Die übrige Gesellschaft folgt seinem Beispiel und sucht sich von dem letzten Rest der Befangenheit frei zu machen, der noch auf ihr lastet. Die lange genug verbannte Heiterkeit besinnt sich auf ihr verbriestes Recht, das sie auf Hochzeiten hat, selbst wenn sie Kriegstrauungen heissen.
Lothar Heckebarth hätte jetzt für seine Scherze und Erzählungen einen willigeren Zuhörerkreis gefunden, wenn er es nicht plötzlich für angebracht gehalten hätte, ernst und in sich versunken zu sein. Es ist von jeher so seine Art gewesen: manchmal bis zur Ausgelassenheit froh, die ganze Gesellschaft mit sich reissend, dann fast im Handumdrehen schweigsam und unnahbar.
Ein junger Offizier, ein Regimentskamerad von Fliessbach, setzt sich an den Flügel und spielt einen Armeemarsch, dann ein ernsteres Stück, zuletzt beginnt er mit wenig geschulter, aber klangvoller Baritonstimme zu singen, Vaterlands- und Burschenlieder, in die die kleine Versammlung fröhlich einstimmt. Das heitere Spiel harmlos sich begegnender Blicke, neckend hingeworfener und lachend zurückgegebener Worte begleitet den anmutigen Wechselgesang.
Aber mit einem Male bricht alles jäh ab: das Spiel, das Lied, das tändelnde Wort.
Ein Bote ist in den Saal getreten, hat sich schnellen Schrittes und unbekümmert um die Störung, die er hervorruft, mitten durch die im Halbkreis sitzende Jugend zu Herrn v. Ravenstein begeben, der mit der alten Frau Fliessbach und einem Bruder von ihr in Generalsuniform in einer Nische am gedeckten Kaffeetisch sitzt.
Der erhebt sich, langsam und in der gemessenen Art, die ihm in jeder Äusserung seines Wesens eigen ist. Aber sein Gesicht ist bleich, und die Lippen presst er fest zusammen, wie er es immer tut, wenn er eine Erregung meistern will.
Mechthild ist an seiner Seite. „Wir müssen nach Hause,“ sagt sie und legt, ohne eine Antwort abzuwarten, ihren Arm in den seinen, ihn leise mit sich ziehend.
Da tritt ihnen die junge Frau, die sich von der Gruppe einiger Freundinnen losgemacht, entgegen: „Mutter ist kränker geworden, ich komme mit euch.“ Mechthild wehrt sie ab, freundlich, aber entschieden: „Du — in diesem Anzug? Du bleibst bei deinem Manne. So wie wir Näheres wissen, komme ich zurück oder schicke dir Sophie, du kannst sich darauf verlassen!“
„Das könnt ihr mir nicht zumuten, dass ich die Mutter — womöglich niemals wiedersehe!“ stammelt Hildegard, und die Tränen fliessen über ihre blassen Wangen. Aber gegen die bestimmte Weisung der älteren Schwester gibt es keine Auflehnung, das weiss sie von ihrer Kindheit an und fügt sich.
„Wenn Sophie schon schickt, kann es nicht gut stehen,“ sagt Herr v. Ravenstein zu seiner Tochter, als sie beide das Gasthaus verlassen und in den draussen harrenden Wagen steigen.
„Ganz unerwartet kam die Verschlimmerung,“ empfing sie Sophie im Vorraum. „Einige Besorgnis hatte ich ja, als ich die Mutter so stark mitgenommen von dem Abschied von Hildegard sah. Aber ich hoffte, dass sich mit dem Abschwächen der Erregung die Kräfte wieder heben würden. Da trat plötzlich diese völlige Apathie ein.“
„Du riefst Mollenhauer an?“
„Natürlich. Aber er war nicht zu treffen. Gegen Abend war die Lähmung so vorgeschritten, dass sie sich überhaupt nicht mehr zu rühren vermochte.“
„Sprach sie?“
„Ich konnte fragen, was ich wollte, sie gab keine Antwort.“
„Wie lange dauerte dieser Zustand?“
„Die ganze Zeit. Ich hätte euch sonst nicht rufen lassen.“
Herr v. Ravenstein wandte sich ab; selbst seine Tochter durfte nicht sehen, wie tief er erschüttert war.
„Ich glaube, sie verlangt nach dir, Vater,“ sagte Mechthild, die aus dem Krankenzimmer zurückkehrte. „Sie vermag ja nicht eine Silbe mehr hervorzubringen!“ äusserte sie mit erstickter Stimme zur Schwester, als der Vater gegangen war. „Ich kann es nicht mit ansehen.“
Einen Augenblick schien es, als wäre der Schmerz grösser als ihre Beherrschungskraft. Sie lehnte sich an den grossen Sessel, der vor dem Schreibtisch ihres Vaters stand. Das bleiche Antlitz mit den starren Augen bildete einen wunderlichen Gegensatz zu dem mattrosa Gesellschaftskleid, das die hochgewachsene Gestalt umschloss.
Dann hatte sie sich wiedergefunden.
„Ich will noch einmal Mollenhauer anrufen, er muss unter allen Umständen kommen!“
„Der Herr Geheimrat sind über Land gefahren und vor Mitternacht nicht zu erwarten.“
Sie liess sich mit seinem Vertreter verbinden, der die Mutter bereits behandelt hatte. Auch der war nicht zu erlangen.
Was sollte sie tun? Sie kannte eine Anzahl von Ärzten, die sie hätte anrufen können. Aber sie waren alle im Felde.
Da kam ihr die Unterhaltung in Erinnerung, die sie bei Tisch mit Pfarrer Wendlandt gehabt. Von einem neuen Arzt hatte er gesprochen, der erst seit kurzer Zeit in der Stadt war, und den er von allen Seiten rühmen gehört.
Ihr Entschluss war gefasst. Hatte die Mutter auch eine schwer überwindliche Abneigung gegen einen fremden Arzt, die Not drängte, sie liess keine Bedenken zu.
Aber nun ward sie mit Erschrecken inne, dass sie den Namen vergessen hatte. Sie strengte ihr Gedächtnis bis zum äussersten an, sie suchte, überlegte, grübelte — alles vergeblich.
„Weisst du, mir ist eben ein Gedanke gekommen,“ hörte sie da Sophies Stimme neben sich, „ruf doch einmal Doktor Eckart an — was starrst du mich denn so entsetzt an, Mechthild?“
,,Es ist etwas Wunderbares, wirklich etwas ganz Wunderbares,“ erwiderte Mechthild, „eben zermartere ich mein Gehirn nach diesem Namen, da sprichst du ihn mit einmal aus.“
„Nun, ein so schwieriger Name ist es doch gewiss nicht.“
„Nein, nein — aber woher kennst du diesen Mann?“
„Die Gerlach, du weisst, die früher immer zum Aufwarten zu uns kam, schwärmte mir vor kurzem von ihm vor; er hat ihren Mann, der bereits aufgegeben war, gesund gemacht. Dann sprach auch Assessor Krampe gelegentlich von ihm.“
Mechthild hatte das Fernrufverzeichnis aufgeschlagen. Richtig, da stand es: Dr. Heinrich Eckart, Nervenarzt.
„Bitte 1235!“ rief sie in so fliegender Eile, dass sie die Nummer wiederholen musste, bevor man sie auf dem Amte verstand.
„Hier der Diener des Herrn Doktor Eckart.“
„Kann ich den Herrn Doktor selber sprechen?“
„Der Herr Doktor haben einen schweren Fall vor, ich darf nicht stören.“
„Es handelt sich um eine dringende Sache! Unser Hausarzt ist über Land, wir müssen so schnell wie möglich ärztliche Hilfe haben.“
„Wer ist am Fernrufer?“
„Oberlandesgerichtspräsident Don Ravenstein, Hohenzollernring 14.“
Eine Weile verging, dann sagte dieselbe Stimme: „Herr Doktor wird in einer halben Stunde dort sein.“
„Nun kann ich es doch nicht mehr verantworten, Hilde ohne Abschied von der Mutter fahren zu lassen,“ sagte Mechthild und wollte in den Kronburger Hof Weisung geben, als Hilde im Reiseanzug in das Zimmer trat.
„Ich bin tortz deines Abredens gekommen, weil ich die Mutter noch einmal sehen musste.“
„Es ist recht so,“ erwiderte Mechthild und weiter nichts.
Regungslos lag die Kranke, ihr Mann und ihre drei Töchter umstanden ihr Lager. Den Präsidenten drängte es, die Hand zu fassen, die matt auf der weissen Decke lag. Manchmal schien es, als sehnte sich auch diese schmale, abgemagerte Hand der seinen entgegen. Aber sie blieb in ihrer Sehnsucht still und rührte sich nicht.
Eine unendliche Traurigkeit war in der Seele des Präsidenten.
Über dreissig Jahre hatte dies Herz, dessen Schlag jetzt schwach und müde geworden, in unwandelbarer Liebe und Treue für ihn gelebt und gewirkt, alles hatten sie miteinander getragen, nicht einmal ein Gedanke war trennend zwischen ihnen gewesen.
Gewiss, ihm blieben die Töchter, er wusste, wie nahe ihm seine Älteste stand. Aber das, was einmal gewesen, konnte nie wiederkehren, das konnte auch sie ihm nicht ersetzen, bei aller Liebe würde er einsam sein.
Sie verlieren müssen, gerade jetzt, wo das Alter nahte und man so tief ineinander verwachsen war — es war etwas Unfassbares, mit dem er sich bei all seiner männlichen Stärke nicht abzufinden vermochte.
Er dachte an die vielen Geschichten in der Heiligen Schrift, die er in stillen Stunden gelesen, oder über die er Pfarrer Wendlandt in der Stadtkirche hatte reden hören: wenn Christus an die Betten der Schwerkranken, der Sterbenden trat und sie mit einem Wort, einer Handauflegung zum Leben rief.
Warum geschah so etwas heute nicht mehr? Warum trat er nicht an dies Schmerzenslager und sagte zu der Armen, die da steif und starr wie eine Mumie lag: „Stehe auf, nimm dein Bett und wandele!“?
Hatte sich etwas in dem Zimmer bewegt? War es ein Schatten, der dort über den Teppich glitt? — Er war nicht mehr allein mit seinen Töchtern, ein anderer stand mitten unter ihnen. Er erinnerte sich doch genau, die Tür geschlossen zu haben. War er so tief in seine traurigen Gedanken versunken, dass er ihr Öffnen nicht gehört? Oder hatten sie unsichtbare Hände aufgetan?
In dem matten Licht der Krankenstube sah er ein Antlitz von blasser Farbe, umrahmt von schwarzem, vollem Haar; ein dünner Schnurrbart von derselben Farbe und demselben weichen Glanze umschattete die schmalen Lippen. An den Schläfen war dies Haar bereits weiss, das milderte und erhellte die Dunkelheit des Kopfes.
Doch das alles sah er nur flüchtig.
Der Fremde schien einen Augenblick unschlüssig, an wen er sich wenden sollte, dann trat er auf Mechthild zu, die immer noch in ihrem rosafarbenen Gesellschaftskleide dastand. Jetzt merkte der Präsident, dass er den linken Fuss leise nachzog.
„Ich bin Doktor Eckart. Sie erbaten meinen in Besuch.“
Und nun einige kurze Fragen über die Leidende und ihren Zustand, die ihn schnell unterrichteten.
„Ich möchte die Kranke untersuchen.“
„Es wird nicht leicht sein,“ erwiderte der Präsident, „sie liegt seit mehreren Stunden ohne jede Bewegung.“
Der andere erwiderte nichts, trat dicht an das Lager und liess das Licht der elektrischen Lampe, die unter einem dunklen Seidenvorhang auf dem kleinen Tische vor dem Bett der Kranken stand, einschalten.
,,Die Beleuchtung ist nicht, wie ich sie brauche. Haben Sie vielleicht einen blauen Schleier für die Lampe . . . aus Gaze oder Seide, gleichviel?“
Nach einigem Suchen hatte man ihn gefunden und brachte ihn.
Nun liess das Licht seinen bläulichen Schein auf das bleiche Antlitz fallen, so dass es in dieser Beleuchtung wie aus Marmor gemeisselt aussah.
Eine Weile betrachtete Dr. Eckart mit einer Aufmerksamkeit, die zusehends wuchs, die Züge der Kranken. Dann lüftete er die Bettdecke, setzte den Hörer an und untersuchte. Nun begann er die Schläfen, die Arme und den Brustkorb zu bestreichen, langsam und mechanisch verrichteten die weissen, überschlanken Hände ihre Arbeit — mit einem Male schlug die Kranke die Augen auf.
„Ich bitte etwas mehr Licht!“ rief er zu Mechthild hinüber, die am Fussende des Bettes stand.
„Es möchte blenden —“
,,Etwas mehr Licht!“ wiederholte er bestimmt, befehlend beinahe.
Da schaltete Mechthild die Birnen der grossen Krone ein, die von der Decke herabhing.
„Nur eine Flamme, wenn ich bitten darf — die nach Ihnen zu — so ist es gut!“
Gedämpft flutete das Licht über das Lager. Zuerst schien es der Kranken unangenehm. Sie schloss die Lider, öffnete sie aber bald wieder. Fest ruhte der Blick des Arztes auf ihrem Antlitz, niemand sah er als sie. Als gäbe es auf der weiten Welt nichts anderes mehr für ihn, so senkten sich die stahlgrauen Augen in ihre leidenden Züge.
Jetzt begann er mit ihr zu sprechen. Er stellte einige Fragen. Sie schüttelte den Kopf und antwortete nicht. Unbekümmert fuhr er fort, auch hierbei den Blick unablässig auf die gerichtet. Ein weicher, wohltuender Klang war in seiner Sprache, bei aller Bestimmtheit etwas Gütiges und Beruhigendes.
„Ich bin gekommen, Sie gesund zu machen, liebe Frau von Ravenstein, Sie Ihrem Manne, Ihren Kindern wiederzugeben, die Sie noch alle sehr nötig brauchen — Sie meinen, ich kann das nicht? Sie irren, ich kann das sehr wohl.“
Sin Stammeln der blutlosen Lippen, das heftiger und lebhafter wird, zeigt ihm, dass sie ihn verstanden hat.
„Mir ist nicht mehr zu helfen.“
Leise und mühsam, aber ganz deutlich ist es aus ihrem Munde gekommen — seit vielen bangen Stunden das erste Wort, der erste klare, zusammenhängende Satz — alle haben ihn gehört. Ein Zucken läuft über das Gesicht des Präsidenten. Hilde und Mechthild tauschen einen halb erfreuten, halb erstaunten Blick. Regungslos lehnt Sophie an dem Bettgestell.
„Ihnen ist sehr wohl zu helfen. Sie müssen nur wollen, das ist das Ganze . . . Sehen Sie, jetzt lachen Sie schon!“
In der Tat, ein mildes, stilles Lächeln huscht über das leidende Gesicht, wie es diese Lippen wer weiss wie lange nicht gekannt. Der Präsident fährt mit der Hand an die Stirn. Ist dies Wirklichkeit? Oder ist es, ein narrender Traum, der so schnell verfliegt, wie er gekommen?
„Ich will schon, Herr Doktor.“
„Dann ist ja alles gut, dann müssen sie sich ein wenig aufrichten, damit ich Sie besser untersuchen kann als vorher.“
„Das kann ich nicht mehr.“
„Das kann sie wirklich nicht, Herr Doktor,“ mischt sich der Präsident, diesmal nicht ohne eine gewisse Erregung, ein.
„Sehen Sie, Iyr Herr Gemahl glaubt nicht an Ihren Willen. Sie werden ihn eines Besseren belehren. Sie müssen sich aufrichten! Sonst kann ich nichts tun!“
Während des ganzen Gespräches hat er nicht ein einziges Mal die Augen von ihr gewandt, auch dann nicht, als der Präsident seine Einrede machte. Ganz ruhig, aber immer fester und bestimmter ist sein Blick und sein Wort.
„Ich werde Ihnen helfen — so — noch ein wenig höher — prachtvoll!“
„Sie sitzt! Ganz aufgerichtet sitzt sie!“ ruft Mechthild. Fest stützt der Präsident die Hand auf die Lehne des Armsessels, an dem er steht. Hildegards Antlitz schwimmt in Tränen. Sophie blickt bald auf die Mutter, bald auf den Arzt. Ihre Züge haben das Leblose verloren, eine erstaunte Frage ist in ihnen, zugleich ein leises Entsetzen.
„Sie sitzt!“ kommt es langsam, stockend nun auch von ihren bebenden Lippen.
Als handele es sich um etwas Selbstverständliches, beginnt Dr. Eckart seine Untersuchung. Auf seinen Wink stützen Hildegard und Mechthild von beiden Seiten ein wenig die Mutter, die während der eingehenden Betastung und Beklopfung aufgerichtet sitzen bleibt.
„Seit drei Monaten hat sie es nicht eine Minute lang vermocht — und jetzt —“ flüstert Mechthild dem Präsidenten zu. Der antwortet nicht.
Dr. Eckart hat seine Arbeit verrichtet, er verabschiedet sich von der Kranken und begibt sich mit dem Präsidenten und seinen Töchtern in das Nebenzimmer.
,,Als was hat man die Krankheit Ihrer Frau Gemahlin bezeichnet?“
„Als eine Lähmung, die auf einem organischen Nervenleiden beruht und kaum mehr zu heben sein wird. — Und Sie, Herr Doktor?“ fügt er hinzu, und eine sichtbare Spannung ist in seinem Antlitz.
Aber der schweigt eine geraume Zeit, den Blick auf die Erde gewendet.
„Für was sehen Sie den Fall an?“ fragt der Präsident noch einmal, dringender als zuerst.
„Ich kann mich heute darüber nicht aussprechen.“ Kurz, beinahe abweisend wird es gesagt.
„Und meine Tochter —?“
Der Präsident erzählt, dass sie eben getraut ist und im Begriffe steht, mit ihrem jungen Gatten eine kurze Reise zu machen, bevor dieser wieder an die Front muss.
„Kann fahren — ohne jedes Bedenken!“
„Ich möchte doch lieber den morgigen Tag abwarten,“ wirft Hildegard ein.
„Sie können heute abend reisen . . . auf meine Berantwortung!“
„Aber wenn nur die geringste Gefahr —“
„Sie ist ausgeschlossen.“
Dem Präsidenten ist es zumute, als zünde eine weiche Hand in seinem Herzen ein Licht an, das aufwärts steigt und über seinem Haupte in hellen Freudengluten zusammenschlägt. Die Stube, das Bett, seine Töchter drehen sich vor seinen Blicken. Es ist das Glück, das nicht mehr erwartete, das nun mit urplötzlicher Gewalt gekommen und ihn, den Besonnenen und Nüchternen, trunken macht.
„Ausgeschlossen?“ fragt er und weiss gar nicht, dass er spricht.
„Völlig ausgeschlossen.“
„Und eine Besserung —?“
„Müssen wir abwarten.“
Wieder die karge, ablehnende Art.
,,Sie werden morgen wiederkommen?“ fragt Mechthild.
„Nein.“
Eine starke Enttäuschung ist in dem Auge, das dem seinen begegnet.
„Mein Besuch ist nur in Vertretung eines abwesenden Kollegen gemacht.“
„Und Sie würden die Behandlung auch nicht in Gemeinschaft mit Herrn Geheimrat Mollenhauer übernehmen?“ dringt jetzt der Präsident in ihn.
“Ich fürchte, unsere Ansichten würden in diesem Falle auseinandergehen. Darum möchte ich eine gemeinschaftliche Behandlung ablehnen.“
Er wehrt den Dank ab, der ihm von dem beglückten Gatten und Mechthild aus bewegtem Herzen gebracht wird. Hildegard ist in aller Eile abgefahren, um mit ihrem Manne den Nachtzug zu erreichen. Sophie hat sich zur Mutter begeben, ihres Amtes in gewohnter Weise zu warten.
Einen Blick noch wirft Eckart durch die geöffnete Tür auf die Kranke, nickt befriedigt vor sich hin und verabschiedet sich.
Sophie sieht ihm eine Weile nach. Etwas Abwesendes ist in ihr, während sie der Mutter einige Handreichungen tut. Bei aller Freude über die Besserung in ihrem Befinden muss sie sich innerlich erst abfinden mit dem Unglaublichen, das sich heute vor ihren Augen vollzogen.
Ruhig, immer noch ein leises Lächeln auf den Lippen, liegt die Mutter da. „Rufe mir den Vater!“ flüstert sie.
Und als der sich Leise an ihr Lager setzt und nun endlich ihre Hand in die seine schliessen kann:
„Ich dachte, ich würde heute abend einschlafen . . . ich schlief bereits — da kam der wunderbare Mann — und erweckte mich. Wie ist das nur —?“
Die letzten Silben klingen in einen Hauch aus, den weder Vater noch Tochter vernehmen können.
„Sie sehn doch, das Kind hat de Krämpf; es liegt seit dem frühjn Morgen in Zuckungen, da werde Se mich doch vorlasse!“
Eine junge Frau aus einfachem Stande mit abgehärmtem Gesicht sagte es zu einer anderen, die in einem mausgrauen Samtumhange, dessen einmal vornehme Abkunft bereits bedenkliche Spuren des Niederganges wies, behäbig und gewichtig auf einem der kleinen Rohrstühle in Dr. Eckarts Warteraum sass.
Recht genommen sass sie nicht da, sondern nur der mausgraue Samtumhang, der früher einmal eine recht wohlbeleibte Besitzerin geschmückt haben musste. Die jetzige aber war dünn und klein und verschwand so in seiner Umhüllung, dass nur der spitze Kopf aus ihm hervorragte und der Vergleich mit einem Maulwurf sich aufdrängte.
„Nee, dat wär’ ick nich, ich hab’ auch Schmerze ins Jesicht und ins I’nick. ’s sind auch noch welche vor mer.“
„Wir können nicht warten, wir sind von ausserhalb und sitzen schon eine Stunde hier!“ pflichtete eine dralle Frau bei, die, sichtbar dem wohlhabenden Bauernstande angehörig, mit einem halberwachsenen Jungen mit platter Nase und abstehenden Ohren auf einem roten Ledersofa Platz genommen, das ausser dem grossen Spiegel in goldenem Rahmen das einzige Schmuckstück des langen, kahlen, sonst nur mit einer nüchternen Reihe einfacher Stühle besetzten Wartezimmers bildete.
Die abgehärmte Frau liess sich nicht abweisen. „Soll mir das Kind hier in den Armen sterben?“ fragte sie mit einer Erbitterung, die ihre eingefallenen Wangen noch blasser erscheinen liess. „Sowie der Mann raus kommt, der jetzt drin is, geh’ ich vor und zeig’ dem Herrn Dokter das Kind. Dann werde wir ja sehe, wen er einlässt, Sie oder mich!“
Ihre Worte, die in der Empörung ihres Herzens beinahe schrill hervorgestossen wurden, erschienen den anderen eine Herausforderung. Besonders der Maul wurf erregten sie so, dass der kleine Kopf plötzlich gross wurde und spitz und krebsrot aus der mausgrauen Umhüllung hervorwuchs.
„Wir wärr’n ja sehe, ja sehe wärr’n wir — wir ha’n unsre Nummern, nach dene jeht’s und nich nach jedermanns Beliebe,“ piepste und gluckste die dünne Stimme.
Wieder schlug sich die dralle Landfrau auf ihre Seite. Damit wurden auch die übrigen Patienten in den Streit hineingezogen, der nun allgemein wurde. Einige nahmen für das kranke Kind Partei, andere, die auch nicht länger warten wollten, pflichteten der Dünnen und der Drallen bei.
Da nahte sich vom Flur her ein Schritt.
Auf weichen, schwarzen Filzschuhen, die seinen Gang kaum hörbar machten, trat ein Mann unter die Streitenden, dessen eng an den hageren Körper sich schmiegender und an dem Halse unter dem grauschimmernden Gummikragen geschlossener Rock an eine priesterliche Gewandung erinnerte: Herr Wattemack, der Diener des Arztes, den die Patienten jedoch als ein Wesen höherer Art, zum mindesten als seinen gebeimnisvollen Gehilfen betrachteten, und der seinerseits durch eine unnachahmliche Würde seiner Haltung und seines Wesens alles tat, sie in diesem Glauben zu erhalten.
„Ich bitte, meine Herrschaften, man muss sich behandhaben!“
Niemand wusste, was er mit diesem rätselhaften Ausspruch meinte, und er selbst am wenigstent. Aber es war sein drittes Wort; er brauchte es bei jeder Gelegenheit.
Man trug ihm den Fall vor. Er wiegte bedächtig das Haupt mit dem borstigen, angegrauten Haar, war innerlich wohl geneigt, der Frau mit dem Kinde recht zu geben, konnte sich aber andererseits nicht entschliessen, die Unfehlbarkeit der Nummerkarten anzutasten, die Tag für Tag mit strenger Gewissenhaftigkeit und ohne Ansehen der Person an die Patienten zu verteilen er als seine heilige Obliegenheit ansah.
„Es geht im Leben nicht anders. Wir waren im Felde, meine Herrschaften, und in den Schützengräben —“ er war acht Wochen als Sanitätssoldat in Mitau gewesen und dabei einmal zu einem Transport für einige Stunden in einen Schützengraben beordert —, was hätten wir wohl da machen sollen, wenn wir uns nicht behandhabt hätten?“
Die Tür zum Sprechzimmer öffnete sich. Ein stark beleibter Herr trat heraus, der sich mit dem buntseidenen Taschentuch den Schweiss von der Stirn wischte; hinter ihm war die untersetzte Gestalt des Arztes sichtbar, der dem Scheidenden noch einige Verhaltungsmassregeln auf den Weg gab.
Nun näherte sich Wattemack seinem Herrn und flüsterte ihm einige Worte zu.
„Das Kind kommt zuerst!“ entschied der kurz, jeden Widerspruch abschneidend.
Ein dankbares Lächeln flog über das unschöne Gesicht der abgehärmten Frau, die jetzt, das schwere Tuchknäuel auf dem Arme, aus dem nur dann und wann ein leises Wimmern klang, an den Arzt herantrat.
Der schloss die dichten Doppeltüren, deren innere mit Filz beschlagen war, führte die Frau in sein grosses, lichtes Zimmer, löste mit ihrer Hilfe das kleine Wesen von seinen Fesseln und begann, es auf das sorgfältigste zu untersuchen.
Etwas Gütiges lag in seinem ernsten, beinahe strengen Antlitz, als er sich über das Kind beugte, ein stiller Zug von Liebe zu der kleinen, leidenden Kreatur, die seiner Hilfe anvertraut war.
Eine ganze Weile hatte das geschwächte Kind schweigend alles mit sich geschehen lassen; als der Arzt jedoch den Hörer ein wenig fest an den zarten Körper ansetzte, ging das klägliche Wimmern in ein lautes Weinen über.
Er aber hatte eine so wunderbare Art, es zu beruhigen, seine weiche, warme Hand strich so liebevoll über den kleinen Kopf dahin, dass es bald wieder still wurde, ja, ein Schimmer von Freude, wie ihn die gequälte Mutter so lange nicht an ihrem Liebling gesehen, lag jetzt auf seinem Antlitz.
„Das Kind mache ich Ihnen gesund, liebe Frau, ganz gesund,“ sagte Eckart, nachdem er seine Untersuchung beendet.
„Herr Dokter —!“
Die Frau war nicht wiederzuerkennen. Aller Harm, alle Angst, ja, die Falten waren aus ihren Zügen wie fortgeblasen, sie sah beinahe hübsch und lieblich aus in ihrem strahlenden Glück. „Wenn Se das könnte — Herr Dokter!“
„Ich verspreche es Ihnen. Nur Geduld müssen Sie haben. Und jeden Tag kommen, vorläufig wenigstens. Sie sollen nicht warten!“
Er drückte auf den Knopf an seinem Schreibtisch. „Diese Frau, Wattemack, wird jedesmal vor den anderen vorgelassen!“
Der Alte wiegte den Kopf. „Es wird sich schwer behandhaben lassen, Herr Doktor.“
„Es muss gemacht werden.“
,,Herr Doktor,“ erwiderte Wattemack, sich ein Herz fassend, „die Leute sind mir schon ganz aufsässig geworden. Die Dame mit dem grossen Samtkragen sagt, sie lasse sich eine solche Bevorzugung der kleinen Leute nicht gefallen, sie wolle zu Herrn Geheimrat Mollenhauer gehen, da käme so etwas nicht vor. Und die andere Dame, die vom Lande, Herr Doktor, die gestern die schöne Stiege Eier in der Küche abgegeben, pflichtete ihr bei.“
„Es bleibt bei dem, was ich gesagt habe.“
Er schrieb einige Rezepte für das kranke Kind und wandte sich dann wieder der Frau zu, seine Verordnungen sorgsam zu erläutern.
„Ich hab’ soviel Leid durch’macht in der letzten Zeit,“ sagte diese; „mein Mann fiel in Russland, er hatte sein gutes Auskomme, wir ware sehr glücklich. Aber als er auszog, wusst’ er, dass er niemals zu mir zurückkomme würd’ — nu war mir nur das Kind gebliebe, das ich kurz nach seinem Fortgang jekricht. Ich hatt’s schon aufgegebe — und wenn Sie es mir wiederschenke würde, Herr Dokter, das wäre ein unbeschreibliches Glück — ein janz unbeschreibliches Glück!“
Sie hatte den Kleinen wieder sorgsam verpackt, ihre Verordnungen eingesteckt und war mit heissen Dankesworten gegangen.
Aber der mausgraue Samtumhang, der sich jetzt in vornehmer Entfernung von der heraustretenden Frau der Doppeltür zu bewegte, stiess auf neuen Widerstand. Denn abermals wies ihn Herr Wattemack mit einer leisen Handbewegung zurück und begab sich statt seiner in das Sprechzimmer.
„Eine Dame wünscht den Herrn Doktor, es ist sozusagen, ohne dass ich sie gefragt habe, eine seine Dame.“
„Sie erhält ihre Nummer und muss warten.“
„Herr Doktor, sie sieht nicht aus, als ob man sie warten lassen könnte.“
„Lass die nächste Patientin herein und frage indes nach ihrem Namen!“
„Die Dame ist Fräulein von Ravenstein,“ meldete Mattemack wiederkehrend, „dieselbe, die den Herrn Doktor vor acht Tagen durch den Fernrufer zu ihrer kranken Mutter bat.“
Ein wenig Unmut lag doch auf Mechthilds Zügen, als sie nach einer guten Stunde endlich vorgelassen wurde.
„Die Besserung in Mamas Befinden hat zu unserer aller Erstaunen bis gestern abend angehalten,“ begann sie in sachlichem Ton. „In der Nacht aber trat ein Rückfall ein, und jetzt liegt sie gerade so teilnahmlos und unbeweglich, wie Sie sie damals angetroffen haben.“
„Ist sie in irgendeiner Weise weiter behandelt worden?“
„Nein.“
„Weshalb nicht?“
Einen Augenblick zögerte Mechthild. „Herr Geheimrat Mollenhauer“, sagte sie dann, „war von vornherein ungläubig und meinte, die unvermutet gute Wendung in ihrem Befinden könnte nur eine trügerische sein. Man hätte es wahrscheinlich mit einer verblüffenden und aufraffenden Wirkung zu tun, die das Ungewohnte Ihres Auftretens, vielleicht auch —“ wieder stockte sie — „vielleicht auch Ihre ganze Persönlichkeit auf die Kranke geübt. So etwas käme bei dieser Art von Leiden öfter vor, erwiese sich aber immer nur als eine Scheinbesserung, auf die nicht viel zu geben wäre.“
Eckart lächelte. Es war ein seltener Anblick, das ernste Gesicht von einem so frohen Lächeln erhellt zu sehen.
„So? Das also sagte er? Dann müsste freilich in meiner Persönlichkeit etwas liegen, das, ich möchte sagen, ein wenig mit Zauberei gemein hat. Und Sie? Schreiben Sie die schnelle Wendung im Befinden Ihrer Frau Mutter ebensolchen Einflüssen zu?“
Eine leise Blutwelle stieg in Mechthilds Antlitz bis hinan an das rötlich goldene Haar. „Ich habe mir diese Frage bereits selber vorgelegt, und ich muss bekennen: es liegt wohl etwas in Ihrer Art und Persönlichkeit, das auf Kranke sonderbar einwirkt. Ich merkte es an der Mutter, sie war völlig verändert. Und ich bin überzeugt, wenn Sie heute wieder kämen —“
„Und ihr aufs neue mein Zaubersprüchlein hersagte, dann würde sie gesund sein — selbstverständlich nur für wenige Tage!“
,,Gerade deshalb bin ich hergekommen —“
„Weshalb sind Sie gekommen?“
„Sie zu bitten, wenn auch nicht Ihr Zaubersprüchlein herzusagen, so doch die Mutter noch einmal zu besuchen, sie sich wenigstens anzusehen. Sie hat ein starkes Verlangen nach Ihnen.“
Er schier sie nicht zu hören. Sein Blick war einwärts gerichtet, sein Gesicht von nachdenklicher Stille umschattet.
„Es ist etwas Wunderbares um die Medizin,“ sagte er mehr zu sich selber sprechend als zu ihr, „sie ist eine ernste, strenge Wissenschaft. Aber es liegen in ihr unergründliche Geheimnisse. Die letzte, noch nicht erklärte und doch stärkste aller Einwirkungen: die des Menschen auf den Menschen, offenbart sich in ihr wie in keiner anderen. Ich lächelte vorhin über den Ausspruch Ihres Hausarztes. Aber er ist ein kluger Mann, den ich schätze, und in dem, was er sagte, liegt ein Gran von Wahrheit.“
Er stand auf. Scharf hob sich der dunkle Kopf mit dem ausdrucksvoll geschnittenen Antlitz von dem schneeweissen Mantel ab, den er während der Sprechstunden zu tragen pflegte.
„Könnten Sie es sich nicht vorstellen,“ fragte er, hart an ihrem Stuhle stehenbleibend, „dass einer niemals Medizin studiert hätte und doch ein Arzt würde, der Grosses wirkte?“
Einen Augenblick schwieg sie. „Nein,“ sagte sie dann in ihrer klaren, zufassenden Art, „das könnte ich mir nicht vorstellen.“
„Und weshalb nicht?“
„Weil sich die gekränkte Wissenschaft eines Tages an ihm rächen würde.“
„An ihm rächen? Wie meinen Sie das?“
„Nun, er würde nach allen scheinbaren Erfolgen, eben weil er unwissend ist, einen verhängnisvollen Missgriff tun.“
Ihre Antwort schien ihm zu gefallen. „Vielleicht,“ gab er zurück, indem er sich wieder zu ihr setzte.
Der Diener trat ein: zwei Patienten wären noch gekommen, die den Herrn Doktor gern sprechen würden.
„Die Sprechstunde ist vorüber,“ sagte Eckart ein wenig verstimmt, „ich habe noch unaufschiebbare Besuche zu machen. Bestelle sie für morgen!“
„Es ist ein alter Mann, er sieht zum Jammern aus, und seine Frau, die mit ihm ist, bat so sehr —“
„Lass sie warten — sie können dann gleich vorkommen!“
„Wovon sprachen wir doch?“ wandte er sich wieder zu Mechthild, sowie der Diener gegangen war. „Ach ja, ich weiss schon: von der gekränkten Wissenschaft als Rächerin. Es war nicht schlecht gesagt. Offengestanden, darüber habe ich noch niemals nachgedacht.
Eins aber möchte ich Sie versichern: dass es bei uns viel mehr auf den Glauben als auf das Wissen ankommt. Und zwar den Glauben in zweierlei Beziehung: der, den der Arzt an sich selber hat, an seine Kunst und Ktraft, zu helfen — und den, den der Patient an ihn hat.
Ich habe es erfahren, mehr als einmal: die tüchtigsten, an Wissen und Können reichsten Ärzte konnten auf die Dauer ihren schweren Beruf nicht erfüllen, weil sie anfingen, an sich und ihrer ärztlichen Kraft zu zweifeln. Und Leibende, denen vielleicht noch zu helfen gewesen wäre, blieben krank, weil es ihnen an dem unerschütterlichen Glauben an ihren Arzt mangelte. Ich für mein Teil verlange von dem Patienten, dem ich helfen soll, dass er an mich glaubt — ganz fest und zuversichtlich!“
„Und kommen doch nicht, wenn Sie diesen Glauben finden!“
Er geriet in eine gewisse Verlegenheit, man sah es seinem Gesichte an.
„Ich erlaubte mir, Sie schon damals darauf hinzuweisen, dass ich meinen Besuch nur als eine Vertretung Ihres abwesenden Hausarztes betrachten konnte.“
„Ich weiss das sehr wohl. Aber jetzt, wo es mit der Mutter wieder schlechter geht, wo sie, wir alle den sehnlichen Wunsch haben, sie von Ihnen behandelt zu wissen, Ihnen mit dem grössten Vertrauen entgegenkommen, müssten solche Rücksichten doch wohl in den Hintergrund treten.“
Er sah sie an, voll und tief ruhte sein Auge aus ihrem Antlitz.
„Ich kann mir meine Stellung hier nicht durch einen Zwiespalt mit den Kollegen untergraben, zumal mit dem tüchtigsten und angesehensten von ihnen allen nicht. Sie ist dazu noch nicht gefestigt genug, und ich muss wirken und schaffen — oder nicht leben!“
Sie erhob sich.
„Dann wäre meine Aufgabe erfüllt,“ sagte sie, und ein Klang von Enttäuschung, ja, fast von Bitterkeit sprach aus ihren Worten. „Nur eine Frage dürfen Sie mir nicht verargen, verzeihen Sie sie der wenig Eingeweihten: Sind diese Rücksichten nicht vielleicht ein wenig eng und klein, wenn es sich um ein Menschenleben handelt?“
Eine merkbare Bewegung war in ihm.
,,Ein Menschenleben!“ wiederholte er, nun wiederum mehr zu sich als zu ihr sprechend. „Ein Menschenleben, das man retten könnte — vielleicht sicher retten!“
Er ging mit starken Schritten über den mit dunkelgrünem Linoleum belegten Boden; das Nachziehen des linken Fusses trat jetzt mehr hervor.
„Und wenn dem so ist, was werden Sie tun?“
„Ich werde kommen! Erwarten Sie mich heute in den Nachmittagsstunden.“
Sie sprach kein Wort. Aber ihr Auge leuchtete ihm entgegen, und ihre Hand lag voll und warm in der seinen.
Dann ging sie, und Wattemack erschien an der Tür.
„Lass jetzt zuerst die beiden Patienten ein, dann besorge mir einen Wagen! Ich muss in einer dringlichen Angelegenheit fort.“