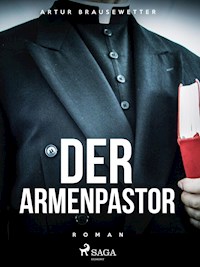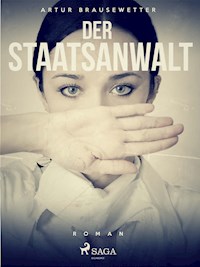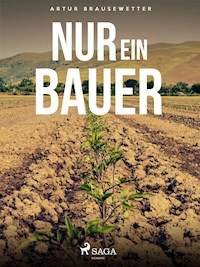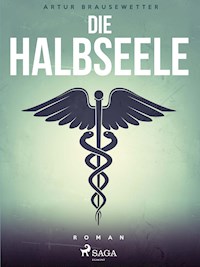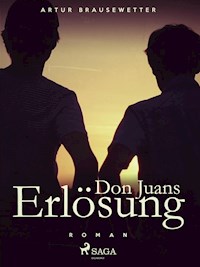Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band enthält die drei Novellen "Die Adebare", "In der Heilanstalt" und "Sommernachtsträume". "Die Adebare" handelt vom Leben einer Pfarrersfamilie und der traurigen Erkrankung ihres Kindes, die zur Krise der ganzen Familie führt. Der Ich-Erzähler von "In der Heilanstalt" berichtet von seinen Erlebnissen in einer Heilanstalt für Nervenkranke, in die er sich als junger Arzt immer weiter einlebt, bis er sich in eine Insassin verliebt und seine tagebuchartigen Aufzeichnungen nun unvermittelt abbrechen – die von dritter Hand angehängten Ergänzungen bieten ein ganz anderes Bild der Geschehnisse ... Die abschließende Titelnovelle "Sommernachtsträume" schließlich, eine heiter-wehmütige Liebesgeschichte, erzählt vom jungen Fräulein von Fehrbach und ihrem "kurzen Sommernachtstraum in Heidelberg, der schönste, den sie je geträumt". In allen drei Erzählungen erweist sich Arthur Brausewetter als ein großer deutscher Erzähler, der eine Wiederentdeckung lohnt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Artur Brausewetter
Sommernachtsträume
Drei Novellen
Saga
Sommernachtsträume
© 1920 Artur Brausewetter
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711487792
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Die Adebare
Der Pfarrer öffnete das Fenster seiner Arbeitsstube. Der weiche Atem der Juninacht umspielte seine Stirn, leise knisterte es in den Blättern des dunklen Ahornbaumes, klang es aus dem Rieseln des Taues, der langsam von Blatt zu Blatt fiel, jenes geheimnisvolle Klingen, welches wie eine Botschaft aus anderer Welt in stillen Sommernächten durch die schlummernde Erde zieht. Über ihr brütete dumpfe Schwüle, aber die tiefe Stille, die sich in ihr um so feiernder kundgab, tat dem Manne am Fenster wohl.
Er atmete auf, als wollte er ein neues Leben, neue Andacht aus der schweigenden Einsamkeit trinken, er fühlte seinen Kopf freier, seine Seele ruhiger.
Er war an seinen Schreibtisch getreten, die wiederkehrenden Gedanken auf das Papier zu bannen, die unterbrochene Arbeit mit frischen Kräften aufzunehmen.
Da durchschnitten schrille Töne die andächtige Stille, ein schmetterndes, klapperndes Durcheinander verstimmter Blasinstrumente tobte durch die Nacht.
Dem Pfarrer stieg eine Zorneswelle in das bleiche Angesicht, er schloss das Fenster, aber er kehrte nicht zu seiner Arbeit zurück, in ruheloser Erregung schritt er durch das kleine Zimmer.
„Noch immer finden sie kein Ende, und so geht es fort, bis die Sonne deinem Tage scheint! Mit diesem rohen Lärme begrüssen sie deinen Sonntag! Ich aber, ich soll Geduld lernen, und es wird mir immer unmöglicher, sie zu üben. Ich soll für sie beten, und mein empörtes Herz kann dem Wunsche nicht wehren, dass aus der Wolkenwand da drüben ein Blitz zuckte und sie strafte — sie alle, die nicht hören, sich nicht bekehren wollen zu dem Ernste deines Wortes!“
War er die Antwort auf seine Bitte, jener lange, fahle, grüne Blitz, der die Wolken plötzlich durchschnitt, wie eine glühende Geissel über ihren Rücken dahinzuckte und niederzitterte in den Schoss der Erde, als wollte er ihn zerklüften mit einem einzigen Schlag, die Antwort jener Donner, der mit feierlicher Majestät über den Erdboden rollte, jenes Meer sich einander verzehrender Feuer, das jetzt am Himmel auf und nieder wogte, bald in flammender Lohe sich emporbäumte, bald mit rasender Geschwindigkeit zur Tiefe fuhr, wie in verzückter Freude über das Toben des Donners und das Heulen des Sturmes, die ihr Kampfspiel mit knatternder Musik begleiteten?
Das alles, so ernst und eindringlich es sprach, die lustige Gesellschaft da drüben in dem Dorfkruge störte es nicht. Die verstimmten Blasinstrumente nahmen den Kampf mit den entfesselten Elementen auf, nur um so lauter und schriller stiessen sie ihre schnelle Tanzweise in die Nacht hinaus.
Er hatte die Feder beiseite gelegt, die kaum beendete Predigt von sich geschoben und war in sein Schlafzimmer getreten.
In ruhigem Schlummer auf sein Bett gestreckt lag ein junges Weib, den linken entblössten Arm unter den Hals gestützt, den rechten schlaff an die Seite gelehnt. Langsam und friedlich hob sich die leise wogende Brust unter dem weissen Nachtgewande.
„Und sie kann schlafen!“ flüsterte er mehr verstimmt als freudig.
Sie hörte ihn nicht. Ein glückseliges Lächeln spielte um die leise geöffneten Lippen, wie der Widerschein eines beglückenden Traumes flog es über die scharf ausgeprägten Züge, aus denen selbst der Schlaf den trübenden Hauch der Sorge nicht zu tilgen vermochte.
Aber dieses Lächeln verjüngte sie wie ein kurzer Sonnenblick den Herbst, es übergoss das nicht regelmässige, für seine Jugend überernste Antlitz mit dem Schimmer einer eigentümlichen Schönheit. Das Bild des Friedens, der sinnenden Ruhe, träumte sie vom Glück des Lebens, indem sie sein stürmender Kampf, seine rohe Lust umtobten.
„Sie kann schlafen!“ sagte der Pfarrer noch einmal, lauter als das vorige Mal.
Da hoben sich die dunklen Lider; aus dem dichten Schleier der braunen Augen traf ihn ein kurzer, erschreckter Blick.
„So spät?“ flüsterte sie noch trunken im Schlafe. Aber das verklärende Lächeln war verschwunden, es war Herbst geworden auf dem ernsten Antlitze.
Doch dann umfasste der Schlaf sie wieder, mit weichen, starken Armen. Nur ruhig war er nicht mehr und friedlich. Sie stöhnte oft im Traume, einmal rief sie laut den Namen ihres Mannes und tastete, beide Arme wie hilfesuchend nach ihm strekkend, nach seinem Lager, wie um sich zu vergewissern, dass er dort war.
Er war dort, mit weit geöffneten Augen lag er schlaflos auf seinem Bette. Er sah die Blitze durch die Zimmer tanzen, er hörte es, wie die Störche, die da drüben auf der Pfarrscheune ihr Nest bauten, aus dem Schlummer aufgeschreckt, ängstlich durch die entfesselte Nacht klapperten.
Auch als das Gewitter nachgelassen und das Grauen des Morgens die Gesellschaft im Kruge auseinandertrieb, die johlend und lärmend sich trennte, und es mit dem erwachenden Tage wieder still und friedlich um das Pfarrhaus wurde, schlossen sich seine Augen noch nicht zur Ruhe.
Das Fest im Dorfkruge und die durch den Regen aufgeweichten Wege hatten das ihre getan. Der Pfarrer hielt seine Predigt vor einer leeren Kirche.
Missgestimmt kehrte er heim.
„Ich wusste es vorher,“ sagte er, „so ist es jeden Sonntag.“
Seine junge Frau legte das Gesangbuch aus den Händen und tat den leichten Umhang von den zart gebauten Schultern.
„Du solltest nicht undankbar sein, Hermann,“ sagte sie beschwichtigend, „deine Gemeinde ist kirchlich und wohl empfänglich.“
„Aber sie wird verdorben, gewaltmässig verdorben! Wie oft habe ich den Amtsvorsteher gebeten, diese rohen Vergnügungen wenigstens am Sonnabendabend zu untersagen, mir nicht nur ihn, nein auch diesen tückischen Krugwirt und das halbe Dorf durch meine Beschwerden bei dem Landrat auf den Hals gehetzt, und nichts erreicht! Mir armen Pfarrer! Man tritt uns mit Füssen, wo man nur kann. Wir mögen nur der Sache dienen und das Beste im Auge haben, man lässt uns überall im Stich.“
„Aber du dienst nicht nur der Sache.“
„Elisabeth!“
Über seine bleichen Züge flog ein Schatten des Unwillens, das Blut stieg ihm bis unter die durchsichtigen Haare.
Sie nahm seine Hand und liess sie auch nicht, als er sie ihr mit einer raschen Bewegung zu entziehen suchte.
„Weisst du noch, was wir uns vor vier Jahren in die Hand gelobten, als wir vom Altare in das elterliche Haus zurückkehrten? Offenheit, unbedingte, unbegrenzte Offenheit in allen Lagen des Lebens, sei sie auch schmerzend. Nein, Hermann, du dienst der Sache nicht, suchst nicht ihre Förderung. Deine eigene erstrebst du nur, und weil du sie in dem bescheidenen Berufe eines Landpastors nicht findest, haderst du mit ihm und bist unglücklich.“
Er konnte sich der ruhigen Wahrheit ihrer Worte nicht entziehen, das aber machte ihn nicht milder.
„Ich hätte ihn vielleicht nie wählen dürfen,“ gab er kurz zur Antwort.
Durch die dunklen Augen zuckte ein leises Erschrecken.
„Wie durftest du es denn tun — jeden anderen Beruf, aber gerade diesen?“
„Weshalb ich es tat — wer wüsste es besser als du?“
Er hatte es schärfer gesagt, als es in seiner Absicht lag. Sie trat einen Schritt zurück, aus ihrem linken Mundwinkel sprang eine harte Falte hervor, ihre Hand löste sich aus der seinen.
„Mir zum Opfer — ja, ich verstehe dich. Mich zu heiraten, wurdest du Landprediger. Du hast es mir bisher nie gesagt, aber ich wusste es längst. Dass du es mir einmal so kalt, so knapp gestehen würdest, ich habe es lange erwartet, — nun aber, wo du es tust, trifft es mich mehr, als ich gedacht. Du hast ganz recht. Ich trage die Schuld. Weshalb liess ich es zu?“
„Weil du mich liebtest — wie ich dich, Elisabeth!“ antwortete er rasch und wärmer als bisher.
„Weil ich dich liebte — gerade deshalb hätte ich es nie leiden dürfen. Ich sah es dir an, aus jedem deiner Blicke las ich es, wie wenig es dir zusagte in dem kleinen bescheidenen Predigerheim der Eltern, wie du den Vater in seiner anspruchslosen Einfachheit, seiner schlichten Weise nie verstehen konntest, so ehrliche Mühe du dir auch gabst. Du wolltest Dozent werden; deine Gaben unterstützten einflussreiche Verbindungen. Und ich — ich — —“
Aus ihren Augen stürzten die Tränen, so sehr sie ihnen wehrte. Sie hob keine Hand, sie zu trocknen. Ihre Zähne gruben sich in die Unterlippe, sie schämte sich, ihren aufgelösten Schmerz vor seinen Augen zu zeigen.
Er kannte ihre Stärke, um so heftiger ergriff ihn ihre Fassungslosigkeit.
„Ich suchte das Glück,“ sagte er weich, „und ich habe es gefunden.“
„Du suchtest das Glück, so sagtest du mir am ersten Tage, als wir uns fanden. In der Befriedigung des Ehrgeizes, der dich durchglühte, aus jedem deiner Worte, jeder deiner Taten sprach, suchtest du es. Ich wusste das bald. Aber ich war ein Kind — und was glaubt man nicht alles, wenn man liebt, was träumt man von der Umgestaltung eines anderen zum eigenen Ich, von Aufhebung schwerer Opfer durch tausendfache Liebe, von — ja, ich war ein Kind, als ich deinem Stürmen nachgab, dir erlaubte, das angebotene Dozentenstipendium zu deiner Ausbildung und belehrenden Reisen auszuschlagen, um des Vaters einsame, abgelegene Pfarre anzunehmen. Und nun — —“
Eine Tränenflut erstickte ihre Worte. Er aber ergriff ihre beiden Hände, zog sie sanft neben sich auf die Lehne des Sessels nieder, auf dem er sass, und sah ihr eine Zeitlang stumm, wie sich sammelnd, in das erregte Antlitz.
Dann sagte er langsam: „Du hast recht, Elisabeth. Deinem ernsten, tiefen Schmerze gegenüber wäre Unehrlichkeit Sünde. Ich habe das Glück gesucht, habe es hier in diesem stillen Wirken, an deiner Seite zu finden gehofft und — habe es nicht gefunden. Vier lange Jahre habe ich es jeden Tag, jede Stunde unter Zagen und Zittern aufs neue versucht — vergeblich! Dieses einfache, tatenlose Wirken, in dem dein Vater einst mit seinem ganzen Leben aufging, es ist nichts für mich! Ich habe nicht eine der drei Tugenden, die einem Geistlichen fester, innerlicher Herzensbesitz sein müssen, habe keine Geduld, keine Demut, keine Selbstlosigkeit. Unterbrich mich nicht — ich habe sie nicht in dem Masse, als sie der schlechteste Prediger braucht. „Das eigene Glück nur darin suchen, dass wir es den andern erringen“, das sagte mir dein seliger Vater, als ich ihm mein Vorhaben kundtat. Ich aber suche ein anderes Glück, ich leugne es nicht. Fort von dieser Einsamkeit möchte ich hinaus ins Leben, auf einer Universität meine Gedanken denen künden, die empfänglicher, gereifter für sie sind als diese kleinen Bauern und Tagelöhner. Sie würden einen besseren Hirten, ich ein angemesseneres Feld zum Wirken und Ausbreiten meiner Kräfte fühlen. Das wäre das Glück! Und glücklich mit mir solltest du sein, Elisabeth!“
„Dass du es fändest!“ Und leiser setzte sie hinzu: „Für mich hat es bis heute hier geruht, in diesem stillen Hause, diesem einsamen Dorfe. Nun aber will ich’s gerne mit dir suchen, wo du’s zu finden meinst.“
Er hatte ihre letzten Worte, mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, nicht gehört.
„Ich werde es finden,“ sagte er voller Zuversicht. „Du weisst, warum ich Tag und Nacht so fieberhaft gearbeitet, mir keine Ruhe und Erholung mehr gegönnt habe.
Mein alter Gönner, der Professor Georgi in Bonn, der meine kleinen pädagogischen Aufsätze bei ihrer Veröffentlichung so warm lobte, hat mich nicht vergeblich angespornt. Aus den Vorarbeiten für sie ist die neue Niederschrift eines grösseren pädagogischen Werkes entstanden, das ich ihm vor kurzem eingeschickt habe. Täglich erwarte ich seine Antwort. Und ich darf dir’s gestehen, Elisabeth, ich hoffe viel von ihm. Lobt er es so wie damals die Aufsätze, so wird es mir nicht nur leicht fallen, einen Verleger zu finden — noch mehr —“
Er machte eine kurze Pause, als erwartete er eine Frage von ihr. „Ja noch mehr,“ fuhr er dann fort. „In der philosophischen Fakultät in Bonn wird voraussichtlich in Jahresfrist eine Professur neu zu besetzen sein. Ich kenne Georgis Einfluss, ich weiss auch, wie aufrichtig er es seit meinen ersten Studentenjahren mit mir meint — Elisabeth, wie glücklich wäre ich!“ — —
Der leise Hoffnungsstrahl genügte, ihn zu berauschen. Er war mit einem Male wie verändert, seine Rechte fuhr über das weiche, wellige Haar seiner Frau, das hier und dort schon mit einigen silbernen Fäden durchwirkt war, und als wollte er für seine harten Worte um Verzeihung bitten, küsste er ihr die feingeformten, aber durch die tägliche Arbeit hart gewordenen Hände.
Da lächelte auch Elisabeth unter ihren Tränen, so matt, als wenn durch den dunkeln Wolkenhimmel ein kleiner Strahl der Sonne sich für eine Sekunde hindurchzwängt und dann stirbt.
„Wie zuversichtlich du mit einem Male geworden bist,“ sagte sie. „Fast kenne ich dich nicht wieder.“
„Hm ... das hat seine eigene Bewandtnis,“ erwiderte er geheimnisvoll. „Ach Herz, liebstes Herz, es wird sich alles wenden ... zum Guten wenden. Ich hoffe wieder. Und weisst du, warum? — Sieh dort!“ Er hatte sie sanft beim Arm genommen und an das Fenster geführt, das er öffnete.
Sie blickte ihn verwundert an. „Ich sehe nichts,“ sagte sie.
„Aber dort, siehst du denn nicht?“ Und er wies mit der erhobenen Hand zum First der alten Pfarrscheune.
An dem äussersten Ende des alten, auf seinem Giebel längst durchlöcherten Strohdaches schwankte, vom leisen Winde des Junitages hin und her geworfen, eine verrostete Wetterfahne. Hoch oben über der knarrenden Stange, die sie trug, war eine Taube von Eisenblech befestigt, der lange Schnabel war abgebrochen, der Flügel hing klappernd, jedem Windzug preisgegeben, an dem siechen Leibe.
Unter ihren Fittichen rings um die schwankende Fahnenstange begannen zwei Störche ihr Nest zu bauen.
Noch war es in den ersten Anfängen, aber um so eifriger arbeitete das Pärchen an ihm.
Eben flog das Männchen mit einem langen Reisig im Schnabel der alten Wetterfahne zu, brachte seine Beute vorsorglich unter ihr in Sicherheit, näherte sich gemessenen Schrittes seiner harrenden Gattin, küsste ihr würdevoll den roten Mund und liess sich dann nach einigen flüchtigen Worten am entgegengesetzten Ende des Scheunendaches nieder.
Und nun warfen sie beide die dünnen Hälse in den Nacken, unaufhörlich, immer schneller, wie zwei Kautschukmänner im Zirkus, und dabei klapperten sie wie närrisch vor Freude mit den Schnäbeln um die Wette, so laut und betäubend, dass sich Elisabeth die beiden Hände an die Ohren hielt und ihren Mann ganz voll Erstaunen ansah, der wie verzückt diesem tollen Treiben zusah.
„Siehst du es jetzt?“ fragte er endlich. „Du wirst mich schelten, aber es hilft nichts. Ich bin nie abergläubisch gewesen, es schickt sich auch wenig für einen Prediger. Aber dies, Elisabeth, dies nehme ich doch für ein wunderbares Zeichen. Solange dieses Haus und die alte Scheune stehen, niemals haben Störche auf ihr gebaut, es ist das erste Mal. Der alte Schulze sagte es mir eben noch, und allen Leuten, die heute vorübergingen, fiel es auf.“
„Auf dem Bauernhof drüben brechen sie die alte Scheune ab, und die vertriebenen Störche ziehen auf unsere, weil sie ihnen die nächste ist,“ warf Elisabeth ein.
„Was es auch sein mag, es ist ein Zeichen vom Himmel, Elisabeth! Ich nehme es an. Es bringt mir, es bringt uns beiden das Glück.“
Ein seltsames Lächeln umzuckte den Mund Elisabeths, eine kleine Weile nur, dann schwand es. Ernster als zuvor pressten sich die bleichen Lippen aufeinander.
„Das Glück,“ erwiderte sie tonlos.
„Ja, das Glück!“ wiederholte er. „Siehst du, da kommt der alte Knorr. Vielleicht trägt er es schon in seiner Tasche.“
Durch den kleinen Gemüsegarten, der vor dem Pfarrhofe lag, schaukelte eine blaue Mütze. Langsam und schwerfällig humpelte der alte Briefträger dem Hause zu. Auf seinem faltendunklen Gesichte, das unter einer platten, leicht gebogenen Nase einen martialischen, weissen Schnurrbart wies, leuchtete die Erkenntnis seiner Würde. Er schien es zu wissen, dass er die bedeutsamste Person für das ganze Dorf, sein Kommen diesem das grösste, oft das einzige Ereignis des Tages war, nicht zum mindesten dem Pfarrer.
Der war ihm bereits auf den kleinen Vorschlag des Hauses entgegengetreten.
„Haben Sie Briefe?“
Er begrüsste ihn Tag für Tag mit dieser ständigen Frage.
„Einen, Herr Prediger, oder vielmehr ein Paketchen.“
„Von wo?“
„Aus Bonn, und eingeschrieben.“
„So geben Sie doch, geben Sie schnell!“
Eilig setzte der Pfarrer seine Unterschrift unter den Schein, den der Alte ihm reichte, und trug dann das kleine Paket an seinen Schreibtisch. „Es ist’s, Elisabeth,“ sagte er mit einer Stimme, die vor freudiger Erregung zitterte.
In Elisabeths Augen hatte es hell aufgeleuchtet, so wie ihr Gatte mit dem sehnsüchtig erwarteten Pakete in die Stube getreten war. Jetzt bog sie sich voller Spannung über die Lehne des Stuhles, auf dem er sass, in nervöser Hast die Fäden des Paketes zerschnitt und aus diesem einen Brief hervornahm. Kaum aber hatte er seine Umhüllung zerrissen und einen kurzen Blick auf die Zeilen geworfen, da sank sein Haupt auf die Brust, tiefe Traurigkeit war in seinen Zügen.
„Das ist es, das Glück! Und alles umsonst, wie immer!“
Elisabeth hob den Brief auf, der zur Erde geglitten war, um aus ihm Trost für ihren gebrochenen Mann, der seinen Inhalt nach seiner Gewohnheit vielleicht zu schwarz angesehen, zu lesen. Aber freilich, wenig Trost war in ihm enthalten.
Der Professor schrieb:
Lieber Freund!
Herzlichen Dank für Ihre Sendung.
Aber ehrliches Streben verdient ehrliche Offenheit. Sie fordern sie ja auch. Lassen Sie deshalb die Flügel nicht sinken, wenn ich Ihnen heute bei aller Anerkennung des Fleisses Ihrer Arbeit sagen muss, dass sie hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Jene Frische und Ursprünglichkeit, die ich in meiner Kritik über Ihre pädagogischen Aufsätze so rühmen durfte, diesem umfangreichen Werke fehlt sie. Man wird bei seinem Studium — und ich habe es langsam, gewissenhaft durchgearbeitet —, den Gedanken nicht los, als hätten Sie mit einer gewissen Gewaltsamkeit etwas Grosses schreiben wollen. Trösten Sie sich mit uns allen, die wir es täglich erfahren: Wenn man den Bogen zu straff spannt, zerreisst er. Die Schlüsse, die Sie als etwas Neues aufstellen, sind zum grösseren Teil bereits Gemeingut unserer Wissenschaft, auch manche Irrtümer laufen unter.
Aber noch einmal, lieber Freund, nicht den Mut sinken lassen. Wer die Hand gleich nach den Sternen ausstreckt, hat immer schweren Kampf. Es fallen viele Blüten nutzlos zur Erde, bis eine zur Frucht reift. Aber sie wird reifen. Auch bei Ihnen! Denn aufrichtiges Streben siegt immer. Nur nichts erzwingen wollen! Sie sind noch jung. Ihrer nächsten Arbeit wird ein besseres Glück blühen.
Leben Sie wohl! Herzlichen Gruss.
Ihr treuer, stets für Sie warmfühlender
Georgi.
„Ein besseres Glück ... aber freilich, er hat ganz recht, erzwingen lässt es sich nicht,“ sagte Elisabeth und liess das Blatt sinken.
Da erhob sich der Pfarrer, nahm seine Arbeit aus ihrer Umhüllung und zerriss, ehe Elisabeth es hindern konnte, die umfangreiche, mit peinlichster Sauberkeit angefertigte Niederschrift mit einer hastigen Bewegung mitten durcheinander.
„Um Gottes willen,“ rief Elisabeth, „was tust du?“
„Er meint es am besten mit mir von allen, und sein Urteil ist gerecht! Ich vernichte das Alte, um etwas Neues zu schaffen ... etwas Besseres, Wertvolleres! Verlasse dich darauf.“
Durch seine verschleierte Stimme flackerte ein unruhiges Feuer. Elisabeth war es unheimlicher als sein verzweifelter Schmerz.
„Wenn der gütige Himmel meinen Traum der letzten Nacht erfüllen wollte! Er war so schön, und ... vielleicht wäre es das Einzige, ihm zu helfen,“ flüsterte sie, als sie an ihre Hausarbeit ging. — —
Mit vereinten Kräften hatte das Storchpaar seine Arbeit vollendet. Der erste Grundriss zu dem neuen Heim war gelegt. Sie klapperten nicht mehr so ungestüm mit den Schnäbeln, sie ruhten aus von der schweren Arbeit. In überlegsames Schweigen gehüllt, das eine der rotbestrumpften Beine dicht unter den Bauch gezogen und mit ihm das andere umklammernd, standen sie da in schweigender Würde. In gemessenem Pendelschlag nickten sie dazu mit dem Kopfe nach dem Pfarrhause hinüber, in dem ehrbaren, braunen Auge einen Anflug überlegen schalkhafter Schlauheit, als wollten sie dem bleichen Manne, der, das besorgte Haupt ans Fenster lehnend, weltverloren zu ihnen hinüberstarrte, zurufen: „Sei ruhig, wir bringen es dir doch ... das Glück ... das Glück.“
Sie hatten nichts Unwahres verheissen, die Adebare.
Sie brachten es wirklich ... das Glück.
Freilich, ob die da drinnen es erkennen, ob sie es wahrnehmen und festhalten wollten, das war ihre Sache nicht. Das mussten die mit sich abmachen, denen sie es auf ihren Schwingen zutrugen.
Der Traum, der in jener unruhigen Gewitternacht ein so glückseliges Lächeln auf das sorgendunkle Antlitz Elisabeths gezaubert, der Traum, den sie mit heisser Sehnsucht die vier Jahre ihrer Ehe geträumt, von dessen Verwirklichung sie alles Schöne, alles Gute für ihr Haus, vor allem für ihren unbefriedigten Mann erhofft, der sie mit seinem süssen Glück umschmeichelt, wenn es ihr einsam war ums Herz und schwer ... dieser Traum verhiess ihr jetzt Erfüllung. — — — —
Ihr Mann hatte die neue Arbeit begonnen, schnell, rastlos und ohne sich die geringste Erholung zu gönnen, wie alles, was er sich vornahm.
Er liebte es in solchen Stunden aufreibenden Schaffens nicht, wenn man ihn störte: selbst Elisabeth, die er gerne zur Vertrauten seines Denkens und Schaffens machte, durfte sich seinem Arbeitszimmer nicht nahen.
Als sie aber jetzt im Dämmerlicht des aufsteigenden Abends mit leisem Schritte an seinen Schreibtisch trat, erstarb ihm das Wort des Unwillens, das er schon bereit hatte, auf den Lippen.
So hatte er sie nie gesehen ... was mochte mit ihr vorgegangen sein? Doch! Einmal war sie seinen Augen so erschienen, aber das war lange her.
Damals war es gewesen in jener dämmernden Abendstunde, als er es ihr zum erstenmal sagte, das zagende Wort seiner jungen Liebe, als sie ihn ansah, gerade so, wie sie ihn jetzt ansah mit dem grundlosen, tränenfeuchten Auge, dem tief errötenden, lieben Antlitz, das sie jetzt an seine Schulter barg.
Was brauchte es Worte, ihm ihr Geheimnis zu enthüllen? Er lass es ihr ab von den stammelnden Lippen.
Nie ist das Weib so liebenswert, so schön. Nie war es so Elisabeth.
Wie glücklich musste Hermann sein.
„Sie haben doch nicht gelogen, deine Adebare, du liebes Kind,“ sagte sie, und küsste die faltentrübe Stirn ihres Mannes. Auch in ihrem Scherze lag eine anmutige Hoheit.
Es war im Zimmer dunkel, sie konnte sein Antlitz, den Ausdruck seiner Züge nicht sehen.
Ungerufen brachte die Magd die Lampe. Sie durfte ihn nicht länger stören. Bevor sie ging, warf sie einen Blick auf ihres Mannes Gesicht, aus dem eine grosse Liebe leuchtete.
Arme Elisabeth!
So ernst, so kühl waren ihr diese Züge nie erschienen. Sie wähnte sie erfüllt von Dankbarkeit und Freude, und nicht den leisesten Hauch von alledem spiegelte das ruhig gleichgültige Antlitz wider.
Wo war ihr Entzücken, ihr Glück geblieben? Das hatte sie nicht erwartet, das nicht. So arm, so elend hatte sie sich noch nie gefühlt ... so verlassen auch in den schwersten Stunden ihres Lebens nicht.
Er sah das. Ein Bewusstsein ihres Schmerzes und seines Unrechts durchzuckte seine Seele. Er stand auf, legte den Arm begütigend um ihren Hals und flüsterte ihren Namen.
„Du hattest mich anders gedacht ... sei nicht böse. Diese aufreibende Arbeit —“
Sie entgegnete nichts.
„Es kam so schnell,“ fuhr er fort, „aber glaube mir’s: ich freue mich mit dir ... von Herzen freue ich mich.“
Sie sagte nichts. Mit schnellen Schritten hatte sie das Zimmer verlassen.
Er kämpfte mit dem Entschlusse, ihr nachzugehen, er stand auf.
Aber er besann sich. Er hatte heute so wenig gearbeitet, es musste noch viel geschafft sein, bevor er an etwas anderes denken durfte.
In fieberhafter Hast flog die Feder über das Papier. Seine Arbeit nahm ihn wieder ganz in Anspruch. —
Allein in ihrem Zimmer sass Elisabeth.
Was ihr der heutige Tag an verheissendem Glück gebracht, er hatte es um so bitterer wieder genommen.
Jetzt erst fiel die Binde von ihren Augen, jetzt erst wusste sie, wie es um ihren Mann und ihre Ehe stand.
Keine Enttäuschung überwindet eine Frau schwerer, keine lässt einen nachhaltigeren Stachel zurück, als die Elisabeth eben erlitten.
Und da draussen die Adebare wussten es auch. Sie kannten die Welt. Alljährlich bereisten sie einen weiten Teil der Erde, ... und es war überall dasselbe. Dasselbe im heissen Delta des Nils wie in den kühleren Gauen Deutschlands. Dasselbe im Herzen des rastlosen Beduinen wie des braunen Fellah, des träumerischen Germanen wie des heissblütigen Südländers. Sie alle suchten es hungernden Herzens, sie jagten ihm nach über Länder und Meere; in zehrendem Kampfe, in hastenden Wetten wollten sie es ergreifen mit fiebernder Hand ... das falsche, trügerische Glück. Sie gaben dafür alles hin; den inneren Frieden, die Liebe der Herzen, die sie brachen, die Ruhe des Gewissens und das Labsal des Schlafes. Und es narrte und hänselte sie wie die spröde Kokette den Geliebten ... das falsche, trügerische Glück. Und wenn sie es ihnen brachten, die es zu seinen Gesandten erkoren, die weissgekleideten, rotgestiefelten Adebare, und es hatte den goldenen Flitterputz nicht um, es nahte ihnen im bescheidenen Hauskleide, das anspruchslose Antlitz erfüllt von der stillen Weihe eines unscheinbaren Friedens ... dann erkannten sie es nicht, die törichten, komischen Menschenkinder.
Sie wiesen die Hand von sich, die es ihnen reichte, und nur um so toller und ruheloser begannen sie die Jagd von neuem, nach Ruhm, nach Schätzen und Ehren ... die Jagd nach dem Glück.
Ja, sie wussten es, die Adebare. Sie waren weise Propheten. Sie sahen es auch heute wieder voraus. Darum standen sie so nachdenklich und sinnend mit dem erhobenen Beine auf dem Dache ihres Hauses, das nun fertig geworden war. Darum senkten sie so langsam und ernsthaft den langen Hals zur Erde und bliesen so bedächtig das dichte Halsgefieder von sich, dass es wie ein langwallender, weisser Kinnbart unter ihrem Haupte sich lagerte. Und in den langwallenden, weissen Kinnbart murmelten und brummten sie darum ärgerlich hinein und schüttelten das würdige Haupt und liessen über ihn hinweg die ernsten Augen traurig in die Weite schweifen; denn in das Pfarrhaus mochten sie nicht länger sehen, wo zwischen einem Wust von Büchern und Papieren der Pfarrer unaufhörlich schreibend sass, wo an dem Fenster kauernd eine junge Frau weinte, blutige, brennende Tränen, obwohl sie das süsseste Glück unter dem unruhig hämmernden Herzen trug.
Manche Monde waren über das einsame Pfarrhaus dahingezogen und hatten es in Winter und Schnee gehüllt. Nun aber war es Frühling geworden. Laue Aprillüfte durchfächelten das Land und sprachen dem ersten Erwachen da draussen Mut zu. Als die Bringer des Lenzes, sehnsuchtsvoll erwartet, jetzt mit Jubel begrüsst, zogen sie truppweise ein, die lieben Gäste aus Ägypten.
Es war an einem sonnigen Mittag, da kam mit einer Reihe guter Bekannter auch Herr Adebar von seiner Reise aus dem fernen Süden an.