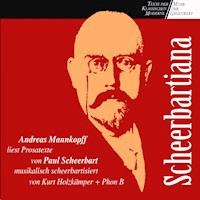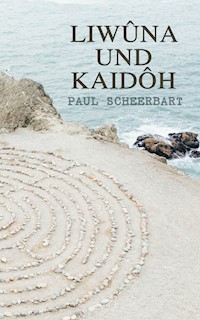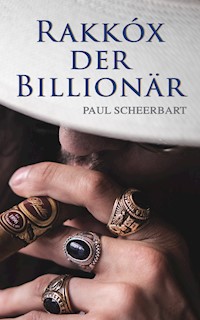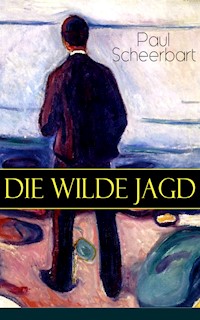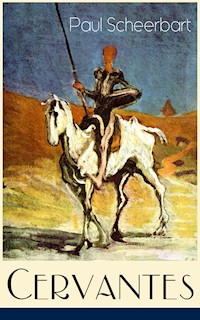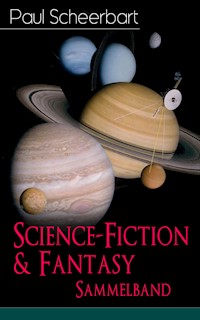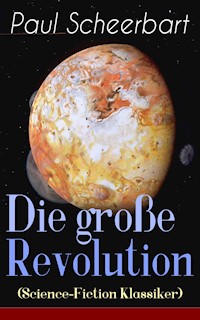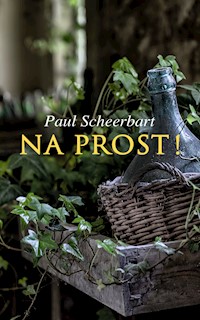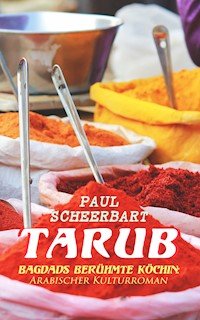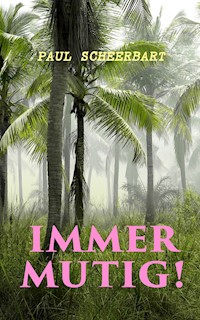Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction
- Sprache: Deutsch
Der vierte Band in der Reihe der »Wiederentdeckten Schätze der deutschsprachigen Science Fiction« stammt von Paul Scheerbart (1863–1915), dem Mitbegründer des Verlags Deutscher Fantasten. Mit »Die Große Revolution« und »Lesábendio« liegen ein maßgeblicher Mond- und ein Marsroman der frühen Stunde vor, die von einem Vorwort Michael Marraks und einem Nachwort Hans Freys begleitet werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAUL SCHEERBART
Die große Revolution
Ein Mondroman
Lesabéndio
Ein Asteroiden-Roman
Originalausgabe
© 2022 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;
[email protected]; http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage Oktober 2022
Die Erstauflage von Die große Revolution erschien 1902 im Insel-Verlag, Leipzig Lesabéndio 1913 bei Georg Müller, München und Leipzig.
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Herausgeber: Hans Frey
Lektorat: Klaus Farin
Korrektorat: Christian Winkelmann-Maggio
Layout:benSwerk
ISBN:
PRINT: 978-3-949452-40-6
PDF: 978-3-949452-42-0
EPUB: 978-3-949452-41-3
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos: https://www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag/
Dieses Buch erschien als Band IV der Reihe »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«. Alle Titel und weitere Informationen finden Sie hier: https://shop.hirnkost.de/produkt/schaetze/
Paul Carl Wilhelm Scheerbart • 1863 – 1915
war Schriftsteller überwiegend fantastischer Literatur und Zeichner. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte und versuchte, das Perpetuum mobile zu erfinden. 1892 gründete er den »Verlag deutscher Fantasten«. Nach verschiedenen Veröffentlichungen verschaffte ihm sein Roman Die große Revolution, der 1902 im Insel Verlag erschien, Anerkennung in literarischen Kreisen, allerdings ohne nennenswerte Verkaufszahlen zu erreichen. Trotz weiterer Förderer – wie Ernst Rowohlt, der 1909 Scheerbarts skurrile Gedichtsammlung Katerpoesie als eines der ersten Bücher des Rowohlt Verlags verlegte – blieb er zeitlebens in finanziellen Schwierigkeiten.
Scheerbarts fantasievolle Aufsätze über Glasarchitektur beeinflussten die damaligen jungen Architekten wie Bruno Taut, aber auch Walter Benjamins Passagen-Werk. Benjamin verfasste bereits 1917 einen bewundernden Essay über Lesabéndio.
benSwerk
geboren 1970, lebt in Berlin. Studierte Werbegrafik und freie Kunst. Wenn sie nicht für Hirnkost layoutet, porträtiert sie das kleine Volk und andere Wesenheiten der Anderswelt, ersinnt Orakelkarten oder gestaltet andere Bücher – mit Vorliebe in den Bereichen WeirdFiction oder Phantastik. www.benswerk.com
Klaus Farin
geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin-Neukölln. Nach Tätigkeiten als Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist nun freier Autor und Lektor, Aktivist und Vortragsreisender. Bis heute hat Farin 29 Bücher verfasst und weitere herausgegeben, zuletzt gemeinsam mit Rafik Schami: Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland? und mit Eberhard Seidel: Wendejugend. Er ist Vorsitzender der Stiftung Respekt! und ehrenamtlich Geschäftsführer des Hirnkost Verlags. Weitere Infos: https://klausfarin.de/ueber-klaus-farin/biographie.
Hans Frey
geboren 1949, Germanist, Lehrer und Ex-NRW-Landtagsabgeordneter, ist in seinem »dritten Leben« Autor und Publizist. Seine Spezialität ist die Aufarbeitung der Science Fiction. Bisher veröffentlichte er ein umfangreiches Werk über Isaac Asimov, das Sachbuch Philosophie und Science Fiction und Monographien über Alfred Bester, J. G. Ballard und James Tiptree Jr. Seit 2016 arbeitet er an einer Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF. Drei Bände sind bislang bei Memoranda erschienen (Fortschritt und Fiasko, Aufbruch in den Abgrund und Optimismus und Overkill). Für die ersten beiden Bände erhielt er den Kurd Laßwitz Preis 2021.
Michael Marrak
geboren 1965, studierte Grafik-Design in Stuttgart und trat Anfang der Neunzigerjahre als Autor, Herausgeber und Anthologist in Erscheinung. Nach einigen Jahren als freier Illustrator widmet Marrak sich seit 1997 ganz dem Schreiben und wurde für seine Romane, Erzählungen und Covergrafiken mehrfach mit dem Deutschen Phantastik Preis, dem Kurd Laßwitz Preis und dem Deutschen Science Fiction Preis ausgezeichnet. Übersetzungen seiner Romane und Erzählungen erschienen in Frankreich, Griechenland, Russland, China und den USA. Sein 2017 erschienener Roman Der Kanon mechanischer Seelen wurde mit dem renommierten Kurd Laßwitz Preis sowie mit dem auf der Leipziger Buchmesse vergebenen Seraph ausgezeichnet. Michael Marrak lebt und arbeitet als freier Schriftsteller und Illustrator in Schöningen am Elm, der ältesten Stadt Niedersachsens und selbsternannten „Stadt der Speere“.
Zum Geleit
Vorwortvon Michael Marrak
Die große Revolution – ein Mondroman
Lesabéndio – ein Asteroiden-Roman
Nachwortvon Hans Frey
Zum Geleit
Wir leben in einer Gegenwart des radikalen Umbruchs, der alle Bereiche der menschlichen Zivilisation durchdringt. Die Probleme scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Wir brauchen kluge Ideen, tragfähige Lösungen, vielleicht sogar Utopien, die neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht ist es gerade in dieser aufwühlenden Situation auch hilfreich, einmal innezuhalten und zurückzublicken. Denn vieles, was uns heute beschäftigt, ist nicht wirklich neu. Schon vor über einhundert Jahren machten sich Autoren und Autorinnen Gedanken über das Klima, über Armut, Wohnen, Ernährung und das Bildungssystem, ob und inwieweit Technik ein Motor für den Fortschritt oder eine existenzielle Gefahr darstellen kann (beispielsweise Atomkraft, Geoengineering, Gentechnik). Vor allem die Autoren und Autorinnen der einst »Zukunftsliteratur« genannten Science Fiction entwarfen wie in keinem anderen Genre gesellschaftliche Utopien und Dystopien, die noch heute so gegenwärtig wirken, als wären sie gerade erst entstanden. Sie sind trotz oder vielleicht gerade wegen ihres oberflächlich antiquiert wirkenden Charmes heute noch mit Gewinn und Genuss zu lesen. Vierzig Perlen aus der deutschsprachigen Science Fiction möchte Ihnen diese Edition im Laufe der nächsten Jahre präsentieren.
Jedes Buch der Edition enthält den Roman selbst sowie in einigen Fällen ergänzende Texte der jeweiligen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Umrahmt werden die Originaltexte von einem Vorwort namhafter Autoren und Autorinnen der Gegenwart und einem historisch-analytischen Nachwort von anerkannten Expertinnen und Experten, das vornehmlich die literaturhistorischen und zeitgeschichtlichen Hintergründe des Textes beleuchtet.
Parallel zur gedruckten Version erscheinen EPubs in allen Formaten und Vertriebsoptionen, die in der Regel zusätzliche ergänzende Materialien (etwa dazugehörige weitere Romane, Sachbücher und Essays der Autoren und Autorinnen, zeitgenössische Rezensionen und andere Leserstimmen sowie weitere Analysen) enthalten und so vor allem für die wissenschaftliche Beschäftigung eine wertvolle Bereicherung darstellen. Damit werden nicht nur die Originaltitel wieder für ein größeres Lesepublikum zugänglich gemacht, sondern auch der Forschung in bislang einzigartiger Weise sowohl historisches Quellenmaterial als auch aktuelle Analysen aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Besonderen Wert legen wir auf die Gestaltung. Auch sie soll zum Lesen einladen, denn die von uns herausgegebenen Werke haben es allemal verdient, neue Leser und Leserinnen zu finden. So werden die Werke nicht einfach als Faksimile reproduziert, sondern komplett neu Korrektur gelesen und gesetzt.
Wir, der Verleger Klaus Farin (*1958) und der Herausgeber Hans Frey (*1949), beide Sachbuchautoren, kennen uns schon seit Jugendjahren. Wir stammen beide aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, engagier(t)en uns für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und sind seit unserer Jugend leidenschaftliche Science-Fiction-Leser. Als wir uns nach Jahren zufällig in Berlin wiedertrafen, wurden sofort Pläne geschmiedet. Angeregt durch die deutschsprachige SF-Literaturgeschichte von Hans Frey im Memoranda Verlag wurde die Idee geboren, eine langfristig angelegte Reihe mit wichtigen, aber fast vergessenen Originaltexten der deutschsprachigen Science Fiction zu veröffentlichen.
Aus dieser Idee ist Realität geworden. Die Reihe leistet einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen SF. Zudem ist sie ein einzigartiges Dokument für die Vielfalt und Vielschichtigkeit des über die Jahre gewachsenen Genres.
Wahr bleibt indes auch: Ohne engagierte Leser und Leserinnen, die die Bücher kaufen und sich an ihnen erfreuen, kann das Projekt nicht gelingen. Empfehlen Sie es bitte weiter. Abonnieren Sie die Reihe. Wir unterbreiten Ihnen ein verlockendes Angebot. Greifen Sie zu!
Hans Frey, Klaus Farin
Krieg dem Kriege im magischen Spiegel
Vorwort von Michael Marrak
Ich landete also auf dem Monde, setzte mich, um ein wenig auszuruhen, nieder und beschaute so von oben herab die Erde (…). Diese Mannigfaltigkeit des Anblickes gewährte mir ein ausnehmendes Vergnügen.
Lukian von Samosata, Ikaromenippus oder Die Luftreise (etwa 160 n. Chr.)
Bei seinen Bewohnern handelte es sich um Männer, Frauen, Tiere, Vögel, Fische und Insekten derselben Gattungen wie bei uns, ohne Ausnahme: Die Männer nicht größer, besser oder klüger als hier; die Frauen nicht schöner oder aufrichtiger als bei uns. Dieselbe Sonne scheint für sie, die Planeten stellen sich für sie ebenso dar wie für uns. Unsere Welt ist ihr Mond und ihre Welt unser Mond.
Daniel Defoe, Der Konsolidator oder Erinnerungen an mannigfaltige Begegnungen mit der Welt des Mondes (1705)
Spätestens seitdem der erste Mensch vor über einem halben Jahrhundert im Meer der Ruhe gelandet ist und Neil Armstrong seinen ikonischen Fußabdruck im Mondstaub hinterlassen hat, wissen wir: Die Oberfläche unseres Trabanten ist eine karge, graue, kratervernarbte Ödnis ohne Leben, zertrümmert von Millionen und Abermillionen kosmischer Geschosse, deren Einschlagswucht von keiner Atmosphäre gemildert wurde. In etwa so groß wie die Landmasse von Europa und Afrika zusammen, steigt die Temperatur auf ihr während des zwei Wochen währenden Mondtages auf bis zu 130 Grad Celsius, wohingegen sie auf der sonnenabgewandten Seite auf bis zu minus 160 Grad Celsius fällt. Das Volumen der dünnen Gashülle unseres Trabanten entspricht unter irdischen Bedingungen einem Würfel von 64 Kubikmetern Größe. Der Mondhimmel ist schwarz, und es herrscht ewige Stille – doch das war nicht immer so …
Meine Erinnerungen an frühe Science-Fiction-Literatur sind geprägt von Geschichten, in denen die Fantasie der Autoren wilde Blüten trieb und jeder Planet unseres Sonnensystems Leben, eine Biosphäre oder gar eine Zivilisation fremdartiger Geschöpfe beherbergte, selbst der ferne Pluto, die Asteroiden oder unser Mond. Und bekamen die abenteuerlustigen Raumfahrer von der Erde es nicht direkt mit Letzteren zu tun, so konnten doch zumindest noch die Ruinen jener geheimnisvollen außerirdischen Völker erforscht werden, wie etwa in Wolf Detlef Rohrs Roman In den Geisterstädten des Merkur (1953), Ray Bradburys Die Mars-Chroniken (1950), Ben Bovas Die dunklen Wüsten des Titan (1972) oder Stanislaw Lems Die Astronauten (1973), worin die zu dieser Zeit fast schon anachronistisch anmutende Erkundung der Venus und ihrer Ruinen beschrieben wird.
Allen fernen Welten des Sonnensystems voraus war, ist und bleibt in dieser Hinsicht jedoch unser Mond. Die Gründe sind im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend.
Seit unsereins auf Erden wandelt, beflügelt der Mond unsere Fantasie, begeistert und ängstigt uns, lässt uns beten, träumen, bewundern, staunen und fürchten. Blickten die Menschen der Frühzeit und der ersten Hochkulturen in den Himmel, sahen sie jedoch nicht zu einem Mond auf, sondern zu einem Gott oder einer Göttin. Luna und Selene mögen heute die Bekanntesten unter ihnen sein. In anderen Kulturen hieß er Isis, Bendis, Nanna, Artemis, Thot, Tecciztecatl, Mani oder Morrigan. An eine ferne Zivilisation dachte dereinst freilich noch niemand. Die Oberfläche klassischer Gottheiten war weder aus mythologischer noch aus literarischer Sicht bewohnt, schon gar nicht von Menschen. Allenfalls tummelten sich in ihrer Peripherie Untergottheiten oder namenlose übermenschliche Dienerwesen.
Der Paradigmenwechsel nebst Götterdämmerung setzte ein, als sich die mannigfaltigen himmlischen Entitäten im Laufe der Jahrtausende in einen ›wahrhaftigen Körper des Himmelszeltes‹ verwandelten und letztendlich zu einem die Erde umkreisenden Mond verschmolzen.
Früheste Reisen zu unserem astronomischen Begleiter waren vom damaligen Weltbild der Menschen und den vorstellbaren Möglichkeiten einer solch fantastischen Himmelsfahrt geprägt. Entweder bereisten die Protagonisten das Sonnensystem nebst Besuch des Mondes dem Ikarus gleich mithilfe (amputierter) Greifvogelschwingen wie in Ikaromenippus oder Die Luftreise des syrischrömischen Satirikers Lukian von Samosata, der um das Jahr 160 n. Chr. die erste uns bekannte Reise zum Mond beschrieb. Oder man träumte sich in einer wundersamen Maschine hinauf zum Mondland wie anderthalb Jahrtausende später der Erzähler in Daniel Defoes Roman Der Konsolidator oder Erinnerungen an mannigfaltige Begegnungen mit der Welt des Mondes (1705).
In späteren Werken gelang die Reise zu unserem Trabanten auch mittels Ballon (Edgar Allan Poe, Das unvergleichliche Abenteuereines gewissen Hans Pfaall, 1835), riesigem Geschoss (Jules Verne, Von der Erde zum Mond, 1865), Sonnentau in Flaschen (Cyrano de Bergerac, Die Reise zu den Mondstaaten, 1657) oder gar mithilfe einer rasant wachsenden Bohnenranke wie in Gottfried August Bürgers Lügengeschichtensammlung Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande – Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen von 1786.
Für die wahre Würze in frühen SF-Geschichten sorgen unzweifelhaft außerirdische Biosphären und – im Idealfall – die darin anzutreffenden Zivilisationen oder ihre Relikte.
Zu einer Zeit, als es noch nicht möglich war, mittels Pumpen ein Vakuum zu erzeugen, formulierte der französische Schriftsteller und Humanist François Rabelais um das Jahr 1530 herum die Phrase Natura abhorret vacuum, die Natur verabscheut das Nichts. Daraus entwickelte sich der auch heute noch gebräuchliche Horror vacui, die Angst vor der Leere.
Es mag nicht unbedingt das Zurückschrecken der Natur vor der Leere gewesen sein, das Autoren früher SF-Werke den Mond als Hort überbordenden Lebens, der Artenfülle und der Zivilisationen hatte beschreiben lassen, sondern die ewige Sehnsucht nach Fremde und Exotik.
So mögen uns die ersten Sätze von Paul Scheerbarts Roman Die große Revolution heute, 120 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung, angesichts des heutigen Wissensstands naiv und realitätsfern, ja geradezu traumtänzerisch erscheinen, wenn er da schreibt:
Auf dem Monde war’s Nacht. Und die dicke Luft war ganz still. Und die Goldkäfer saßen auf den dunklen Moosfeldern und leuchteten – so wie die Sterne am schwarzen Himmel leuchteten. (…) Undfünf Mondmänner schwebten über den Moosfeldern und leuchteten auch – aber so wie Kugeln von Phosphor.
Doch trotz aller Sprachfülle und des Ideenreichtums sind seine zu Beginn des 20. Jahrhunderts erdachten Geschichten aus historischer Sicht fast nur noch ein fantastisches Nachglühen.
Den Grundstein für die erst dreizehn Jahrhunderte später mit Ludovico Ariostos Orlando Furioso (1516) zaghaft aufblühende Space Fantasy und Retro-SF legte im 2. Jahrhundert nach Christus erneut der Satiriker Lukian. Er beschreibt in seiner Burleske Wahre Geschichten erstmals das Zusammentreffen mit einer extraterrestrischen Zivilisation von Mondmenschen, was ihn für nicht wenige zum ersten Science-Fiction-Autor der Welt macht, ein Prädikat, das bisher noch immer Mary Shelley für ihr 1818 erschienenes Werk Frankenstein oder Der neue Prometheus zugesprochen wird, dicht gefolgt von Jules Verne.
In den Wahren Geschichten gerät ein Segelschiff in einen gewaltigen Sturm, bei dessen Wüten es aus dem Meer gehoben und bis zu unserem Trabanten getrieben wird. Dort trifft die Crew auf Mondwesen, haarlose Geschöpfe mit nur einem Zeh und Grasbüscheln statt Ohren, deren Nachwuchs an den Waden der Männer wächst, weil es keine Frauen gibt.
Schon bald gerät die Besatzung »in einen wahren Krieg der Sterne«, wie es Sebastian Fischer von der Nordwestzeitung in seinem Artikel »Was Tim und Struppi Neil Armstrong voraus hatten« formuliert; eine Schlacht zwischen den Armeen des Mondkönigs und denen des Sonnenherrschers um den Planeten Venus.
Trotz des kosmischen Konflikts, außerirdischer Rassen, fortschrittlicher Technik und einer bizarren lunaren Fauna und Flora wird Lukians Abenteuer nur der sogenannten Proto-Science-Fiction zugeordnet, erklärt 1E9-Redakteur Michael Förtsch in seinem Artikel »Schrieb ein römischer Autor die erste Science-Fiction-Geschichte?« – mangels Einfluss von Wissenschaft und Technik als gesellschaftsbestimmenden Faktoren.
Romane und Erzählungen, in denen Mondzivilisationen oder gar Mondbiosphären beschrieben werden, ziehen sich durch die gesamte fantastische Literatur, wobei sich der Blick der Autoren auf die mannigfaltigen Mondgesellschaften wie bei Scheerbart oft auch als kritischer, teils zynischer, teils satirischer Blick in den Spiegel entpuppt. Ein Aspekt, der sicher der Nähe beider Himmelskörper zueinander geschuldet ist. Johannes Keplers Somnia (Der Traum, 1634) gilt es in dieser Liste zu erwähnen, Washington Irvings Die Unterwerfung durch den Mond (1809), Richard Adams Lockes Pseudo-Tatsachenbericht Neueste Berichte vom Cap der Guten Hoffnung über Sir John Herschel’s höchst merkwürdige astronomische Entdeckungen, den Mond und seine Bewohner betreffend (1835), heute bekannt als The Great Moon Hoax, Jules Vernes Von der Erde zum Mond (1865), Herbert George Wells’ Die ersten Menschen auf dem Mond (1901), Edgar Rice Burroughs’ Die Mond-Trilogie (1926) sowie Kurt Karl Doberers Wunder im Mond oder Kampf der Pflanzen (1926), um nur einige zu nennen.
Durch Paul Scheerbarts Variante, dem Mond Leben einzuhauchen, zieht sich ebenfalls ein kriegerischer, zerstörerischer roter Faden, doch keinesfalls der seiner Mondgeschöpfe, sondern jener der von ihnen seit Jahrtausenden beobachteten und verabscheuten Erdenmenschen. Seine beinlosen, rübenköpfigen, schwebenden, friedliebenden und unsterblichen Mondmänner vermögen je nach Stimmung zu leuchten und betrachten Wesen mit Beinen als primitive Geschöpfe. Der überzeugte Pazifist Scheerbart hält sich nicht mit Gesellschaftskritik zurück, verpackt diese jedoch in ein weitaus opulenteres SF-Gewand als Daniel Defoe sein lunares Spiegel-Britannien.
In seinem auf dem Asteroiden Pallas spielenden Roman Lesabéndio hingegen bleiben die Menschheit und ihre selbstzerstörerische Natur gänzlich außen vor. Hier agieren einzig die Angehörigen einer absonderlichen Zivilisation molchartiger Kreaturen, deren Lebenszweck darin besteht, ein dem Genuss und der Kunst gewidmetes Dasein zu führen. All ihr Tun und Streben gilt dabei der Errichtung eines riesigen Turms, von dessen Fertigstellung die Pallasianer sich ihr Einswerden mit dem Universum erhoffen.
Mit einem durchschnittlichen Durchmesser von knapp 550 Kilometern ist der kartoffelförmige Asteroid Pallas, den Scheerbart sich für seinen Roman ausgesucht hatte, nach Ceres der zweitgrößte und drittmassereichste Himmelskörper des Asteroidengürtels. Als Lesabéndio entstand, waren die Gelehrten noch der Ansicht, Pallas, Vesta, Ceres und alle übrigen Objekte des Asteroidengürtels seien die Reste eines in grauer Vorzeit zerborstenen Planeten namens Phaeton, dessen Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter gelegen hatte – ein Aspekt, der seinen Weg selbstverständlich auch in die Science Fiction fand. So nennt Manfred Langrenus den hypothetischen, in seiner Vorstellung durch einen interplanetaren Krieg zerstörten Planeten in seinem 1951 erschienenen Roman Reich im Mond Atlan.
Auch über die und zu den kleinen Asteroiden gibt es wundersame Geschichten inmitten exotischer Fauna und Flora, wenngleich längst nicht in der Fülle wie jene, die auf dem Mond spielen. Was aus heutiger Sicht bereits auf unserem Trabanten relativ unwirklich erscheint, ist auf Winzlingen wie Pallas eigentlich so gut wie unmöglich – doch keinesfalls unvorstellbar. So verortet Edmond Hamilton in seinem 1941 veröffentlichten Captain-Future-Roman Im Zeitstrom verschollen auf dem namenlosen Asteroiden 221 einen dichten Dschungel, in dem Asteroidenratten umherhuschen und Flammenvögel in der dünnen Luft phosphoreszierende Schweife hinter sich herziehen. Eine Gruppe von Erzschürfern ist es dann, die des Nachts nahe den Raumschiffen, mit denen sie gelandet sind, uralte, von Vegetation überwucherte Ruinen entdecken.
Selbst wenn die utopischen Geschichten der frühen Science Fiction den meisten Lesern und Leserinnen unbekannt sind und schwebende, kugelbäuchige Mondmänner und tropisch bewaldete Asteroiden vielen allenfalls ein mildes Lächeln entlocken, ist ein kleiner Asteroidenbewohner, der etwa zur gleichen Zeit wie Hamiltons Captain Future das Licht der Welt erblickt hat, den meisten auch heute noch wohlbekannt: Antoine de Saint-Exupérys Der kleine Prinz (1943), der auf einem winzigen Asteroiden mit drei Vulkanen lebt, sich mit lästigen Affenbrotbäumen abplagt, deren Wurzeln den Himmelskörper ständig zu sprengen drohen, und sich mit seiner sprechenden Rose unterhält, die alles ist, was er liebt. Auf der Suche nach Freunden begibt er sich auf die Reise zu weiteren Asteroiden, die ebenfalls von einsamen Existenzen bewohnt sind, und gelangt schließlich auch zu uns auf die Erde.
Hier in unserer ureigenen Biosphäre, die wir lieb gewonnen haben und gern mit einem Buch in der Hand und einem Glas Wein auf dem Tisch in der Stille und Einsamkeit der Geschichtenleser verbringen, sollen nun Paul Scheerbarts Fantasie und die opulenten, fremdartigen und bisweilen seltsam anmutenden Welten seiner Luniden und Pallasianer das weitere Wort haben. Und wer weiß, ob tatsächlich alles nur Science-Fiction-Schwärmerei gewesen ist, was er vor über einem Jahrhundert verfasst hat. Der Mond hütet noch viele Geheimnisse …
Auf dem Monde war’s Nacht.
Und die dicke Luft war ganz still.
Und die Goldkäfer saßen auf den dunklen Moosfeldern und leuchteten – so wie die Sterne am schwarzen Himmel leuchteten.
Von der Erde war nur ein Viertel als Halbkreis zu sehen.
Und fünf Mondmänner schwebten über den Moosfeldern und leuchteten auch – aber so wie Kugeln von Phosphor.
Und der Mondmann, der voranflog, wurde plötzlich so rot wie eine feurige Kohle, und da flogen die vier anderen Mondmänner an seine Seite und wurden ganz allmählich ebenfalls so rot.
Durch dieses Rotwerden sagten sich die Mondleute, dass sie bereit wären, miteinander zu sprechen.
Und der Mondmann, der zuerst rot wurde, sprach jetzt langsam und nachdenklich:
»Der Stern, mit dem wir leben, unser guter Mond, will ein großes Auge haben und – wenn’s möglich wäre – schließlich ein großes Auge sein – bloß noch ein einziges Auge sein – ganz Auge sein.«
Die Mondleute hatten, wenn sie in der Luft schwebten, unten Kugelgestalt, und aus der ragte oben ein kleiner Brustrumpf mit einem Rübenkopf und zwei Armen heraus.
Und mit den siebenfingrigen Händen, die unten an den Armen hingen, klatschte jetzt jeder der fünf Mondmänner auf seinen Ballonbauch, dass es dumpf dröhnte – wie von Pauken.
Mit diesen Tönen tat die Mondbevölkerung ihr Wohlbehagen und ihre Heiterkeit kund.
Rasibéff, der Mondmann, der seiner feurigen Gesinnung wegen seit Jahrhunderten bekannt war, rief nun hell in die Nachtluft:
»Was der große Mafikâsu soeben gesagt hat, das gibt unserm Streben das Rückgrat. Wir wollen, was unser Stern will. Und wenn unser Wille der Wille unseres Sterns ist, so muss dieser Wille alle Mondvölker mitreißen – und wir müssen in unserem Monde ein Fernrohr bauen, wie’s der Mond nicht größer haben kann – ein Fernrohr von der Größe des Monddurchmessers.«
Wenn die Mondleute ihren Rumpf vorbeugten und über ihren Ballonbauch rüber nach unten blickten, so kam ihnen das Bild der dunklen Mondoberfläche fast ebenso wie das Bild des Himmels mit den Sternen vor, da die Goldkäfer unten auch so still leuchteten wie oben die großen Weltgestalten im unendlichen Raum.
Die fünf Mondmänner beugten sich jetzt sämtlich vornüber und flogen danach viel schneller als bisher mit dem Rübenkopfe voran dem nächsten Krater zu.
Die Rübenköpfe hatten oben einen Kranz von Fühlhörnern, die sich beim Fliegen nach allen Richtungen vorreckten und dadurch kronenartig wirkten; die Fühlhörner witterten wie feine Geruchsorgane alle Dinge, an denen man sich stoßen kann.
Da sprach Zikáll, der Mann der Wissenschaft:
»Jedenfalls bezweifle ich, dass der Mond seinen Willen mit unserer Beihilfe durchsetzen möchte. Wenn der Mond wirklich auf der anderen Seite ein Organ haben will, das unserem Auge entspricht, so braucht er dazu nicht die Beihilfe der kleinen Mondleute. Wissenschaftlich nicht zu begründende Aussprüche wie die vom Mondauge sollten bei der Agitation nicht gebraucht werden. Wenn wir sagen, dass wir ein großes Fernrohr haben wollen, dessen Länge die des Monddurchmessers erreichen soll, so haben wir damit nach meiner Meinung genug gesagt. Die großen Worte haben immer einen kleinen Spaßgehalt in sich. Die großen Worte sind der Tatenlust zuwider.«
Die Sterne des Himmels funkelten jetzt, und die beiden hellblauen Augen des großen Mafikâsu, der zuerst gesprochen hatte, funkelten ebenfalls, und er sagte nun, während er langsamer flog:
»Jedenfalls freue ich mich, dass der große Zikáll die Herstellung des großen Fernrohrs, das so lang wie der Monddurchmesser werden soll, nicht für eine Unmöglichkeit erklärt. Und da Zikáll nicht will, dass ich das Wort Mondauge gebrauche, so will ich das Wort vermeiden, obschon ich doch bemerken muss, dass die Sterne öfters gerade die kleinsten Lebewesen zur Durchführung ihrer großen astralen Absichten benutzen.«
Hierauf sagte der Zikáll sehr rasch:
»Es fragt sich übrigens, ob unser Stern, der Mond selber, durch das große Fernrohr sieht – wenn wir, die Mondmänner, da durchsehen.«
»Das«, versetzte Mafikâsu, »fragt sich wohl. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir das große Fernrohr nur dann durchdringen werden, wenn’s unserem Monde nicht unbequem ist. Wir wollen nicht den Respekt vor dem Ganzen vergessen.«
Nach diesen Worten hatten die fünf den Krater, dem sie zuflogen, erreicht und ließen sich nun oben am Rande des Kraters auf fünf freien Natursäulen nieder. Die Mondmänner setzten sich auf die Säulen, indem sie ihren Ballonbauch zusammenzogen und daraus eine Art Raupenfuß machten; die dicke gummiartige Hautmasse des Bauches umschloss muskulös den ganzen Kopf der Säule, sodass das Sitzen recht bequem war und auch so aussah.
Die Mondmänner glühten immer noch wie rote Kohlen, nur die Rübenköpfe und die Hände phosphoreszierten silberartig, und die zehn Augen flimmerten in hellblauen Farbtönen.
Nun ergriff der weitsichtige Loso das Wort:
»Ja!«, rief er. »Wir verstehen den großen Mafikâsu vollkommen. Alles geht gegen die Erdbeobachtung. Die Mondleute, die das große Fernrohr haben wollen, haben eine große Abneigung gegen den Stern, der uns am nächsten steht – gegen die große Erde. Wir sollen gezwungen werden, die Erdbeobachtung aufzugeben. Wir sollen uns fürderhin nur noch mit den weiter fort befindlichen Sternen – mit dem entfernteren Weltenraume – beschäftigen. Das ist es, worauf alles hinausläuft.«
In der Ebene, die sich unten vor dem Krater weit ausdehnte, glitzerten jetzt die Goldkäfer – und oben am Himmel glitzerten die goldenen Sterne; die Luft machte die Lichteffekte oft anders.
Der heftige Rasibéff, der immer röter wurde als alle anderen, sagte leise:
»Loso dürfte nicht so ganz unrecht haben.«
Der weitsichtige Loso sprach noch einmal – sehr eindringlich – also:
»Auf der Mondseite, die stets der Erde zugekehrt ist, haben wir heute im Ganzen ungefähr zehntausend Fernrohre. Unsere Krater haben sich doch recht brauchbar gezeigt; wenn auch die Beweglichkeit des einzelnen Rohres nicht allzu groß ist, so ergänzen sich doch die verschiedenen Krater untereinander so gut, dass wir zufrieden sein können. Jedes Fernrohr sitzt in seinem Krater so naturgemäß drinnen, dass es uns beinahe schon unnatürlich erscheint, wenn wir einen Krater erblicken, in dem sich kein Fernrohr befindet – obschon wir wissen, dass auf zehn Krater nur einer mit Fernrohr kommt, während neun noch ohne Fernrohr sind. Wenn wir nun die Absicht hätten, unsere sämtlichen Krater mit Fernrohren zu versehen, so würde ich diese Absicht nur loben, denn die Arbeit, die uns dadurch aufgebürdet wäre, müssten wir für klein ansehen gegen die Arbeit, die uns das große Fernrohr, das Monddurchmesserlänge haben soll, verursacht. Unsere Fabrikleiter sprechen da doch von einer Arbeit, die Jahrhunderte in Anspruch nehmen könnte. Demnach sage ich klar und deutlich: Lieber neunzigtausend großartige Kraterfernrohre als das eine einzige Riesenteleskop mit einer Monddurchmesserlänge! Das ist meine Meinung! Und von der werde ich vorläufig nicht abgehen!«
Über die Ebene schwebten jetzt große Scharen silbern phosphoreszierender Mondleute vorüber, die verglichen mit den Goldkäfern in der Tiefe Silberkäfern nicht unähnlich sahen. Wie silberne Sterne zogen die Mondleute in der Ferne vorüber; runde Ballonbäuche hatten alle Mondleute ohne Ausnahme – und auch alle Mondkäfer.
Zikáll, der Mann der Wissenschaft, sagte leise:
»Was mehr Arbeit machen würde – das eine große oder neunzigtausend kleine Teleskope –, das dürfte wohl schwer zu entscheiden sein. Es käme doch nebenbei noch darauf an, welche Größe die kleinen Teleskope erreichen sollen. Wir haben in den letzten Jahrhunderten jedes neue Fernrohr immer ein wenig größer gebaut als das vordem fertiggestellte; wenn wir also die Größe bei den neuen neunzigtausend so weiter steigern, so könnte das letzte vielleicht viel größer werden als das eine große, das die Länge des Monddurchmessers doch nicht überragen darf.«
Jetzt lachte Rasibéff.
Und die anderen lachten ebenfalls.
Aber der fünfte Mondmann, der bislang geschwiegen hatte und Knéppara hieß, sprach nun folgendermaßen:
»Das kommt davon, wenn man über eine Sache mit Leidenschaft redet. Man schweift ab und gibt schließlich nur Gelegenheit zum Lachen. Das Wichtigste wird dabei regelmäßig vergessen. Ihr denkt gar nicht mehr daran, welchen Umfang die Beobachtung der Erde erreicht hat. Das ist doch die Hauptsache! Ich leite die Beobachtung an neunhundert Teleskopen, und der liebe Loso leitet die Beobachtung an vierhundertunddreißig Teleskopen. Und diese dreizehnhundertunddreißig Teleskope sind nur auf die Erde gerichtet – seit Jahrhunderten! Und viele Hundert anderer Teleskope sind ebenfalls nur auf die Erde gerichtet, sodass man wohl sagen kann: Die Hälfte der Mondbevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit der Erde.«
»Die Rechnung stimmt nicht«, rief da heftig der Rasibéff. »Mehr als zwei Drittel der Mondbevölkerung beschäftigen sich mit der Erde.«
»Nun – wenn’s so ist«, fuhr der mächtige Knéppara fort, »dann spricht ja das noch besser für uns. Dann begreife ich aber nicht, wie ihr die Erdfreunde dazu bestimmen wollt, ihre Tätigkeit, die ihnen jahrhundertelang so viel Freude bereitete, plötzlich an den Nagel zu hängen. Die Mehrzahl ist doch gegen euch. Es war doch wahrlich keine Kleinigkeit, das Leben der Erdbewohner genauer kennenzulernen. Wir sind doch schon in der Lage, das zu lesen, was sie drucken lassen. Das hat Mühe gekostet – denn wir haben ihre Sprache mit dem Ohre niemals vernommen. Wir sehen, welche Anstrengungen die Erdleute machen, nach allen Seiten weiterzukommen. Wir sehen, wie sie den ganzen Erdball mit eisernen Schienen umspannen und alles außerdem noch mit Drahtnetzen umspinnen. Die Beobachtung dieser energischen Völkerscharen sollen wir plötzlich aufgeben, um nach den entferntesten Sternen zu greifen? Ich muss feierlich erklären, dass ich die himmelstürmenden Ziele für himmelschreienden Leichtsinn halte – und werde, solange ich noch Einfluss besitze, die Weltfreunde bekämpfen und mit allen Mitteln die Arbeiten der Erdfreunde zu schützen wissen.«
Loso hatte während dieser Rede seine rote Farbe verloren, Knéppara verlor sie jetzt auch – und dadurch deuteten die beiden an, dass sie das Gespräch abzubrechen wünschten.
Mafikâsu sagte nur noch ernst, während er noch röter wurde:
»Ich weiß, dass Knéppara und Loso unsere mächtigsten Gegner sind. Und die Weltfreunde wissen, dass sie keinen kleinen Kampf zu kämpfen haben – und dass sie den nicht mehr vermeiden können.«
Zikáll, der Mann der Wissenschaft, hatte nur noch rote Punkte auf seinem Phosphorleibe.
Und als die beiden Erdfreunde, Knéppara und Loso, fragten, ob Zikáll mitkäme – zum Zackenkrater –, da zergingen die roten Punkte auf Zikálls Haut.
Und Zikáll begleitete die beiden Erdfreunde.
Die drei Herren wünschten den Zurückbleibenden freundlich »Guten Abend!«.
Und gleich nach der Erwiderung dieses Grußes war der große Mafikâsu mit seinem Apostel Rasibéff allein.
»Glaubst du«, fragte hastig der Apostel, »dass der Zikáll den Erdfreunden treu bleiben wird?«
»Das glaube ich keineswegs«, versetzte der große Mafikâsu gelassen.
Jetzt schwebten in nächster Nähe viele andere Mondleute vorüber. Und nach einigen Augenblicken gesellten sich drei von diesen zu den beiden glühenden Weltfreunden.
Diese drei sagten ebenfalls freundlich »Guten Abend!«.
Und dabei setzten sie sich auf die Säulen, auf denen noch vor Kurzem die drei anderen saßen.
»Pflastermann!«, rief Mafikâsu lächelnd. »Wo willst du hin?«
Der Pflastermann erwiderte ebenfalls lächelnd:
»Die Herren Nadûke und Klámbatsch, die hier neben mir sitzen, wollen ihrem Leben ein Ende machen, da sie müde geworden sind. Wir wollen morgen in den Todesgrotten sein.«
»Ich spreche«, sagte Mafikâsu rasch, »den beiden Herren meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Herren begleiten dürfte.«
»Bist du«, fragte der Pflastermann, »auch schon müde geworden?«
»Das nicht«, versetzte Mafikâsu. »Aber ich hoffe, in den Todesgrotten neue Freunde zu finden.«
»Aha!«, rief Nadûke. »Er hat seine Idee vom großen Fernrohr noch nicht aufgegeben.«
»Ich gab niemals«, erwiderte Mafi, »das, was ich anfing, auf. Wir haben übrigens ein neues Agitationsmittel gefunden.«
»Lass hören!«, sagte Klámbatsch darauf.
Die Müden wurden aber nicht rot – auch der Pflastermann wurde nicht rot. Aber das wirkte nach dem Gesagten nicht abstoßend.
Mafikâsu glühte jetzt noch heftiger als bisher – so wie glühendes Eisen. Und er sprach leise und eindringlich:
»Ihr wisst, es gibt drüben auf der anderen Seite des Mondes, die von der Erde und von uns niemals gesehen wurde, keine Luft. Wir können da nicht fliegen. Wir können schon hier nicht sehr hoch steigen – dort aber könnten wir nicht einmal auf den Händen kriechen. Nun ist es aber ein paar Freunden der Weltsache gelungen, am Rande ein paar kurze Strecken mit Luftschläuchen auf Schienen in das unbekannte Land vorzudringen. Und da haben die Mutigen gefunden, dass dort der Boden überall aus durchsichtigen Glassteinen besteht. Und von diesen Glassteinen haben sie etliche mitgebracht. Und Rasibéff trägt nun immer welche bei sich. Dass die ganze andere Mondseite sich nur aus solchen durchsichtigen Glassteinen zusammensetzt – daran glaube ich. Nun besteht unsere Mondhälfte fast nur aus großen und kleinen Grotten – darum dürften in der anderen Mondhälfte auch Grotten sein. Die müssen aber infolge der durchsichtigen Glasoberfläche Licht von außen bekommen. Da müssen also wundervolle bunte Lichtgrotten sein – mit vollem Sonnenlicht. Ist das nicht großartig? Schon allein dieser Lichtgrotten wegen müssen wir den alten Mond im Mittelpunkte durchbohren. Vom Mittelpunkte aus müssen wir ja ganz bequem in die sonnigen Lichtgrotten hineinkommen; diese könnten auch in der Nacht sehr seltsam wirken. Wenn das große Teleskop nicht mehr ziehen will, so ziehen vielleicht die Glassteine.«
»Und hier sind die Glassteine!«, rief der ebenfalls glühende Rasibéff.
Während dieser aus seinem Rucksack kleine bunte, leuchtende und funkelnde und glitzernde Steine hervorholte, liefen die beiden Müden und der Pflastermann rosarot an.
Die Steine gingen von Hand zu Hand, und verschiedene funkelten im Sternenlicht – wie Brillanten.
Und Rasibéff sagte erklärend:
»Es sind auch wirkliche Brillanten unter den Steinen – daher das Funkeln; das bleibt auch im Dunkeln.«
Nachdem die drei die Steine vielfach untersucht und bewundert hatten, verabschiedete sich der Rasibéff und flog rasch davon; er hatte noch viel vor.
Indessen stiegen die vier anderen, während sie lebhaft über die Existenz und über die Bewohnbarkeit der Lichtgrotten ihre Meinungen äußerten, langsam mit ihrem Ballonleibe, der sich durch einen Atemzug wieder füllte, empor – und schwebten über den Kraterrand.
Im Krater war’s dunkel.
Und oben zogen die vier ihren Ballonleib wieder zusammen – und stürzten sich kopfüber in die Tiefe.
Die Mondleute brauchten keine leuchtenden Wegweiser, denn sie waren ja selber fliegende Lampions, die alles hell machten. Und mit ihren Fühlhörnern, die jetzt steif wie ein Hörnerschmuck aus ihrem Rübenkopfe herausragten, konnten sie noch besser als mit den Augen alles Hindernde von ferne bemerken.
Und sie sausten – hinab.
Und unten im Krater ging’s durch und dann rechts und dann links.
Und ein großes Grottenreich tat sich vor den vieren auf. Und da flogen sie hinein.
Den Felsenwänden entströmte ein veilchenblaues Licht, das auch die Mondleute veilchenblau machte.
Die Ballonbäuche wurden hier, wenn die Mondleute langsamer schweben wollten, lange nicht so weit aufgeblasen wie auf der Oberfläche des Mondes, da die Luft in den Grotten dicker und schwerer ist.
In stillen blauen Nischen saßen andere Mondmänner auf seltsam geformten Alabastersäulen – und ruhten sich aus und dachten an die Erde und an die große unendliche Welt.
Und alles war sehr ruhig und – veilchenblau.
Und die vier schwebten hinaus und weiter durch eine lang gestreckte schwarze Grotte, deren Wände stellenweise als ganz glatte Flächen spiegelten. Die vier konnten sich in den schwarzen Spiegeln deutlich sehen, da die Körper der Mondleute in dunkleren Räumen noch heftiger leuchten; wie ferne Gespenster zogen die Spiegelbilder rechts und links dahin.
Und aus den schwarzen Grotten ging’s in die hellen Bernsteingrotten, die mit dem Nebelkrater in Verbindung stehen.
Hier ging’s lebhafter zu.
Viele Mondleute sausten scharenweise aus dem großen Nebelkrater heraus – in die sehr tief gelegenen Bernsteingrotten hinunter –, mit Glasplatten und Messinginstrumenten, Papierrollen und Beleuchtungsgeräten, mit Röhren und Schrauben, mit Chemikalien in flüssigem und festem Zustande, mit Kapseln und Schläuchen, Büchern und Handwerkszeug; verschiedene von diesen Sachen wurden immer zusammen von mehreren Leuten auf flachen Schalen aus Gummihäuten getragen.
Andere Mondleute schwebten wieder scharenweise mit Aluminium-Fässern, Eisendrähten und Kupferstangen nach oben dem breiten Kraterloche zu, in das die Schlussapparate des kolossalen Fernrohrs wie mit langen Fühlhörnern sich hinunterreckten.
»Mafikâsu! Mafikâsu!«, ertönte es da von allen Seiten. Und der so Begrüßte wurde nun von vielen angesprochen, sodass er und seine drei Begleiter langsamer schweben mussten.
Und im Fluge hörte der Führer der Weltfreunde ein paar Dutzend Neuigkeiten.
»Du hast recht«, rief ein sehr korpulenter Mondmann dem Mafikâsu zu. »Deine Gedanken sind stets ganz außerordentlich praktisch. Wir sind deinem Rate gefolgt und haben die Aufnahmebedingungen an unserem Rohr erleichtert und infolgedessen zweihundert Mann auf unsere Seite gezogen. Zweihundert Weltfreunde gibt’s jetzt wieder mehr.«
Der Korpulente sauste so schnell wie ein Stück Gold mit schlappem Bauch in die Tiefe.
»Wird hier«, fragte Nadûke, »die Erde gar nicht mehr beobachtet?«
»Längst nicht mehr!«, erwiderte der Pflastermann. »Man merkt, dass Nadûke müde geworden ist; den Nebelkrater hätte so leicht keiner vergessen.«
Und Klámbatsch sagte lächelnd:
»So hat mein Gedächtnis noch nicht gelitten. Und ich sehne mich doch auch nach dem Tode. Nadûke weiß nicht mehr, dass im Nebelkrater nur noch Nebelflecke beobachtet werden. So was!«
Wie in einem Bienenkorbe wogte es in der Tiefe des Kraters auf und ab – und die Stimmen der geschäftigen Mondleute summten und brummten durcheinander; jeder hatte da seine bestimmten Obliegenheiten am Rohre – wie in den Salpeterkörben die blauen Käfer, die auf dem Monde Bienen heißen und den Moossamen zerreißen.
Ein Teil der Mondleute war an den fotografischen Apparaten tätig – ein anderer sorgte dafür, dass sich die Bewegung des Rohres stets in der gewünschten Weise vollzog. Einzelne saßen abseits und rechneten – sehr viele hatten nur die verschiedenen Putzapparate zu beobachten und zu regulieren –, und die komplizierte Beleuchtung nahm ebenfalls viele Hände und Köpfe in Anspruch.
»Jetzt«, sagte Nadûke, der sich aufmerksam das ganze Treiben am Rohre angesehen hatte, »erinnere ich mich, und ich möchte nur wissen, ob hier auch noch das Farben- und Wärme-Spektrum untersucht wird.«
»Das ist aufgegeben«, erwiderte der Pflastermann.
Und die vier flogen schneller.
Der Pflastermann fuhr leise fort:
»Der Nadûke darf nicht vergessen, dass er sterben will. Die lebhafte Beteiligung an den Ereignissen unserer Zeit ist den Müden nicht mehr erlaubt. Wer dem angenehmen Tode ins Auge blickt, soll nicht mehr so lebhaft sein.«
»Na«, versetzte der Mafi, »so lebhaft ist der Nadûke doch nicht.«
Schweigend schwebten die vier in die große Lesegrotte der Bibliothek. Da waren alle Wände weiß wie Schnee und leuchteten wie sonnenheller Tag. Hundert Ecken hatte die Grotte. Und die Mondleute saßen auf weißen Säulen, die überall in ziemlich gleicher Höhe vor den Wänden aus der Tiefe emporragten. In Nischen, die sich dicht hinter den Säulen in die Wände hineinwölbten, lagen dicke Bücher und Mappenwerke, vor denen die Mondleute – blätternd, lesend und schreibend – sich eifrig beschäftigten mit dem, was auf fernen Nebelflecken sich ereignete.
Aufgestapelt waren die gesammelten Bücher und Mappenwerke in langen schmalen Seitengrotten, zu denen die Eingänge tiefer lagen; wie Radspeichen den Mittelpunkt des Rades umgeben, so reihten sich die Seitengrotten um die große Lesegrotte.
Sehr still war’s in dieser großen weißen Lesegrotte; die vier wurden kaum bemerkt, da hier die meisten Mondleute weitab saßen und ihr Gesicht den Wandnischen zugekehrt hatten.
Wer die Beobachtungen am Nebelkrater regelmäßig verfolgen wollte, hatte mehr zu tun als an den anderen Kratern; dafür gehörten aber auch die Entdeckungen, die in den ferner gelegenen Nebelflecken gemacht wurden, zu den interessantesten der ganzen Welt – es wurden nicht bloß Tausende von Momentbildern vervielfältigt, es drehte sich auch um geistreiche Auslegung, Klarlegung und Kombination der gewonnenen Bilder, sodass in diesen Bibliotheksräumen immerzu neue Bücher entstanden.
Während die Erdbeobachtung ganz deutliche Bilder vom Kleinsten lieferte – selbst solche von Schriftzügen und Druckwerken –, hatte die Nebelbeobachtung natürlich nur mit beträchtlichen Größenverhältnissen zu rechnen.
Die Bibliothek des Nebelkraters wurde von den Erdfreunden, die zum Teil viel größere Bibliotheksräume besaßen, die ›Hypothesen-Bibliothek‹ genannt.
Der Pflastermann sagte hier zum Mafikâsu:
»Es ist doch nicht richtig, dass über diese Bibliothek gespottet wird. Die Erdfreunde lernen nur Wesen kennen, die so groß wie wir selber sind. Aber die Weltfreunde lernen doch Wesen kennen, die Millionen Mal größer, die Billionen und Trillionen Mal größer sind als wir! Dass das Kennenlernen derartiger Wesen viel wichtiger ist als die Beschäftigung mit kleinen Erdmännern, die uns in so mancher Beziehung ähnlich sind – das muss doch jedem sonnenklar sein.«
»Natürlich«, versetzte Mafikâsu. »Wir werden daher ganz bestimmt als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen. Jetzt heißt es aber: mit allen Mitteln und allen Kräften die große Revolution vorbereiten! Unsere Gegner werden nicht untätig sein – sie werden den Mondleuten die große Arbeit wie ein Gespenst aufputzen. Wir aber werden mit dem, was nach der Arbeit kommt – hinreißen. Mit besonnener Ruhe müssen wir vorgehen. Übrigens – dass uns die Erdmänner in der Rumpf-, Arm- und Kopfbildung äußerlich ähnlich sind, sollte man nicht für so wichtig halten.«
Die vier hatten währenddem längst die weiße Lesegrotte des Nebelkraters verlassen – sie schwebten jetzt durch die langen Smaragdgalerien, die in einer Schraubenlinie immer tiefer ins Innere des Mondes führten. Wundervoll wirkte hier der kugelrunde rote Leib des Mafikâsu – zwischen den grünen Smaragdwänden – wie ein schwebender großer roter Gummiball.
Und unten in den tiefen grauen Bleigrotten, in denen nur riesige Tag- und Stundenverkünder ein weißes Licht ausstrahlten, da zogen die vier ihre kugelrunden Leiber ganz zusammen, dass sie wie leere Beutel aussahen.
Und so stürzten sie sich wieder kopfüber in die Tiefe – und kamen so in immer tiefere Grotten, in denen violette, braune und orangefarbige Felsenwände nur ein schwaches Dämmerungslicht verbreiteten; scharfe Kanten sah man hier selten im Gestein.
So ging’s tiefer und tiefer – hinab zum Mittelpunkte des Mondes – zu den stillen Todesgrotten.
Aber der Weg war weit, und die Stundenverkünder ließen sich oft hören.
Durch die zinnoberroten Badegrotten, in denen die runzlige Haut der Mondleute durch eine Art Schwitzkur renoviert wird, gelangten die vier in die herrlichen Rauchergrotten, wo die Raucher so langsam und ruhig umherschwebten, als ginge wirklich gar nichts vor in den großen weiten Sternallwelten; die wurden hier oftmals ganz und gar vergessen.
Diese Rauchergrotten waren allen Mondleuten sehr wohl bekannt – und wurden immer Beruhigungstempel genannt und gehörten zum Herrlichsten, was es im Innern des Mondes gab; hier wuchsen jene köstlichen Blumen, die in ein paar Sekunden eine halbe Meile groß werden konnten. Diese Blumen, die in allen Farben irisieren und opalisieren, sind hauchartig dünne Fächergebilde und kolossalen bunten Eisblumen ähnlich; aber die Blumen in den Rauchergrotten sind nicht einseitig – sie können sich nach allen Seiten entfalten und werden weite Spitzenblüten und Strahlendüten mit Schaumranken und haarfeinen Adern, die sich kräuseln, zitternd und glühend.
Jeder Mondmann hatte in seinem Rucksack, der am Rumpfgurte hing und gewöhnlich hinten auf dem Ballonleibe lag, seine kleine dicke Steinpfeife, in deren Kopf ein seltsamer Schwamm stak – dieser Schwamm wurde sofort glühend, sobald er mit einer Schaumranke der großen Duftblumen in Berührung kam –, und dann ließ sich der Schwamm rauchen.
In den glühenden Schwamm zog die ganze Blume hinein, sodass diese verging wie eine Vision. Und so rauchte der Mondmann meilenhohe Blumen, die so fein sind, dass sie von den zartesten Händen nicht zu bemerken wären.
Duftende irisierende Rauchwolken wirbeln aus der dicken Steinpfeife des rauchenden Mondmannes heraus. Und der Rauch ist so bunt wie Regenbogen, die sich schlängeln und sich umschlingen, und wie Opalgeflimmer, das wie Schnee herumrieselt, sodass man im Rauche noch die Blumen erkennt.
Mafikâsu steckte sich jetzt auch seine Pfeife an, und seine drei Begleiter folgten seinem Beispiel.
Und ein langes Lächeln floss über das Gesicht des müden Nadûke, und er sagte zum Klámbatsch:
»Ein langes Leben zieht an mir vorbei – steigt so schnell auf – wie da drüben die knisternden Blumen.«
Und drüben wuchsen wieder neue Blumenwälder aus der Tiefe empor.
Die Zapfengrotten, in denen die Raucher dahinschwebten, waren sämtlich dunkelbraun und spendeten kein Licht; die Blumen leuchteten hier viel feiner als alle Wände – und auch viel feiner als die Mondmänner selber –, da das Blumenlicht immer wieder wie Opalgeflitter aufflatterte und dann irisierend in Schlangenlinien dahinzog und zitterte. Es war so – denn nicht alle Teile der Blumen spendeten Licht –, als wenn die Raucher eigentlich nur dieses Licht in den Blumen rauchten, da der Rauch beinahe ganz so aussah wie dieses Blumenlicht; die Farbenspiele des Rauches waren nur gedämpfter und zuweilen etwas trübe.
Große Scharen von Mondleuten zogen an den vieren rauchend vorüber, und die großen Blumen, die in ein paar Sekunden eine halbe Meile groß werden können, wuchsen immer wieder von Neuem – knisternd.
Und die vier schwebten durch eine Nischenpforte und schossen wieder kopfüber in schier unüberschaubare meilentiefe Grotten hinein, die teilweise ihr Licht nur von herumschwirrenden Käfern empfingen; nicht alle Felsenwände im Mondinnern haben Leuchtkraft; doch die dunklen Felsen wirken fast immer wie Sammet.
Und nun flogen die vier in das Reich der großen Fabrikgrotten, allwo blaue und grüne und rote Flammen, ohne Rauch zu erzeugen, um die glatten spiegelnden Felsenwände flackerten. Hier hörte man fortwährend ein großes Hämmern, Klirren, Klappern, Rollen und Stampfen; an neuen Teleskopen und an neuen Utensilien und Apparaten ward ohne Unterlass in den Fabrikgrotten gearbeitet.
»Es geht doch«, sagte der Pflastermann, »niemals so schnell, wie man denkt.«
Die Stundenverkünder zeigten den Herren an, dass sie schon länger als hundert Stunden unterwegs waren.
Bald war ein halber Mondtag dahin.
So schnell konnte man die Todesgrotten nicht erreichen, wenn man auch noch so fix hinunterstürzte.
In den Delikatessgrotten machten die vier noch einmal Rast. Dort leuchteten die dicken Lüfte selber in den verschiedensten Farben und in verschiedener Lichtstärke. Diese Luft einzuatmen war den Mondleuten ein ganz besonderes Vergnügen; diese dicken leuchtenden bunten Lüfte bildeten lauter Luftdelikatessen.
Brummkäfer waren immer in Menge da.
Aber lange hält es der Mondmann in dieser prickelnden Atmosphäre nicht aus; wohl lebt der Mann mit dem Luftleibe nur von der Luft, aber ihm ist die leuchtende Luft nicht unentbehrlich – die ist nur so eine Art Sonntagsscherz.
Nachdem Mafi und seine drei Begleiter sich genügend in der Lichtluft erquickt hatten, sausten sie weiter hinab ihrem Ziele zu.
Und zweihundert Stunden später waren sie endlich unten nicht weitab vom Mittelpunkte des Mondes – in den Todesgrotten.
Da sitzen die Mondleute nicht auf Säulen, denn da sind keine Säulen.
Die Wände steigen in Terrassen empor. Und auf den Terrassen liegen die Mondleute; sie haben ihren Kopf in eine Hand gestützt, der Ballonleib liegt glatt wie ein dickes Fell auf dem Stein – und auch unter dem Arm, dessen Hand den Kopf stützt.
Ein leises Flüstern lässt sich auf den Terrassen vernehmen.
Und von allen Seiten fliegen eilig die Gehilfen des Pflastermannes herbei und wollen die drei Herren zur Ruhe bringen.
Mafikâsu schüttelt lächelnd mit dem Kopfe, und der Pflastermann sagt leise:
»Nur diese beiden, die Herren Nadûke und Klámbatsch, wollen ihrem Leben ein Ende machen. Gebt den Herren einen Platz mit interessanter Perspektive; sie haben in den Zinnkratern große Arbeiten vollbracht – von vielen Mondleuten sind sie als Führer anerkannt worden.«
Und die Gehilfen, lauter gute, sehr freundliche Mondleute, die ihr Amt sich selber wählten, bringen Nadûke und Klámbatsch in eine entfernte Terrassenecke, die sich unter einer weiten Kuppelöffnung hinzieht, durch die man hoch hinaufblicken kann – durch kanten- und seitenreiche Lichtgrotten hindurch; fast sieben Meilen lang ist die Perspektive von einzelnen Punkten aus.
Mafikâsu schwebt mit dem Pflastermann neben der reich gegliederten Horn-Terrasse dahin, und beide überschauen die langen Reihen der Sterbenden, die leise flüstern.
Die Sterbenden sprechen aber nicht zueinander – sie sprechen zu sich selber.
Und dennoch sind es nicht Monologe, die flüsternd über ihre Lippen kommen.
Das Sterben auf dem Monde ist nicht so wie das Sterben auf der Erde. Wer auf dem Monde müde wird, fühlt bald in der dem Rumpfe nahe liegenden Ballonhaut einen Schmerz. Und wer diesen Schmerz fühlt, schwebt hinab zu den Todesgrotten und lässt sich dort ein Pflaster auf den oberen Teil der Ballonhaut legen. Und das Pflaster lindert den Schmerz. Und aus der vordem schmerzenden Stelle wächst ein anderer Rumpf heraus, der anfänglich ganz klein wie ein Pilz ist – aber in Bälde Kopf- und Armbildung zeigt. Und während der alte Rumpf immer mehr zusammenschrumpft, entwickelt sich der neue Rumpf genau in den Formen des alten; der neue hat nur anfänglich eine nicht so runzelreiche Haut.
Und der alte Kopf spricht zu seinem neuen Kopf – wie ein Vater zu seinem Kinde.
Und so geht der Geist des Vaters langsam in den des Sohnes über.
Und es ist eigentlich kein Tod – es ist nur eine Wiedergeburt.
Und es ist wundersam, zu sehen, wie das Alte in das Neue übergeht.
Und es ist wundersam, zu hören, wie das alte Ich zu seinem neuen Ich spricht und ihm alles erklärt, was es auf dem Monde wissen muss.
Und so lange spricht der alte Kopf – bis der neue genauso klug und ebenso weit ist wie der alte.
Und es ist so, als wenn sich Doppelgänger miteinander unterhalten.
Und es ist ein vollkommenes Aufgehen des Alten im Neuen.
Und es stirbt eigentlich nur die Haut des Alten – die schließlich vergeht, wie eine Blume vergeht, in den Rauchergrotten.
Mafikâsu hält an in der Luft und horcht und hört, was ein Sterbender zu seinem neuen Leben sagt.
Der Pflastermann schwebt weiter durch eine Bogenpforte hindurch.
»Es wird sich«, sagt der alte Kopf zu seinem neuen, »vieles ereignen, was Unruhe auf dem Mond erzeugen muss. Vielen Mondleuten genügt das Leben nicht mehr, das sie führen; sie wollen die Fülle ihrer Weltbilder noch vergrößern; sie wollen noch mehr anschauen können als bisher. Die große Revolution, die uns eine Abkehr von der Betrachtung der Erde bringen wird, kommt. Aber bei allen revolutionären Bewegungen dürfen wir nie vergessen, dass uns nur die reine absichtslose Anschauung das Glück schaffen kann. Wir müssen immer ganz ruhig auch die unruhigen Bilder nur als Bilder auf uns wirken lassen – wie ein großes Bilderspiel, dem wir ohne Absicht als ferne Zuschauer zuschauen dürfen. Wenn uns das, was für uns in und auf den Sternen sichtbar wird, nicht mehr unterhaltend genug erscheint, so dürfen wir ja wohl danach streben, durch bessere Vergrößerungsgläser tiefer in diese Lebensspiele der Sterne zu dringen. Aber vergessen dürfen wir dabei nie, dass dieses Mehrhabenwollen eine Gefahr in sich birgt. Wir könnten so leicht von der sich selber genug gebenden, alle Absicht verschmähenden Betrachtung der Welt abgelenkt werden und in der zerstreuenden Tätigkeit mehr erblicken als in der sammelnden Anschauung. Ich fühle, dass du mich verstehst; du wirst so leben, wie ich gelebt habe.
Und ich fühle, dass ich in dir lebe und leben werde. Aber behalte das eine: Geh überall mit, wenn die Neuerungsstürme kommen – widersetze dich nicht –, doch bleibe stets in allen Phasen der Entwicklung mit dem momentan Daseienden im Einklang; auf dass du immer dich ganz behalten kannst – in den Bildern, die du hast.«
Mafikâsu hörte das und zitterte und wurde glühend rot; doch gleich darauf wurde er wieder silbern wie sonst – und dann kam ein grünlicher Ton in seine Hände. Und als der Führer der Weltfreunde das bemerkte, erschrak er heftig – denn die grüne Farbe am Leibe der Mondleute bedeutet Ärger und Stimmungen, deren sich jeder Mondmann schämt.
Und Mafikâsu ließ den Kopf sinken und schwebte langsam weiter.
In den großen Todesgrotten war’s immer sehr still, und das leise Flüstern auf den Terrassen machte die Stille noch empfindlicher.
Hoch oben in den meilenhohen dunklen Deckengewölben glitzerten Goldmassen, als wären’s Sterne am dunklen Himmel.
Und die Wände mit ihren Zacken und Torbogen waren alle dunkelviolett und so wie von Sammet, und auf den glatten Bodenflächen der Terrassen flimmerte es – wie von dunklen Perlen.
Und auf diesen Terrassen mit dem dunklen Perlenglanz lagen die alten Mondleute bequem auf der Seite – den Kopf in der Hand –, die runzlige Ballonhaut ihres Leibes war ihnen zum Diwan geworden.
Und vor ihnen wuchs – hellblau geisterhaft leuchtend – der Rumpf ihres neuen Ichs aus ihrem Leibe heraus.
Die Neuen waren immer hellblau – solange die Alten noch da waren.
Und die Sterbenden konnten, während sie bequem auf der einen Seite ihrer Ballonhaut lagen, auf der anderen Seite ihr neues Leben wachsen sehen und sprechen hören.
Und das Alte und das Neue waren so freundlich zueinander, dass es einfach rührend erschien.
Und die Hellblauen wuchsen langsam und stetig, und die Alten schrumpften im selben Maße zusammen.
»Die Anschauung!«, flüsterte ein Hellblauer.
Und ein anderer sagte leise:
»Der Einklang mit dem Daseienden!«
Und ein Dritter sagte:
»Stetes Zusammenklingen mit dem, was wir haben!«
Und ein Vierter sprach ganz weich:
»Stetes Zusammenklingen mit dem Ganzen; alle Mondleute müssen zusammen ein Wesen bilden.«
Und ein Fünfter rief leise lachend:
»Die Welt muss in uns hinein – mit allem!«
Und so sagten alle sehr oft nur das, was sie für schrecklich wichtig hielten.
Die grüne Farbe des Leibes war den neugeborenen Mondleuten noch ganz unbekannt.
Aber das Gedächtnis des neuen Mondmannes ward sehr bald so reich und vollständig wie das Gedächtnis des Alten, wenn dieser ganz weg war.
So wurde das Leben erhalten – in den heiligen Hallen der Wiedergeburt – tief unten in der Nähe des Mittelpunktes.
In die dunkelvioletten stillen Todesgrotten zogen die Mondleute müde hinein – und kamen verjüngt und lebensfrisch wieder heraus.
Während Mafikâsu neben den Terrassen, die im Zickzack weiterführten, dahinschwebte und sich den Neugeborenen, die schon fortkonnten, zu nähern suchte – währenddem konnte man in den tiefer gelegenen Partien der Todesgrotten ein leises Klopfen und Hämmern vernehmen; Mafikâsus Freunde suchten da unten eifrig Zugänge zu neuen Höhlen auf.
Verschiedene neue Höhlen, in die die Mondleute nur auf den Händen gehend hineingelangten – wobei sie irdischen Vögeln ähnelten, wenn die auf der Erdoberfläche gehen –, verschiedene neue Höhlen waren schon weiter ab in anderen Regionen entdeckt worden. Aber seit fünfzig Jahren hatten die Entdeckungen aufgehört. Und sooft sie auch da unten hämmerten und klopften – es klang an keiner Stelle hohl –, es gelang nicht; auch unter den Todesgrotten kam man schlechterdings nicht weiter.
Und das machte die Mondleute da unten sehr traurig, denn danach ließ sich das große Fernrohr, das die Länge des Monddurchmessers erreichen sollte, nur nach kolossalen Bohrarbeiten durchbringen. Und zu den Bohrarbeiten mussten alle Mondleute ohne Ausnahme hinzugezogen werden. Und das fiel sehr schwer. Für die Bohrarbeiten ließen sich die beschaulich lebenden Mondleute nicht so leicht begeistern.
Ein halbes Jahr später saß Mafikâsu im Ratskrater, und die großen Erdfreunde Knéppara und Loso waren ebenfalls da.
Man sprach über die Erde.
Schließlich sagte Mafikâsu nach all den langen Reden kurz und feierlich:
»Ich möchte nicht mehr ein einziges Wort gegen die Erdbetrachtung sagen, wenn wir bemerken würden, dass die Erdmänner ganz ernsthaft darangingen, ihre bunt gefärbten Kriegsheere abzuschaffen, und nicht mehr daran dächten, sich in Masse gegenseitig umzubringen.«
Es wurde sehr still im Ratskrater – die hundert Ratsherren hielten sämtlich den Atem an.
Dann bemerkte nach einer guten Weile Knéppara, der Erdfreund, leise:
»Die Existenz dieser kostümierten Massenmörder ist auch uns ein Dorn im Auge.«
Nach diesen Worten ließ sich wieder ein leises Atmen in der Versammlung vernehmen.
»Ich möchte«, fuhr nun Mafikâsu mit klarer, weithin hallender Stimme fort, »den Erdmännern genau fünfzig Jahre Zeit geben – und die Annahme oder Ablehnung der von mir geplanten Bohrarbeiten von der Weiterexistenz dieser irdischen Kriegsheere abhängig machen. Werden diese in fünfzig Jahren mindestens zur Hälfte abgeschafft, so wird von dem großen Fernrohr, das die Länge des Monddurchmessers haben soll, niemals mehr die Rede sein.«